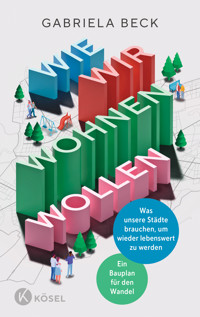
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Unsere Städte kämpfen mit vielen Problemzonen. Dieses Buch zeigt, wo wir anpacken können.« Katja Diehl
Wir leben in Städten, die uns Zeit und Nerven kosten und häufig wirken, als wären sie nicht für Menschen gemacht: steigende Mieten, zu viele Autos, zu wenig Grün und wo man hinsieht Dauerbaustellen. Kein Wunder, dass die Frustration schneller wächst als die städtischen Speckgürtel. Gleichzeitig werden wir unser Wohnumfeld radikal anpassen müssen: an den Klimawandel mit Starkregen und Hitzeperioden, an eine alternde Gesellschaft, an Digitalisierung, neue Mobilitäts- und Energiekonzepte. Ein ›Weiter so‹ funktioniert nicht mehr – doch darin liegt auch eine Chance.
Machen wir unsere Städte wieder lebenswert! Gabriela Beck zeigt, wie das gelingen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Wir leben in Städten, die uns Zeit und Nerven kosten und häufig wirken, als wären sie nicht für Menschen gemacht: steigende Mieten, zu viele Autos, zu wenig Grün und wo man hinsieht Dauerbaustellen. Kein Wunder, dass die Frustration schneller wächst als die städtischen Speckgürtel. Gleichzeitig werden wir unser Wohnumfeld radikal anpassen müssen: an den Klimawandel mit Starkregen und Hitzeperioden, an den demografischen Wandel mit mehr alten Menschen, an Digitalisierung, neue Mobilitäts- und Energiekonzepte. Ein ›Weiter so‹ funktioniert nicht mehr. Doch darin liegt auch eine Chance, unser zukünftiges Miteinander vielfältig, gesund und sozialverträglich zu gestalten.
Machen wir unsere Städte wieder lebenswert! Gabriela Beck zeigt, wie das gelingen kann.
GABRIELA BECK
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Kathrin Sabeth Ohl, Hamburg
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32170-3V001
www.koesel.de
INHALT
EINLEITUNG SONEHMENWIRUNSERESTÄDTEWAHR
ESISTENGGEWORDENINDEUTSCHLANDSSTÄDTEN …
WOWIRANPACKENMÜSSENFÜREINELEBENSWERTESTADT
GESELLSCHAFT
WIEWOLLENWIRGEMEINSCHAFTLICHLEBEN?
WOHNUNGSKRISE
WIEHALTENWIRUNSEREINNENSTÄDTELEBENDIG?
MOBILITÄT
WIEVIELEAUTOSWOLLENWIRINDERSTADT?
GESUNDHEIT
WIEREDUZIERENWIRSTRESSIMSTADTALLTAG?
ARTENVIELFALT
WIEVIELNATURWOLLENWIRINDERSTADT?
KLIMAWANDEL
WIEWAPPNENWIRUNSGEGENHITZEUNDSTARKREGEN?
RESSOURCEN
WIEKÖNNENWIRNACHHALTIGBAUENUNDWOHNEN?
DIGITALISIERUNG
WIEDURCHSCHAUBARWOLLENWIRSEIN?
FAZITSOBEKOMMENWIRUNSERESTÄDTEZURÜCK
WIEWOLLENWIRINZUKUNFTWOHNEN?
BUCHEMPFEHLUNGENDERAUTORIN
ANMERKUNGEN
EINLEITUNG
SO NEHMEN WIR UNSERE STÄDTE WAHR
ES IST ENG GEWORDEN IN DEUTSCHLANDS STÄDTEN…
… und es wird noch enger. Das ist nicht nur so ein Gefühl, das wir haben, wenn wir mit offenen Augen durch unser Viertel gehen. Oder wenn wir uns mit anderen in volle Busse und U-Bahnen zwängen. Wenn wir unser Kind an der Wunschschule anmelden wollen und bangen müssen, weil es zu viele Interessent*innen gibt. Wenn wir eine bezahlbare Studentenbude suchen. Oder ein Pflegeheim für unsere Eltern.
Es ist nicht nur so ein Gefühl, denn in Deutschland leben knapp 78 Prozent der Menschen in Städten, Tendenz steigend.1 Viele tun dies freiwillig und mit Begeisterung. Sie fühlen sich angezogen von dem kulturellen Angebot, den vielen Freizeitmöglichkeiten, dem Austausch mit anderen Menschen. Andere machen die Entscheidung für ihren urbanen Wohnort ganz pragmatisch oder auch gezwungenermaßen davon abhängig, wo es Jobs gibt, die passende Uni oder eine bessere Gesundheitsversorgung, weil man ja älter wird.
So vielfältig die Gründe sind, in die Stadt zu ziehen oder in der Stadt zu bleiben, so vielfältig die Ansprüche sind, so vielfältig sind eben auch die Menschen dort. Es gibt ihn nicht, den Stadtbe-wohnenden. Ob Studierende, Pendler*innen, Familien mit Kleinkindern, Alleinerziehende, Singles, Obdachlose – ob Menschen mit Behinderung, Alte oder Junge, mit oder ohne Migrationshintergrund – sie alle nutzen dieselben Straßen, Plätze und Parks, dieselben Busse, Schulen und Schwimmbäder, dieselben Ämter, Geschäfte und Bahnhöfe. Die Stadt ist gebaute Demokratie: Schließlich müssen alle, müssen wir, die Fähigkeit entwickeln, uns diese Orte zu teilen mit Menschen, die teilweise ganz anders ticken als wir selbst. Die Stadt ist also »eine Weise, Raum gesellschaftlich zu organisieren«, schreibt der Historiker Jürgen Osterhammel.2 Zugleich sind Städte Zentren politischer, religiöser und ökonomischer Macht, Schmelztiegel der Kulturen und das Versprechen auf ein besseres Leben.
Jede Stadt ist anders. In manchen fühlen wir uns sofort wohl, können uns gut orientieren, finden auf Anhieb reizvolle Läden und gute Restaurants. Wir haben das Gefühl, als sei die Stadt auf einer Wellenlänge mit uns. Sogar die Passant*innen scheinen uns freundlich anzulächeln. Andere Metropolen fühlen sich kalt und abweisend an, nichts ist dort, wo wir es vermuten, die Straßen zu eng oder zu weit. Der Aufenthalt strengt uns an, so als ob sich der Ort gegen unsere Anwesenheit sperren würde. Dass uns eine Stadt querliegt, mag manchmal nur am regnerischen Wetter liegen oder daran, dass wir nicht gut geschlafen und deshalb miese Laune haben. Vielleicht verbinden wir mit ihr auch schlechte Erinnerungen. Manchmal passt sie aber tatsächlich nicht zu uns. Denn jede Stadt besitzt ihre spezielle »Eigenlogik« – lokale Eigenheiten aufgrund der jeweiligen Stadtkultur, die sich unter anderem aus der baulichen Struktur, der Geschichte und dem nach außen transportierten Image zusammensetzt.3 Man könnte auch sagen: Jede Stadt hat ihre eigene Persönlichkeit.
Wobei zwei Menschen ein und dieselbe Stadt völlig unterschiedlich erfahren werden. Besuchen sie am selben Tag zum Beispiel München, wird der eine vielleicht durch den Englischen Garten joggen, den Surfern auf der Eisbachwelle zuschauen, mit einem Radler und einer Bratwurst vom Kiosk an der Isar die Beine ins Wasser baumeln lassen und abends in einem der Clubs im Werksviertel abhängen. Der andere macht einen Spaziergang durch den Schlossparkt Nymphenburg, besichtigt eine Ausstellung in der Alten Pinakothek, durchstöbert die Antiquariate im Univiertel und beschließt den Abend in einer schicken Weinbar im Lehel. Und selbst wenn beide die Wiesn besuchen sollten, wird sich der eine hinterher vielleicht an die beeindruckende Aussicht vom Riesenrad auf die schneebedeckten Alpen in der Ferne und den süßlichen Geruch gebrannter Mandeln erinnern und der andere an die Blasmusik und seine erste Maß im Bierzelt und danach an nicht mehr viel. Beide Personen werden mit ihren individuellen Erfahrungen unterschiedliche Empfindungen verknüpfen. Befragte man sie nach ihren Eindrücken, könnte man meinen, sie hätten unterschiedliche Metropolen besucht.
Städte mit all ihren Facetten und ihrer individuellen Gestalt wirken sich aber auch auf ihre Bewohner*innen aus. So laufen Passant*innen beispielsweise schneller durch die Straßen, je größer die Stadt ist, in der sie leben, fand das Forscherpaar Marc und Helen Bornstein in seiner viel zitierten Studie aus dem Jahr 1976 heraus.4 In einer neueren Studie maßen Forschende der Technischen Universität Chemnitz die Gehgeschwindigkeit von 6000 Passant*innen in 20 deutschen Städten. Sie stellten fest, dass es regionale Unterschiede gibt, die Menschen von Norden nach Süden tendenziell langsamer unterwegs sind. Nach den Messergebnissen gehören die Bürger*innen von Hannover und Dresden zu den schnellen, gemütlicher geht es in Trier und Saarbrücken zu.5 »Man könnte auch sagen, das Gehen spiegelt das allgemeine Tempo wider, in dem ein Mensch lebt und in dem er kulturell verankert ist«, sagt Studienleiter Olaf Morgenroth.
Ob Einwohner*innen »ihrer« Stadt einheitliche Charakteristika zuordnen, haben Soziolog*innen der Technischen Universität Darmstadt untersucht, indem sie öffentliche Diskussionen zum Thema »typisch Darmstadt« analysierten.6 Demnach erfahren die Bewohner*innen ihre Stadt als ruhig und zuverlässig, sie schätzen Routinen, bevorzugen Vertrautes gegenüber Experimenten mit ungewissem Ausgang und handeln Kompromisse aus. Das bedeutet nicht, dass alle Darmstädter*innen Phlegmatiker sind. Alteingesessene empfinden die lokalen Sitten und die spezifische Geschwindigkeit ihrer Stadt aber als normal. Neuzugezogene, die sich in Darmstadt wohlfühlen möchten, müssen sich mit dieser Kultur auseinandersetzen und auf ein eher gemächliches Tempo einstellen. Das wird ihnen leichterfallen, je mehr die Eigenlogik der Stadt ihrer eigenen Persönlichkeit entgegenkommt.
Wie sich die Bewohner*innen ein Bild von ihren Städten machen, haben die Psychologen Stanley Milgram und Denise Jode-let untersucht.7 Sie ließen 218 Personen aus den 20 Pariser Arrondissements ihre Stadt auf ein leeres Papier zeichnen. Fast alle skizzierten zuerst die äußeren Grenzen entlang des Boulevard Périphérique, der Stadtautobahn, die sich ringförmig um die Metropole legt. Als Zweites zeichneten sie die Seine ein, es folgten Notre-Dame und die Seine-Insel Île de la Cité – alle im Herzen von Paris gelegen. Daran erkannten die Forschenden, wie wichtig den meisten Menschen ein historischer Stadtkern ist und dass sich die Probanden mit Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt offenbar stärker verbunden fühlen als mit ihrer direkten Wohnumgebung.
Der Psychiater und Stressforscher Mazda Adli nennt es ein »urbanes Spinnennetz«, das diese geografischen Elemente in unseren Köpfen bilden.8 Je dichter es demnach gewebt ist, je klarer also das Bild einer Stadt und ihrer Bestandteile, desto beherrschbarer erscheint sie und desto wohler fühlen wir uns. Deshalb seien Städte wie Paris oder Köln, die eine historische Struktur mit einem Stadtkern aufweisen, den meisten Menschen angenehmer als in rechten Winkeln angelegte Städte, wie es zum Beispiel in den USA oft der Fall ist, obwohl diese uns die Orientierung eigentlich erleichtern. Eine unregelmäßige Stadtstruktur stimuliere uns, schreibt Adli, sie biete einen als wohltuend empfundenen Wechsel zwischen Anregung und Beruhigung.
Das belegt auch eine Studie des National Trust for Historic Preservation, eine gemeinnützige Organisation für den Erhalt historischer Gebäude in den USA. Sie hat einen Character Score entwickelt und damit Straßenblöcke in Seattle, San Francisco und Washington D.C. bewertet. Demnach ist in gewachsenen Vierteln mit einer kleinteiligen Bebauung und einer bunten Mischung aus alter und moderner Architektur mehr los als in Straßenzügen, in denen sich ein Neubau an den anderen reiht.9 Die Forschenden machten dies fest an Parametern wie Ladenöffnungszeiten, Smartphone-Aktivität, Wohndichte, die Anzahl der Outdoor-Sitzplätze von Cafés und der Menge der aus der Umgebung auf Flickr hochgeladenen Fotos.
Das Abbild einer Stadt erschaffen wir uns aber nicht nur über die visuelle Wahrnehmung. Fast wichtiger noch sind Gerüche. Denn der Geruchssinn ist nicht nur der älteste unserer fünf Sinne, er hat auch als einziger einen direkten Zugang zum Zentrum unserer Erinnerungen und Emotionen im Gehirn: zum Hippocampus und zum limbischen System. Dabei wissen wir noch nicht einmal, wie viele verschiedene Gerüche wir überhaupt wahrnehmen können. Klar ist nur, dass unser Riechsinn von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt ist. Wovon der eine Kopfweh bekommt, nimmt die andere unter Umständen genetisch bedingt gar nicht wahr. Bei der weiteren Verarbeitung im sogenannten olfaktorischen Kortex unseres Gehirns spielen unsere Erfahrungen eine Rolle. Je nachdem welche früheren Erlebnisse zum Beispiel mit Rosenduft oder Kohlgeruch in Verbindung gebracht werden, assoziiert man damit Positives oder Negatives.10
Auf die Stadt bezogen kann das zum Beispiel bedeuten, dass uns der spezielle Geruch in den Tunneln der U-Bahn Unbehagen bereitet, obwohl es dafür vielleicht in dem jeweiligen Moment gar keinen Anlass gibt. Im Stadtpark oder am Ufer eines Flusses riecht es anders als neben einer Hauptverkehrsader, die Fußgängerzone in der Innenstadt unterscheidet sich geruchlich von einem Villenvorort mit Gärten und Blumenbeeten, dasselbe Stadtviertel verströmt nach einem Sommerregen einen anderen Duft als an einem kalten Wintertag. Und manchen Orten haften unverwechselbare Aromen an. Vielleicht kennen Sie das: Bei hoher emotionaler Bindung an einen solchen Ort, ploppen Geruchserinnerungen auch nach Jahren der Abwesenheit sofort wieder auf.
Natürlich verändern sich Geruchskulissen von Städten und Stadtvierteln mit der Zeit. So duftete es in der Hamburger Speicherstadt vor deren Umbau zur HafenCity noch sanft nach Kaffee, Tee, Pfeffer und Kardamom – ein Andenken an die frühere Funktion der historischen Backsteingebäude als Lagerhäuser für Kolonialwaren aus aller Welt, die im Hamburger Hafen angelandet wurden. Und wo in Augsburg bis vor gar nicht so langer Zeit ein süßlich-herber Malzgeruch an die Bierbrautradition der Stadt erinnerte, zieht heute im Sommer eher Grillgeruch durch die Straßen. Und wie riecht es in Ihrer Stadt, in Ihrem Stadtviertel?
Jede Stadt ist eine Gerücheküche – und lässt sich auch mit der Nase erkunden. Einige Citys wie Köln, Dresden, Frankfurt am Main oder München bieten sogar Schnupper- und Duftspaziergänge an. Dresden verbindet das Geruchserlebnis sogar mit einer Reise in die Vergangenheit. Während der Stadtführung Dresden der Nase nach erfahren die Teilnehmenden unter anderem, wie es auf der Hochzeit von Kurfürst Friedrich August II. und Maria Josepha gerochen haben mag.
Wie es in europäischen Städten des 18. Jahrhunderts geradezu gestunken haben muss, können wir uns heute nur schwer vorstellen. Es gab kaum Kanalisation, die Menschen kippten die Inhalte ihrer Nachttöpfe in die offenen Abflussrinnen entlang der Straßen, wo sie bis zum nächsten Regenguss vor sich hin moderten. In den Hinterhöfen hielten sie Kühe, Schweine und Hühner als praktische Abfallverwerter. Mitten in den Städten betrieben sie Schlachtereien und Gerbereien, ein Heer von Pferden zog die Kutschen und Karren und bereicherte mit Pferdeäpfeln die Gerüchekakophonie. Im Winter räucherten die vielen Holz- und Kohleöfen die Luft. Und wo Menschen aufeinandertrafen, vermischten sich die Aromen von nasser Kleidung, ungewaschenen Haaren und sonstigen Körperausdünstungen.
Der Historiker William Tullet arbeitet am Forschungsprojekt Odeuropa mit, das eine Online-Enzyklopädie europäischer Gerüche zwischen dem 16. und dem frühen 20. Jahrhundert erstellt.11 Der Experte weist darauf hin, dass die Menschen damals die vielfältigen Gerüche zu jener Zeit nicht unbedingt negativ wahrgenommen hätten, da sie für sie normal gewesen seien. Dasselbe gelte für die heutige Zeit. Würde jemand aus dem 18. Jahrhundert in die Gegenwart reisen, »wären die Gerüche einer modernen Großstadt sicher sehr überwältigend – allein die Luftverschmutzung durch Abgase, dann die Fast-Food-Dämpfe und so weiter. Viele Dinge, die wir selbstverständlich finden, würden für Besucher aus der Vergangenheit sicher stinken.«12
Und die Erfolgsgeschichte der Stadt beginnt ziemlich weit in der Vergangenheit. Bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. entstanden in Mesopotamien die ersten urbanen Kulturen. Mehr noch, die Städte Uruk und Ur gelten mit ihrer räumlichen Anordnung – einer Tempelanlage im Zentrum, mit Straßen, Stadtvierteln und einer Stadtmauer – als Prototypen unserer heutigen Metropolen. Sie waren Handelszentren mit eigenen Häfen und in ihnen tauschten die Menschen nicht nur Waren und Dienstleistungen aus, sondern auch Wissen und Ideen: Die beiden Orte im Vorderen Orient entwickelten sich zu Brutstätten der menschlichen Zivilisation. In Uruk bildete sich eine neue soziale Hierarchie mit Priestern, Beamten und Ingenieuren an der Spitze.13 Händler und Verwalter erfanden die Schrift. Um Waren zählen und Lieferscheine ausstellen zu können, ritzten sie Bildzeichen in Tontafeln, aus denen schließlich die Keilschrift entstand.
Auch heute noch liegt der Reiz der Stadt zu einem großen Teil in ihrer Innovationskraft. Denn wo Menschen mit unterschiedlichem kulturellem und professionellem Hintergrund, mit ihren Meinungen und ihrem Erfahrungsschatz aufeinandertreffen, Kontakte knüpfen und sich austauschen, kann Neues entstehen.
Mittlerweile wohnt jeder zweite Mensch weltweit in einer Stadt. Immer mehr Metropolen blähen sich auf zu Megacities mit über zehn Millionen Einwohner*innen. Manche wuchern weiter zu sogenannten Endless Cities – Städte, die keine Begrenzung mehr haben, sondern sich unkontrolliert und ohne geplante Infrastruktur in die Fläche ausbreiten, meist in Asien oder Lateinamerika. Der Fokus dieses Buchs richtet sich aber auf europäische Metropolen, auf das, was uns in unseren im Vergleich überschaubaren, zumeist historisch gewachsenen Städten beschäftigt.
Und das ist nicht so sehr das Wachstum. Was uns umtreibt, sind die Auswirkungen des Klimawandels, eine alternde Bevölkerung, die neue Arbeitswelt mit ihren flexiblen Modellen, Konsequenzen unseres veränderten Konsumverhaltens, das schwierige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Wie werden wir uns künftig fortbewegen, wenn es Alternativen zum Auto braucht? Wie funktioniert die Wirtschaft in der Zukunft, wo bekommen wir die Rohstoffe her und wie können wir sie effektiv und sparsam nutzen? Wie schützen wir uns in dicht bebauten Ballungsräumen gegen Hitze und Starkregen? Was müssen wir tun, damit unsere Innenstädte lebendig bleiben, wenn alle nur im Internet einkaufen und die Mieten durch die Decke gehen?
Tatsächlich sind es die hohen Mieten, die den Menschen am meisten zu schaffen machen. Zwar stagniert das Wachstum einiger deutscher Städte oder sie schrumpfen sogar.14 Immer mehr Bewohner*innen der Ballungsräume haben jedoch Mühe, die steigenden Mieten zu bezahlen – oder überhaupt eine neue Wohnung zu finden, wenn sich ihre Lebensumstände ändern. Allein in den 82 deutschen Großstädten15 – dazu zählen Gemeinden mit mindestens 100 000 Einwohnenden – fehlen rund 1,9 Millionen günstige Wohnungen.16 Und es wird viel zu langsam gebaut. Von den jährlich 400 000 neuen Wohnungen, die sich die Ampel-Regierung vorgenommen hatte, ist Deutschland weit entfernt. Im Jahr 2023 wurden gerade mal 294 400 fertiggestellt (2021: 293 400; 2022: 295 300)17. Und für 2024 sehen die Prognosen nicht besser aus. Eine hohe Nachfrage, steigende Zinsen und Materialkosten, immer mehr Vorschriften und Auflagen – all das verteuert das Bauen.
Verschärft wird die Lage dadurch, dass Immobilien in Deutschland spätestens seit der Finanzkrise in den Zweitausenderjahren zum beliebten Spekulationsobjekt geworden sind. Viele Eigentümer*innen, darunter Immobiliengesellschaften und sonstige Investor*innen, betrachten Wohnungen mittlerweile nur noch als reine Wertanlagen. Sie verzichten selbst bei hohem Mietniveau auf eine Vermietung, da sie Wohnungen schneller und besser verkaufen können, wenn sie nicht mit lästigen Mieter*innen besetzt sind. Und so kommt es, dass in Großstädten, in denen Menschen teils verzweifelt eine Bleibe suchen, zugleich Tausende Wohnungen leer stehen, manchmal über Jahre. Selbst die öffentliche Hand hat bei diesem Monopoly mitgemacht und Grundstücke und Wohnungsbestände verkauft, um ihre Haushalte zu sanieren.
Viele, denen die Stadt zu teuer (geworden) ist, ziehen mehr oder weniger freiwillig ins Umland. Und dort, wo auch der Speckgürtel um die Metropolen kaum mehr erschwinglich ist, noch weiter hinaus aufs platte Land. Dort wohnen sie zwar günstiger, doch Bus, Bahn oder S-Bahn fahren nur sporadisch und so sind sie auf das Auto angewiesen, um mobil zu sein. Zum Arbeiten, zum Shopping, zum Geburtstag von Freunden, zum Schaufensterbummel, für Kino-, Theater- oder Weihnachtsmarktbesuche fahren sie damit dann wieder in die Stadt. Und tragen zur Verstopfung der innerstädtischen Straßen bei.
Die Stadt, so wie sie heute gebaut, organisiert und gelebt wird, ist aber auch ein Ort, der große ökologische Probleme verursacht. Rund 80 Prozent der weltweit erzeugten Energie und Ressourcen werden dort verbraucht.18 Denn in Städten wird gebaut, geheizt und gekühlt. Die vielen Fahrzeuge blasen gigantische Mengen an Treibhausgasen und Schadstoffen in die Luft und die Bewohner*innen produzieren Berge von Abfall. Städte tragen damit nicht nur erheblich zum Klimawandel bei – sie sind auch besonders von seinen Folgen betroffen. Steigende Temperaturen, heftigere Regenfälle und längere Trockenperioden machen den Cities stärker zu schaffen als dörflich geprägten Regionen, weil sie dicht bebaut sind und mit Straßen, Parkplätzen und Fußwegen versiegelt. Die Hitze staut sich, mehr Menschen kollabieren und sterben, vielerorts geht es nicht ohne Klimaanlagen, die Ressourcen verbrauchen. Bei Starkregen wiederum kann das Wasser nur begrenzt versickern, es überflutet Straßen, Keller laufen voll.
Und schließlich stellt sich die Frage, welche Formen des Zusammenlebens unsere Städte in Zukunft zulassen. Denn die Bevölkerungsstruktur ändert sich. Immer weniger junge Menschen stehen immer mehr älteren gegenüber. Jede zweite Person in Deutschland ist heute älter als 45, jede fünfte Person älter als 66 Jahre19, wobei mehr junge Menschen und Zuwandernde aus dem Ausland in die Zentren der Großstadtregionen ziehen. Dazu kommt: Unsere Städte sind nicht für alle Menschen gleich zugänglich, erfahrbar und sicher. Viele öffentliche Gebäude und Bahnhöfe sind immer noch nicht barrierefrei, Frauen fühlen sich in Stadtparks oft nicht sicher, Radfahrer und Fußgänger haben hinter dem Autoverkehr das Nachsehen.
Auch unsere Lebenslagen ändern sich mit der Zeit. Wer jung ist und studiert, wohnt vielleicht gern in einer WG mit Kneipen und Cafés in der Nähe. Gründet man eine Familie, gewinnt der Park ums Eck mit Kinderspielplatz an Bedeutung. Wer sich um ältere Angehörige kümmert oder für das Einkaufen zuständig ist, für den sind kurze Wege hilfreich. Für Kleinkinder oder Hochbetagte wiederum ist das unmittelbare Wohnumfeld wichtig, denn ihr Bewegungsradius ist begrenzt.
Wie müsste sie also aussehen, die lebenswerte Stadt für alle? Wie schaffen wir es, dass unsere Städte grüner, sozialer und gerechter werden? Dass in ihnen keine Ressourcen verschwendet werden? Dass sie dem Klimawandel trotzen? Dass sie uns emotional guttun, uns Sicherheit und Erholung bieten? Und was können wir selber dafür tun?
Dieses Buch soll Sie mit vielen positiven Beispielen dazu inspirieren, sich ein wünschenswertes Wohnumfeld auszumalen, und Ihnen Lust auf Veränderung machen. Es soll Antworten auf all diese Fragen geben, die so immens wichtig für die Zukunft unserer Städte sind. Und für unsere Zukunft. Denn die wichtigste Ressource einer Stadt sind immer noch ihre Menschen. Also: wir.
WO WIR ANPACKEN MÜSSEN FÜR EINE LEBENSWERTE STADT
GESELLSCHAFT
WIE WOLLEN WIR GEMEINSCHAFTLICH LEBEN?
Unsere Gesellschaft wird immer älter und immer diverser. Darauf müssen sich unsere Städte einstellen, damit sie für alle nutzbar und lebenswert bleiben. Innovative Wohn- und Nachbarschaftsprojekte zeigen, wie trotz aller sozialen und kulturellen Unterschiede Zusammenhalt entstehen kann. Zielgruppengerechte Planungen gestalten öffentlichen Stadtraum und Infrastruktur so, dass beides von allen gleich gut und sicher genutzt werden kann. Denn vielfältiges gesellschaftliches Miteinander macht das urbane Leben aus. Die Stadt als Gemeinschaftsprojekt.
Welche Orte und Plätze in Ihrer Stadt würden Sie Ihren Freunden oder Verwandten zeigen, wenn sie Sie besuchen kommen? Welche Ecken finden Sie besonders anziehend, welche Architektur sagt Ihnen zu, welche Attraktionen gibt es? Ist es vielleicht ein Café mit einer besonderen Atmosphäre, der Platz mit den Sitzbänken und Boulespielern, der Markt mit den lokalen Spezialitäten, eine Straße mit unkonventionellen Läden, ein Bild in einem Museum? Wenn Sie nicht gerade zu den Urban Explorern gehören, die von verlassenen und verfallenden Gebäuden magisch angezogen werden, werden es wahrscheinlich Orte mit Aufenthaltsqualität sein, an denen Sie sich wohl- und sicher fühlen. Eher nicht am Stadtrand gelegen, nicht von Beton umgeben und nicht einsam und ohne Menschen.
Es ist die Vielfalt der Dinge, die Fülle an Möglichkeiten, das Nebeneinander von Unterschiedlichem, welche die Stadt attraktiv machen. Die Stadt als Unterbau gesellschaftlichen Miteinanders, als Einladung für genussvolles Erleben, animierender Freiraum für Kreative und Vordenker*innen. Klingt gut, oder?
Die Realität sieht leider oft anders aus. Die modernen Zentren unserer Metropolen sind selten beflügelnd. Sie sind zu voll, zu laut, zu teuer. Verkehr, Konsum und Eventkultur dominieren die Stadtzentren. Die sind häufig von eintöniger Bauträgerarchitektur und austauschbaren Einkaufsmeilen geprägt. Man sieht es unseren Städten an, wer darin das Sagen hat: Immobilienunternehmen und Investor*innen, Fast-Food- und Handelsketten, die einzig an Profit interessiert sind. Wenn das große Geld die Stadt aufkauft und dirigiert, wird sie zur homogenen Wüste.
Wie konnte es so weit kommen? Die Finanzkrise 2008 und die Reaktion der Europäischen Zentralbank mit einer jahrelangen Nullzinspolitik machten Immobilien mit ihrer vermeintlichen Sicherheit vor Wertverfall zu begehrten Anlageobjekten. Das »Betongold« lockte. Viele Kommunen privatisierten auch schon vorher ihre Bestände, um sich zu entschulden, und sorgten für Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt, mit denen Profit über Gemeinwohl gestellt wurde: Auslaufen von preisgebundenen Wohnungen, Umwandeln von Miet- in Eigentumswohnungen, Verkauf von städtischem Boden an den Höchstbietenden, Bereitstellung von Flächen für private Projektentwickler*innen.
Heute können sich sogar Haushalte mit mittleren Einkommen das Wohnen in vielen Innenstadtvierteln nicht mehr leisten. Und auch der öffentliche Raum wird exklusiver: Luxusgeschäfte allenthalben und immer weniger Sitzgelegenheiten ohne damit verbundenen Konsum. Gentrifizierung nennt man diesen sozioökonomischen Strukturwandel. Die Folge ist eine soziale Entmischung attraktiver Stadtviertel zugunsten zahlungskräftiger Eigentümer*innen und Mieter*innen. Die alteingesessenen Anwohnenden werden aus ihren Vierteln verdrängt, was auf die ungleiche Verteilung sozialer Gruppen im Stadtraum hinausläuft. In benachteiligten, oft migrantisch geprägten Vierteln am Stadtrand bilden sich Parallelgesellschaften. Der als Geldanlage missbrauchte Wohnraum im Stadtzentrum steht oft leer, die Besitzenden weilen lieber in Dubai, Shanghai oder auf den Malediven. Und die aus der Stadt verdrängte Mittelschicht steigert den Flächenfraß in suburbanen Lagen. All das läuft dem Leitbild einer kompakten, funktional und sozial gemischten Stadt entgegen und bedroht den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft.
An die regelnden Kräfte des freien Marktes glaubt indes niemand mehr. Und die Stadtbewohner*innen fangen an sich zu wehren. Sie sprayen ihren Unmut an Hauswände, besetzen Häuser, protestieren mit Plakaten, auf denen »Miethaie zu Fischstäbchen« zu lesen steht, fordern Mietpreisdeckel und die Enteignung von Immobilienkonzernen. Initiativen und Baugruppen pochen auf Teilhabe und Mitgestaltung des Stadtraumes.
Wie aber soll die Stadt angesichts des demografischen Wandels aussehen? Wie schaffen wir es, den steigenden Anteil Migrant*innen und alter Menschen sozialgerecht in unsere Städte zu integrieren? Wohnen, Freiraum, Mobilität, soziale und kulturelle Infrastruktur – wie soll das in Zukunft geregelt sein? Und wie verhindern wir das Ausbluten unserer Innenstädte?
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) schlägt in einer Studie das Zielbild der alltäglichen Innenstadt vor.20 Stadtgestalter*innen müssten sich demnach vom Bild urbaner Zentren mit Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen, Altstadtkern und Gastronomiezeilen lösen. Es brauche stattdessen ein neues Verständnis des Stadtzentrums als Ort der Interaktion und gemischten Nutzung: Arbeiten und Wohnen, Kultur und Freizeitgestaltung, Produktion, Handwerk, Dienstleistung – alles gleichzeitig und nebeneinander.
Zur genaueren Betrachtung bietet sich das Quartier als kleinste Einheit von Stadtgesellschaft an. Das unmittelbare Wohnumfeld ist der Ort des täglichen Lebens, soziale Teilhabe ist möglich, verschiedene Dienstleistungen und kulturelle Angebote sind verfügbar. Wer den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern will, muss in den Stadtvierteln ansetzen.
Positive Beispiele gibt es einige. Baden-Württemberg zum Beispiel hat mit Quartier 2030 ein Förderprogramm zur gemeinschaftlichen Quartiersentwicklung aufgelegt.21 Die Ideen aus den Kommunen für bereits bestehende Viertel reichen vom Aufstellen eines »Schwätzbänkle« oder eines Infokiosk zu Nachbarschaftsaktivitäten im Quartier über das Betreiben eines Inklusions-Cafés oder einer Quartiersgalerie bis hin zu »Ausbildungslots*innen« für Personen mit Migrationshintergrund.
Wie man eine bestehende Siedlung aus den Fünfzigerjahren sozial durchmischt nachverdichtet, zeigt ein Projektvorschlag im Stadtteil Stuttgart-Rot für die Internationale Bauausstellung IBA27. Die Neubauten sind auf generationengerechtes Wohnen und auch für Personen mit Einschränkungen und Pflegebedarf ausgerichtet und werden sich um ein Netz von kleinen Plätzen und eine zentrale Gemeinschaftswiese gruppieren. Um die bereits vor Ort lebenden Menschen in die weiteren Planungen einzubinden, wurde mitten im Quartier eine »Laborbühne« für Info-Veranstaltungen und Aktionen errichtet. Aus einer reinen Wohnsiedlung soll auf diese Weise ein lebendiges Quartier entstehen, das gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsmodelle sowie barrierearmes Wohnen verbindet.
Die Alte Artilleriehalle in Köln wiederum könnte nach den Plänen des Vereins Wohnwerk bald ein Ort für inklusives Wohnen und Arbeiten werden. 120 junge und alte Menschen mit und ohne Behinderung sollen dort ein Zuhause finden. Ein Viertel der Wohneinheiten ist für Studierende konzipiert, ein Viertel als geförderter Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen, ein Viertel wird frei finanzierter Wohnraum für Singles, Paare und Familien und im letzten Viertel entstehen Gewerbeeinheiten, die den Menschen mit Behinderung im Quartier Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Um einen »Dorfplatz« sollen sich eine Rösterei mit Café, ein Restaurant, eine Quartierswerkstatt, ein Spielplatz und ein inklusives Hostel ansiedeln.
Die Stadt Köln hat schon vor einigen Jahren beschlossen, dass sie ihre Grundstücke künftig nicht mehr dem Höchstbietenden verkauft, sondern nur noch ein Erbbaurecht an dem jeweiligen Grundstück übertragen wird. Den Zuschlag erhält das beste Konzept für eine gemeinwohlorientierte Nutzung, sodass möglichst viele etwas davon haben und nicht nur ein einzelner Investor seinen Profit steigert.
Als Gegenreaktion auf den angespannten Wohnungsmarkt vor allem in Großstadtregionen, tun sich auch immer mehr Menschen zu Genossenschaften zusammen oder treten dem Mietshäuser Syndikat bei. Sie erwerben gemeinschaftlich Immobilien oder bauen neu. In der Regel sind die Häuser im kollektiven Besitz, das Eigentum wird formell an eine Genossenschaft übertragen oder eine ähnliche Körperschaft, die nicht gewinnorientiert ist. Die Mieter*innen werden zu ihren eigenen Vermietenden und halten die Mieten auf einem niedrigen Niveau.
Das Besondere am Mietshäuser Syndikat: Alle, die mitmachen, müssen über die Miete hinaus einen Solidarbeitrag zahlen. Mit dem Geld werden finanzschwächere Projekte unterstützt. So können auch Menschen Eigentum bilden, deren Eigenkapitaldecke für einen Immobilienkredit von der Bank zu dünn ist. Sie können ihre Schulden beim Syndikat über die Miete und langsam zunehmende eigene Solidarbeiträge abbauen.22
In den Wohnprojekten solcher Gruppierungen werden häufig alternative Formen des Zusammenlebens und innovative Wohnkonzepte ausprobiert. Die Idee: Die Mitglieder organisieren und gestalten ihre Wohnumwelt gemeinsam und selbstbestimmt.
In der Berliner Genossenschaft Möckernkiez zum Beispiel lenken die rund 900 Anwohnenden die Geschicke ihres Viertels. Dort hat niemand Angst vor der nächsten Mieterhöhung. Der Kiez ist auto- und zum größten Teil barrierefrei, es gibt Sandkästen, Sitzbänke und viele Fahrradstellplätze. Die Bewohner*innen können hier selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben. Alle Häuser haben Aufzüge, ein Drittel der Wohnungen ist rollstuhlgerecht ausgeführt. Im Keller kann man seinen Elektro-Outdoor-Rollstuhl über Nacht aufladen und sich per Lift im Hausrollstuhl in die eigene Wohnung hinaufbringen lassen.
Die Hausgemeinschaft funktioniert generationenübergreifend. Es gibt die Alten, die mit den Kindern im Haus Schularbeiten machen, während die Eltern arbeiten. Und es gibt die Jungen, die älteren Nachbarn die Einkäufe mitbringen. In den Hausfluren hängen Termine zum gemeinsamen Kochen im Café der Siedlung aus, in den Gemeinschaftsräumen treffen sich Chor- und Pilates-Gruppen. Verwaltet wird vieles selbst, etwa die gemeinschaftliche Nutzung der Dachterrassen.
Die Gruppe der Alten ist so heterogen wie nie. Die Stadt bietet ihnen kurze Wege und ein anregendes Umfeld.
Wohnprojekte, die Bedürfnisse von Senior*innen berücksichtigen, werden dringend benötigt, denn unsere Gesellschaft wird immer älter. Der Anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung betrug 2021 sieben Prozent. In 40 Jahren könnte jede zehnte Person in Deutschland 80 Jahre und älter sein.23 Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer gehen in Rente. Der demografische Wandel ist in vollem Gang.
Eine Entwicklung, die sich nach Prognosen des Statistischen Bundesamts bis zum Jahr 2050 fortsetzen wird, trotz aktueller Nettozuwanderung und leicht steigender Geburtenrate.24 Bis 2035 wird in Deutschland die Zahl der Menschen über 67 Jahre um etwa vier Millionen auf mindestens 20 Millionen steigen.25 Das hat auch Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur unserer Städte. Zwar ziehen mehr junge Menschen und Zuwandernde aus dem Ausland in die Ballungsräume, doch die meisten Menschen, die jetzt schon dort leben und immer älter werden, ziehen ja nicht unbedingt weg.
Im Gegenteil, gerade im Alter werden eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeiten und der Zugang zu Ärzt*innen, Apotheken und Gesundheitsversorgung wichtig. Hier punkten vor allem kleine und mittlere Städte mit einer guten Infrastruktur und kurzen Wegen. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten und Immobilienpreise dort oft noch moderat.
Insgesamt nimmt die Umzugsbereitschaft im Lauf des Lebens allerdings ab. »Ältere ziehen etwa fünfmal seltener um als Menschen unter 30 Jahren«, sagt Altersforscher Hans-Werner Wahl.26 Vor allem Babyboomer zwischen 65 und 75 Jahren fassten noch am ehesten einen Umzug ins Auge. Oft sei die Nähe zu Kindern und Enkelkindern der Grund.
Was unsere Städte kaum im Angebot haben, sind barrierefreie Wohnungen. Weder zum Kauf noch zur Miete. Nur 2,5 Prozent aller Wohnungen in Deutschland sind barrierereduziert, also noch nicht einmal barrierefrei, geschweige denn rollstuhlgerecht mit einem ausreichend großen Bad, schwellenlosem Zugang von der Straße weg und extrabreiten Durchgängen.27
Eine andere Herausforderung unserer alternden Gesellschaft ist die soziale Isolation. Viele Senior*innen wohnen allein, weil ihre Partner*innen gestorben sind. Mit dem Eintritt in die Rente sind Kontakte zu Arbeitskolleg*innen weggefallen, vielleicht machen körperliche Einschränkungen Besuche bei Freunden zunehmend mühsam. Leben die Kinder nicht mehr in unmittelbarer Nähe, ist der soziale Kontakt zu anderen Menschen oft begrenzt.
Eine Möglichkeit, Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken, ist das Wohnen im Seniorenhaus. Neben der eigenen Wohnung gibt es dort meist noch einen Gemeinschaftsraum, in dem gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Auch für Paare ist das Konzept eine gute Lösung, um den Kontakt zu anderen Senior*innen zu pflegen.
Auch Senioren-Wohngemeinschaften werden immer beliebter. Schließlich haben nicht wenige Ältere bereits als Studierende Erfahrung mit dieser Art des Zusammenlebens gesammelt. Und eine Senioren-WG funktioniert auch nicht anders. Private Zimmer dienen als persönlicher Rückzugsort, Küche, Bad und Wohnraum werden geteilt. Der tägliche Kontakt mit den Mitbewohner*innen, die Möglichkeit, gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen, und dass man sich die Arbeiten im Haushalt aufteilen kann, machen das Leben in einer WG für viele attraktiv. Außerdem ist ein Zimmer in einer Senioren-WG meist günstiger als eine eigene Wohnung.
Wer den Kontakt zu jüngeren Generationen nicht missen möchte, wird das Konzept Mehrgenerationenhaus ansprechend finden. Dort leben Menschen verschiedenen Alters unter einem Dach – Singles, Familien, Paare, Alleinerziehende. Die Grundidee: Jüngere und Ältere helfen sich im Alltag, etwa wie im Möckernkiez beschrieben. Der Vorteil: Alle Wohnparteien können ihre Unabhängigkeit bewahren und trotzdem ein gemeinsames Miteinander erfahren.





























