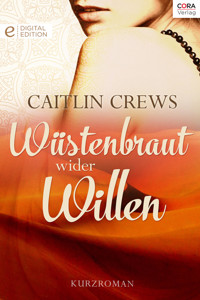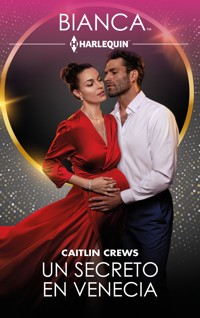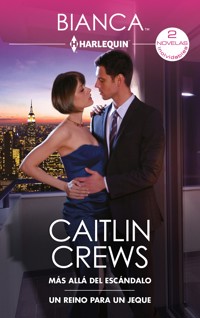4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical
- Sprache: Deutsch
Auf der Insel der Angelsachsen, anno 918: Von Kriegen hat die adlige Aelfwynn die Nase voll! Und auch von ihrem Leben bei Hofe, wo sich alles um zukünftige Schlachten zu drehen scheint. Lieber geht sie ins Kloster! Doch auf dem Weg dorthin stellt sich ihr ein hochgewachsener Wikinger entgegen und zwingt sie, ihm zu folgen. Was für eine Bestie! Aelfwynn ist entsetzt, dass ihre Pläne so durchkreuzt werden. Aber etwas am wilden Nordmann Thorbrand zieht sie magisch an. Und des Nachts schlagen die Flammen der Leidenschaft hoch …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
IMPRESSUM
HISTORICAL erscheint in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2021 by Caitlin Crews Originaltitel: „Kidnapped by the Viking“ erschienen bei: Mills & Boon Ltd., London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe 2023 in der Reihe HISTORICAL, Band 389 Übersetzung: Ralph Sander
Abbildungen: Harlequin Books S. A., alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 10/2023 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783751515993
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
… und so wurde sie all ihrer Autorität beraubt und nach Wessex gebracht.“
– Das Leben der Aelfwynn, Tochter der einzigen Lady der Mercier, so niedergeschrieben in der angelsächsischen Chronik, im Jahre des Herrn 918
Wie ein Berg aus Stein und Furcht stand der Nordmann mitten auf der alten Straße – ein Riese, der den Weg durch den dunkler werdenden Wald versperrte. Im ersten Moment glaubte Aelfwynn noch, sie würde sich ihn nur einbilden. Schon viele Stunden dauerte der unbequeme Ritt von der befestigten burh Tamworth, wo sie vor einem halben Jahr den Tod ihrer Mutter, der so geliebten Lady der Mercier, hatte miterleben müssen. Sie waren noch vor den ersten Sonnenstrahlen des ersten Tages aufgebrochen und hatten trotz des zu dieser Jahreszeit eisigen Nebel ein zügiges Tempo angestrebt.
Jede morastige, überfrorene und tückische Unebenheit hatte Aelfwynn an diesem Tag allzu deutlich gespürt, der zum Teil so betrüblich war, weil das müde alte Pferd alles war, was ihr Onkel ihr für die lange und strapaziöse Reise nach Süden ins prachtvolle Königreich Wessex überlassen hatte. Aber sie reiste auch mit schwerem Herzen ab, und das machte jeden Schmerz und jedes Sehnen umso eindringlicher.
Ihre Gedanken hatten sich auf eine eigene Reise begeben, die wegführten von jenem neuen, ruhigen Leben, das sie in Wilton Abbey erwarten würde. Ihr Herz hatte sich nach dem gesehnt, was sie hinter sich zurückgelassen, was sie verloren hatte und was man ihr niemals zurückgeben würde.
Und dann war er wie ein Albtraum erschienen, ein Albtraum, wie Aelfwynn ihn viele Male durchlitten hatte – im wachen Zustand wie im Schlaf. Grund dafür waren die zahlreichen Schlachten, die sie in ihrem Leben hatte mitansehen müssen. Und bei den Gelegenheiten, bei denen ihr das erspart geblieben war, hatte sie von Ungewissheit erfüllt dagesessen und warten müssen, wer aus dem Kampf zurückkehrte und wer nicht.
Sie war das einzige Kind ihrer adligen Mutter, der ältesten Tochter des großen Königs Alfred von Wessex. Der Kampf gegen die unzähligen Wilden, die sich immer wieder gegen sie erhoben hatten, um ihnen ihre Ländereien wegzunehmen und sich als ihre neuen Herrscher auszurufen, hatte sie in Atem gehalten, solange sie alle zurückdenken konnten.
Die Schuld am Tod ihrer Mutter im letzten Juni und ihres ältlichen Vaters sieben Jahre zuvor gab sie der unerbittlichen Plage von Nordmännern wie diesem dort, ebenso aber auch den schrecklichen Dänen oder den verdammten Norse. Diese feindseligen, kriegerischen Männer aus dem Osten gaben einfach nie Ruhe, sondern raubten und plünderten und eroberten unablässig. Besiege sie im Westen, und sie erheben sich im Osten gleich wieder, hatte ihre Mutter stets gesagt. Und danach im Norden und im Süden. Das Einzige, was sich niemals änderte, war das Blutvergießen. Immer und ewig strömte das Blut und besudelte die Erde unter Aelfwynns Füßen.
Doch diese Erkenntnis half ihr heute Abend in keiner Weise dabei, dieses Hindernis zu passieren.
Dieser Nordmann war groß und breitschultrig, er war in Felle und Wolle gekleidet, was aber nicht über seine wahre Natur hinwegzutäuschen vermochte. Allein an der Art, wie er dastand, war offensichtlich, dass er ein Krieger war. Zwar schwieg er, doch schon seine Ausstrahlung hatte etwas Bedrohliches an sich. Der Schnee, der seit dem eisigen düsteren Mittag gefallen war, bedeckte seine Schultern ebenso wie seine Haare und den dunklen Bart. Doch er schien weder davon Kenntnis zu nehmen noch von den scheuenden Pferden jener zwei Männer, die ihr Onkel ihr widerwillig mitgegeben hatte und deren kämpferische Fähigkeiten eher fragwürdig waren.
Sein Blick wanderte zu ihr, ein finsterer, kraftvoller Blick, der Aelfwynn wie ein Schlag ins Gesicht traf. Sie war froh darüber, dass sie die Kapuze ihres Mantels übergezogen hatte, da sie sich in deren Schutz zumindest ein wenig verstecken konnte. Dennoch wusste sie, dass kein Räuber sie für eine Bürgerliche halten würde, selbst wenn sie nicht von den Wachmännern umgeben gewesen wäre, die sie auf ihrer Reise begleiteten. Es genügte, dass sie zu Pferd unterwegs war, anstatt zu Fuß zu gehen. Und sie war zu gut gekleidet. Ihr Mantel und das Kopftuch, das sie unter der Kapuze trug, waren aus Wolle, und sie konnte nur hoffen, dass ihm nicht die mit Edelsteinen besetzten Nadeln auffielen, von denen ihr Kopftuch gehalten wurde. Wenn er diese Nadeln bemerkte, konnte sie genauso gut ihm und dem ganzen Königreich zurufen, wer sie tatsächlich war.
„Macht Platz!“, rief einer der Männer ihres Onkels.
Ein wenig spät, überlegte Aelfwynn.
Der Nordmann rührte sich nicht von der Stelle. Er fühlte sich von der Aufforderung genauso wenig angesprochen wie die kahlen Bäume, die die Straße säumten.
„Wir reisen unter dem Banner von König Edward von Wessex!“, rief der andere Mann. „Wagt Ihr es, seinen Unmut auf Euch zu lenken?“
„Ich sehe vor mir aber keinen König“, erwiderte der Nordmann und sprach mit einer so tiefen, rauen Stimme, dass es Aelfwynn so vorkam, als würde sie von Schwindel befallen. Ihr nervöses altes Pferd begann zur Seite auszuweichen, doch da gab es nur den Wald, in dem auch nichts Gutes auf sie wartete.
Nirgends scheint noch etwas Gutes verblieben zu sein, wenn ein Riese die Straße versperrt, überlegte sie und verspürte einen Hauch von Selbstmitleid, das sie in dem Moment beschämte, als das Gefühl erwachte. Sie dirigierte ihr Pferd zurück auf die Straße und bemühte sich darum, ihre düsteren und unwürdigen Gedanken zu vertreiben. Dabei spürte sie die ganze Zeit, wie der Blick des Kriegers auf ihr ruhte.
Aelfwynn wollte nichts weiter als ihn anbrüllen, damit er aus dem Weg ging, so wie es ihre Männer eben erst versucht hatten. Allerdings hatte deren Tonfall deutlich erkennen lassen, dass es ihnen an Mut fehlte, was sehr wahrscheinlich der Grund dafür gewesen war, dass ihr Onkel ausgerechnet ihnen diese unangenehme Aufgabe übertragen hatte, die ihnen nur sehr wenig Ruhm versprach.
Ihrer Aufforderung wollte sie dann den Dolch folgen lassen, der unter ihrer Kleidung verborgen war. Doch sie wusste genau, dass der Nordmann seine eigenen Waffen ebenfalls am Körper bei sich trug. Wenn sie im Verlauf dieses langen und düsteren Jahrs eine Sache gelernt hatte, dann die, wie man Dinge gut versteckte. Hätte sie in dieser Zeit auch nur einmal auf ihre finstere Seite gehört – was sich sicherlich in diesem Moment gut angefühlt hätte –, würde sie heute längst nicht mehr leben.
Sie war am Hof ihres Vaters großgezogen worden, danach war sie während der sieben Jahre, die ihre Mutter Aethelflaed nach dessen Tod geherrscht hatte, deren wichtigste Gefährtin gewesen. Noch vor einem Jahr war sie sich ihrer Stellung sicher gewesen. Ihre Mutter hatte niemanden gefürchtet, keinen Mann und keine Armee. Aethelflaed hatte die Five Boroughs eingenommen und als Teil des Danelags regiert, jenem vereinbarten Gebiet der Invasoren, die diese Ländereien für mehr als hundert Jahre mit Feuereifer belagert hatten. Im abgelaufenen Jahr hatte die Lady von Mercia das von den Dänen gehaltene Derby fallen lassen, die Kapitulation von Leicester angenommen, und ihr war die Ergebenheit der christlichen Führer von York angeboten worden. Die hatte sie nicht mehr annehmen können, da sie vom Tod ereilt worden war.
Damit wäre es an Aelfwynn gewesen, anstelle ihrer Mutter weiterzumachen. Doch sie hatte sich schon vor langer Zeit damit abgefunden, dass sie nicht so war wie ihre Mutter. Dafür fürchtete sie sich einfach vor zu vielen Dingen, und sie ließ sich diese Furcht auch noch viel zu leicht ansehen. Einzelne Männer und ganze Armeen, Dänen, Nordmänner und Sachsen und alle anderen hatten sie umschwärmt und ihr zugeflüstert, was Mercia tun müsse, um sich von seinem Verbündeten im Süden zu unterscheiden – dem Königreich Wessex, über das ihr Onkel Edward herrschte. Der sah sich weniger als Verbündeter, sondern vielmehr als der rechtmäßige König, der seiner Schwester großzügig gestattet hatte, so zu regieren, wie es ihm gefiel.
Diese Gunst beabsichtigte er nicht auf seine Nichte zu übertragen, was insbesondere damit zu tun hatte, dass er ihre Ergebenheit nicht so mühelos einfordern konnte, wie es ihm bei seiner Schwester möglich gewesen war.
Ich könnte dich mit einem Verbündeten verheiraten, hatte er zu ihr gesagt, als er hergekommen war, um Tamworth für sich zu beanspruchen. Mit diesem Akt hatte er auch noch die letzten Träume Mercias von Unabhängigkeit zerschlagen, und zugleich war er zur Verkörperung von Aelfwynns sämtlichen Befürchtungen geworden. Doch Verbündete haben die schlechte Angewohnheit, sich in Feinde zu verwandeln, nicht wahr?
Hätte Aelfwynn auf die gehört, die ihr ins Ohr geflüstert hatten, und hätte sie getan, wozu sie von ihnen angefleht worden war, oder hätte sie allein schon in seiner Gegenwart so klare und deutliche Worte gesprochen, wie es ihre Mutter ohne den Hauch eines Zögerns getan hätte, dann wäre sie von ihm so behandelt worden wie jeder seiner Feinde. Niemand hätte ihm das zum Vorwurf gemacht.
Das wusste sie nur zu gut. Ihr Schweigen – jene Wehrlosigkeit, in die sie sich einhüllte wie in einen dicken Wollmantel, ganz gleich, wie sie sich in dessen Innerem fühlte und ganz gleich, wie sehr diese Wolle auf ihrer Haut auch kratzte – hatte ihr das Leben gerettet. Und nur deshalb war sie nun auf dem Weg zu einer Abtei, in der sie den Rest ihres Daseins fristen würde, obwohl es für ihren Onkel viel leichter gewesen wäre, sie zu töten. Und auch das hätte ihm niemand zum Vorwurf gemacht.
Man nennt es Gnade, Nichte, waren seine Worte gewesen, als er ihr seine Entscheidung mitgeteilt hatte. Seine Augen hatten dabei auf eine Weise gefunkelt, die noch nicht ganz für pure Bosheit, aber ganz eindeutig nicht für Zuneigung stand. Mein Geschenk für dich im Gedenken an meine Schwester.
Damals hatte Aelfwynn genauso wie er den Kopf gesenkt, obwohl ein kleiner Teil von ihr sich danach sehnte, dem Vorbild ihrer furchtlosen Mutter zu folgen und zu kämpfen. Um Armeen anzuführen und Städte dem Erdboden gleichzumachen. Um Königreiche zu beherrschen und jeden Feind niederzuringen und ihn dazu zu bringen, dass er vor ihr duckte. Aber es hatte nur eine Lady der Mercier gegeben. Aelfwynn war sich nur zu gut der Tatsache bewusst, dass sie im Vergleich mit ihrer Mutter immer nur enttäuschen konnte. Und das hatte sie auch bereits bewiesen – nicht nur, weil sie keines dieser Kriegsspiele mitmachen, sondern Frieden haben wollte.
Also tat sie nun das, was sie schon immer getan hatten: Sie nutzte die wenigen Mittel, die ihr zur Verfügung standen, und machte sich klein und scheinbar fromm, indem sie in ihrem besten Kirchenlatein ein Gebet sprach, das sich mit einer hübschen Melodie gegen die anbrechende Nacht wandte.
„Ich bin wegen eurer Lady hier“, sagte der Nordmann zu den Männern ihres Onkels. Seine Stimme war weder hübsch noch melodisch, und doch war die Wirkung nahezu die Gleiche. Noch immer rührte er sich nicht von der Stelle, so als wäre er tatsächlich aus Stein gemeißelt. „Ich habe mit euch keinen Streit, doch wenn ihr euch gegen mich erhebt oder wenn ihr versucht, mich aufzuhalten, werde ich mit eurem Blut die Bäume rot anstreichen.“
Seine Stimme war so leise und so finster, und seine Worte waren eine solche Drohung, dass sich Aelfwynns Haut zusammenzog und ein eisiger Schauer sie durchfuhr. Und doch konnte sie wieder nur das tun, was seit dem Tod ihrer Mutter immer wieder ihre einzige Reaktion gewesen war: Sie senkte den Kopf und hoffte einmal mehr, dass die Mächte, denen sie sich unmöglich entgegenstellen konnte, stattdessen Mitleid mit ihr haben würden. Hauptsache, sie blieb am Leben.
Der Nordmann musterte die Männer links und rechts von ihr auf eine Weise, als stünde ihnen ihr fehlender Mut auf die Stirn geschrieben. „Wenn ihr jetzt geht, wird niemand etwas davon erfahren.“
„Die Lady soll nach Wilton“, sagte einer der Wachleute, auch wenn seine Worte mehr nach einer Frage als nach einer Feststellung klangen. „Auf Befehl des Königs soll sie ins Kloster gebracht werden.“
„Im Winter sind die Straßen tückisch“, sagte der Krieger fast beiläufig. Als Aelfwynn ihn jedoch kurz ansah, war sein Blick sehr eindringlich und wieder auf sie allein gerichtet. „Banditen und Wölfe treiben ihr Unwesen, und Könige findet man hier so gut wie keine. Wer vermag schon zu sagen, von welcher Tragödie ein so zartes Geschöpf hier draußen in der Dunkelheit heimgesucht werden könnte?“
Aelfwynn stockte der Atem. Sie gab nicht länger vor zu beten, denn die Männer ihres Onkels warfen sich untereinander Blicke zu und wandten sich wieder dem Nordmann zu. Ihre Furcht und ihr Unwillen waren ihnen deutlich anzusehen.
Von Aelfwynn nahmen sie dabei keine Notiz, so als würde sie bei deren Entscheidung gar keine Rolle spielen.
„Mein Onkel ist ein mächtiger Mann, und ihm gehört jetzt Mercia“, machte sie den beiden Männern deutlich, wobei sie hoffte, dass auch dieser Riese dort vor ihnen sich die Warnung zu Herzen nehmen würde. „Wollt Ihr es wagen, Euch mit ihm anzulegen?“
Der Krieger wandte nicht den Blick von ihr ab, so als würde es um sie herum nicht immer dunkler werden und als hätte er den Schnee noch gar nicht bemerkt. Es war so, als wüsste er längst, wie diese Konfrontation enden würde.
„Ihr solltet Euch lieber fragen, ob Ihr es wagen wollt, Euch mit mir anzulegen“, sprach er mit tiefer, unheilvoller Stimme.
Aelfwynn fiel auf, dass sie immer noch den Atem anhielt, während in ihr ein seltsamer Kampf tobte. Sie war sich nicht sicher, ob seine Worte den verängstigten Männern ihres Onkels galten oder – was noch beunruhigender war – ob sie selbst gemeint war. Sie betete stumm und inständig, dass andere Reiter des Weges kamen und dem Treiben des Fremden ein Ende setzten, wozu die Männer ihres Onkels nicht fähig waren. Doch sie wusste nur zu gut, dass außer Narren und Ungeheuern niemand bei diesem Wetter nachts unterwegs war, zumal die nächste Unterkunft weit entfernt lag.
Narren und Ungeheuer waren auch die Einzigen, die sich in diesem Moment auf dieser verwaisten Straße aufhielten. Sie selbst war die größte Närrin, weil sie gedacht hatte, sie könnte der Trauer und dem Tumult dieses finsteren letzten Jahrs unversehrt entkommen.
Es hätte sie auch gar nicht überraschen sollen, als die beiden Männer ohne einen einzigen Blick in ihre Richtung ihre Pferde kehrtmachen ließen, um sie mit Tritten in die Flanken und mit lauten Rufen zur Eile anzutreiben, damit sie mit ihnen dorthin zurückkehrten, woher sie gekommen waren. Feiglinge bis zum letzten Augenblick!
Aelfwynn streifte hastig den Schleier der Schwäche ab und versuchte, ihren armen alten Gaul zur Eile anzutreiben, doch dann war der hünenhafte Nordmann schon bei ihr. Dass er sich bewegt hatte, davon hatte sie nichts mitbekommen. Von einem Moment zum anderen stand er neben ihr und nahm wie selbstverständlich die Zügel und damit die Kontrolle über ihr ohnehin unnützes Pferd an sich. Dann wartete er einfach und sah sie dabei mit dieser finster lodernden Ruhe an, so als wollte er sie zu dem Kampf herausfordern, vor dem ihre Männer davongelaufen waren.
Ihren Dolch trug sie am Oberschenkel, die Gurte des Halfters drückten durch den Strumpf auf ihr Bein. Aber wie sollte sie danach greifen, wenn er neben ihr stand? Sie bezweifelte, dass er tatenlos zusehen würde, wie sie sich auf ihrem Pferd sitzend durch den Wollmantel und den darunter getragenen, mit Fell besetzten Untermantel wühlte, um dann auch noch unter ihr hübsches Kleid mit den Stickereien und das leinene Unterkleid zu gelangen, ehe sie endlich den Dolch zu fassen bekommen konnte.
Der Mann war zu groß und zu nah. Er würde so mühelos nach ihrer Hand fassen, wie er es schon mit den Zügeln gemacht hatte. Das Funkeln in seinen Augen stellte sie vor die Frage, ob er nicht nur wusste, dass sie bewaffnet war, sondern ob ihm auch klar war, wo genau an ihrem Körper sie die Klinge versteckt hatte, bevor sie an diesem Morgen aus Tamworth abgereist war. Dieser Gedanke ließ sie nur noch viel deutlicher spüren, wie stark und gefährlich er war, selbst wenn er nicht zu den Waffen griff, von denen sie die eine oder andere unter seinem Mantel ausmachen konnte.
„Lasst von mir ab“, sprach sie so würdevoll, wie sie nur konnte, wenn gleichzeitig ihre Hände zitterten. „Dann verspreche ich Euch, dass Euch nichts geschehen wird.“
Er musterte sie nachdenklich. „Aber was ist Euer Versprechen wert, wenn Ihr es so wenig verteidigen könnt wie Euch selbst?“
Unter dem dicken Mantel faltete Aelfwynn die Hände, damit der Nordmann von ihrem Zittern nichts bemerkte. Sie hätte zu gern den Stoff ihres Kopftuchs vor ihr Gesicht gezogen, doch das wagte sie nicht. Sie wusste nur zu gut, wie Angst bei einem Mann finstere Gelüste zu wecken vermochte, und sie war klug genug, ein solches Feuer nicht auch noch selbst zu entfachen. Sie dachte an ihre Mutter, die stets zum Kampf bereit gewesen war und dabei immer völlig gelassen gewirkt hatte.
Sie neigte den Kopf ein Stück weit. Ihr Magen verkrampfte sich, da dieser Mann auch noch größer und breiter war als die meisten Männer. Weit musste sie daher den Blick nicht senken, bis sie ihm in die Augen sehen konnte.
„Es ist so, wie meine Männer es Euch gesagt haben. Mein Onkel ist Edward, der König von Wessex.“ Sie wartete darauf, dass der Nordmann vor Ehrfurcht oder Angst zurückwich, falls ihm die beiden Banner entgangen sein sollten, die goldene Drachen und den Namen ihres Onkels zeigten. Aber weder Ehrfurcht noch Angst zeichnete sich auf dem Gesicht des Kriegers ab, das wie versteinert wirkte. „Er weilt derzeit in Tamworth, fast einen Tagesritt von hier entfernt. Es wird ihm nicht gefallen, sollte mir etwas zustoßen.“
„Tatsächlich?“ Er hörte sich leicht amüsiert an, doch sein schroffes Gesicht spiegelte das nicht wider. Seine Aufmerksamkeit ließ nicht für einen Moment nach. „Ihr steht nicht in der Gunst Eures Onkels, Lady Aelfwynn. Sonst hätte er Euch nicht Euer Geburtsrecht streitig gemacht und Mercia für sich selbst beansprucht, nicht wahr?“
Ihr wurde kalt und heiß, blankes Entsetzen sorgte dafür, dass ihre Lippen taub wurden, auch wenn sie sich noch so sehr einzureden versuchte, dass es am Schnee lag. „Wie kann es sein, dass Ihr mich kennt?“
„Wer kennt Euch nicht?“, fragte der Nordmann mit einem gewissen bedrohlichen Unterton. In seinen Augen bemerkte sie ein Funkeln, das sie nicht deuten konnte. Sie spürte es aber so deutlich, als hätte er seine Hände auf ihre Haut gelegt. „Ihr besitzt einen größeren Anspruch auf Mercia als der Mann, der es an sich gerissen hat, und doch lebt Ihr noch.“
Sie wusste, es war keine Einbildung, sondern er betonte den angehängten Satz tatsächlich mit viel Nachdruck. Aelfwynn versuchte Ruhe zu bewahren und sich nicht von ihrer Angst mitreißen zu lassen. Dabei wünschte sie, sie wäre so mutig, sich vom Rücken ihres Pferds zu werfen, das er mit einer Selbstverständlichkeit und Ruhe festhielt, als würden Ross und Reiterin ihm gehören. Würde sie es wagen, könnte sie davonlaufen und ihr Glück versuchen, ihm im angrenzenden Wald zu entkommen. Doch der Nordmann irrte sich nicht, was seine Worte über diesen einsamen Ort hier anging. Sogar im hellen Licht eines Sommertages waren die Straßen gefährlich, doch jetzt waren es nur noch drei Wochen bis Mittwinter, und sie erwartete zwischen diesen kahlen Bäumen nichts anderes zu finden als einen brutalen Tod.
In der Ferne heulte ein Wolf, und Aelfwynn konnte nicht verhindern, dass ihr daraufhin ein Schauer über den ganzen Leib lief.
„Ihr würdet gut daran tun, Euch die Frage zu stellen, was Euer Onkel für Euch vorgesehen hatte“, redete der Krieger weiter und deutete auf den Wald und die Straße. Zwischen den Ästen hing noch der letzte Rest von Tageslicht, der wie eine unerfreuliche Warnung wirkte. „Die Nacht ist angebrochen, und dennoch seid Ihr weit von jeder Unterkunft entfernt. Wärt Ihr überfallen worden, wie hätten Euch Eure Männer dann verteidigen sollen? Ich habe sie ja schon verjagt, ohne auch nur eine Waffe gezogen zu haben.“
Ich bin überfallen worden, überlegte sie, während sie ihr Herz wie wild schlagen hörte. Und zwar von einem Nordmann.
Was für eine Sorte Mann war er, wenn er besänftigend auf sie einredete und ihr seltsame Rätsel aufgab, obwohl er sie längst mühelos hätte abschlachten können? Als sie das dunkle Chaos in seinem Blick sah, wusste sie genau, was er war – ein Mann, der sich von den beiden Wachleuten, von denen sie schändlich im Stich gelassen worden war, nicht stärker hätte unterscheiden können. Ein Mann, der es mit den Wäldern, mit Wölfen und jeder anderen Gefahr aufnahm, der er begegnete.
Ein wilder Nordmann, der nicht zögern würde, nach Belieben Blut zu vergießen, zu plündern und zu brandschatzen.
„Welchen Nutzen hat es, jede Wahrheit auszusprechen?“, brachte Aelfwynn mit Mühe heraus und wünschte, diese häufig angewandten Worte ihrer Mutter würden ihr in dieser Nacht mehr Trost spenden. Doch die Kälte, ihre eigene Angst und sein unbarmherziger Blick hatten die Oberhand gewonnen, auch wenn sie sich noch so sehr dagegen zu sträuben versuchte.
„Ein schöner Spruch“, fand der Nordmann, der den Mundwinkel verzog. „Was glaubt Ihr? Wird er Euch das Leben retten?“
Aelfwynn betrachtete sein Gesicht, seinen strafenden, immer gleichen Blick, und suchte nach einem Anzeichen für Gnade, das sie nicht finden konnte. Aus dieser Nähe betrachtet konnte sie nicht anders als Kleinigkeiten zu bemerken, die sich in ihr Gedächtnis einzubrennen schienen. Sie sah, dass seine vom Schnee bedeckten Haare eigentlich dunkel waren. Er trug sie zu Zöpfen geflochten, damit sie ihm nicht ins Gesicht fielen. Sein Bart war von der gleichen Farbe wie das Haupthaar, doch hatte sich dort noch mehr Schnee angesammelt, was er gar nicht zu bemerken schien. Sein Blick war gleichfalls dunkel, aber die Augen waren von einem tiefen, satten Mitternachtsblau.
Er war ein rauer Krieger, das war nicht zu übersehen, bedauerlicherweise jedoch sah er nicht so abscheulich brutal aus, wie es Aelfwynn lieb gewesen wäre. Ganz im Gegenteil: Es fiel ihr sogar schwer, den Blick von ihm abzuwenden. Trotz seiner Größe hatte er sich unglaublich schnell von der Stelle bewegt, und er stand in einer Haltung neben ihr, die ihn so erscheinen ließ, als sei er etwas, dem die Aufmerksamkeit der ganzen Natur zu gelten habe, nicht umgekehrt.
Er war so beeindruckend, wie er furchteinflößend war, und Aelfwynn war ihm in jeder Hinsicht ausgeliefert.
Ihre Mutter war von militärischen Taktiken begleitet aufgewachsen, die ihr von ihrem Vater – König Alfred – weitervererbt worden waren. Er hatte in seiner Zeit nahezu unablässig gegen den Ansturm aus Nordmännern, Norse und Dänen gekämpft. Aethelflaed war stets davon ausgegangen, dass sie eines Tages ganze Armeen befehligen würde, weshalb sie sich auf dem Pergament und in der Tat auf diesen Tag vorbereitet hatte. Dazu gehörte auch ihr berüchtigter Ausspruch, dass sie, nachdem sie nach fast zehn Ehejahren das einzige Kind der Familie zur Welt gebracht hatte, zu keiner weiteren Schwangerschaft bereit gewesen war, weil ihr das Risiko für ihr eigenes Leben zu groß erschien.
Sie hatte ihrer Tochter geraten einen Plan zu schmieden, anstatt sich Angst einjagen zu lassen.
Aelfwynn vermisste ihre Mutter so sehr. Doch die unangenehmen Monate des politischen Taktierens und des Vortäuschens lagen nun hinter ihr. Jetzt gab es nur noch diesen Mann und den Wald und das Lied der Wölfe – und eine Abrechnung, die in dieser kommenden kalten Nacht geschehen würde, ob sie es wollte oder nicht.
Sie konnte es nicht mit Gebeten verhindern, und sie konnte auch nicht davor weglaufen.
Er hatte sie in seine Gewalt gebracht, ohne sein Schwert ziehen zu müssen. Das was die Schande, die sie ertragen musste und ertragen würde, sollte sie das hier überleben. Sie war von finsterer Nacht umgeben, bewaffnet mit einem Dolch, nach dem sie nicht greifen konnte, auf einem Pferd sitzend, das nicht zum Galopp fähig war. Die Männer ihres Onkels waren längst uneinholbar weit weg, und damit waren ihr Schutz und ihre Sicherheit nichts weiter als eine Geschichte, die man sich in ihrer Kindheit vor dem Kaminfeuer erzählt hatte.
Sie hatte alles Vertraute hinter sich zurückgelassen, und geblieben war ihr nur noch … sie selbst.
Nur sie selbst, mehr nicht.
Etwas regte sich in ihr. Vielleicht so etwas wie ein Plan. Auf jeden Fall nicht das blanke Entsetzen, das ihr das Gefühl gab, genauso eingefroren zu sein wie die alte Straße unter den Hufen ihres Pferds.
Ich bin die Tochter meiner Mutter, sagte sich Aelfwynn. Ob man es mir ansehen kann oder nicht.
Um den Gedanken zu beweisen, wich sie absichtlich nicht vor dem Mann zurück, der sie so genau beobachtete und dessen Blick zu wissend und zu kühn war.
Stattdessen lächelte sie ihn an. „Ich bezweifele, dass Ihr im Wald von Dunkelheit umgeben und mit Schnee bedeckt in immer schlechter werdendem Wetter auf mich gewartet habt, um meinen Retter zu spielen. Ihr werdet mich verschonen oder töten, ganz wie es Euch beliebt. Das wissen wir beide so gut, wie es auch die Wölfe wissen.“
Ihr Tonfall klang gelassen und gleichgültig, auch wenn Aelfwynn innerlich in Flammen stand. Aber sie lächelte beharrlich weiter, denn sie war vom Blut alter Könige und Königinnen, und sie würde sich zur Wehr setzen.
Auf die einzige Weise, zu der sie fähig war.
Die mitternachtsblauen Augen des Nordmanns loderten auf.
Aelfwynn wich seinem Blick nicht aus. „Doch Ihr müsst mir schon sagen, was ich tun muss. Das werde ich dann auch tun.“
2. KAPITEL
Eigi fellr tré við it fyrsta högg.
Ein Baum fällt nicht beim ersten Windstoß um.
– Njáls Saga, Redewendung
Sie war nicht das, was er erwartet hatte. Die zweite Hälfte dieses langen Jahres hatte Thorbrand damit verbracht, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Er, sein Bruder Ulfric und sein Cousin Leif hatten den Befehl zu diesem Unternehmen von keinem Geringeren als ihrem König Ragnall erhalten, der von diesen Merciern seit Langem gehasst und gefürchtet wurde. Alle drei waren sie kaum mehr als unerfahrene Jugendliche gewesen, als ihr Volk von den irischen Königen aus Dublin verstoßen worden waren. Gemeinsam waren sie zu leidenschaftlichen und ergebenen Männern herangewachsen, geschmiedet im brutalen Feuer einer langwierigen, blutigen Schlacht nach der anderen. Sie waren Verwandte, gute Freunde und kampferfahrene Waffenbrüder. Als gefürchtete und furchteinflößende Krieger hatten sie für Ruhm und Ehre gekämpft und dabei an Ragnalls Seite Land von der Isle of Man bis nach Northumbria erobert, weiter nach Irland, um dort das zurückzuerobern, was man ihnen fünfzehn Jahre zuvor weggenommen hatte. Von dort war es dann Anfang des Jahres weitergegangen zu dieser bitterkalten Insel, gefolgt von Scharmützeln entlang der Grenze zu den Schotten.
Dieses letzte Gefecht bei Corbridge hatte bei Ragnall Gefallen am Prinzip der Täuschung aufkommen lassen, da er mit der von ihm angeführten Kolonne in Lauerstellung gegangen war, bis die Schotten davon überzeugt gewesen waren, all ihre Feinde geschlagen zu haben. Erst dann waren seine Leute losgestürmt und hatten den Sieg errungen. Seitdem dachte Ragnall weniger darüber nach, was er mit seinen Fäusten zerschlagen oder mit seiner Axt zerstückeln konnte, sondern er überlegte sich, zu welchen taktischen Spielen er greifen konnte, um seine Vorhaben zu verwirklichen.
Und er hatte überlegt, welchen seiner treuen Männer er zutrauen konnte, dass sie seine raffiniertesten Pläne in die Tat umsetzten.
Während dieser langen Zeit der Planung und Vorbereitung hatte Thorbrand sich immer vor Augen halten müssen, dass es nichts Geringeres als eine Ehre war, mit seinem geduldigen Abwarten seinem König dienen zu dürfen. Nicht im direkten Kampf mit dem Schwert in der Hand würden Thorbrands Fähigkeiten auf die Probe gestellt, sondern auf eine andere, bedeutungsvollere Weise.
Und dennoch wussten die Götter nur zu gut, dass dieser Auftrag ihn in seinem Herzen nichts von einer Ehre spüren ließ.
Allerdings hatte er aber auch erwartet, dass Lady Aelfwynn sich vor ihm duckte und zu jammern begann, wie es diese sächsischen adligen Frauen für gewöhnlich machten, die voller Aufregung Gebete an ihren Christengott schickten und dann ohnmächtig in den Morast sanken, wenn ihre Gebete ungehört verhallten.
Da war es doch besser, wenn man eine ganze Reihe von Göttern zur Auswahl hatte, wie Thorbrand es sich immer sagte. Ein einzelner Gott mochte gerade einmal kein Interesse daran haben, Hilfe zu leisten, was bei diesen launischen Kreaturen oft vorkam.
Aelfwynn hatte in der alten lateinischen Sprache gebetet, doch sie war nicht vor ihm zurückgewichen. Vielmehr saß sie kerzengerade da und sah ihn unverhohlen an. Diese wortlose Herausforderung hatte sein Blut in Wallung gebracht. Thorbrand war ein Krieger, kein Schwächling, und er sehnte sich nach den mutigen, starken Kriegerinnen, die sein Volk hervorbrachte. Aber nicht nach diesen mürrischen, finsteren Christinnen mit ihrer blutleeren Frömmigkeit.
Und doch verdiente diese Frau – diese mercische Prinzessin, der er sich ganz unabhängig davon anzunehmen hatte, was er von ihr hielt – genauer betrachtet zu werden. Fast erinnerte sie ihn an … aber derartige Gedanken verwarf er gleich wieder. Seine Vergangenheit hatte hier nichts zu suchen. Was geschehen war, konnte durch Erinnerungen nicht verändert werden. Das wusste Thorbrand sehr genau.
„Bietet Ihr Euch mir an?“ Seine Frage war kaum mehr als ein düsteres Kratzen. Sein Blick ruhte weiter auf ihrem reizenden Gesicht, das nur wenig von dem Kopftuch und der Kapuze verdeckt wurde, mit der sie sich vor der kalten Nacht schützte. Forschend schaute er ihr ins Gesicht, doch da war immer noch kein Ausdruck von Angst, den er dort eigentlich erwartete.
Es war zwar nicht so, dass sie gar keine Angst gehabt hätte, immerhin war es dunkel, und bei ihr war nur ein Mann, den sie vermutlich für ein Ungeheuer hielt. Er war ihr jetzt nahe genug, um erkennen zu können, dass sie ganz leicht zitterte. Dennoch waren ihre Augen weiter stur auf ihn gerichtet. Diese Augen schimmerten golden, und er stellte sich unwillkürlich die Frage, welcher Mann schon abgeneigt war, so viel Gold zu horten, wie er nur konnte.
Sie ist mutig, dachte Thorbrand erfreut.
Es war viel zu verführerisch sich auszumalen, wie es sein würde, wenn sie sich ihm hingab. Wie es sich anfühlen würde, tief zwischen ihren Schenkeln Erfüllung zu finden.
„Kann eine Frau denn das anbieten, was durch die Androhung von Gewalt mitten in einem dunklen Wald längst genommen wurde?“, fragte Aelfwynn mit einem Hauch von Ironie in ihrer Stimme.
Sie überraschte Thorbrand damit auf ein Neues, und wieder stieg in ihm Hitze auf. „Eine Frau kann immer etwas anbieten. Gibt es irgendwen, der es nicht mag, wenn ihm etwas aus freien Stücken geschenkt wird?“
„Ich bekenne mich zu einer gewissen Skepsis, was Geschenke angeht“, erwiderte sie ohne den Blick von ihm abzuwenden. Sie saß unverändert kerzengerade da, ganz anders als die Frau, die er in den ersten Momenten erlebt hatte, als sie den Kopf einzog und mit schwacher Stimme ihr Gebet sprach.
Mit jedem Augenblick, der verstrich, empfand Thorbrand diese Frau umso faszinierender. Sein Blut reagierte darauf, indem es wie ein zum Leben erwecktes Feuer durch seine Adern schoss.
„Ich finde, je größer das Geschenk ist, umso mehr wird als Gegenleistung dafür erwartet. Oder ist das nicht so?“
Sie erinnerte ihn an ähnliche Worte, die er in den Langhäusern seiner Kindheit gehört hatte. Es war beunruhigend, denn er hatte nicht erwartet, dass sie ihm in irgendeiner Weise ähnlich sein könnte – sie, diese Beinahe-Königin, die für das, wofür sie stand, kostbarer war als für alles andere. Man hatte ihr die Ländereien, die Menschen weggenommen. Sie war vom Hof ihres Onkels weggeschickt worden, und sie hätte ohne weiteres in einem Kloster in Vergessenheit geraten können, ganz so wie eine Sage, die nur selten erzählt wurde. In keinem Lied und keiner Geschichte würde ihr Name erwähnt werden, für niemanden würde sie je wieder eine Bedrohung darstellen.
Er war davon ausgegangen, dass sie nicht mehr war als eine Frau, die er irgendwohin verschleppen konnte um letztlich einen Weg zu finden, wie er sein Leben mit ihr teilen konnte. Und das vielleicht sogar in Frieden, wenn die Götter das wollten. Aber auch ohne Frieden würde er sein Leben mit ihr verbringen, denn wenn Thorbrand ganz ehrlich zu sich selbst war, wusste er ohnehin so gut wie gar nichts darüber, was Frieden war, selbst wenn man ihn mit der Nase darauf gestoßen hätte.
„Der Lauf der Welt wird hier in diesem Wald sicher nicht verändert werden“, gab er schroff zurück, meinte damit aber nicht nur sie, sondern auch sich selbst. Er durfte sich nicht vergessen, auch wenn er sie ansprechender fand, als er es je für möglich gehalten hatte. Auch wenn sie Erinnerungen weckte, die er nach Kräften aus seinem Kopf verbannt hatte. Er wusste, was er mit dieser Frau anzufangen hatte. Und das hätte er auch gewusst, wenn sie vor Angst von ihrem Pferd gefallen wäre und sich zu seinen Füßen auf dem eisigen Boden gekrümmt hätte.
Seine Befehle hatten mit dem zu tun, was sein König begehrte, aber nicht er selbst. Um ihn ging es dabei niemals. Er hätte bei der Erledigung seines Auftrags nicht trödeln sollen, und doch rührte sich Thorbrand noch immer nicht von der Stelle. Er stand weiterhin nur da und sah sie an, während sie weiterhin auf seinem Pferd saß. Dabei wirkte sie seiner Meinung nach fast so stolz wie die Königin, die sie hätte sein können. Und die sie sehr zum Zorn ihres Onkels in diesen letzten sechs Monaten beinahe auch gewesen war. „Sagt mir, Aelfwynn, was wollt Ihr mir für Euer Leben anbieten?“
„Bin ich es, die bestimmt, was mein Leben wert ist?“ Sie legte den Kopf ein wenig schräg. „Oder bestimmt das nicht derjenige, der es mir nehmen will?“
Thorbrand kannte sich mit diesen Spielen aus, und sie gefielen ihm gar nicht. Worte wie Schwerter, das Lebenselixier am königlichen Hof, wo ein Flüstern vergiften und ein Gerücht töten konnte. Es war ratsam, sich vor Augen zu halten, dass sie über diese Waffen verfügte, auch wenn er ihnen nur wenig Wert zumaß. Jedenfalls dann nicht, wenn er nur mit seinem Schwert ausholen musste, um seine Welt zu bestimmen.
„Welch philosophischen Worte, Mylady.“ Er sah, wie sie trotz ihres Zitterns die Lippen zusammenpresste, und sagte sich, dass dies ein gutes Zeichen war. Es war besser, wenn sie sich vor ihm fürchtete, anstatt sich einzubilden, dass sie ihn mit ihrem schönen Gerede um den Finger wickeln konnte. „Und trotzdem schneit es immer noch, und die Wölfe heulen auch unverändert. Und was glaubt Ihr, wo Ihr heute Nacht Euer Haupt zur Ruhe betten könnt?“
Aelfwynn lachte und ließ ihn zusammenzucken, obwohl er ein so abgehärteter Mann war, dass er bei den Göttern hätte schwören können, dass es auf dieser finsteren, verdammten Erde nichts gab, was für ihn unverhofft kommen konnte. Ausgenommen offenbar ihr Lachen. Unverhofft war, dass sie es überhaupt gewagt hatte zu lachen, aber es galt auch für das Gelächter an sich. Es ließ ihn an einen kalten, klaren Strom denken, der in den Bergen dieses neuen Landes mit Namen Ísland entsprang. Jene Welt weit weg im Westen, die er in diesem Sommer zum ersten Mal gesehen hatte und die er jetzt in sich trug, als hätten diese an schlummernde Drachen erinnernden Berge und die Strände aus schwarzem Gestein so schnell von ihm Besitz ergriffen. Und das, wo er es doch gewesen war, der von dem Land hatte Besitz ergreifen wollen, da die Menschen über kurz oder lang Land brauchten.
Das Problem daran war, dass alles Land, das Thorbrand je zu sehen bekommen hatte, mit Blut getränkt war. Das Land war umkämpft, wieder und wieder wurde es von jemandem begehrt, und kein Schwert war jemals mächtig genug, um diejenigen aufzuhalten, die einem Mann das Recht streitig machen wollten, auf diesem Land sesshaft zu werden. Kein Krieg war jemals wirklich beendet, jeder Waffenstillstand war letztlich brüchig, selbst wenn er einmal hundert Jahre oder noch länger anhalten sollte.
Thorbrand hatte noch nie ein Zuhause gekannt, das er nicht mit seinem Körper, seinem Schwert, mit der Kraft in seinen Armen und mit dem Willen in seinem Herzen hatte verteidigen müssen. Zu gut wusste er, was ein Mann verlieren konnte, wenn seine Kraft nicht ausreichte, wenn sein Schwert abgewehrt wurde, wenn sein Wille nicht stark genug war. Er erinnerte sich noch deutlich an jenen verdammten Morgen in Dublin, als er gescheitert war.
Bei den Göttern, wie sehr war er doch gescheitert!
Allzu lebhaft erinnerte er sich an den Gesichtsausdruck seiner Mutter, als sie an diesem Tag niedergestreckt wurde, weil er sie nicht so beschützt hatte, wie er es hätte tun sollen. Er wusste noch genau, wie der Feind ihn, den fünfzehn Jahre alten Mann, wie ein Kind zur Seite geschleudert hatte, um dann seine Mutter tötete, während Thorbrand zusah und nichts tat.
Diese Schmach machte ihm noch heute zu schaffen.
Seine Mutter war kühn und mutig, wunderschön und klug. Sie hatte seinem Vater Söhne geschenkt und sich vor kaum etwas gefürchtet. Während andere Frauen um Gnade gebettelt hätten, war seine Mutter auf ihren Angreifer losgegangen, als wollte sie ihm die Augen auskratzen.
Sie hatte für ihr Zuhause gekämpft, dennoch war es ein Raub der Flammen geworden.
Thorbrand hatte niemandem anvertraut, was er an diesem Tag mitangesehen hatte. Und wie er an diesem bitteren Tag versagt hatte, als die irischen Könige Thorbrands Leute aus jenem Ort vertrieben hatten, der für viele von ihnen das einzige Zuhause gewesen war, das sie je gekannt hatten. An jenem Tag, an dem ihnen befohlen worden war, Irland zu verlassen oder zu sterben.
Er hatte sich gesagt, dass er nicht auf der Suche nach einem Zuhause war, wenn man ihm seines abgenommen und in Schutt und Asche gelegt hatte, nachdem seine Mutter ermordet worden war, was er nicht hatte verhindern können. Er hatte sich gesagt, dass er in all den Jahren, die seitdem vergangen waren, unablässig Wiedergutmachung geleistet hatte. Denn nach diesem schrecklichen Tag hatte Thorbrand zu kämpfen gelernt – härter und viel besser, als es ihm als Junge möglich gewesen war. Er hatte gelernt zu kämpfen, zu siegen und immer wieder dem nächsten Feind gegenüberzutreten, um das nachzuholen, was er damals versäumt hatte, als es mehr denn je darauf angekommen wäre.
Lange Zeit hatte er geglaubt, dass er das machen musste, um sich selbst zu bestrafen und um den Göttern seinen Willen zu beweisen, dass er sein Versagen wiedergutmachen wollte. Und dennoch hatte er sich in diesen stets verzweifelten Zeiten gefragt, ob das Leben mehr zu bieten hatte als nur diese düstere, unablässige Abfolge von blutigen Scharmützeln. Mehr als die Schlachtrufe. Mehr als das Klirren von Stahl, wenn Klinge auf Klinge traf.
Manchmal träumte er von einem Zuhause, einem richtigen Zuhause, nicht bloß einem Zelt auf einem Lagerplatz, der dem nächsten Schlachtfeld viel zu nahe war.
Ein Ort, an dem er leben konnte, anstatt kämpfen zu müssen, müde vom Kampf, aber frei.
Doch er wusste, dass solche Gedanken eine große Schande darstellten, denn ein Mann kämpfte, bis die Götter ihn zu sich holten, und träumte bis zu diesem Moment stets von Walhalla. Ein Mann sehnte sich nach der Ehre, die er nur im Kampf finden konnte. An jenem rabenschwarzen Tag vor so langer Zeit hatte Thorbrand geschworen, dass er niemals aufhören würde, so zu kämpfen, wie er es damals gern gekonnt hätte. Niemals!
Er war kein sanftmütiger Mann, der von einem Bauernhof und von den Jahreszeiten träumte, vom Ertrag der Ernte und von den Rufen des Viehs. Thorbrand war an jenem Tag aus der Asche auferstanden, und er war zu einer Waffe geworden.
Es beschämte ihn, dass er in seinem trostlosen Leben mehr wollte als das. Und trotzdem hatte die sächsische Lady gelacht, als würde sie keine Angst kennen. Als fände sie die Gefahr vergnüglich, in der sie schwebte.
Ganz so, wie es seine Mutter an jenem verhassten Tag getan hatte.
„Es freut mich, dass ich Euch zum Lachen bringen kann“, sagte er zu Lady Aelfwynn, nachdem sie verstummt war. Er nahm keine Notiz von dem seltsamen Ziehen in seiner Brust, als sie aufhörte zu lachen. Er würde es einfach seiner Sammlung einverleiben, in der sich schon seine Schande und sein Tadel befanden. Diese Sammlung war sein eigener, persönlicher knarr, der aber nicht aus Waren aller Art bestand, wie es bei den Handelsschiffen üblich war, sondern bis zum Rand beladen mit all den Dingen, die er bereute und bedauerte. „Das wird es uns umso einfacher machen.“
Ihre goldenen Augen erfassten ihn weiterhin. „Dann habt Ihr also nicht vor, mich zu töten. Geht es Euch um ein Lösegeld?“
„Ein Lösegeld?“ Er lachte nicht, aber als er die Mundwinkel hochzog, ging ihr Atem so schnell, dass er die kleinen weißen Wölkchen sehen konnte, die aus ihrem Mund aufstiegen. „Ich fürchte, Ihr überschätzt, was Ihr Eurem Onkel wert seid. Wäre es ihm darum gegangen, Euch zu beschützen, hätte er Euch dann auf diese Weise aufbrechen lassen? In der Begleitung von zwei Feiglingen, die als Eure Beschützer gedacht waren? Mit prall gefüllten Taschen als Gepäck, die jeden Banditen sofort auf Euch aufmerksam werden lassen, während Ihr zu Eurem Schutz nur Eure Gebete habt?“
Zwar begannen ihre Wangen bei seinen Worten rot zu werden, doch Aelfwynn ließ sich auch jetzt nicht von ihm einschüchtern. „Es ist nicht an mir, die Entscheidungen infrage zu stellen, die mein Onkel trifft, denn er ist auch mein König.“
„Dann werde ich ihn an Eurer Stelle fragen, und das sogar mit Vergnügen, denn er ist nicht mein König.“
Sie zuckte nicht mal, während Thorbrand mit Tränen gerechnet hatte, mit einem verängstigten Zusammenkauern. Nicht etwa aus dem Grund, dass sie eine Frau war, denn er war mit Geschichten über Schildmaiden und Walküren aufgewachsen. Seine eigene Mutter hatte ihm beigebracht, was Mut war, und dann hatte sie über jeden Zweifel erhaben ihren Mut zur Schau gestellt. Vielmehr hatten sich seit Juni die Geschichten über die enttäuschende Tochter der Lady von Mercia herumgesprochen.
Diese mercische Königin war eine würdige Gegnerin gewesen. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass sie genau genommen gar keine Königin war, sondern lediglich die adlige Ehefrau eines Ealdorman, auch wenn sie Armeen auf die gleiche Weise wie eine Königin befehligt hatte. Die Tochter – so erzählte man sich voller Verachtung – hatte dagegen nichts weiter getan, als den Kopf hängen zu lassen und sich mit Gebeten zu begnügen, gerade als eine Herrscherin dringend benötigt wurde.
Alles wäre ganz anders verlaufen, wäre sie als Junge zur Welt gekommen. Zum einen wäre Thorbrand nicht auf diese Mission entsandt worden. Man hätte ihn losgeschickt, um zu kämpfen, doch nicht auf diese Art und Weise.
Doch er wusste auch zu gut, dass es verschiedene Wege gab, um einen Krieg zu gewinnen.
„Dann werde ich mein Schicksal also nicht erfahren?“, fragte sie so forsch, als wüsste sie genau, auf welchen Pfaden sich seine Gedanken bewegten.
„Wir alle erfahren unser Schicksal, wenn es uns in die Hand gelegt wird“, entgegnete er. „Keines Eurer Gebete wird daran etwas ändern, Mylady. Alles ist längst entschieden.“
„Und dennoch bin ich mir gewiss, dass die Entscheidung über mein Schicksal in Euren Händen liegt“, erwiderte sie mit dieser Gelassenheit, die ihn um den Verstand zu bringen vermochte.
„Ich werde von Eurem Onkel kein Lösegeld fordern“, machte Thorbrand ihr klar und sah zu, wie der Schnee sich auf dem dunklen Stoff ihres Mantels sammelte und ihn weiß erscheinen ließ. „Euch muss doch klar sein, dass er Euch geradewegs Eurem Tod entgegengeschickt hat.“
„Ich fürchte, ich bin nichts weiter als eine einfache Frau, die in die Angelegenheiten des Königs verstrickt wurde“, erwiderte sie gleich darauf. Doch an der Art, wie sie seinem Blick trotzte, verriet sie ihm, dass sie soeben gelogen hatte. Diese Sachsenprinzessin mochte vieles sein, aber eines war sie ganz sicher nicht: eine einfache Frau. „Es war meine Mutter, die sich in die Politik all dieser kriegführenden Männer eingemischt hatte. Ich bevorzuge die schöneren Künste. Spinnen oder Sticken ist längst nicht so blutrünstig.“
Er verlagerte sein Gewicht ein wenig, seine Hand lag auf dem Hals des Pferdes. Er hätte näher kommen können, wenn er es gewollt hätte. Er hätte sie anfassen können, um ihr zu zeigen, wie dumm es war, ihn zu belügen. Etwas in ihm bäumte sich von einem plötzlich erwachenden Verlangen angetrieben auf, doch er rührte sich nicht von der Stelle, denn ein kluger Mann griff nicht zum Hammer, wenn die Feder genügte.
„Die Welt wird von Blut bestimmt“, sagte er ihr geradeheraus. Vieles davon war sein eigenes Blut und das der anderen, das er vergossen hatte. Blut, das seine Hände besudelt hatte, ob es nun von ihm vergossen worden war oder nicht. „Und Euer Blut macht Euch zu einer kostbaren Beute für jeden, der danach sucht. Denn solange Ihr lebt, muss es Zweifel daran geben, dass Edward tatsächlich die Herrschaft über Mercia hat.“
Diesmal zuckte sie zusammen, rührte sich aber so schnell, dass sie es fast hätte überspielen können. Thorbrand musste feststellen, dass diese Reaktion ihn gar nicht so erfreute, wie er es sich vorgestellt hatte.
Du willst dieser Frau keine Angst machen, meldete sich eine Stimme in seinem Inneren zu Wort, als würden die Götter zu ihm sprechen. Vielmehr willst du sie unter dir haben, von Freude erfüllt und mit strahlender Miene.