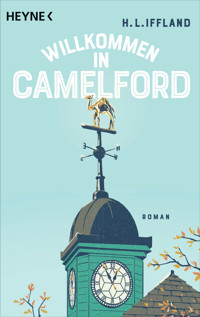
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diesen Ort muss man einfach lieben
Auf den ersten Blick ist Camelford im Hinterland von Cornwall nicht der malerischste Flecken Englands. Kein Wunder also, dass die gesamte Gemeinde Kopf steht, als der bekannte, und immer noch gut aussehende, Soap-Darsteller Cosmas Pleystein ankündigt, seinen neuen Film hier drehen zu wollen. Wird Camelford bald so berühmt sein wie die Drehorte von »Game of Thrones«? Vieles spricht dagegen. Zum Beispiel, dass die Produktionsfirma das raffinierte Drehbuch ohne Wissen des Hauptdarstellers zu einer kitschigen Schnulze umgeschrieben hat. Als Pleystein von dem Verrat erfährt, flieht er Hals über Kopf vom Set. Und plötzlich sucht ganz Camelford einen Hauptdarsteller ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
»Zweifeln Sie an der Existenz von Feen? Oder von Schnecken?«
Er musste lachen. Was war das für eine Frage! »Ich hab als Kind Schnecken aus den Beeten gesammelt und mit meinen Schwestern Schneckenrennen veranstaltet. Und bei uns zu Hause isst man sie auch.«
Die Nase der Alten krümmte sich belustigt. »Sehen Sie, und ich bin gebürtige Londonerin. In meiner Kindheit gab es Schnecken nur in Kinderbüchern. Genau wie Feen.«
Die Autorin
H. L. Iffland wurde 1967 geboren. Nach dem Studium der Politologie, Germanistik und Romanistik war sie u. a. Praktikantin bei einer ivorischen Tageszeitung und Mädchen für alles bei einem reisenden Zeltvarieté. Sie arbeitete für Multimedia-Agenturen, Radiosender und eine Klima-NGO, bevor sie sich im Rheinland niederließ, wo sie heute lebt und arbeitet. »Willkommen in Camelford« ist ihr erster Roman.
H. L. IFFLAND
Willkommen in Camelford
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 10/2023
Copyright © 2023 by H. L. Iffland
Copyright © dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Tamara Rapp
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
Coverillustration: © Yves Haltner
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-29822-7V001
www.heyne.de
In Erinnerung an Sue Gordon, Künstlerin und Frau vieler Talente, Freundin,Vorbild.
I Ich bin hier der Scheiß-Co-Produzent
1
Camelford ist ein unbedeutender Marktflecken im südwestlichen England. Es gibt hier fünf Charity-Shops, drei Pubs und zwei Bestattungsunternehmen, aber keine Bank und keinen Bahnhof mehr. Camelford ist Englands verregnetste Stadt.
Damit wäre schon alles über das Städtchen gesagt, hätte nicht eine boshafte Laune der Natur es so eingerichtet, dass es praktisch nur einen Steinwurf weit von Englands sonnigster Stadt entfernt liegt. Keine zwanzig Meilen trennen das regnerische Camelford von Bude, dem Ort mit den meisten Sonnentagen pro Jahr im ganzen Land. Für diese meteorologische Gemeinheit zeichnet das willkürliche Zusammenspiel geologischer und klimatischer Ereignisse in der frühen Erdgeschichte verantwortlich, die im Laufe der Jahrmillionen Cornwall und Devon mit der englisch-schottischen Landmasse zusammenschoben. Dabei wurde die kornische Nordküste gestaucht, emporgehoben und so lange gebrochen und gefältelt, bis eine Kette geschützter und gerade eben noch vom warmen Golfstrom umspülter Buchten entstand – Budes berühmte Sonnenstrände, die wohlig in Richtung Sonnenuntergang blinzeln –, während auf dem Granit des Hinterlands ein Hochmoor entstand. Bodmin Moor, von der Tektonik auf achthundert Fuß über null gewuchtet, zieht Wolken und Kälte an wie ein Magnet. Und genau dort, am Rand von Bodmin Moor, liegt Camelford. Selbst im Hochsommer, wenn Scharen von Badegästen unter den Palmen von Cornwalls Küsten ihren Sonnenbrand spazieren führen, können sich die Camelforder lediglich der Annehmlichkeit erfreuen, ihre gefütterten gegen leichte Regenmäntel auszutauschen.
In einem trotzigen Anfall von Lokalpatriotismus hat sich das Städtchen neuerdings den leicht überkandidelten Beinamen »Gateway to the Moors« verpasst. Im nationalen Bewusstsein wäre es trotzdem nicht vorhanden, hätte das Schicksal nicht noch einmal böse nachgetreten. Ein letzter boshafter Zufall, diesmal in der jüngsten Vergangenheit angesiedelt, hat nämlich dafür gesorgt, dass Camelford Schauplatz des größten Chemieunfalls in der Geschichte Großbritanniens wurde. Seltsamerweise ist der Aluminiumskandal aus den neunzehnhundertachtziger Jahren im Ort selbst schon fast in Vergessenheit geraten, während das unfaire Wetter ein Skandal bleibt, auf den sich die Camelforder täglich aufmerksam machen, wenn sie einander begegnen.
»Guten Morgen«, rief der Gemüsehändler dem Briefträger zu, der einen Armvoll Telefonrechnungen und Telepizza-Werbung ausgeteilt hatte und nun zurück in den Wagen sprang. Der Briefträger schob sich die regennasse Kapuze aus dem Gesicht, um zu sehen, wer ihn grüßte.
»Ach, hallo, dir auch einen guten Morgen! Wird ein schöner Tag heute.«
»O ja, ziemlich warm. In Bude kriegen die Surfer wohl den ersten Sonnenbrand.«
Es war erst Anfang März, aber am Strand von Bude tummelte sich tatsächlich eine Gruppe junger Surfer. Einige von ihnen würden auf dem Heimweg, wenn sie mit dem Brett unter dem Arm die Stadt durchquerten, sogar die Oberteile ihrer Neoprenanzüge abstreifen, womit sie exakt der Vorstellung entsprächen, die man sich in Camelford von den Budern machte.
Der Händler öffnete den Sonnenschirm, der die Kartoffelkisten auf dem Bürgersteig vor Regen schützen sollte. »Heute Nachmittag soll es auch bei uns ein paar trockene Abschnitte geben.«
»Fantastisch! Schönen Tag noch.«
Der Gemüsehändler winkte dem Postauto hinterher und schob eine schwere Steinplatte auf den Fuß des im Wind schwankenden Sonnenschirms. Die Ladenglocke bimmelte, als er im Geschäft verschwand, um sich erst mal eine schöne Tasse Tee zuzubereiten.
Auf der anderen Straßenseite der Victoria Road fischte Bonnie Pierce die Post aus dem altmodischen Außenbriefkasten des Town Councils, wobei sie versuchte, das eiserne Türchen schnell wieder zu schließen, bevor die Briefe feucht wurden. Bonnie arbeitete seit zehn Jahren für die Gemeindeverwaltung und hatte in dieser Zeit sehr unterschiedliche Aufgaben innegehabt, darunter die eigenhändige Renovierung ihres neuen Büros sowie die Betreuung des Camelford-Businessplans, der hauptsächlich – und vergeblich – darin bestanden hatte, die Schließung der letzten Bank im Ort zu verhindern. Seit es ihr im darauffolgenden Jahr gelungen war, den Supermarkt dazu zu bewegen, an der Außenfront des Ladens einen Geldautomaten anzubringen, galt sie als neue Hoffnung der Geschäftswelt. Außerdem engagierte sie sich bei einer neuen Charity-Organisation, die die Haustiere älterer Mitbürger versorgte, wenn diese einmal krank waren. Senior’s Pet Care war Tier- und Menschenschutz in einem und darüber hinaus eine wirtschaftsfördernde Maßnahme, da neuerdings nicht nur die jungen Leute abwanderten, sondern mehr und mehr Alte dem Ort ebenfalls den Rücken kehrten, um in Städte mit ärztlicher Versorgung und regulärem öffentlichen Nahverkehr zu ziehen. Camelford lief Gefahr, eine sterbende Stadt oder, schlimmer noch, eine Stadt zu werden, in der man noch nicht einmal sterben konnte.
Während Bonnie Pierce die städtische Post aus dem Briefkasten barg, riss der Wind die Wolkendecke über der Victoria Road auf und legte ostereiblaue Flecken von Frühjahrshimmel frei. Die Morgensonne spendierte der Stadt einen breiten, schrägen Lichtstrahl, der ihr frisch renoviertes Wahrzeichen, das goldene Kamel auf dem Uhrenturm, hell aufleuchten ließ. Als es vom Uhrenturm mit dem goldenen Kamel Viertel nach zehn schlug, war Bonnie Pierce in ihrem Büro mit der Durchsicht der sich wellenden Briefe beschäftigt. Ein Umschlag lag schwerer in der Hand als die restlichen, Absender war eine Londoner Filmproduktionsfirma. Diesen Brief aufzuschlitzen, ihn zu lesen und den tätowierten Arm triumphierend in die Luft zu stoßen, war eins: Das war der Vertrag mit Studio Black Tomato, der die geplanten Spielfilmaufnahmen in der Stadt regelte!
Seit Jahren war der Küstenstreifen entlang der Atlantic Highway genannten A30 zwischen Bude und Padstow ein beliebter Schauplatz von Filmen und Serien. Jeden Sommer tummelten sich hier BBC- und ausländische Filmteams, dank derer die Besitzer feuchter Cottages, ausgemusterter Krabbenfischerboote und seit Jahrzehnten unrenovierter Tearooms innerhalb weniger Wochen ein zweites Jahresgehalt verdienten. Jeder Bürgermeister der in den Moors gelegenen Gemeinden hätte für die Adelung seines Städtchens durch Spielfilm-Aufnahmen einen Mord begangen, doch die Kameras liebten die grünen Klippen über dem karibikblauen Meer nun einmal mehr als die baumlose, braune Einöde der Hochmoorlandschaft. Wie der Sonnenschein kam auch der Geldregen der Filmbranche nur bis nach Bude, nie ins Hinterland. Tja, bis jetzt, dachte Bonnie, bis jetzt, und griff zum Telefon, um den Bürgermeister zu informieren. Der Wind hatte sich gedreht, Sonne und Schicksal lächelten gütig auf die Stadt herab.
2
In Berlin stand Cosmas Pleystein, gebürtiger Oberfranke, Wahl-New-Yorker und Wahl-Berliner, in Unterhosen am Fenster und telefonierte. Ja, es war wirklich der Cosmas Pleystein, und wer jetzt seufzt, ist vermutlich über vierzig. Der Schauspieler telefonierte seit einer Stunde mit seinem jungen Kollegen Bo Starck, der sich, im Gegensatz zu ihm, noch keinen Namen gemacht hatte, aber das konnte ja noch werden. In Bos Alter hatte Cosmas noch nicht einmal gewusst, dass er Schauspieler werden würde. Zur Erinnerung: Cosmas Pleystein hatte als Sechzehnjähriger die Schule und als Achtzehnjähriger eine Brauerei-Ausbildung geschmissen, um nach New York abzuhauen, wo er dank seiner juvenilen Schönheit und seiner selbst gebrauten Biere eine gewisse Berühmtheit im Village erlangt hatte, durch die er zum Kleindarsteller in Independent-Filmen aufgestiegen war. Ende der Neunzigerjahre war er nach Deutschland zurückgekehrt und hatte die Hauptrolle in Dreißigtausend Wimpernschläge gespielt, einer ambitionierten Low-Budget-Produktion, die zum Avantgarde-Kultfilm avanciert war. Allerdings – und Pleystein war der Erste, der das zugab – hatte er es aufgrund seiner künstlerischen Ehrgeizlosigkeit anschließend anstatt zum guten bloß zum gut bezahlten Darsteller gebracht. Er war als arroganter Banker, Kommissar, verzweifelter Vater, nachdenklicher Nazi und zuletzt als Hotelier in einer in Cornwall spielenden Miniserie besetzt worden. Vor annähernd zwei Jahren hatte er sich wegen einer, wie es hieß, persönlichen Lebens- und Schaffenskrise aus dem Geschäft zurückgezogen, aber nun stand er kurz vor einem glanzvollen Comeback. Pleystein selbst hätte dieses Wort nicht benutzt, denn der Film, den er sich anschickte zu drehen, stellte keine Rückkehr zum alten Pleystein, sondern eine radikale Neuerfindung dar.
Seine Fans wären übrigens überrascht gewesen, wenn sie ihn hier halb nackt in seiner Dreiraumwohnung im Osten Berlins gesehen hätten. Erstens, weil er ganz schön zugelegt hatte. Und zweitens wegen der Adresse: Pleysteins Platte lag in einer Gegend, die hässlich und rau war und voraussichtlich niemals hip werden würde, denn es gab hier keine ungenutzten, die Fantasie der Kreativen anregenden Brachen, sondern bloß eine solide Betonlandschaft aus Neun- und Elfgeschossern. Hier lebten Menschen, die für die Aura einer Altbauwohnung im Prenzlberg keinen Sinn oder kein Geld hatten. Warum auch Pleystein hier wohnte, glaubten seine Berliner Bekannten zu wissen: aus Distinktion, in Mitte wohnen konnte schließlich jeder! Oder weil ihn die Hochhausblocks an seine Anfänge in New York erinnerten. Doch in Wahrheit lebte Pleystein aus verschiedenen anderen Gründen hier, einer davon war Bequemlichkeit. Er hätte sogar behauptet, dass er hier überhaupt nicht lebte, sondern nur ein provisorisches Lager in der Wohnung seiner jüngeren Schwester aufgeschlagen hatte. Katharina Pleystein hatte wie ihr Bruder eine Zeit lang im Ausland gelebt (im Vereinigten Königreich, nicht in den Vereinigten Staaten) und war nach ihrer Rückkehr – die sich weit weniger glorreich als Cosmas’ Heimkehr gestaltet hatte – in diese Hood gezogen wie in ein fremdes Land. In ihrem Reiseblog berichtete sie davon, wie sie in Sofia’s Bar Schwedeneisbecher aß und Wodka mit vietnamesischen Zigarettenhändlerinnen trank. Pleystein hingegen kannte immer noch keinen Einzigen der – wie vielen … dreihundert, oder mehr, vielleicht eintausend? – Bewohner des Viertels persönlich. (Die tatsächliche Einwohnerzahl, die in etwa der Camelfords entsprach, hätte ihn verblüfft, aber nicht interessiert.) Bei seinem Einzug hatte er ein paar von Katis Bekannten kennengelernt, aber anschließend nie wiedergesehen. Er traf niemals Nachbarn, er fuhr mit dem Fahrstuhl in den siebten Stock und verschanzte sich dort. Früher war er ohnehin oft wochenlang fort gewesen oder nur zum Schlafen hergekommen. Sein Kiez gehörte zu den am dichtest besiedelten Gegenden Berlins, doch in Pleysteins Kopf lag die Wohnung so abgeschieden, so fern von der Welt, dass er sich hier wie ein Eremit fühlte – vor allem, seitdem Kati nicht mehr da war –, und nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit war ihm die Wohnung ein perfekter Kokon gewesen.
Während Pleysteins Telefonat mit dem Nachwuchsstar hatte sich die Sonne von Brandenburg her über die Wohntürme gehievt und eilte nun weiter Richtung Zentrum. Versonnen rieb sich der Schauspieler mit der Hand über den Bauch. Das Gespräch mit Bo Starck war seit Wochen überfällig gewesen, nun kam es ihm zugleich verspätet und zu früh dafür vor. Es war das erste Gespräch, das er in seiner heiklen Doppelfunktion als Kollege und Co-Produzent führte. Es lief erfreulicher als erwartet und dauerte mittlerweile schon doppelt so lang wie geplant. Etwas Ähnliches schien auch Bo Starck zu empfinden, der jetzt, lauter und mit mehr Betonungen als notwendig, ausrief: »Krass, wie ausführlich du mit mir über meine Figur, ich meine, über unsere Figur, gesprochen hast. Hans erinnert mich irgendwie voll an meinen Opa, obwohl, ich glaub, der war im Krieg bloß Flakhelfer, ach egal, trotzdem …«
Die beiden Männer hatten ausführlich über Kan Werin gesprochen, das Filmprojekt, mit dem Cosmas Pleystein sich neu erfinden würde. Die Handlung des Films war teils in den Sechzigerjahren, teils kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs (oder zu Beginn, so genau nahm Pleystein es nicht) in Cornwall angesiedelt. In der Rahmenhandlung befindet sich ein Deutscher namens Hans, gespielt von Pleystein, auf einer Art Pilgerreise durch Cornwall. Hans wandert seit Jahren in Etappen den nördlichen Coastal Pathway ab, weil er auf der Suche nach einem ganz bestimmten Pub ist, der irgendwo an dieser Küste liegen muss. Im Ohr hat er ein ganz bestimmtes Volkslied – keltisch »Kan Werin« –, das er in den Dreißigerjahren dort gehört hat. In Rückblenden wird vom jungen Hans (Bo Starck) erzählt, der während des Zweiten Weltkriegs Teil einer U-Boot-Besatzung ist, die die südenglische Küste nach geeigneten Stellen für eine deutsche Landung ausspioniert. Doch anstatt Strände, Straßen, Brücken und Armeeposten auszukundschaften, folgt der junge Matrose lieber dem verführerischen Duft von Hopfen bis zu einem Pub. Versteckt zwischen Bierfässern, durstig, bibbernd vor Angst, Kälte und Sehnsucht, beobachtet er die Trinker, hört sie lachen und singen. Fasziniert kommt er Nacht für Nacht wieder, um dem Gesang der Engländer zu lauschen. Während er für die Nazis Fantasielandkarten zeichnet, nimmt er sich vor, nach dem Krieg hierher zurückzukehren. Doch es dauert ein halbes Jahrhundert (Hans ist im U-Boot-Krieg versenkt, gerettet und wieder auf See geschickt worden, hat eine Frau geheiratet und sie später beerdigt), bis er es wirklich wieder nach Cornwall schafft und den Pub findet. Eine wahre Geschichte, schlicht und bewegend.
»Gut. Dann sag ich mal: auf Wiedersehen in Cornwall, Bo.« Pleystein spürte die Vibration seiner eigenen, berühmten sonoren Stimme im Telefon. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal freiwillig da drehe …« Er lachte. »Du weißt natürlich, dass das Original-Drehbuch von meiner Schwester Kati ist?«
Pleysteins Schwester Katharina war dem sehnsüchtigen, alten U-Boot-Matrosen in ihrer wilden Englandzeit in den Nullerjahren wirklich begegnet. Seine Geschichte hatte sie nicht losgelassen. Was hatte einen alten Mann dazu bewogen, eine solche Pilgerwanderung auf sich zu nehmen, um am Ende ein Glas Bier mit Blick aufs Meer zu trinken? Jahre später, in Berlin, hatte sie schließlich ein Drehbuch daraus gemacht.
»Mhm, als ich gehört hab, dass du nicht nur mitspielst, sondern dass du und deine Schwester Co-Autoren und -Produzenten seid – Wahnsinn! Vielleicht wird ja so was Crazyes wie die Dreißigtausend Wimpernschläge daraus. Ich jedenfalls bin zu allem bereit und mache …«
Langsam wurde Pleystein hungrig, er brauchte eine Dusche und einen Kaffee und hoffte, Bo würde nicht merken, dass ihm nicht mehr die volle Aufmerksamkeit zuteilwurde.
»… Sprung ins kalte Wasser. Mensch, wenn ich mir vorstelle – ich kenne ja keinen von euch, mal abgesehen von Philipp und so von Orion Film. Aber die haben mir so von dir vorgeschwärmt. Und ich vertrau jetzt einfach mal auf meinen Bauch. Mischen wir zusammen Rosamunde-Pilcher-Land auf! Wir sehen uns im April!«
Pleystein verabschiedete sich ebenso überschwänglich. Dann ließ er das Handy aufs Sofa fallen und tanzte einen kurzen Two-Step in die winzige Küche – Kati und er waren stolz auf die originale DDR-Ausstattung –, um sich einen Espresso zuzubereiten. Der alte Kunststoffboden fühlte sich warm und leicht klebrig unter seinen Fußsohlen an. Er fragte sich, was Bo wohl mit »Wiedersehen im April« gemeint hatte, denn der Dreh startete schließlich erst im Juni. In das Brausen der Düsen hinein musste Pleystein grinsen. Starck war nett, aber eine hohle Nuss. Vermutlich war er selbst mit zwanzig, oder wie alt Bo auch immer war, genauso gewesen. Er kippte den Kaffee im Stehen hinunter, um gleich darauf seinen Agenten anzurufen.
»Cosmas! Wie ist es mit Starck gelaufen?«
»Gut. Perfekt. Danke, dass du das vermittelt hast, Mark. Er ist absolut liebenswürdig, wie du gesagt hast.«
»Philipp meint, er sei Feuer und Flamme, mit dir zusammenzuarbeiten …«
Pleystein rekelte sich geschmeichelt und begann wieder, die Härchen auf seinem Bauch zu kraulen. »Den Eindruck hatte ich auch. Bo erwähnte übrigens einen Termin im April. Steht davon irgendwas in meiner Agenda?«
»Keine Ahnung, soweit ich weiß, werden im April nur die Locations gesichtet. Eine Änderung hab ich nicht reinbekommen.« Mark schwieg, wahrscheinlich sichtete er gerade Pleysteins Termine. Wie nebenbei fragte er: »Fühlst du dich denn fit für die Aufnahmen? Du hast lange keinen so anstrengenden Dreh mehr gehabt … Als wir uns auf der Berlinale getroffen haben, hat es ein bisschen gewirkt … wie soll ich sagen, als ob sich niemand um dich kümmert. Sollen wir dir einen Personal Trainer besorgen?«
»Lieb von dir, Mark, aber danke, nein. Ich geh trainieren, und ich schwimme auch wieder an der Landsberger Allee. Sogar Tanzunterricht nehme ich.«
»Klingt ja super.«
Als sich der Schauspieler im Februar nach zwei Jahren Abstinenz wieder auf ein paar Berlinale-Veranstaltungen gezeigt hatte, war er mit »Lass dich mal angucken, Mensch, erholt siehst du aus, steht dir aber« begrüßt worden. Es hatte musternde Blicke auf seine Figur gegeben: »Ist das für ’ne neue Rolle?« Auch ohne derartige Kommentare über sein Gewicht wäre Pleystein der Rummel nach so langer Auszeit zuwider gewesen, doch sein Agent hatte darauf bestanden. »Ich kann die Ware nur verkaufen, wenn sie auch mal im Regal steht«, hatte Mark behauptet, bevor er ihm ungnädig den Bauch getätschelt hatte. »Übrigens: Fettreduziert ist leider immer noch in.« Vermutlich erstattete Mark Philipp Schmeltzer, dem Produzenten von KanWerin, regelmäßig Bericht über Pleysteins Form, denn die beiden waren befreundet. Es war Mark gewesen, der vor einigen Jahren den Kontakt zu Schmeltzers Firma Orion vermittelt hatte, als Pleysteins Schwester ihr Drehbuch verkaufen wollte. Die Empfehlung hatte Pleystein überrascht, denn er selbst hatte zu dieser Zeit mehrmals Anfragen von Orion abgelehnt. Die Firma, eine der größten der Branche, produzierte überwiegend Fernsehunterhaltung von der Stange, und die angebotenen Rollen hatten genau dem entsprochen, was er nicht mehr spielen wollte. Doch Schmeltzer war eine renommierte Figur in der deutschen Filmlandschaft und machte durchaus auch Filme für das Arthouse-Kino. Und offensichtlich hatte Pleysteins Agent damals sofort erkannt, welches Potenzial in Katis Geschichte steckte.
»Ganz im Vertrauen, Mark, glaubst du, Orion pfuscht mehr in Katis Drehbuch rum als nötig? Was Bo mir vorhin von seiner Rolle erzählt hat, hab ich teilweise gar nicht wiedererkannt.«
»No worries. Bei Philipp gibt’s keinen Pfusch …«, murmelte der Agent abwesend. Offenbar suchte er etwas auf seinem Schreibtisch, seine Stimme kam etwas undeutlich durch den Hörer. »Sag mal, die Drehbuchfassung von Orion hast du aber schon gelesen, oder? Die ging voriges Jahr über meinen Tisch. Ich weiß, das letzte Jahr war für dich nicht ohne, aber inzwischen …«
»Klar«, log Pleystein, der es nicht leiden konnte, wenn sich sein Agent als Oberlehrer aufspielte. »Jedenfalls überflogen. Ich warte noch auf die letzte Überarbeitung …«
»Mhm. Gut. Was anderes«, unterbrach ihn Mark. »Auf meinem Tisch liegt eine Anfrage für eine Tee-Werbekampagne mit dir als Testimonial, die zeitgleich zum Start von Kan Werin …«
»Egal, du, mail’s mir einfach rüber. Kan Werin absorbiert mich im Moment total. Und bitte frag für mich bei Orion nach, ob im April irgendwas ansteht.«
Am anderen Ende der Leitung wurde geseufzt. »Schön. Aber ich erinnere dich daran, dass ich dich nur als Schauspieler vertrete – als Co-Produzent musst du dich schon selbst mit Orion rumschlagen.«
»Mensch, du kennst Philipp doch: Der labert und bezirzt einen, und am Ende hat man vergessen, worüber man eigentlich mit ihm reden wollte.«
Der Chef von Orion war ein Verführer, ein Menschenflüsterer, dem man nicht ohne Vorbereitung gegenübertreten durfte. Doch Cosmas Pleystein fühlte sich heute wie ein Kapitän, der zum ersten Mal seit langer Zeit endlich wieder an Deck seines Schiffes stand und frischen Wind um die Nase spürte. So einen wackeligen ersten Tag an Bord verdarb man sich nicht durch unüberlegte Halsen.
Daher widmete er sich zunächst der ausgiebigen Schönheitspflege, die sein Beruf von ihm verlangte. Duschen, Peeling, Pediküre, föhnen, rasieren, sanfte Gesichtsmassage mit Aftershave. Während er zum Abschluss der Prozedur vorsichtig Creme auf die empfindlichen Partien um seine berühmten, ausdrucksstarken blauen Augen klopfte – nie zerren, das vertiefte die Falten –, sprach er mit seinem Spiegelbild. Energisch, aber cool. Also nicht wie ein Wehrmachtsoffizier, sondern mehr wie … er überlegte, ja, wie Neymar bei der Vertragsverhandlung mit Paris Saint-Germain. Bo Starck hatte einen Fußballer in einer Orion-Serie gespielt. Für eine solche Rolle wäre Pleystein natürlich ein klein wenig zu alt – aber ein Golfer oder ein Ex-Tennis-Profi? Er war groß, athletisch (jedenfalls würde er das bald wieder sein), und sein Haar war immer noch prächtig, drahtig, dunkel, voll. Er wuschelte sich durch die Mähne und warf sich selbst einen letzten liebevollen Blick zu, bevor er das Bad verließ. Er zog Katis Lieblingspulli über, ein schwarz-weiß-rosafarbenes Oversize-Monster von Missoni, und tappte zurück in die Küche, um seine Tasse erneut unter die Kaffeemaschine zu stellen. Es war Katis großer Lieblingsbecher mit dem Surfer, der die Badehose fallen ließ, wenn man etwas Heißes eingoss, allerdings funktionierte er nicht mit kurzen Kaffeeshots. Während der zweite Espresso aus der Maschine gurgelte, schmierte er sich ein Brot. Kauend wanderte er ins Wohnzimmer zurück, suchte mit der freien Hand sein Handy zwischen den Kissen des weißen Ledersofas und wählte die Nummer von Philipp Schmeltzer bei Orion. Er wollte beiläufig klingen, von Mann zu Mann, aber der Produzent ging schon nach dem ersten Klingeln dran, und Pleystein verschluckte sich. Schmeltzer schien es nicht zu bemerken und übernahm das Reden. Dass er sich selbst gern reden hörte, war seine einzige Schwäche. Dafür stammelte er manchmal, wie jemand, der vor Begeisterung um Worte ringt, was ihn wieder sympathisch machte. Ohne Zweifel kultivierte er seinen Tick.
»Cosmas Prince of Cornwall! Perfektes Timing! Ich wollte dich eben auch anrufen. Viel, viel zu tun, wie? Hab gehört, du trainierst dir gerade den Körper eines Sexgottes an? Schade, schade, dass wir uns auf der Berlinale verpasst haben.«
In Pleysteins Erinnerung hatten sie sich nicht wirklich verpasst, vielmehr hatte der Produzent ihn versetzt. Überrumpelt entschied Pleystein, aus Schmeltzers Worten nicht Ironie, sondern ein Kompliment herauszuhören. »Sexgott, genau. Aber so was von«, lachte er, nachdem er endlich sein Brot heruntergewürgt hatte, und erzählte, dass er in Kreuzberg Latin Dance inmitten von megamotivierten Unter-Zwanzigjährigen machte, die keine Ahnung hatten, wer Cosmas Pleystein war. »Die machen Dirty Dancing, und ich bin nur der Kerl, der die Melone getragen hat.«
Schmeltzer freute sich, dass sein Star gut drauf war. Er wollte das Gespräch schon wieder beenden, als Pleystein zum Glück wieder der eigentliche Grund seines Anrufs einfiel.
»Bo Starck sprach von einem Dreh im April. Dazu hab ich gar keine Infos …«
»Mach, mach dir keine Sorgen, Cosi. Wegen einer Überschneidung bei Starcks Bookings mussten für ihn ein paar Drehtage vorverlegt werden. Das übernimmt ein klei-kleines Team, das dabei gleich die Locations sichten wird.«
»Das hättet ihr mir doch sagen müssen.« Den Satz hätte Pleystein am liebsten wiederholt, und zwar weniger quengelig. Mehr wie Neymar, dachte er. »Ich bin immerhin dein Co-Produzent.«
»Natürlich. Aber bei diesem Projekt muss nicht jeder alles machen. Sei einfach nur der Star. Dies ist eine andere Zeit und eine andere L-Liga als deine Dreitausend Wimpern …«
»Dreißigtausend. Bo Starck findet den Film übrigens gut.«
»Ach, Cosmas! Er hat ihn doch gar nicht gesehen. Niemand, den wir kennen, hat ihn gesehen. Noch nicht mal ich hab mir das zu, zu Ende angeguckt, nichts für ungut. Wir m-machen hier richtiges Kino. Für richtige Zuschauer. Und du hast uns deine Story und ’ne Menge Geld anvertraut, weil du weißt, wir wuppen das.«
»Bo sagt auch, dass er keinen Rosamunde-Pilcher-Quatsch drehen will.«
»Wird er auch nicht. Es wird Pleystein-Quatsch, hahaha!«
Der Schauspieler schwieg gekränkt. Schmeltzer, der spürte, dass er einen wunden Punkt erwischt hatte, entschuldigte sich und lobte Cosmas’ Hypernervosität: »Wie ein gutes Rennpferd vor dem Rennen. Jeder überdurchschnittliche Schauspieler besitzt diese gesteigerte Empfindsamkeit. Gewöhn sie dir bitte nie, niemals ab! Jetzt leidest du vielleicht darunter, aber der Film kann davon nur p-profitieren. Okay, was anderes. Super News: Bernd Czmajduk macht die Kamera. Er sagt, deinetwegen. Darauf kannst du dir was einbilden.«
In der Tat! Pleystein hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet Czmajduk ihn in guter Erinnerung behalten hatte, denn Pleystein für seinen Teil hatte ihn als ziemlich ungnädig abgespeichert. Extrem sympathisch nach Drehschluss, aber hinter seiner Kamera ein Korinthenkacker. Anstrengend, fordernd. Unangenehm. Allerdings, nach den Fachsimpeleien am Set zu schließen, galt Czmajduk, der mehr fürs Kino als fürs Fernsehen arbeitete, beinahe schon als Legende. Alle respektierten ihn. Es war ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn Bernd Czmajduk mit ihm Kan Werin machen wollte.
3
Das Restaurant flutete die Kantstraße mit filmreifem Licht, einer Art Infrarotwärme, die durch die Fensterscheiben drang und Pflaster und Asphalt in weitem Umkreis summen ließ. Eine ganze Weile blieb Pleystein in dieser brummenden Aura stehen und scannte durch das Fenster die Gäste (weniger um zu sehen, wen er kannte, als um zu sehen, wer ihn kannte); angeblich kam ja nicht mehr die hochkarätige Prominenz von früher her, doch im Eingang thronte immer noch die strenge Mamsell vor ihrem Reservierungsbuch, und an den farbigen Wänden hingen die alten Bilder in Petersburger Hängung, allerdings, wie er gelesen hatte, nicht mehr die Originale. Trotzdem strahlten Interieur und Gäste noch immer dieses vertraute, inspirierende Je-ne-sais-quoi aus. In Kenntnis des Dekors hatte Cosmas sich für ein schlichtes, aber sehr gut geschnittenes weißes Hemd entschieden. Er wartete ein Weilchen, bis man drinnen auf ihn aufmerksam wurde, bevor er das Restaurant betrat. In gespielter Verlegenheit verwuschelte er sich das etwas zu lange Haar, während er sich höflich zu seiner Clique durchdrängte, die bereits fröhlich in der Mitte des langen Saals lärmte und noch lauter wurde, als er endlich ihren Tisch erreichte. Er begrüßte zwei Maskenbildnerinnen, die am Ende seiner letzten Produktion, der furchtbaren Cornwall-Serie, seine einzigen Freundinnen am Set gewesen waren, einen ehemaligen Kameramann, der inzwischen Werbung machte, sowie ein sehr attraktives Paar, das er nicht mehr ganz einsortieren konnte (mit wem von beiden hatte er mal was gehabt?). Neben dem Paar saß eine Schauspielerin, die ihr Haar in zwei kurzen, geflochtenen Schaukeln trug.
»Ouh, nice«, schrie Cosmas, während sie Wangenküsschen austauschten. »Bist du jetzt DJane im Berghain – oder Kindergärtnerin?«
»Danke, danke, und selbst? Schwanger – oder ist das für eine neue Rolle?«
Alles lachte. Pleystein genoss das Bohei, das sie um ihn veranstalteten, so lange wie möglich. Er hatte gar nicht gemerkt, wie sehr ihm das gefehlt hatte! Schließlich setzte er sich neben Sacha, den Komponisten von Dreißigtausend Wimpernschläge, der ihm sofort erzählte, dass er demnächst als Keyboarder die Auftritte einer angesagten Berliner Zwei-Mann-Combo begleiten würde. »Wow!«, rief man quer über den Tisch, und die Frau, die Sacha gegenübersaß, quengelte mit Kleinmädchenstimme: »Karten haben will!«
»Wir gehen alle hin«, ordnete Pleystein an, »wenn es mein Drehplan zulässt.« Um Platz für den Kellner zu schaffen, der jetzt mehrere Platten Antipasti auf den Tisch stellte, beugte er sich dichter zu dem Komponisten. »Obwohl ich gestehen muss, Sacha, deine Arbeiten klingen für mich seit zehn Jahren wie Klone unseres erfolgreichen Soundtracks von damals.«
»Hallo, schon mal was von persönlichem Stil gehört?«, erwiderte Sacha würdevoll. »Ennio Morricone klingt auch immer gleich! Genau wie du in deinen Rollen übrigens, mein Alter!« Sacha lachte schnell, formte die Hände zum Quadrat und zwinkerte dem Schauspieler durch das angedeutete Kameraobjektiv zu. Nur freundschaftliches Gefrotzel, bitte nicht böse sein!
Alles wurde an diesem Abend als Witz vorgetragen, man sprach ehrlich, aber nie ganz offen miteinander. Die Gespräche waren atemlos, auf Pointen ausgerichtet, als würde eine Gesellschaftskomödie aufgeführt. Wie jeder am Tisch wollte auch Pleystein am liebsten nur über das eigene Projekt sprechen.
»Wir überlegen noch, ob wir in Schwarz-Weiß drehen«, behauptete er.
»Wer produziert deinen Film noch mal?«, wurde er daraufhin gefragt. »Doch nicht Orion – das passt irgendwie gar nicht, die machen doch so Liebesfilme.«
Pleystein gab zu, dass es in Kan Werin inzwischen auch eine Liebeshandlung gab.
»Ah, du drehst ’ne Romantic Comedy, wie schön …«
»Nein, nein, ich sagte doch, ich mache diesmal was Authentisches, ganz Unaufgeregtes. Eigentlich passiert praktisch gar nichts in dem Film. Er wird wirklich sehr schlicht, ganz ohne Geigen.«
Die Liebesgeschichte unterschlug Pleystein gern, weil sie nicht wesentlich war und sich lediglich aus filmerzählerischen Gründen um diese wahre, kleine Story rankte. Kati hatte sie nachträglich ins Drehbuch hineingeschrieben, weil dies Philipp Schmeltzers Bedingung gewesen war.
»Mhm, schön«, nickten Pleysteins Zuhörer. »Noch eine Flasche Pinot Noir!«, riefen sie dann, und zu einer Hereinkommenden: »Gibt’s ja nicht, die Emm!«
Jemand wollte von Pleystein wissen, ob seine britische Co-Produktion Schwierigkeiten wegen des Brexits bekommen würde; darüber hatte er noch nie nachgedacht. Bevor er antworten musste, rief das gut aussehende Pärchen: »Ach ja, du drehst ja wieder in Cornwall, wo denn genau? Wir haben da jetzt ein Feriencottage.« Und schon fachsimpelte die Tischgesellschaft über die englischen Immobilienpreise. Pleystein musste lange warten, bis sich für ihn das nächste Stichwort ergab: Bo Starck. Schnell warf er ein, dass Starck in Kan Werin sein jüngeres Film-Ich spielen würde. Es war die erste Information, von der die anderen wirklich beeindruckt schienen. Nur der Werbefilmer, offenbar ein aufmerksamerer Freund, als Cosmas gedacht hatte, rief: »Du Ärmster, um den alten Bo zu spielen, wirst du ja hundert Jahre in der Maske sitzen müssen!« Alles lachte, als er prompt den Leidenden mimte. Er verriet niemandem, dass er das Sitzen in der Maske sogar sehr genoss. Kein anderer Spiegel hatte ihm je seine eigene, außergewöhnliche Schönheit so deutlich gezeigt wie die Spiegel in der Maske. Im Grunde war die Garderobe, in der man ihn verhätschelte wie einen Prinzen, der einzige Ort, an dem Pleystein sich wirklich wie ein richtiger Schauspieler fühlte. (Sie war, nebenbei gesagt, auch der einzige Ort, an dem er ernsthaft seine Texte lernte.) Außerhalb der Garderobe, am Set, war er nur noch eine Art widerspenstiges Requisit, das von Regie- und Kameraassistenten herumbugsiert wurde. Das Höchste, was ihn erwartete, sobald er seine Garderobe verließ, war, dass sein Spiel auf Anhieb gefiel und man ihn in die nächste Szene scheuchte. Selbst nach zwanzig Jahren im Geschäft war diese Effizienz immer noch eine unangenehme neue Erfahrung, an das Tempo würde er sich nie gewöhnen. Pleysteins frühe New-York-Filme waren romantische Amateur-Projekte gewesen, bei denen jeder Aufnahme lange Plenumsdebatten, viel Trinken, Rauchen und Lachen vorausgegangen waren. Damals in den Staaten und auch noch bei Dreißigtausend Wimpernschläge hatte es ihn manchmal genervt, wenn das ganze Team wie besessen über die Figuren und ihre Motive, über Kameraeinstellungen und Dekor diskutierte. Heute vermisste er es. Daher hatte er sich geschworen, Kan Werin wieder so ernsthaft anzugehen wie die Filme von damals. Es würde Zeit für ausführliche Diskussionen geben, man würde im Schneidersitz im Kreis hocken und Gefühle teilen, vielleicht über den Zweiten Weltkrieg reden, so wie Bo Starck und er es am Telefon getan hatten. Dafür war er Co-Produzent geworden, deshalb hatte er eingewilligt, in Katis Film mitzuspielen. Und natürlich weil es unheimlich guttat, wieder zurück zu sein.
Kan Werin sei sein und Katharinas Baby, beteuerte er der Tischgesellschaft. Das Geld der Geschwister steckte in diesem Projekt, und das hieß, da Kati keines besessen hatte, Cosmas’ Geld – sowie das seiner Familie in Form einer Hypothek auf das Elternhaus in Hof. Mit anderen Worten: Pleysteins Existenz und die seiner Schwestern und ihrer Familien hingen am Erfolg des Films. »Wow«, hauchte seine Kollegin und drehte nachdenklich an ihren Zöpfchen. »Ist das nicht total gruselig, so viel Verantwortung?« Ja, gestand er, das Risiko mache ihm Angst, so sehr, dass er eine Schlafstörung entwickelt habe. Schockiert schwieg die Tischgesellschaft. Dabei hatte Pleystein die Schlafstörung möglichst lapidar eingeworfen, dieses Wort mit seinen zwei Sch-Schs klang ja sowieso fast mütterlich-beruhigend und gab nicht annähernd wieder, worunter er wirklich litt: Schlaflosigkeit. Sirrende, weiße Nächte, in denen er schwitzend und wie gelähmt vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden lang hellwach im Bett lag und einfach nicht in Schlaf fallen wollte. Stattdessen fand er sich den Geräuschen aus elf Stockwerken ausgeliefert, dem Heizungsklopfen, dem Fahrstuhlscheppern, den Toilettenspülungen, Fernsehern, Türsummern, Streits. Dem ewigen Knallen der Haustür, Lärm aus ankommenden und abfahrenden Wagen. Dann wieder der Fahrstuhl, aufwärts, abwärts. Wenn es im Hochhaus ausnahmsweise doch einmal ruhig wurde, war es noch schlimmer, dann setzte sich ihm die Stille auf die Brust. Die Geräuschlosigkeit, die Leere seiner – Katis – Wohnung erzeugte eine Art Unterdruck, die ihm die Luft absaugte. Ersticken schien in diesen Nächten wahrscheinlicher als Einschlafen. Dass Pleystein jedoch gar nicht unter Schlaflosigkeit, sondern lediglich an einer harmlosen Schlafstörung litt – weil er offenbar doch irgendwann wegdämmerte, also schlief, geschlafen hatte –, musste er seinem Zahnarzt glauben, der ihm nächtliches Zähneknirschen attestierte und sich wegen des Abriebs am einst makellosen Schauspielergebiss sorgte.
Die Schlafstörung also hatte Pleystein bisher nur beim Zahnarzt thematisiert, bevor er sie heute Abend in Charlottenburg unvermittelt zwischen Steak-Frites und Crème brûlée auftischte. Auf seine kleine Taktlosigkeit folgte Schweigen, und einen Augenblick lang hörte man nur Tellerklappern und das wichtigtuerische Geschrei der Kellner. Dann: »Ach, Cosi, mit so viel Herz und Leidenschaft muss dein Film ja ein Erfolg werden.« – »Ich bewundere deinen Mut, das eigene Geld da reinzustecken – also, ich könnte das nicht.« Man verglich ihn mit den schlaf- und auch anderweitig gestörten cineastischen Giganten Orson Welles und Francis Ford Coppola. Der unglückselige Coppola hatte sein Privatvermögen in Apocalypse Now gesteckt – und versenkt. »The Horror. The Horror«, stöhnte Pleystein in Imitation von Marlon Brando, man lachte, und die Unterhaltung sprang von Vietnam zu aktuelleren amerikanischen Traumata, bevor er hatte erklären können, dass ihm gar nicht die Angst um die Finanzierung den Schlaf raubte, sondern die Angst vor der Schlaflosigkeit. Er verstand einfach nicht, was sie ausgelöst haben mochte, möglicherweise nur die neue Rolle und die Verantwortung als Co-Produzent, jedenfalls nicht die Sorge um sein Geld oder das seiner Familie. Das finanzielle Risiko schätzte er insgesamt als sehr gering ein – dass Kan Werin ein Erfolg werden würde, war ja klar.
Am Ende des Abends (oder vielmehr: am Ende der Nacht) hatte Pleystein zu wenig gegessen und zu viel getrunken. Und wie alle anderen war er in der Hoffnung, dass sich noch etwas ganz Besonderes, Einmaliges ereignen würde, bis zum Morgengrauen geblieben. Ja, das war eine weiße Nacht nach seinem Geschmack! Es fühlte sich herrlich an, wieder da zu sein.
4
Einmal im Monat tagte der Rat der Stadt Camelford im großen Saal eines generös »Camelford Hall« getauften Mehrzweckbaus. Obwohl die Sitzungen öffentlich waren, erschien üblicherweise höchstens eine Handvoll Interessierter, bei schlechtem Wetter weniger. Heute jedoch waren alle Stühle schon eine Viertelstunde vor Beginn der Ratssitzung besetzt, sodass man aus dem Keller eilig weitere heraufholte. Doch selbst die volle Bestuhlung, die sonst nur für Weihnachtsfeiern und die Auftritte der Camelford Pantomimes benötigt wurde, reichte gegen Ende des zweiten Tagesordnungspunktes (von siebzehn) nicht mehr aus. Immer noch strömten Interessierte herein.
Der Kämmerer verlas soeben den trostlosen Quartalsbericht über Soll und Haben – gemessen an der kläglichen Summe der entrichteten Gewerbesteuern hatten die städtischen Einnahmen des vergangenen Quartals überproportional aus Strafzetteln und Bücherei-Mahngebühren bestanden –, aber Bürgermeister Skuse blickte sich dennoch zufrieden im Saal um. Edward Skuse war ein alter Knabe von gesunder, roter Gesichtsfarbe, dessen Familie in dritter beziehungsweise – seit Eddies Ruhestand – bereits in vierter Generation einen Landhandel führte. In Camelford und den Mooren kannte er jedes Kind und jeden Stein. Im Publikum entdeckte er heute viele, die den Rat noch nicht einmal gewählt hatten, da ihr einziger Wahlgang in letzter Zeit das Brexit-Referendum im vergangenen Jahr gewesen war. (Camelford hatte, wie die gesamte Grafschaft Cornwall, mehrheitlich für »Leave« gestimmt.) Doch Skuse, der alte Fuchs, war nicht im Mindesten erstaunt, all diese Leute hier zu sehen, und nickte jedem Neuankömmling leutselig zu. Zwischendurch tuschelte er vergnügt mit Bonnie Pierce, die neben ihm saß und seine Papiere verwaltete. Beide wussten genau, welche Ratsangelegenheit die Camelforder heute hergelockt hatte. Auf Bonnies Mund-zu-Mund-Propaganda war Verlass, ging sie doch täglich nach Feierabend ins Darlington Inn.
Zu Bonnies Ehrenrettung sei erwähnt, dass sie sich dort hinter die Theke stellte, da ihr Mann Fabio den Pub betrieb. Viele Camelforder hielten das Darlington Inn übrigens für den einzigen verdammten Pub im Ort, in dem man ein bisschen Spaß haben konnte. Zugegeben, er war nicht so gepflegt wie das Queen’s Head, und es wäre auch niemand auf die Idee gekommen, sich ein Gericht von der Karte zu bestellen, die nur pro forma existierte, doch am Wochenende gab es Livemusik, dann wurde getanzt, gesoffen und manchmal auch gerauft; dennoch rief der Wirt nur selten die Polizei. Was nicht daran lag, dass sich die nächste Polizeistation zwanzig Meilen entfernt in Bude befand, sondern weil der größte Raufbold der Stadt sein bester Freund war: Martin Pennoc, stark wie ein Ochse und grimmig wie ein im Winterschlaf gestörter Bär.
Sei dem, wie es sei, der Bürgermeister hatte sicher sein können, dass sich dank den Pierces die frohe Kunde von den Filmaufnahmen im ganzen Ort verbreiten würde, noch bevor im Darlington Inn das erste Fass Ale gewechselt worden war. Und nun freute er sich ungemein, zur Abwechslung einmal vor vollem Haus performen zu können. Demokratie zum Anfassen und Mitmachen, so nannte er das bei sich. Und weil Skuse, der die Politik erst im Ruhestand entdeckt hatte, sich überdies wie ein Missionar der guten Sache verpflichtet fühlte, hatte er, sozusagen aus erzieherischen Gründen, die interessanteste Ratsangelegenheit ganz ans Ende der Tagesordnung gesetzt.
Doch um halb zehn Uhr abends schien es, als würde Skuse eine altkatholische Messe vor heidnischen Barbaren halten. Die anfänglich freundliche Neugier des Publikums auf die exotischen Riten des Stadtparlaments war stumpfer Apathie gewichen. Die Luft in der Camelford Hall war zum Schneiden. Alles döste auf Klappstühlen in einem ausgesprochen ungemütlichen Halbschlaf vor sich hin, als endlich die Stichwörter Stadtmarketing, deutsch-britische Co-Produktion und »Synergien für unser schönes Gateway ins Bodmin Moor« fielen. Erst beim entscheidenden Schlüsselbegriff, Spielfilmaufnahmen, kam endlich wieder Leben in die Schläfer.
Der Bürgermeister fasste die mit Studio Black Tomato getroffenen Vereinbarungen zusammen, und Bonnie Pierce verlas die Namen der Straßen, auf denen gedreht werden würde. Die angekündigten Umleitungen und Totalsperrungen wurden beinahe kommentarlos hingenommen. Dann, als Skuse enthusiastisch ausrief: »Ich brauche euch nicht zu sagen, dass dieser Film Camelfords große Chance ist!«, wurde geklatscht, gepfiffen und gejohlt.
»Wir werden ein Touristenmagnet! Wie die Locations von Game of Thrones …«, riefen die Leute und: »Yeah, so berühmt wie Port Isaac!«
Port Isaac war ein nahe gelegener Küstenort, in dem zahllose Staffeln einer populären Arztserie gedreht worden waren. Seither wohnten viele Einheimische das halbe Jahr über bei Freunden oder auf Campingplätzen, weil sie ihre Häuser und Wohnungen mit Gewinn an Touristen vermieten konnten. Wer sich noch den Luxus leistete, im Sommer zu Hause in Port Isaac zu bleiben, musste damit leben, dass einem neugierige Urlauber durch die Fenster spähten und man im Pub nur noch Fremde traf. Den Camelfordern schien dies ein geringer Preis dafür zu sein, dass auch ihre Stadt endlich eine Koordinate auf der inneren Landkarte britischer Touristen (und einiger Urlauber vom Kontinent) wurde.
Plötzlich brüllte es von der Tür her: »Camelford war doch schon mal berühmt!! Ich spreche von 1988! Als unser Trinkwasser verseucht wurde! Mit giftiger Aluminiumbrühe!«
Ein Riese von einem Mann, schwarzhaarig und bierbäuchig, hatte sich im Türrahmen aufgebaut: Martin Pennoc, Bierbrauer und größter Troublemaker im Ort. Ohne sich einen Deut um seine erhebliche Verspätung zu scheren, schob er sich zu seinem Freund, dem Wirt Fabio Pierce, durch. Als der Brauer noch eine eigene Brauerei besessen hatte, war Pierce sein bester Kunde gewesen; inzwischen arbeitete Martin Pennoc jedoch schon länger als angestellter Brauer in Tintagel, als er je sein eigener Herr gewesen war. In Camelford gab es seit dreißig Jahren keine Brauerei mehr. Seine freie Zeit verbrachte Pennoc entweder bei seiner gebrechlichen Mutter, die am Ende der Hauptstraße bei der Brücke über das Flüsschen Camel lebte, oder am Tresen des Darlington Inn, wo er jede Getränkebestellung abschätzig kommentierte. Eigentlich kommentierte er alles abschätzig.
Jetzt lehnte er sich neben Fabio Pierce an die Wand, die dicken Arme über dem Bauch verschränkt. Zumindest ansatzweise verschränkt, da die prallen Bizepse keine enge Beuge zuließen. Herausfordernd sah er sich im Saal um.
Skuse klopfte auf den Tisch. »Das Schlechtreden meiner Gemeinde verbitte ich mir grundsätzlich. Und das Wort Aluminium ist in den nächsten Wochen tabu! Habt ihr das verstanden? Weil nämlich schon zu Ostern – tadaa! – eine kleine Delegation aus London und Deutschland anreist. Für Probeaufnahmen oder so was in der Art.«
»Hurra! Die filmen unseren Osterumzug!«
»Leider nein«, erwiderte Skuse prompt und mit ostentativer Fröhlichkeit. »In der Tat wäre der Umzug die Gelegenheit für uns, unser schönes Camelford im allerbesten Licht erscheinen zu lassen. Aber. Leider. Kommt das Filmteam nicht Ostersonntag, sondern …« Er blätterte in dem Brief, den Bonnie Pierce ihm hinhielt, so als hätte er den Termin nicht ganz genau im Kopf. »Drei Tage später.« Er legte eine Pause ein, und es kam, wie er gehofft hatte: Der Rat diskutierte kurz und heftig, dann wurde der Osterumzug auf den Mittwoch verschoben. Der Saal klatschte Applaus, nur die bibelfesten Frauen vom Women’s Institute waren empört. Der Bürgermeister konnte fortfahren.
»Bedauerlicherweise haben immer noch nicht alle Hausbesitzer, deren Immobilien als Locations angefragt wurden, ihre Einwilligung gegeben beziehungsweise den Vertrag an Studio Black Tomato zurückgeschickt.«
Diverse Zwischenrufe: »Die können gern bei uns drehen, alte Möbel ham wir auch!«
»Nein, Black Tomato ist an einem bestimmten Haus interessiert, dem oben an der Brücke.« Besorgt schielte Skuse zu Martin Pennoc hinüber, bevor er fortfuhr: »Leider will die Besitzerin, eine alte Dame, nichts davon wissen. Mehr als ärgerlich, denn ihr, äh …«, Skuse las erneut aus dem Brief ab, »Mid-Century Interieur ist für den Film offenbar von höchstem Interesse. Wir können nur hoffen, dass die Dame und ihre Angehörigen es sich noch mal gut überlegen. Ein derart abweisendes Verhalten gegenüber den Filmleuten sollte bei uns nicht Schule machen.«
Bonnie Pierce, die neben dem Bürgermeister saß, drückte die Daumen. Es war das Haus von Martin Pennocs Mutter, um das es ging, aber das Filmprojekt interessierte die Alte kein Stück. Der Ruf von Camelford war ihr piepegal, und das gute Geld, das die Produktionsfirma zahlte, ebenfalls. Deshalb hatten die Pierces ihren Freund Martin gedrängt, zur Ratsversammlung zu kommen, obwohl es immer ein gewisses Risiko war, ihn einzuladen. Jetzt nickte Bonnie dem Brauer aufmunternd zu und gab ihm so lange Zeichen, etwas zu sagen, bis er schließlich schnauzte: »Geht mir nich’ auf die Nüsse mit euerm Film! Wenn Mama nich’ will, will se eben nich’. Ich misch mich da nich’ ein. Und ihr lasst sie gefälligst damit in Ruh’.«
Fassungslos starrte Bonnie zu ihrem Mann hinüber; beide hatten Martin doch extra ausführlich gebrieft.
Der Bürgermeister rieb Daumen und Zeigefinger aneinander. »Es soll euer Schaden nicht sein …«
»Geld brauch’ se nich’. Und ich auch nich’ – wofür? Jeder weiß, mein einziges Hobby is’ Saufen.«
Dass Pennoc seiner garstigen Mutter ein liebevoll ergebener Sohn war und kein Geld brauchte, wäre etwas ganz Neues gewesen – viel wahrscheinlicher war, dass der ewige Griesgram dem Städtchen seine Vorfreude missgönnte. Der Bierbrauer lachte fett und dämlich, während er sich zum Ausgang zurückdrängte. »Und saufen tu ich kostenlos, wie ihr wisst.«
Nachdem Pennocs Auftritt einigermaßen vom Publikum verdaut war, stellte sich endlich die eine wirklich brennende Frage: Wie konnte Camelford den größtmöglichen Nutzen aus den Filmaufnahmen ziehen? Es gab unendlich viele Aspekte zu berücksichtigen, da viele Anwesende gleich drei oder vier verschiedene in den Moors aktive gesellschaftliche Gruppen in Personalunion vertraten. Es gab Pub-Gänger, die fromme Anglikaner waren und ihre Sorgen bezüglich der Qualität der Spielfilmhandlung sowie der Sperrung der Hauptstraße vorbrachten, an der alle drei Kneipen lagen; die Ehrenamtlichen von der Küstenwache wiederum, die erfahren hatten, dass ihr Wachturm an der Klippe ebenfalls zur Filmlocation werden würde, wollten nun, da sie im richtigen Leben Gewerbetreibende oder Handwerker waren, der Produktion ihre vielfältigen Dienste anbieten; selbst Bonnie Pierce stand nicht nur für die Interessen der Kommune, sondern für die von Senior’s Pet Care und, wegen Fabio, auch für die der Gastronomiebranche ein. Doch niemand vereinte so viele Ämter und Interessen in einer Person wie Amanda Hewett. Sie war eine bekannte Camelforder Persönlichkeit: Pensionswirtin, Mitglied eines Hexenkonvents, Vorständin des örtlichen Heimatmuseums und im britischen Tierschutzverein RSPCA engagiert. Außerdem verwandelte sie sich einmal im Jahr, sobald sie im Herbst ihr Bed and Breakfast zusperrte, in eine Theater-Impresaria und führte die Camelford Pantomimes mit fester Hand zur jährlichen Aufführung. Das Repertoire ihrer Laienspielgruppe war beschränkt, jedes zweite Jahr führten sie Jack und die Riesenbohnen auf, in der Duncan, der Metzger, eine Frau spielte und zwei Unglückliche in ein zweiteiliges Pferdekostüm schlüpften. Am Ende wurden reichlich Bonbons in die Menge geworfen, und immer gab es tosenden Applaus. Nur Amanda Hewett schwitzte, ackerte, schimpfte und litt jedes Jahr aufs Neue, denn im Gegensatz zu allen anderen Mitwirkenden nahm sie die Schauspielerei sehr ernst – womit sie streng genommen natürlich gegen die wichtigste Regel der britischen Pantomime-Tradition verstieß. Sie liebte die Schauspielerei wie nichts auf der Welt, und seit ihre Freundin Bonnie Pierce ihr von den geplanten Spielfilmaufnahmen in der Stadt erzählt hatte, konnte sie an überhaupt nichts anderes mehr denken. Bevor Mrs. Hewett dem Rat ihre wohlüberlegten Fragen stellte, erhob sie sich von ihrem Platz in der vordersten Reihe und lächelte und grüßte nach allen Seiten, bis sie sich der Aufmerksamkeit der Camelford Hall sicher sein konnte. Dann ergriff sie im Namen des Tierschutzvereins das Wort: Ob in dem Film Tiere mitspielen würden? Als Nächstes wollte sie als Chefin der Camelford Pantomimes wissen, ob man schon daran gedacht habe, ihre bekannte Truppe als Statisten mitwirken zu lassen, und wie sie Kontakt zum Casting von Studio Black Tomato aufnehmen könne. Da sie außerdem das schönste Bed and Breakfast der Stadt führte, wunderte sie sich schließlich, warum noch keine Buchungsanfrage der Filmleute bei ihr eingegangen war. Und damit hatte Amanda Hewett ins Schwarze getroffen. Der Bürgermeister und die Ratsmitglieder begannen, untereinander zu murmeln. Es war eine verlockende Vorstellung, an die hundert Leute für einen ganzen Monat in der Stadt zu beherbergen – das ergäbe ein stattliches Sümmchen, nicht zuletzt für die Stadtkasse. Von nun an wurde die Diskussion in der Camelford Hall ausschließlich von der Frage nach der Beherbergung der Filmleute beherrscht.
»Die gehen eh nach Bude oder Padstow, für den Meerblick«, vermuteten gleich mehrere Pessimisten. Der Inhaber des Queen’s Head widersprach: »Meerblick, so ein Unsinn, das sind Deutsche, die kommen zum Arbeiten her. Und die sind effizient. Es ist effizient, am Drehort zu wohnen.« »Warum schicken wir nicht eine Liste von lokalen Unterkünften an die Produzenten?!«
Ed Skuse dämpfte die Erwartungen. »Die Delegation von Studio Black Tomato, die zum Osterumzug kommt, wird jedenfalls nicht bei uns wohnen«, sagte er bedächtig. »Sondern in Tintagel.«
Der Saal explodierte vor Zorn. »Wir kriegen die gesperrten Straßen und Tintagel die Stars und die Kohle!«
Der Bürgermeister machte eine Kunstpause, bevor er ins Mikro seufzte: »Das kennen wir doch nicht anders.«
Die Rivalität zwischen den beiden Städtchen war über hundert Jahre alt, und kurz gesagt ging es dabei um den legendären König Artus. Tintagel besaß die Burg, in der der Sagenkönig geboren war, und Camelford das Schlachtfeld, auf dem er sein blutiges Ende gefunden hatte. Trotzdem floss der Strom der Touristen beinahe ausschließlich nach Tintagel, was gleich mehrfach unfair war, weil die Tintageler Burg, die überhaupt bloß eine Ruine war, Jahrhunderte nach Artus erbaut worden war, was sich sogar auf den Schautafeln des Burggeländes nachlesen ließ, während die Authentizität des Schlachtfeldes bei Camelford durch Englands berühmte Mittelalter-Chronik, die Historia Regum Britanniae, belegt war. Außerdem war vor zweihundert Jahren nahe dem Schlachtfeld, im Schlamm des Camels, eine römisch-keltische Grabstele entdeckt worden, deren verwitterte Inschrift nahelegte, dass sie zum Gedenken an den gefallenen König Artus errichtet worden war. Radikale Kreise behaupteten darüber hinaus sogar, dass sich der Name Camelford von Camlann, also Camelot herleite, was beweise, dass hier der Sitz der Tafelrunde gewesen sei. Doch mit einem Anagramm und einer lumpigen Stele im Bach kam man gegen das fotogene Tintageler Ensemble aus tosender See, Felsklippe und Ruine einfach nicht an. Gegenüber der Küste war das Städtchen am Rande des Moors – wie immer – nur zweite Wahl, und so waren die Camelforder auf Tintagel fast so schlecht zu sprechen wie auf Bude.
Immerhin, so stellte man am Ende dieser denkwürdigen Sitzung mit Befriedigung fest, war Camelford bald offiziell Filmstadt. Und Tintagel nicht. War es da nicht an der Zeit, ein größeres Stück vom Kuchen zu verlangen? Ed Skuse versprach also, sich bei Studio Black Tomato dafür einzusetzen, dass Crew und Stars in seiner Stadt untergebracht werden würden, und hob die Sitzung auf. Bonnie Pierce ließ eine improvisierte Liste herumgehen, in die sich alle, die in Camelford und Umgebung Zimmer vermieteten, eintragen durften. Ganz oben stand schon das Darlington Inn mit seinen sechs Betten. Der halbe Saal drängte nach vorn. Während Bonnie das Klemmbrett weiterreichte, unterhielt sie die Wartenden.
»Ich verrat euch mal was, topsecret«, krähte sie wenig geheimnistuerisch. »In dem Film wird Valeria McBride mitspielen, Valeria McBride, kennt ihr doch!«
Jemand stöhnte vor Begeisterung. »Die Süße aus der Serie Hollyoaks! Die was mit Prinz Harry hat.«...Ende der Leseprobe





























