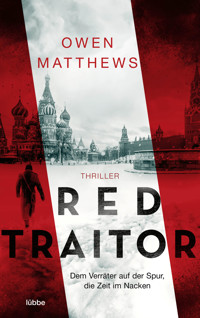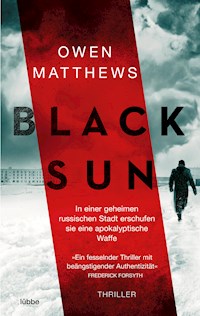8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Owen Matthews, Sohn einer Russin und eines Engländers, erzählt seine eigene Familiengeschichte und ein mitreißendes Stück Zeitgeschichte. Er schildert das Drama Russlands von innen heraus. Ein Bestseller, der in 28 Ländern erschien. An einem Mittsommertag im Jahr 1937 küsste Boris Bibikow seine beiden Töchter zum Abschied und verschwand für immer. Eine der beiden, Mila, verliebte sich viele Jahre später, mitten im Moskau des Kalten Krieges, in einen jungen Engländer und beginnt mit ihm eine gefährliche, leidenschaftliche Affäre. Jahrzehnte später trägt ihr Sohn Owen Matthews die Puzzleteile dieser dramatischen Geschichte zusammen: Er möchte wissen, wie sein Großvater den grausamen Säuberungen Stalins zum Opfer fiel. Wie seine Mutter ihre Kindheit in Waisenhäusern überlebte. Und wie Willkür, bittere Armut und ideologischer Fanatismus jahrzehntelang einen ganzen Kontinent beherrschen konnten. Und schließlich: wie die leidenschaftliche, ungewöhnliche Liebesgeschichte seiner Eltern mitten im Moskau des Kalten Krieges ihr glückliches Ende fand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über das Buch
An einem Mittsommertag im Jahr 1937 küsste Boris Bibikow seine beiden Töchter zum Abschied und verschwand für immer. Eine der beiden, Mila, verliebte sich viele Jahre später, mitten im Moskau des Kalten Krieges, in einen jungen Engländer und beginnt mit ihm eine gefährliche, leidenschaftliche Affäre.
Jahrzehnte später trägt ihr Sohn Owen Matthews die Puzzleteile dieser dramatischen Geschichte zusammen: Er möchte wissen, wie sein Großvater den grausamen Säuberungen Stalins zum Opfer fi el. Wie seine Mutter ihre Kindheit in Waisenhäusern überlebte. Und wie Willkür, bittere Armut und ideologischer Fanatismus jahrzehntelang einen ganzen Kontinent beherrschen konnten. Und schließlich: Wie die außergewöhnliche Liebesgeschichte seiner Eltern mitten im Moskau des Kalten Krieges ihr glückliches Ende fand.
Über den Autor
Owen Matthews, geboren 1971 in London, studierte Neuere Geschichte in Oxford und begann seine Karriere als Journalist in Bosnien. 1995 ging er als Redakteur nach Moskau und schrieb von dort als freier Korrespondent für The Times, The Spectator und The Independent. Seit 1997 Korrespondent für Newsweek. Er lebt heute mit seiner russischen Frau und zwei Kindern in Istanbul.
Ausgewählte Pressestimmen zu Winterkinder
»Ein tief berührendes und mitreißendes Stück Zeitgeschichte, glänzend über vier Generationen erzählt … eine erstaunliche Familiengeschichte voll Liebe, Tod und Verrat.«Simon Sebag Montefiore
»Eine der faszinierendsten Familiengeschichten der jüngsten Zeit. Nur wenigen gelingt es, so wie Owen Matthews über die bewegte Liebe seiner Eltern und über das grausige Schicksal seiner Großeltern mit dieser Mischung aus tiefer Zuneigung und kritischer und zugleich unaufdringlicher Objektivität zu schreiben.«Library Review
»An den berührendsten Passagen wird dieses Buch zum Liebesbrief eines Kindes an seine Mutter – wunderschön geschrieben und äußerst bewegend …«Daily Telegraph
»Eine mitreißende Familiengeschichte … Dieses faszinierende Buch ist keine Fußnote zur sowjetischen Geschichte: Es ist sowjetische Geschichte …«Observer
»Eine unglaubliche Geschichte … Viele Passagen sind von fast unerträglicher Eindringlichkeit.«The Independent
»Ein russisches Wilde Schwäne.«Sunday Times
»Eindrucksvoll … Owen Matthews schreibt nicht nur äußerst lebendig … seine Technik ist eher die eines Romanciers als die eines Journalisten – eines meisterhaften noch dazu. Winterkinder sollte in seiner Übersetzung in den Kanon der russischen Literatur aufgenommen werden.«Spectator
OWEN MATTHEWS
WINTERKINDER
DREI GENERATIONEN LIEBE UND KRIEG
Aus dem Englischen von Vanadis Buhr
Mit 34 Fotos
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Stalin’s Children. Three Generations of Love and War« bei Bloomsbury in London.
ISBN 978-3-8437-0688-9
© 2008 by Owen Matthews
© der deutschsprachigen Ausgabe:
2014 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.de
Abbildungen: © Plainpicture und Getty Images (Illustration)
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Für meine Eltern
Prolog
Die Hand die unterschrieb hat eine Stadt ruiniert … Hat die Toten des Erdballs verdoppelt, ein Land halbiert.
Dylan Thomas
Auf einem Regal in einem Keller der einstigen KGB-Zentrale in Tschernigow, im Herzen der Ukraine, liegt eine dicke Akte mit einem zerfledderten Deckel aus brauner Pappe. Sie umfasst etwa eineinhalb Kilo Papier, alle Seiten sorgfältig nummeriert und gebunden. Es geht darin um den Vater meiner Mutter, Boris Lwowitsch Bibikow, dessen Name in eigentümlich kunstvoll gestochener Schrift auf dem Deckel eingetragen ist. Direkt unter dem Namen steht mit Schreibmaschine geschrieben: »Streng geheim. Volkskommissariat für innere Angelegenheiten. Sowjetfeindliche rechte trotzkistische Organisation in der Ukraine.«
Die Akte dokumentiert, wie mein Großvater im Spätsommer 1937 in den Händen von Stalins Geheimpolizei zu Tode kam. Ich fand sie 58 Jahre nach seinem Tod in einem schäbigen Büro in Kiew. Die Akte lag schwer auf meinem Schoß, auf unheimliche Weise bösartig, ein geschwollener Tumor aus Papier. Sie roch nach säuerlichem Moschus.
Den größten Teil der Akte machen dünne Formulardurchschläge aus, an vielen Stellen von der Schreibmaschine durchstanzt. Dazwischen immer wieder Zettel aus dickerem Papier. Gegen Ende finden sich einige Blätter weißes Schreibpapier, bedeckt mit einer dünnen Handschrift und zahlreichen Tintenklecksen – das Bekenntnis meines Großvaters, ein Volksfeind zu sein. Das 78. Dokument ist eine Bestätigung, dass er das Todesurteil gelesen und verstanden hat, das ein Gericht in Kiew unter Ausschluss der Öffentlichkeit über ihn verhängte. Die daruntergekritzelte Unterschrift ist seine letzte dokumentierte Handlung auf Erden. Ganz am Ende der Akte ist ein schlechter Durchschlag abgeheftet, der die Vollstreckung des Urteils am folgenden Tag, dem 14. Oktober 1937, bestätigt. Der Vollstrecker hat mit einem nachlässigen Kringel unterzeichnet. Da die sorgfältigen Bürokraten, die die Akte zusammentrugen, vergaßen zu dokumentieren, wo er begraben wurde, umfasst dieser Stapel Papier gleichsam die sterblichen Überreste von Boris Bibikow.
Auf dem Dachboden der Alderney Street Nr. 7 in Pimlico, London, steht ein schmucker Überseekoffer, auf den in ordentlichen schwarzen Buchstaben »W. H. M. Matthews, St Antony’s College, Oxford, АНГЛИЯ« gemalt ist. Darin befindet sich eine Liebesgeschichte. Oder vielleicht eine Liebe.
Der Koffer enthält Hunderte Liebesbriefe meiner Eltern, sorgfältig nach Datum sortiert, aus der Zeit von Juli 1964 und bis Oktober 1969. Viele sind auf dünnem Luftpostpapier geschrieben, andere auf sauberem weißem Schreibpapier. Die Hälfte der Seiten – die Briefe meiner Mutter, Ljudmila Bibikowa, an meinen Vater – sind mit einer geschwungenen, geneigten und doch sehr femininen Handschrift bedeckt. Die meisten Briefe meines Vaters an meine Mutter sind maschinengeschrieben, weil er gern von jedem Brief einen Durchschlag behielt. Doch am Ende hat er immer von Hand eine kleine Notiz über seiner extravaganten Unterschrift eingefügt oder manchmal eine charmante kleine Zeichnung. Die wenigen Briefe, die er mit der Hand geschrieben hat, sind in schmaler, gerader und sehr korrekter kyrillischer Schrift gehalten.
In den sechs Jahren, die meine Eltern durch die Geschicke des Kalten Krieges getrennt waren, schrieben sie sich jeden Tag, manchmal sogar zweimal täglich. Seine Briefe sind aus Nottingham, Oxford, London, Köln, Berlin, Prag, Paris, Marrakesch, Istanbul, New York. Ihre sind aus Moskau, Leningrad, der Familiendatscha in Wnukowo. Die Briefe schildern jedes Detail, jeden Gedanken im Alltag meiner Eltern. Er sitzt an einem nebligen Abend in einem einsamen möblierten Zimmer in Nottingham und schreibt über Curry zum Abendessen und unbedeutende akademische Streitereien. Sie verzehrt sich nach ihm in ihrem winzigen Zimmer am Arbat in Moskau und schreibt über Gespräche mit Freunden, Ballettaufführungen, Bücher, die sie liest.
Manchmal ist ihr briefliches Gespräch so intim, dass ich mir bei der Lektüre ihrer Korrespondenz wie ein Voyeur vorkomme. Manchmal ist ihr Schmerz über die Trennung so intensiv, dass das Papier zu erzittern scheint. Sie rufen sich winzige Begebenheiten ins Gedächtnis aus der kurzen Zeit im Winter und Frühjahr 1964, die sie gemeinsam in Moskau verbrachten. Sie plaudern über gemeinsame Freunde und Essen und Filme. Aber vor allem sind die Briefe erfüllt von Verlust, Einsamkeit und einer Liebe so groß, dass sie, wie meine Mutter schrieb, »Berge versetzen und die Welt aus den Angeln heben kann«. Und obwohl die Briefe so schmerzlich sind, glaube ich, dass sie zugleich auch die glücklichste Zeit im Leben meiner Eltern schildern.
Jetzt, wo ich sie durchblättere, auf dem Fußboden des Dachbodens, der mein Kinderzimmer war und in dem ich 18 Jahre lang unmittelbar neben dem verschlossenen Koffer schlief oder den Stimmen meiner Eltern lauschte, die von unten heraufschwebten, wird mir plötzlich klar, dass diese Korrespondenz ihre ganze Liebe enthält. »Jeder Brief ist ein Stückchen unserer Seele. Sie dürfen nicht verloren gehen«, schrieb meine Mutter in den ersten qualvollen Monaten nach der Trennung. »Deine Briefe bringen mir kleine Stücke von dir, von deinem Leben, deinem Atem, deinem pochenden Herzen.«
Beide schütteten hier jeweils ihre Seelen aus, sie befanden sich in diesem Stapel Papier, der Blatt für Blatt sechs Jahre lang fast ununterbrochen auf Postzügen quer durch Europa ratterte. »Während unsere Briefe unterwegs sind, bekommen sie etwas Magisches … das macht sie so besonders«, schrieb Mila. »Jede Zeile ist mit dem Blut meines Herzens geschrieben.« Doch als sich meine Eltern wiedersahen, mussten sie feststellen, dass kaum noch genug Liebe übrig war. Sie war zu Tinte geworden und auf Tausende Seiten Papier geflossen, die nun sorgfältig zusammengefaltet in einem Koffer auf dem Dachboden eines Reihenhauses in London liegen.
Wir glauben, dass wir mit unserem rationalen Verstand denken, aber in Wirklichkeit denken wir mit unserem Blut. Dieses Blut war in Moskau überall um mich herum. Ich habe als junger Erwachsener viel Zeit in Russland verbracht, und in jenen Jahren stolperte ich immer wieder über den Ursprung jener Erfahrungen, die für meine Eltern wesentlich waren. Viele der Details und Sinneseindrücke dieser Stadt nahm ich genauso wahr, wie meine Eltern es seinerzeit taten, auch wenn mir die Stadt so voll vom Hier und Jetzt schien. Der Geruch nach nasser Wolle in der Metro im Winter. Verregnete Nächte in den Seitenstraßen des Arbat, über denen der schaurige Koloss des Außenministeriums wie ein Schiff im Nebel glüht. Die Lichter einer sibirischen Stadt wie eine Insel in einem Meer aus Wäldern, gesehen aus dem Fenster eines winzigen wackeligen Flugzeugs. Der Geruch des Meeres im Hafen von Tallinn. Und gegen Ende meiner Zeit in Moskau die plötzliche glasklare Erkenntnis, dass ich mein Leben lang genau die Frau geliebt hatte, die neben mir am Tisch saß, mitten unter Freunden im warmen Dunst der Zigaretten und Gespräche in einer Küche in der Nähe des Arbat.
Und doch war das Russland, in dem ich lebte, ganz anders als das Russland, das meine Eltern gekannt hatten. Ihr Russland war eine streng kontrollierte Gesellschaft, in der unorthodoxe Gedanken ein Verbrechen waren, in der alle wussten, was ihre Nachbarn taten, und das Kollektiv jedes Mitglied, das es wagte, sich über die Regeln hinwegzusetzen, massivem moralischem Terror aussetzte. Mein Russland war eine haltlose Gesellschaft. In den 70 Jahren unter sowjetischer Führung hatten die Russen viel von ihrer Kultur, ihrer Religion, ihrem Gott verloren; und viele von ihnen auch den Verstand. Aber immerhin hatte der sowjetische Staat das ideologische Vakuum mit seinen eigenen kruden Mythen und strikten Regeln gefüllt. Er hatte die Menschen ernährt, gelehrt und eingekleidet, ihr Leben von der Wiege bis ins Grab durchgeplant und, wichtiger als alles andere, für sie gedacht. Kommunisten – Männer wie mein Großvater – hatten versucht, einen neuen Menschen zu erschaffen, hatten den Menschen ihre alten Überzeugungen genommen und sie mit bürgerlichem Pflichtgefühl, Patriotismus und Fügsamkeit erfüllt. Doch als die kommunistische Ideologie wegbrach, verschwand auch ihre seltsame Fünfzigerjahremoral im schwarzen Loch abgehalfterter Mythologien. Die Menschen glaubten nun an Wunderheiler im Fernsehen, japanische Weltuntergangskulte und sogar wieder an den eifersüchtigen alten Gott der Orthodoxie. Doch tiefer als all diese neuen Glaubensrichtungen reichte Russlands absoluter, bodenloser Nihilismus. Plötzlich gab es gar keine Regeln mehr, jedes Mittel war erlaubt, und alles war möglich für die, die kühn und skrupellos genug waren, zu raffen, so viel sie konnten.
Es gab jede Menge Asche, aber nur wenige Phönixe. Vor allem der narod, das Volk, zog sich auf sich selbst zurück, machte weiter wie immer und ignorierte die Erdstöße, die seine Welt erschüttert hatten. Arbeit, Schule, Auto, Datscha, Schrebergarten, Fernsehen, Wurst und Kartoffeln zum Abendessen. Russland nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erinnerte mich oft an einen Käfig voller Laborratten in einem aufgegebenen Experiment, die immer noch vergebens an den Zuckerwasserspendern nuckeln, lange nachdem die Wissenschaftler das Licht gelöscht haben und ausgewandert sind.
Ein Teil der russischen Intelligenzija nannte es rewoluzija w sosnanii, die »Revolution des Bewusstseins«. Doch das beschrieb es nicht einmal ansatzweise. Es war keine richtige Revolution, weil nur eine kleine Minderheit sich entschied oder die Vorstellungskraft hatte, die Gunst der Stunde zu nutzen, um sich neu zu erfinden und an die schöne neue Welt anzupassen. Für die Übrigen war diese Revolution mehr wie eine leise Implosion, ein kollabierender Bovist, ein plötzliches Ineinanderschieben der Möglichkeiten im Leben, keine Revolution, sondern ein langsames Absacken in Armut und Verwirrung.
Die meiste Zeit in Russland glaubte ich mich in einer Geschichte ohne Handlungsstrang, einer ständig wechselnden Diaschau der Phantasmagorien, die Moskau zu meiner persönlichen Erbauung auf mein Leben projizierte. Tatsächlich aber war ich gefangen im Gespinst familiärer Vorgeschichte, das sich immer enger um mich legte.
Ich ging nach Moskau, weil ich meinen Eltern entkommen wollte. Aber genau dort fand ich sie wieder, auch wenn ich das lange Zeit nicht wusste oder nicht sehen wollte. Dies ist eine Geschichte über Russland und über meine Familie, über einen Ort, der uns geschaffen und befreit und inspiriert und beinahe gebrochen hat. Und letztlich ist es eine Geschichte über die Flucht, darüber, wie wir aus Russland geflohen sind, auch wenn wir alle – selbst mein Vater, ein Waliser, selbst ich, der ich in England aufwuchs, immer noch etwas Russisches in uns tragen, das unser Blut wie ein Fieber infiziert.
1
Der letzte Tag
Ich glaube nur an eines: die Macht des menschlichen Willens.
Josef Stalin
Ich sprach Russisch, bevor ich Englisch sprach. Bevor ich in Mütze, Blazer und kurzen Hosen auf eine englische Prep School geschickt wurde, sah ich die Welt auf Russisch. Wenn Sprachen eine Farbe haben, dann ist Russisch das grelle Rosa der Siebzigerjahrekleider meiner Mutter, das warme Rot der alten usbekischen Teekanne, die sie aus Moskau mitgebracht hatte, das kitschige Schwarz-Gold des handbemalten russischen Holzlöffels, der in der Küche an der Wand hing. Englisch, die Sprache, die ich mit meinem Vater sprach, war das gedeckte Grün des Teppichs in seinem Arbeitszimmer, das verblichene Braun seiner Tweedjacken. Russisch war eine vertrauliche Sprache, ein privater Code, den ich mit meiner Mutter benutzte, warm und sinnlich und rau, die Sprache von Küche und Schlafzimmer. Sie roch nach warmem Bett und dampfendem Kartoffelbrei. Englisch war die Sprache der Förmlichkeit, des Erwachsenseins, des Lernens, die Sprache von »Janet and John« auf dem Schoß meines Vaters, und sie roch nach Gauloises und Kaffee und dem Motorenöl seiner Dampfmaschinensammlung.
Meine Mutter las mir Puschkins Geschichten vor, zum Beispiel das fantastische Versepos Ruslan und Ljudmila. Die übernatürliche Welt der dunklen russischen Wälder, das lauernde Böse und strahlende Helden, heraufbeschworen an Winterabenden in einem kleinen Londoner Wohnzimmer und untermalt vom fernen Quietschen der in die Victoria Station einfahrenden Züge, war mir in meiner Kindheit unendlich lebendiger als alles, was mein Vater heraufbeschwören konnte. »Dort ist der russische Geist. Dort riecht es nach Russland«, schrieb Puschkin über ein geheimnisvolles Land am Meer, wo eine große grüne Eiche stand; um die Eiche war eine goldene Kette geschlungen, an der Kette lief eine schwarze Katze auf und ab, und im Gewirr der Äste schwamm eine Meerjungfrau.
Am Ende des brütend heißen Sommers 1976 besuchte uns meine Großmutter Marta in London. Ich war damals viereinhalb Jahre alt, und der Rasen im Eccleston Square Garden war nach der Hitzewelle gelb und verbrannt. Glühend heiße Gehwege, der Geschmack von Erdbeereis, meine Lieblingslatzhose aus beigefarbenem Cord mit einer großen gelben Blume auf dem Bein. Ich erinnere mich an die Korpulenz meiner Großmutter, ihren modrigen russischen Geruch, ihr weiches, rundes Gesicht. Auf den Fotos sieht sie immer aus, als sei ihr unwohl. Groß und ärgerlich und männlich hält sie mich wie einen zappelnden Sack, und meine Mutter lächelt nervös. Sie machte mir Angst, wenn sie unvermittelt losschimpfte, mit ihrer Unberechenbarkeit, ihrer spürbaren Anspannung. Sie saß oft stundenlang da, allein und still in einem Sessel am Wohnzimmerfenster. Manchmal schob sie mich weg, wenn ich auf ihren Schoß klettern wollte.
Eines Nachmittags waren wir auf dem Eccleston Square. Meine Mutter plauderte mit anderen Müttern, meine Großmutter saß auf einer Bank. Ich spielte Räuber und Gendarm mit mir selbst, ausgerüstet mit einem Polizeihelm aus Plastik und einer Cowboypistole, und rannte im Park herum. Ich schlich mich von hinten an meine Großmutter heran, sprang dann hinter der Bank hervor und versuchte, ihr Handschellen anzulegen. Sie saß reglos da, während ich mit dem Verschluss der Handschellen kämpfte, und als ich aufblickte, weinte sie. Ich holte meine Mutter, und dann saßen sie lange Zeit beisammen. Ich versteckte mich in den Büschen. Dann gingen wir nach Hause, und meine Großmutter weinte immer noch still.
»Sei nicht traurig«, sagte meine Mutter. »Oma weint, weil die Handschellen sie an die Zeit erinnern, als sie im Gefängnis war. Aber das ist lange her, und jetzt ist alles gut.«
Die meiste Zeit ihres Lebens lebte meine Mutter für eine imaginäre Zukunft. Ihre Eltern kamen ins Gefängnis, als sie drei war. Von da an übernahm der sowjetische Staat ihre Erziehung und formte ihren Verstand – nicht aber ihren Geist – nach seinen Vorstellungen. Ein strahlender Morgen warte hinter dem Horizont, erzählte man ihrer Generation, aber damit er kommen könne, müsse wie bei den Azteken Blut vergossen werden, und der Einzelne müsse sich der großen Sache opfern. »Einfache sowjetische Menschen sind überall und vollbringen Wunder« ist ein Satz aus einem beliebten Lied der Dreißigerjahre, den meine Mutter oft zitiert, immer voller Ironie, wenn sie sich bürokratischer Dummheit oder Grobheit ausgesetzt sieht. Doch in einem tieferen Sinne prägte die Vorstellung, der Einzelne könne jedes noch so große Hindernis überwinden, ihr Leben.
Ihr Vater Boris Bibikow glaubte das auch. Er inspirierte – und terrorisierte – Tausende Männer und Frauen so, dass sie eine gewaltige Fabrik buchstäblich aus dem Schlamm errichteten, auf dem sie stand. Meine Mutter ihrerseits vollbrachte ein kaum weniger bemerkenswertes Wunder. Gewappnet mit nichts als ihrer unerschütterlichen Überzeugung trat sie gegen das Ungeheuer des sowjetischen Staates an und gewann.
Ich sehe meine Mutter nie als kleine Frau, obwohl sie winzig ist, gerade mal 1,50 Meter groß. Aber sie hat einen gigantischen Charakter; die kinetische Energie ihrer Gegenwart füllt ganze Häuser. Ich habe sie oft weinen sehen, aber nie ratlos. Selbst in ihren schwächsten Momenten zweifelt sie nie an sich selbst. Sie hat keine Zeit für Nabelschauen, für das maßlose Leben, das meine Generation führt, obwohl sie bei all ihrer eisernen Selbstdisziplin auch bereit ist, bei anderen großzügig über Fehler hinwegzusehen. Schon in meiner frühesten Kindheit beharrte meine Mutter darauf, man müsse um alles im Leben kämpfen, und jedes Scheitern sei vor allem ein Scheitern des Willens. Ihr Leben lang stellte sie kompromisslose Forderungen an sich selbst und genügte ihnen auch immer. »Wir müssen uns ihres Glaubens an uns würdig erweisen, wir müssen kämpfen«, schrieb sie an meinen Vater. »Wir dürfen es uns nicht erlauben, schwach zu sein … Das Leben kann uns schon im nächsten Moment niederschmettern, und niemand wird uns schreien hören.«
Sie ist auch unglaublich schlagfertig und intelligent, doch diese Seite erlebe ich an ihr nur, wenn sie in Gesellschaft ist. Beim Abendessen mit Gästen ist ihre Stimme klar und einfühlsam, und sie formuliert ihre Ansichten mit altmodischer Bestimmtheit in rollendem Englisch.
»Alles ist relativ«, sagt sie beispielsweise schelmisch. »Ein Haar in einem Teller Suppe ist zu viel, ein Haar auf dem Kopf ist nicht genug.« Oder sie erklärt: »Das Russische hat so viele reflexive Verben, weil die Russen pathologisch unverantwortlich sind! Im Englischen sagt man ›ich will‹, ›ich brauche‹. Im Russischen heißt es ›der Wille ist aufgekommen‹, ›der Bedarf ist entstanden‹. Die Grammatik ist der Spiegel der Psychologie! Der Psychologie einer infantilen Gesellschaft!«
Wenn sie spricht, springt sie mühelos von Nurejew zu Dostojewski, zu Karamsin und Blok. Ihr abschätziges Schnauben und ihre wegwerfenden Gesten werden begleitet von bewunderndem Luftholen und verzückt an die Brust gedrückten Händen, wenn sie ein neues Thema ansteuert wie ein Rennfahrer, der um die nächste Kurve rast. »Ha, Nabokov!«, sagt sie mit geschürzten Lippen und hebt eine Augenbraue, damit alle Anwesenden wissen, dass sie ihn für einen unverbesserlichen Aufschneider und eine kalte, herzlose und gekünstelte Person hält. »Ach, Charms«, sagt sie und hebt eine Handfläche zum Himmel, um zu zeigen: Das ist ein Mann, der Russlands Absurdität, Pathos und tägliche Tragödie wirklich versteht. Wie viele russische Intellektuelle ihrer Generation ist sie in der Kasba der Literatur ihres Landes ganz und gar zu Hause und findet ihren Weg durch die Gassen wie eine Einheimische. Ich habe meine Mutter immer bewundert, doch in solchen Momenten, wenn sie eine ganze Tischgesellschaft in Atem hält, erfüllt mich unbändiger Stolz auf sie.
Milan Kundera schrieb einmal: »Der Kampf des Menschen gegen die Macht ist der Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen.« Und so ist es auch für meine Mutter, wenn sie diese Geschichte erzählt. Sie hat selten mit mir über ihre Kindheit gesprochen, als ich selbst noch ein Kind war. Doch als ich sie als Erwachsener danach fragte, begann sie freimütig zu erzählen, ohne dabei melodramatisch zu werden, mit verblüffender Sachlichkeit und Aufrichtigkeit. Doch zugleich sorgt sie sich, die Geschichte könne zu düster, zu bedrückend werden, wenn ich sie erzähle. »Schreib über die guten Menschen, nicht nur über das Dunkel«, sagte meine Mutter zu mir. »Ich habe so viel menschliche Güte erlebt, so viele wunderbare, seelenvolle Menschen.«
Ein letztes Bild meiner Mutter, ehe wir ihre Geschichte erzählen: Sie ist 72 Jahre alt und sitzt an einem sonnengesprenkelten gedeckten Mittagstisch. Wir sind im Haus eines Freundes auf einer Insel in der Nähe von Istanbul, auf einer luftigen Terrasse mit Blick über das Marmarameer. Meine Mutter hockt seitlich auf dem Stuhl, wie sie es wegen ihrer Hüfte immer tut, die eine Tuberkulose in ihrer Kindheit verkrüppelt hat. Unser Gastgeber, ein türkischer Schriftsteller, ist braun gebrannt wie ein antiker Meeresgott. Er schenkt Wein ein und reicht Platten mit selbst gesammelten Muscheln und Speisen, die sein fantastischer Koch zubereitet hat.
Meine Mutter ist entspannt und so hinreißend, wie sie eben sein kann. Unter den Gästen ist auch eine türkische Balletttänzerin, eine große, wunderschöne Frau mit dem langgliedrigen Körperbau einer Tänzerin. Sie und meine Mutter sprechen voller Leidenschaft über das Ballett. Ich sitze am Ende des Tisches und rede mit unserem Gastgeber, als ich höre, wie sich der Ton meiner Mutter verändert; nicht dramatisch, es ist nur eine Nuance. Doch die winzige Veränderung ist über die verschiedenen Gespräche am Tisch hinweg hörbar, und wir drehen uns um und hören zu.
Sie erzählt eine Geschichte über Solikamsk, eine Stadt der verlorenen Kinder im Krieg, in die sie 1943 evakuiert wurde. Die Lehrerin der überfüllten Schule, die sie besuchte, brachte ein Tablett mit Schwarzbrot für die Kinder zum Mittagessen. Sie sagte den Kindern aus dem Ort, sie sollten ihre Stücke den Waisenkindern geben, obwohl sie alle am Verhungern waren.
Meine Mutter erzählt die Geschichte mit einfachen Worten, ohne großes Pathos. Sie sieht niemanden an. Um ihre Lippen spielt ein schmerzliches Lächeln. Mit ihren beiden beiden Zeigefingern zeigt sie uns, wie groß die Brotstücke auf dem Tablett waren. Aus ihren Augen strömen Tränen. Auch die Tänzerin fängt an zu weinen und umarmt meine Mutter. Ich kenne die Geschichte schon, und doch bin ich erneut erschüttert darüber, welch ganz normales Wunder das Leben und das Schicksal für uns bereithält – dass jenes hungrige Kind aus dem winterlichen Klassenzimmer im Krieg dieselbe Person ist, die nun hier an diesem heißen Nachmittag bei uns sitzt, als sei sie aus einer anderen, unendlich fernen Welt zu uns in unser sorgloses, modernes Leben gestoßen.
Die Küche meiner Tante Lenina am Frunsenskajaufer an einem hellen Moskauer Sommerabend Ende der Neunzigerjahre. Ich sitze auf dem breiten Fenstersims und rauche eine Zigarette nach dem gewaltigen, fettigen Mahl, das ich mindestens fünf Mal loben musste, ehe sie überzeugt ist, dass ich zufrieden war. Lenina kocht in ihrem alten Emaillekessel Wasser. Den deutschen Wasserkocher, den ihre Töchter ihr geschenkt haben, verschmäht sie.
Lenina, die Schwester meiner Mutter, ist genauso üppig, wie es ihre Mutter Marta gewesen war, mit breiten Hüften und großen Brüsten, der Rücken unter der Last der Probleme der Welt gebeugt. Sie hat Martas stechend blaue Augen. Meine Mutter auch, ich auch und mein Sohn Nikita auch. Doch ihr Temperament hat Lenina wohl eher von ihrem geselligen Vater Boris Bibikow geerbt. Sie liebt es, Freunde um den Küchentisch zu versammeln, zu plaudern, zu tratschen, Intrigen zu schmieden. Sie zieht gerne die Fäden und organisiert das Leben anderer in ausgedehnten Telefonaten. Sie liebt es, Fernsehmoderatoren über Telefon-Hotlines zu terrorisieren und Ladenbesitzer in persona. Sie ist eine große Frau mit einer kräftigen Stimme, und sie leidet an vielen, vielen, oft beinahe tödlichen Krankheiten, über die sie sehr gerne spricht.
Als sie den Tee einschenkt, stürzt sich Lenina in ihr Lieblingsthema: das bunte Liebesleben ihres Neffen. Ihre Augen beginnen mädchenhaft-lasziv zu leuchten. Ich habe Leninas Rolle der strengen alten Dame schon lange durchschaut. Sie ist nur eine der Waffen in ihrem umfangreichen Arsenal, das sie im täglichen Kampf gegen die Außenwelt auffährt. Am liebsten aber beugt sie sich auf ihrem Hocker an der Ecke des Tisches vor, stützt einen Ellbogen auf, fixiert ihren Neffen mit wachsamem Auge und will die neuesten Einzelheiten erfahren. Wenn es unanständig wird, gackert sie wie ein Marktweib.
»Du hast Glück, dass ich das alles nicht deiner Mutter erzähle«, gluckst sie. Obwohl sie es nie müde wird, ihre eigenen Töchter auszuschimpfen, kritisiert sie mich nur selten während unserer allwöchentlichen Tratschrunde. Stattdessen steuert sie lebenskluge und oft recht zynische Ratschläge bei. Meine Tante Lenina ist mir, obwohl ein halbes Jahrhundert älter als ich, eine wahre Freundin und Vertraute.
Lenina hat ein phänomenales Gedächtnis. Unsere Gespräche beginnen immer in der Gegenwart, aber verweilen dort nur flüchtig, da diese nicht bunt und dramatisch genug ist, um ihre Aufmerksamkeit lange genug zu fesseln. Schon mit dem nächsten Satz geht sie nahtlos in die Vergangenheit über und begibt sich auf eine nächtliche Wanderung durch ihre Erinnerungen. Wie beim Stühlerücken wird ihre Aufmerksamkeit mal hierhin, mal dorthin gezogen.
Mit zunehmendem Alter wird sie blinder und weniger mobil, doch ihre Vorstellungskraft scheint an Klarheit zu gewinnen. Die Vergangenheit ist ihr näher als die Gegenwart. Sie beklagt sich, dass sie nachts Besuch von den Toten bekommt. Sie lassen sie nicht in Ruhe – ihr Mann, ihre Eltern, ihre Freunde, ihre Enkelin Mascha, die mit 26 Jahren an Krebs starb. Sie alle streiten, schmeicheln, lachen, meckern und gehen ihren Beschäftigungen nach, als merkten sie nicht, dass sie tot sind. Sie sieht die Vergangenheit in ihren Träumen, unablässig. »Es ist wie im Kino«, sagt sie. Zum Ende ihres Lebens hin erscheint ihr sein Anfang lebendiger als je zuvor. Einzelheiten tauchen auf, Gespräche, Begebenheiten, Geschichten, Schnipsel eines Lebens als winzige Filmclips, die sie chronologisch aufschreibt, um sie mir bei meinem nächsten Besuch zu erzählen. Sie weiß, ich kenne die handelnden Personen inzwischen so gut, dass sie sie nicht mehr erklären muss.
»Hab ich dir erzählt, was mir zu Onkel Jascha und den Mädchen, die er in seinem Mercedes abgeholt hat, wieder eingefallen ist? Was Warja gesagt hat?«, fragt sie am Telefon, und ich weiß sofort, dass sie über ein legendär unmoralisches Automobil spricht, das mein Großonkel Jakow 1946 aus Berlin verschiffen ließ, und über den Zorn, den dies in meiner Großtante entfachte. »Sie war so zornig, dass sie alle Blumentöpfe im Haus nach ihm warf und das Geschirr aus der Küche. Jascha konnte nicht aufhören zu lachen, selbst als ihm die Teller um die Ohren flogen. Und das machte sie erst recht wütend!«
Lenina sieht die Welt durch Gespräche, Stimmen, Menschen. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, meiner lesewütigen Mutter, liest sie nicht viel. Sie ist eine Schauspielerin, der Küchentisch ihre Bühne und die stetig wechselnden Freunde, Bittsteller, ehemaligen Studenten, Nachbarn und Verwandten sind ihr Publikum.
Die Geschichte von Ljudmila und Lenina beginnt in einer anderen Küche, im Hochsommer 1937 in einer schmucken Wohnung mit hohen Decken im Zentrum von Tschernigow. Die großen Fenster standen weit offen und ließen die kühle Brise von der Desna herein. In einer Ecke spielte meine dreijährige Mutter mit einer Lumpenpuppe. Meine Tante Lenina lehnte auf dem breiten Fenstersims und suchte die Straße nach der eleganten Silhouette des großen, schwarzen Packard ihres Vaters ab. Sie war zwölf Jahre alt und hatte ein rundes Gesicht mit großen, klugen Augen. Sie war modisch gekleidet in ihrem geliebten Tennisrock aus weißer Baumwolle, nachgeschneidert aus einer Moskauer Zeitschrift. Draußen, jenseits der Wipfel der Platanen in der Lermontowstraße, sah sie die goldenen Kuppeln der Kathedrale von Tschernigows mittelalterlichem Kreml.
Am Küchentisch machte ihre Mutter Marta viel Aufhebens um ein Proviantpaket für ihren Mann Boris: gebratenes Huhn, hart gekochte Eier und eine Gurke, ein paar Kekse, eine in Zeitungspapier eingewickelte Prise Salz, alles eingeschlagen in Pergamentpapier. Boris wollte auf dem Weg zum Bahnhof kurz vorbeischauen, um sein Gepäck abzuholen, bevor er in ein Sanatorium der Partei in Gagra am Schwarzen Meer aufbrach. Es sollte sein erster Urlaub innerhalb von drei Jahren sein.
Marta beschwerte sich, an niemanden Bestimmtes gerichtet, dass ihr Mann sich wieder einmal verspätete, so typisch, einfach typisch! Boris war so besessen von seiner Arbeit, dass er sich nicht einmal den Morgen seines Urlaubsbeginns freinehmen konnte. Für die Parteiausschüsse schien er immer mehr Zeit zu haben als für seine Familie.
Marta war eine große, kräftige Frau, die schon füllig wurde, wie die russischen Bäuerinnen, sobald sie Kinder geboren haben. Sie trug ein Kleid aus importierter Baumwolle und war sorgfältig geschminkt. Ihre Stimme war immer nörgelig, so kam es Lenina jedenfalls vor, und ihr graute bei dem Gedanken an eine Woche allein mit ihrer Mutter ohne den mäßigenden Einfluss ihres Vaters. An der Spüle stand Warja, das leidgeprüfte Hausmädchen der Familie, ein stämmiges Landmädchen, das einen weiten sarafan mit gestärkter Schürze trug, das traditionelle Kleid der Bäuerinnen. Warja schlief in einer Art Schrank am Ende des Flures, aber sie verdiente Geld und wurde verköstigt, und so akzeptierte sie Marta und Schlimmeres. Marta verließ grummelnd die Küche, um Boris’ Gepäck zu überprüfen, das im geräumigen Flur stand, und Warja zwinkerte Lenina zu, als sich ihre Blicke trafen.
Ljudmila – oder Mila – war ihrer großen Schwester treu ergeben wie ein kleiner Hund und ließ sie am liebsten keine Sekunde aus den Augen. Die Mädchen hatten mit ihrem Vater ein gegenseitiges Verteidigungsbündnis geschlossen, eine Komplizenschaft, die Marta missfiel und die sie nicht verstand.
Lenina am Fenster sah das große schwarze Auto ihres Vaters um die Ecke biegen und vor dem Wohnhaus halten. Es polterte im Treppenhaus, und Boris kam in die Wohnung gestürmt. Er war ein kräftig gebauter Mann, der bereits Bauch ansetzte und dessen rasierter Schädel vorzeitig kahl wurde. Er trug bewusst proletarische Kleidung, schlichte Leinenhemden im Sommer und gestreifte Matrosenjacken im Winter, und sah viel älter aus als seine 34 Jahre. Er war schon jetzt der zweitmächtigste Mann der Stadt, Sekretär für Agitation und Propaganda des Regionalausschusses der Kommunistischen Partei, ein bekannter politischer Agitator, ein aufsteigender Stern in der Partei, Träger des Leninordens. Boris betrachtete seine Lehrjahre in der Provinzverwaltung als Vorspiel zu einem mächtigen Posten in Kiew oder sogar Moskau. Er würde es weit bringen. Nun ignorierte er die Schimpftiraden seiner Frau und küsste seine beiden Töchter schnell zum Abschied.
»Sei brav und pass auf deine Mutter und deine Schwester auf«, flüsterte er Lenina zu.
Er brachte seine Frau mit einer flüchtigen Umarmung zum Schweigen, griff nach dem gepackten Koffer und dem Proviantpaket und rannte die Treppe hinunter. Lenina eilte ans Fenster und sah den Fahrer ihres Vaters rauchend am Auto stehen. Er warf die Zigarette weg, als er seinen Chef die Steintreppe herunterkommen hörte. Lenina winkte eifrig, als ihr geliebter Vater in sein Auto stieg, und er winkte flüchtig zurück, es war mehr eine Wischbewegung als ein Winken. Es war das letzte Mal, dass sie ihn sah.
Nachdem sie ihren Mann verabschiedet hatte, ging Marta über den Treppenabsatz zu den Nachbarn hinüber, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Sie hatte am Morgen nicht wie sonst die Tür gehört, und niemand war zum Mittagessen nach Hause gekommen. Als Marta zurückkam, fiel Lenina auf, wie blass und nervös sie war. Niemand hatte auf ihr Klingeln hin die Tür geöffnet. An dieser klebte ein gestempelter Zettel mit dem Siegel des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten, des NKWD. Sie wusste sofort, was das bedeutet. Die Nachbarn der Bibikows, die Familie eines Kollegen ihres Mannes, waren in der Nacht verhaftet worden.
Am nächsten Morgen lag große Müdigkeit in Martas Augen, als sie die kleine Ljudmila anzog, und ihre Stimme war herrisch, als sie den Kindern die Sommerhüte auf die Köpfe drückte und sie zum Einkaufen trieb.
Auf dem Weg zum Markt blieb Marta stehen, um Ljudmilas Schuh nachzubinden. Als sie in die Hocke ging, trat ein Mädchen in Leninas Alter leise zu ihr. Sie flüsterte Marta etwas ins Ohr und lief eilig wieder davon. Anstatt aufzustehen, sank Marta wie ein angeschossenes Tier auf dem Bürgersteig auf die Knie. Ihre Kinder versuchten erschrocken, sie aufzurichten. Nach wenigen Augenblicken hatte sie sich erholt, stand auf und eilte zurück nach Hause, Ljudmila, die stolpernd Schritt zu halten versuchte, hinter sich her ziehend. Jahre später erzählte Marta Lenina, was das Mädchen gesagt hatte: »Heute Nacht kommen sie mit einem Durchsuchungsbefehl.« Niemand wusste, wer das Mädchen war oder wer sie geschickt hatte.
Zurück in der Wohnung, fing Marta an zu weinen. Sie war in den zwölf Jahren ihrer Ehe nur einmal von ihrem Mann getrennt gewesen – als er in der Roten Armee diente, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Und jetzt war er weg und die Welt, die sie sich aufgebaut hatten, im Begriff, auseinanderzufliegen.
An jenem Abend gingen die Kinder hungrig zu Bett. Zum Abendessen hatte ihre Mutter nur hastig ein paar Reste zusammengeworfen. Marta konnte nicht schlafen, wie sie später Lenina erzählte, und wusch die halbe Nacht Wäsche. Dann saß sie am offenen Fenster und wartete auf das Auto. Kurz vor Morgengrauen schlief sie schließlich ein und hörte es nicht.
Marta wurde durch ein heftiges Klopfen geweckt. Sie sah auf ihre Armbanduhr; es war kurz nach vier Uhr morgens. Marta zog einen Morgenrock über und öffnete die Tür. Draußen standen vier Männer, alle in schwarzen Lederjacken mit Pistolengürteln und Lederstiefeln. Der Anführer zeigte ihr einen Durchsuchungsbefehl und einen Haftbefehl gegen ihren Mann. Er fragte, ob Bibikow zu Hause sei. Marta sagte Nein, er sei weg, und bettelte um eine Erklärung. Die Männer drängten sich an ihr vorbei und begannen, die Wohnung zu durchsuchen. Die Kinder wurden von ihren Stimmen geweckt. Ljudmila fing an zu weinen. Ein Mann öffnete die Tür zu ihrem Zimmer, schaltete kurz das Licht an, schaute sich um und hieß die Kinder still sein. Ljudmila krabbelte zu Lenina ins Bett und weinte sich in den Schlaf. Ihre Mutter kam verwirrt herein und tröstete sie. Sie lauschten, wie nebenan Schubladen durchwühlt und Schränke ausgeleert wurden.
Die Männer blieben zwölf Stunden und durchsuchten systematisch jedes Buch, jede Akte in Boris’ Arbeitszimmer. Sie erlaubten Marta nicht, in die Küche zu gehen und den Kindern etwas zu essen zu machen. Lenina erinnert sich, dass ihre Gesichter »hart waren wie ihre Ledermäntel«. Als sie mit der Durchsuchung fertig waren, konfiszierten sie eine Kiste voller Dokumente, für die Marta unterschreiben musste. Die Beamten des NKWD versiegelten die vier Zimmer der Wohnung und ließen Marta und die Kinder in Nachthemden in der Küche. Nachdem sie die Tür zugeknallt hatten, brach Marta tränenüberströmt auf dem Fußboden zusammen. Ljudmila und Lenina fingen ebenfalls an zu weinen und umarmten ihre Mutter.
Als Marta die Fassung wiedererlangt hatte, ging sie ins Bad und wrang ein nasses Kleid aus. Sie wischte sich vor dem Badezimmerspiegel das Gesicht ab, wies Lenina an, sich um ihre Schwester zu kümmern, und ging aus dem Haus. In der Gewissheit, ihre Familie sei Opfer eines schrecklichen Fehlers geworden, lief sie zur örtlichen Zentrale des NKWD. Spät am Abend kam sie zu den Kindern zurück, mit leeren Händen und verzweifelt. Sie hatte praktisch nichts in Erfahrung gebracht, außer dass sie nur eine von Dutzenden panischen Ehefrauen war, die den ungerührten Rezeptionisten wegen ihrer vermissten Ehemänner bestürmt hatten, nur um zu hören, die Männer würden überprüft, und man würde die Frauen auf dem Laufenden halten.
Zu dem Zeitpunkt wusste Marta nicht, dass ihr Mann noch auf freiem Fuß und in einem Schlafwagen erster Klasse auf dem Weg nach Süden war, voller unschuldiger Vorfreude auf seinen wohlverdienten Urlaub im Sanatorium der Partei.
2
»Nicht Männer, sondern Giganten!«
Jungens, lasst uns den Plan erfüllen!
Wahlspruch, den Boris Bibikow mit Kreide an die Wand der Fabriktoilette schrieb
Es gibt heute nur noch zwei Fotos von Boris Bibikow. Eines ist ein zwangloses Gruppenfoto, das irgendwann um 1932 im Charkower Traktorenwerk aufgenommen wurde. Er sitzt auf dem Boden, vor zwei Dutzend jugendlich aussehenden, strahlenden Arbeitern. Seinen Arm hat er um die Schultern eines jungen Mannes mit Bürstenhaarschnitt gelegt. Bibikow trägt ein zerknittertes, am Kragen offenes Hemd, und sein Schädel ist rasiert, ganz im proletarischen Stil, den so viele Parteikader in seiner Generation zur Schau trugen. Anders als alle anderen auf dem Foto lächelt er nicht, sondern blickt streng in die Kamera.
Das andere Foto, in seinem Parteidokument, datiert von Anfang 1936. Bibikow trägt die Uniform eines Parteikaders, zugeknöpft bis zum Hals, und starrt auch hier entschlossen aus dem Bild. Seine heruntergezogenen Mundwinkel verraten mehr als nur einen Anflug Grausamkeit. Er ist durch und durch rücksichtsloser Gefolgsmann der Partei. Die Förmlichkeit seiner Pose und die Tatsache, dass Bibikow in einer Zeit geboren wurde, in der man vor einer Kamera nie ganz ungezwungen war, ergeben eine nahezu perfekte Maske. Auf keinem der beiden Bilder ist er selbst zu sehen, nur der Mann, der er sein wollte.
Er starb als Mensch ohne Vergangenheit. Wie viele seiner Zeit und seiner Schicht warf Bibikow sein einstiges Selbst ab wie eine schändliche Haut, um als Homo soveticus wiedergeboren zu werden, der neue sowjetische Mensch. Er erfand sich so vollständig neu, dass selbst die Ermittler, die akribisch seinen Weg durch den »Fleischwolf« des NKWD im Sommer und Herbst 1937 aufzeichneten, nicht die geringste Spur seiner einstigen Existenz ausmachen konnten. Es gibt keine Fotos, keine Papiere, keine Dokumente aus seinem Leben vor der Partei.
Seine Familie stammte von Alexandr Bibikow ab, einem General unter Katharina der Großen, der sich die Gunst der Zarin und einen Adelstitel verdiente, als er 1773 den Bauernaufstand unter dem Anführer Jemeljan Pugatschow unterdrückte. Der Aufstand wurde mit größter Brutalität niedergeschlagen, ganz wie es die Zarin befohlen hatte. Tausende Rebellen wurden aufgehängt oder verprügelt, weil sie es gewagt hatten, sich dem Staat zu widersetzen.
Boris Bibikow wurde 1903 oder 1904 auf der Krim geboren – in seiner NKWD-Akte steht ersteres Jahr, seine Mutter schrieb letzteres nieder. Sein Vater Lew, ein kleiner Grundbesitzer, starb, als Boris und seine Brüder Jakow und Issaak noch ganz klein waren. Bibikow sprach nie von ihm. Seine Mutter Sofija war Jüdin aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie auf der Krim. Ihr Vater Naum besaß eine Getreidemühle und einen Getreideheber, was wohl den merkwürdigen »Beruf« erklärt, den Bibikow auf seinem Verhaftungsprotokoll angab: »Mühlenarbeiter«. Boris konnte Englisch und kämpfte nicht im Bürgerkrieg. Das ist so ziemlich alles, was wir über seine frühen Jahre wissen. Jakow, der Einzige der Brüder Bibikow, der den Zweiten Weltkrieg überlebte und erst 1979 starb, war ähnlich besessen – er sprach niemals über seine Herkunft oder seinen hingerichteten Bruder. Für die Brüder gab es nur die Zukunft, sie blickten nie zurück.
Ich glaube nicht, dass mein Großvater ein Held war, aber er lebte in heroischen Zeiten, und solche Zeiten treiben große wie kleine Menschen zu großen Taten. Die Losung der bolschewistischen Revolution war »Frieden, Land und Brot«, und damals muss diese Botschaft in den Ohren ehrgeiziger und idealistischer Männer frisch, kraftvoll und prophetisch geklungen haben. Die Parteikader sollten nichts Geringeres als die Avantgarde der Weltgeschichte sein. Irgendwann, nachdem die Oktoberrevolution das alte Russland hinweggefegt hatte, scheint Bibikow, wie so viele Mitglieder der »einstigen Klassen«, eine Art romantische Offenbarung erlebt zu haben. Oder vielleicht – wer weiß das heute schon – war die Triebfeder Ehrgeiz, Eitelkeit oder auch Gier. Sein Erbe, das kleine Getreidemühlenimperium seines Großvaters mütterlicherseits auf der Krim, wurde 1918 verstaatlicht. Viele seiner nobleren Verwandten in Moskau und Petrograd waren ins Exil geflohen oder als Klassenfeinde verhaftet worden. Die Bolschewiken waren die neuen Herren Russlands, und ein tatkräftiger und intelligenter junger Mann kam nur dann zum Erfolg, wenn er sich so schnell wie möglich auf die Gewinnerseite schlug.
Die einzige verbliebene Zeugin ist Lenina, und sie beschreibt ihren Vater als edelmütigen und selbstlosen Menschen. Und selbst wenn das nicht stimmte, so trägt Leninas Wort eine eigene emotionale Wahrheit in sich. Einigen wir uns also darauf, dass eine neue Welt errichtet werden sollte und dass die Großartigkeit dieser Vision in all ihrer Frische und Schönheit Bibikow fesselte. Er und seine beiden jüngeren Brüder Jakow und Issaak stürzten sich von ganzem Herzen hinein.
Im letzten Jahr des Bürgerkriegs schrieb sich Boris an der neu eröffneten Höheren Parteischule in Simferopol auf der Krim ein. An der Schule sollte eine neue Generation Kommissare ausgebildet werden, die das riesige Reich regieren sollten, das die Bolschewiken zu ihrer eigenen Überraschung gerade gewonnen hatten. Nach einer einjährigen Ausbildung in der Theorie des Marxismus-Leninismus und den Grundlagen der Agitation und Propaganda wurde mein Großvater im Mai 1924 Parteimitglied – ein junger Hitzkopf von 21 Jahren, der der Revolution dienen wollte, wo auch immer sie ihn brauchte.
Wie sich herausstellen würde, waren die dringendsten Erfordernisse der Revolution recht prosaisch. Boris wurde ausgesandt, die sommerliche Tomaten- und Auberginenernte einer neuen Kolchose in Kurman Kimiltschi zu überwachen, einer ehemaligen tatarischen Siedlung in den Bergen der Halbinsel Krim, die zwei Jahrhunderte lang von Deutschen bewohnt worden war. Und dort, auf den staubigen Feldern, begegnete er seiner zukünftigen Frau Marta Platonowna Schtscherbakowa.
Einige Wochen, bevor sie Boris kennenlernte, hatte Marta Schtscherbakowa ihre jüngere Schwester Anna sterbend auf einem Bahnsteig in Simferopol zurückgelassen.
Die beiden Mädchen waren auf dem Weg von ihrem Heimatdorf in der Nähe von Poltawa in der westlichen Ukraine zu den Feldern auf der Krim, wo sie den Sommer über arbeiten wollten. Marta war mit ihren 23 Jahren schon weit über das Alter hinaus, in dem die Bauernmädchen ihrer Generation heirateten. Sie hatte zehn Schwestern; zwei Brüder waren bereits als Kinder gestorben. Ihr Vater Platon empfand so viele Töchter zweifellos als Fluch und dürfte froh gewesen sein, zwei von ihnen loszuwerden.
Marta wuchs auf in einer Atmosphäre des unterschwelligen Misstrauens und der willkürlichen Brutalität eines armen, dreckigen Dorfes in der ukrainischen Steppe. Doch selbst gemessen an den harten Maßstäben des russischen Bauernlebens, fanden die Schwestern Marta streitsüchtig, eifersüchtig und schwierig. Das erklärt vielleicht, warum sie keinen Mann in ihrem Dorf gefunden hatte und warum sie und Anna für überzählig gehalten und weggeschickt wurden, um sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Die Zurückweisung durch den Vater war die erste und vielleicht tiefste der vielen Wunden, die ihrer Seele in ihrem Leben zugefügt wurden und deren Narben sich zu einer ausgeprägten Bösartigkeit verhärten sollten.
Als Anna und Marta Simferopol erreichten, hatten sie schon mindestens eine Woche Strapazen hinter sich, waren in Bummelzügen und auf Lastwagen mitgefahren. Anna hatte Fieber, und inmitten der Menschenmenge auf dem glühend heißen Bahnsteig fiel sie in Ohnmacht. Die Leute drängten sich um das Mädchen, das blau angelaufen war und zitterte. Jemand schrie »Typhus!«, und Panik breitete sich aus. Marta wich von ihrer Schwester zurück, drehte sich um und lief mit den anderen davon.
Marta war jung, verängstigt und zum ersten Mal allein nach einem Leben in der drangvollen Enge des Holzhauses der Familie. Ihre Befürchtung, in eines der berüchtigten und tödlichen Typhusspitäler in Quarantäne gesteckt zu werden, war vielleicht nur allzu berechtigt. Doch die Entscheidung, ihre Schwester zurückzulassen, sollte sie für den Rest ihres Lebens verfolgen als eine Sünde, für die sie grausam bestraft wurde. Getrieben von Angst und sicherlich auch Verwirrung, leugnete Marta, das vom Fieber geschüttelte Mädchen auf dem Bahnsteig zu kennen, und stieg mit der Menge in den ersten Zug nach Westen.
Viele Jahre später, als Mutter und Tochter ein halbes Leben voller Gräuel hinter sich hatten, erzählte Marta Lenina davon, wie ihre Schwester wahrscheinlich gestorben war. Doch Marta erwähnte den Vorfall nur beiläufig, als sei er nicht weiter bemerkenswert. Irgendetwas war in ihr zerbrochen, oder vielleicht war es nie dagewesen.
Schon als kleiner Junge hatte ich Angst vor meiner Großmutter Marta. Als sie uns 1976 besuchen kam, verließ sie zum ersten und einzigen Mal die Sowjetunion und flog auch zum ersten Mal in einem Flugzeug. Vor dieser Reise nach England war ihre längste Fahrt die als Gulag-Gefangene gewesen, im Zug nach Kasachstan und wieder zurück. In die schweren Koffer, die sie nach London mitbrachte, hatte sie ihre eigene dicke Baumwollbettwäsche gepackt, wie es bei sowjetischen Reisenden üblich war.
Der Parteigenosse. Offizielles Foto ausBoris Bibikows Parteiausweis, aufgenommen 1936. Auf dem Bild ist er 36 Jahre alt und war gerade zum Vorsitzenden des Regionalausschusses der Kommunistischen Partei in Tschernigow ernannt worden.
Martas Bewegungen waren unglaublich schwerfällig, als sei der Körper ihr eine Last. Zu Hause trug sie billige sowjetische bedruckte Kleider und Pantoffeln; wenn sie ausging, zog sie ein muffiges Tweedkostüm an. Sie lächelte fast nie. Beim gemeinsamen Abendessen saß sie düster und teilnahmslos am Tisch, so als missfiele ihr der bürgerliche Luxus, in dem ihre Tochter lebte. Einmal, als ich mit Messer und Gabel Schlagzeug auf dem Tisch spielte, schimpfte Marta mich mit unvermittelter Wut so aus, dass mir die Tränen in die Augen schossen. Ich war nicht traurig, als sie wieder abreiste. Sie verabschiedete sich tränenreich von uns, was mir peinlich war. »Ich werde dich nie wiedersehen«, sagte sie zu meiner Mutter, und sie sollte recht behalten. Für mehr blieb keine Zeit, mein Vater wartete bereits draußen in seinem orangefarbenen VW-Käfer, um sie nach Heathrow zu bringen.
Heute denke ich oft an Marta und versuche, unter den vielen Schichten aus Gerüchten und Erwachsenenwissen, die sich um ihr Bild in meinem Kopf gelegt haben, meine eigenen Erinnerungen an sie wachzurufen. Ich versuche, mir das hübsche, aufblühende Mädchen vorzustellen, das Boris geheiratet hat. Und ich frage mich, wie sie eine Tochter haben konnte, die so lebhaft und lebensfroh war wie meine Mutter. Nun, da ich einen Teil von Martas gebrochener Lebensgeschichte kenne, verstehe ich, dass etwas in ihrer Seele geschehen war, was bewog, das sie all ihre Energie und Lebenskraft gegen sich selbst richtete. Sie hasste die Welt, und da ihr selbst alles Glück verwehrt geblieben war, versuchte sie, es auch in denen zu zerstören, die um sie waren. Ich war ein kleiner Junge, als ich sie kennenlernte, doch schon damals sah ich, wie tot ihre Augen, spürte, wie hölzern ihre Umarmungen waren. Da war etwas Furchterregendes, Kaputtes um sie.
Der Zug in Simferopol brachte Marta nach Westen, nach Kurman Kimiltschi. Sie hatte gehört, dass es dort Arbeit geben sollte, und so stieg sie aus auf den staubigen Bahnsteig und ging zum Büro der Kolchose. Man wies ihr eine Pritsche in einer schäbigen Baracke für Wanderarbeiter zu. Und dort begegnete sie dem jungen Kommissar Boris Bibikow.
Das Liebesverhältnis von Marta und Boris führte zu einer revolutionären Ehe. Er war ein aufsteigendes und gebildetes Mitglied der neuen revolutionären Elite, sie ein einfaches Bauernmädchen mit tadellosen proletarischen Referenzen. Mag sein, dass Bibikows Wahl zu einem gewissen Grad Berechnung war. Aber noch wahrscheinlicher war es eine Mussheirat, das Ergebnis eines Flirts auf der Krim im hohen Gras einer Wiese in einer heißen Sommernacht.
Ihre erste Tochter kam sieben Monate, nachdem sie »unterschrieben« hatten – die neue Bezeichnung für die Zivilehe –, im März 1925 zur Welt. Bibikow nannte sie Lenina, nach dem kürzlich verstorbenen Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin. Als Lenina acht Monate alt war, trat ihr Vater seinen Militärdienst bei der Roten Armee an. Marta zeigte Lenina stets die Briefe, die Bibikow nach Hause schickte, und sagte: »Papa.«
Als Bibikow dann nach Hause zurückkehrte, war Lenina zwei Jahre alt und weinte, als der fremde Mann ins Haus kam. Marta erklärte ihr, Papa sei wieder da. Die kleine Lenina sagte: »Nein, das ist nicht Papa!« und wies auf die Blechkiste, in der Marta die Briefe ihres Mannes aufbewahrte. »Das ist Papa, da drin!« Es war wie eine kindliche Vorahnung des Tages, an dem Boris aus der Tür und aus ihrem Leben verschwinden würde – um sich wieder in einen Stapel Papier zu verwandeln.
Boris Bibikows Leben wird eigentlich erst 1929 deutlicher, als Leninas Erinnerungen an ihn einsetzen und das Projekt begann, dem er seine Karriere widmete und das ihm zu einer gewissen Größe verhelfen sollte. Im April jenes Jahres verabschiedete der 16. Parteitag der KPdSU den ersten Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft. Der Bürgerkrieg war gewonnen, der Generalsekretär der Partei, Josef Stalin, hatte seinen Erzrivalen Leo Trotzki abgelöst, und die Partei wollte mit dem Plan aus den Ruinen eines von Krieg und Revolution zerstörten Russlands ein neues sozialistisches Land erstehen lassen. Das Ganze war nicht nur ein Wirtschaftsprojekt – es war für junge Gläubige wie Bibikow nichts Geringeres als der Entwurf einer strahlenden sozialistischen Zukunft.
Der Plan sah vor, die Bauern zu sozialisieren, die über 80 Prozent der Bevölkerung ausmachten und aus Sicht der Partei gefährlich reaktionär waren. Die Revolution war vorwiegend urban, gebildet, doktrinär – so wie Bibikow selbst. Die Bauern mit ihrem blasphemischen Wunsch nach der eigenen Scholle und ihrer starken Bindung an Familie und Kirche wehrten sich gegen das Monopol der Partei über ihre Seelen. Ziel war es, das Land zu einer »Getreidefabrik« zu machen und die Bauern zu Arbeitern.
»100 000 Traktoren machen den muschik, den Bauern, zum Kommunisten«, schrieb Lenin. So viele Bauern wie möglich sollten in die Städte getrieben werden, um dort gute Proletarier zu werden. Die, die auf dem Land blieben, sollten auf großen, effizienten Kolchosen arbeiten. Und um diese Kolchosen effizient zu machen und Arbeitskräfte für die Städte freizustellen, wurden Traktoren gebraucht. Während der Aussaat im Frühjahr 1929 waren in der ganzen Ukraine lediglich fünf Traktoren im Einsatz. Die übrige Arbeit wurde von Männern und Pferden geleistet. Das weite Land mit der schwarzen Erde folgte, wie schon seit unzähligen Generationen, dem langsamen Herzschlag der Jahreszeiten und dem Rhythmus der Arbeit von Mensch und Tier.
Das würde die Partei ändern. Stalin selbst befahl den Bau von zwei gigantischen Traktorenwerken im Herzen des Getreidegürtels in Süd- und Zentralrussland – eine in Charkow in der Ukraine, dem Brotkorb des Reiches, und die andere in Tscheljabinsk am Rande der leeren Steppen. Die Partei gab auch die Losung heraus: »Wir produzieren erstklassige Maschinen, um den jungfräulichen Boden des bäuerlichen Bewusstseins gründlicher zu pflügen!«
Das Charkower Traktorenwerk oder ChTS sollte vor der Stadt gebaut werden, auf einem leeren Feld. Die schiere Größe des Projekts und seine Zielsetzung waren atemberaubend. Für das erste Produktionsjahr stellte die Partei 287 Millionen Goldrubel bereit, 10 000 Arbeiter, 2000 Pferde, 160 000 Tonnen Eisen und 100 000 Tonnen Stahl. Aus dem Lehm, der für das Fundament ausgehoben wurde, wurden Ziegel gebrannt. Bei Baubeginn waren 24 mechanische Betonmischer und vier Steinbrecher die einzigen Maschinen vor Ort.
Die überwiegende Mehrheit der Arbeitskräfte waren ungelernte Bauern, die gerade erst enteignet worden waren. Die meisten hatten noch nie eine andere Maschine als eine von Pferden gezogene Dreschmaschine gesehen. Die Maurer wussten zwar, wie man einen russischen Ofen baut, hatten aber keinerlei Erfahrung mit Ziegelsteingebäuden. Die Zimmermänner wussten, wie man mit der Axt eine isba baut, eine Holzhütte, aber Baracken hatten sie noch nie gebaut.