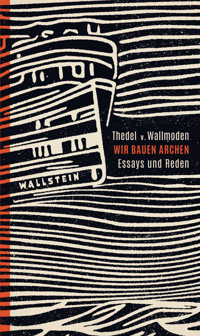
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dem Verleger über die Schulter geschaut. Verantwortung für Autoren und Werke zu übernehmen, sich für literarische Qualität einzusetzen und diese auch gegen den herrschenden Trend durchzusetzen, persönlich für sie zu haften – das ist es, was Verleger immer ausgezeichnet hat. Zum erfolgreichen Verlegen gehört aber auch die Kontinuität der Zusammenarbeit und die Pflege eines Werkes. Das Bewahren der literarischen Tradition ist für Thedel v. Wallmoden ebenso wichtig wie langfristige Beziehungen zu Autorinnen und Autoren. Mit dem Bild der Arche ist ein kulturelles Erbe gemeint, das es zu bewahren gilt. Leidenschaftlich schreibt Thedel v. Wallmoden über Fluch und Segen der Arbeit des Verlegers, über wichtige Autoren, Freunde und Wegbereiter wie Ruth Klüger, Heinz Ludwig Arnold oder Walter Pehle, über Ringelnatz, Rosa Luxemburg und Ernst Toller. Vorbilder wie Kurt Wolff und Samuel Fischer werden gewürdigt ebenso wie die Rolle des oft verkannten "unsichtbaren Zweiten" – der Lektorin oder des Lektors. Außerdem wird die Frage diskutiert, weshalb Klassikerausgaben auch heute noch sinnvoll und notwendig sind und warum wir wissenschaftliche Editionen brauchen. In Aufsätzen, Vorträgen und kurzen Reden zu Buchpräsentationen kann man dem Verleger über die Schulter schauen und beginnt zu verstehen, was es bedeutet, ein leidenschaftlicher Büchermacher zu sein. Was es heißt, in "Büchern zu denken" (Eugen Claassen).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thedel v. Wallmoden
Wir bauen Archen
Essays und Reden
Herausgegeben von Thorsten Ahrend,Christoph König undNikola Medenwald
Wallstein Verlag
Inhalt
I. Verlegen
Visionäre und Realisten Deutsche Verleger im 20. Jahrhundert
»Offen sein für das Heutige, offen bleiben für das Gestrige« Die Anfänge des Kurt Wolff Verlags zwischen Goethezeit und Expressionismus
Wer bestimmt den Wert? Über die Beziehung von symbolischem und ökonomischem Kapital in der Verlagswirtschaft
»Die unsichtbaren Zweiten«
Versuch über den Erfolg Ein Brief von Siegfried Unseld über Kurt Wolff .
Summa Summarum Über das Verlegen von Gedichten
Der Verleger: »Der blödeste Beruf der Welt« Über die performative Aushandlung von symbolischem und ökonomischem Kapital
Versuch einer Standortbestimmung des geisteswissenschaftlichen Publizierens
Was ist Erfolg?
II. Klassikerausgaben, Editionen und Editionswissenschaften
Der Text und der Leser Für Michael Assmann
Was ist Editionswissenschaft und warum veröffentlichen wir wissenschaftliche Editionen?
Klassiker Verlegen: Warum? Welche? Wie?
Klassiker? Es ist nicht gut um sie bestellt.
III. Autoren und Werke
Heinz Ludwig Arnold, Freund der Dichter
Eine Hymne der Ambivalenz Gottfried Benns spätes Gedicht »Teils-Teils«
Wie alles anfing Die Veröffentlichung von Ruth Klügers »weiter leben. Eine Jugend«im Wallstein Verlag
Diese Schärfe des Blicks. Nachruf auf Ruth Klüger
Gedenktafel für Adolph Freiherrn Knigge in GöttingenEine Laudatio
Gertrud Kolmar: Die jüdische Mutter Nachwort
Zeit urbar machen Lichtenbergs Sudelbuchnotiz C 245
Büffel und Schwalben Rosa Luxemburgs und Ernst Tollers »Briefe aus dem Gefängnis«
»... über Ihren Herrn Großvater würde ich mirab sofort keine Illusionen mehr machen.« Laudatio für Walter Pehle
Ringelnatz und seine Verleger
Zu den Werksammlungen und Werkausgaben Ernst Tollers
»Seit ich sprechen kann, leide ich unter stilistischen Sorgen« Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke
Ein Band, das Geister aneinanderreiht ... verknüpfteHans Wollschläger mit August Graf von Platen
IV. Buchpräsentationen
Ferdinand Beneke, Die Tagebücher I (1792 – 1801)
Menschen in Bergen-Belsen
Jean Bollack, Ein Mensch zwischen zwei Welten
Barthold Heinrich Brockes, Werke1
Lothar Graf zu Dohna, Die Dohnas und ihre Häuser
Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Ausgewählte Werke
Bernhard Jensen, Ein Kanon jüdischer Renaissance
Keyßlers Welt. Europa auf Grand Tour
August Klingemann, Briefwechsel
Die Klosterkammer Hannover 1931 – 1955
Anton Kuh, Werke
Carl Heinrich Merck, Das sibirisch-amerikanische Tagebuchaus den Jahren 1788 – 1791
Johann Heinrich Merck, Gesammelte Schriften
Historisch-kritische Ausgabevon Friedrich Rückerts Werken
V. Bibliophilie
Über das schöne Buch
BibliophilieDie Gegenwart der Geschichte
Mit Büchern leben
VI. Epilog: Persönliches
Jürgen Serke: Die verbrannten Dichter Eine Wiederbegegnung
In Inhalten denken
Die Thedelsage
Anhang
Anmerkungen
Verzeichnis der Erstdrucke und Vortragsanlässe
Nachbemerkung der Herausgeber
Register
Impressum
I. Verlegen
Visionäre und Realisten
Deutsche Verleger im 20. Jahrhundert
Hier sprechen zu dürfen, ist mir eine große Ehre, aber: Ich will Ihnen auch nicht verschweigen, dass der heutige Vortrag Ausdruck eines doppelten Leichtsinns ist: Es war leichtsinnig von Ihnen, einen Verleger und keinen Buchhandels- oder Verlagshistoriker einzuladen, denn wir wissen alle, dass Verleger am liebsten über sich selbst, also über ihre eigenen Verlage und Bücher reden. Trauen Sie deshalb keinem Verleger! Selbst wenn er vorgibt, über die großen Vorbilder zu reden. Am Ende läuft es doch darauf hinaus, dass der Kerl ausschließlich über sich selbst spricht.
Leichtsinnig war es aber auch von mir, einen Vortrag mit solchem thematischen Zuschnitt zu übernehmen – und das ausgerechnet im Frühjahr kurz vor der Leipziger Buchmesse, während die Frühjahrsproduktion erscheint und meine ungeteilte Aufmerksamkeit fordert.
Ein Thema zumal, das ganze Bibliotheken füllt, denken Sie nur an Peter de Mendelssohns herrliches Buch S. Fischer und sein Verlag (1.485 Seiten), denken Sie an Reinhard Wittmanns Geschichte des Carl Hanser Verlags, die 2005 erschienen ist, oder an Edda Zieglers Buch 100 Jahre Piper. Die Geschichte eines Verlags. Denken Sie an die große Zahl von Verlagsgeschichten, Verlegerbiografien und Verlegerautobiografien und schließlich auch an die vielen großartigen Briefwechsel zwischen Verlegern und Autoren.
Einige Abende habe ich am Schreibtisch gesessen und überlegt, wie ich Ihnen dieses Thema nahebringen könnte. Im Bücherregal direkt in meinem Blickfeld standen die Verlagsgeschichten und Briefwechsel, Heinz Sarkowskis Studien über den Insel Verlag, Reinhard Pipers Vormittag / Nachmittag, Bermann Fischers Bedroht – Bewahrt, die eindrucksvollen Briefe Kurt Wolffs, S. Fischers Briefwechsel mit Autoren oder Eugen Claassens Briefe In Büchern denken.
Ich habe mich also gefragt, wie ein solcher Vortrag beginnen könnte?
Vielleicht mit dem alten Verlegerwitz, den Sie aber vermutlich alle schon kennen: Nämlich mit der Frage: »Wie erwirbt man ein kleines Vermögen?« Antwort: »Man nimmt ein großes und gründet einen Verlag.«
Nein! So geht das nicht, aber ich werde später nochmal im Ernst auf den Zusammenhang von Geld und Verlagsgründung zurückkommen.
Also: Verlagsgeschichte ist immer auch die Geschichte der Entstehung von Literatur, ist auch die Geschichte ihres Verstehens, die Geschichte des Umgangs mit Literatur und natürlich auch des Umgangs mit dem, der schreibt, des Umgangs mit dem Produktiven schlechthin!
»Verlagsgeschichte ist Literaturgeschichte unter den ökonomischen Bedingungen des Marktes, des Buchhandels«,[1] hat Siegfried Unseld einmal geschrieben. Der Buchhandel wiederum ist nicht statisch, sondern in ständigem Wandel begriffen.
Wenn ich Ihnen aber etwas über Leben und Werk deutscher Verleger im 20. Jahrhundert erzählen will, so kann ich dies nur tun, indem ich zuvor zumindest skizzenhaft die Linien von den Anfängen im 15. Jahrhundert bis in das »lange 19. Jahrhundert«[2] ziehe, um das 20. Jahrhundert mit seinen Veränderungen, Umwälzungen und Aufbrüchen darzustellen.
Es sind dieselben Flüsse nicht, in die wir steigen.
Das Verlagswesen ist genau wie alle anderen Branchen einem enormen Wandel unterworfen. Drucktechnische Innovationen, allen voran die Digitalisierung, haben in den letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts den Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchmarkt enorm verändert. Der Buchhandel hat durch Konzentrationsprozesse, durch die Herausbildung von Handelsketten oder durch international operierende Medienkonzerne sein Gesicht in den letzten 20 Jahren dramatischer verändert als in den 40 Jahren davor.
Aber lassen Sie mich kurz zu den Anfängen gehen: Mit dem sich entwickelnden Buchdruck der Nach-Gutenberg-Zeit entstand zunächst der Typus des gelehrten Drucker-Verlegers, der natürlich noch selbst der Verkäufer seiner Bücher war.
Vom 16. Jahrhundert an trafen sich Drucker-Verleger in Frankfurt zur Messezeit und tauschten Bogen gegen Bogen, Ballen gegen Ballen, um sie dann zu Hause zum Verkauf anzubieten. Und erst im frühen 18. Jahrhundert bahnte sich die Spezialisierung an, die zwischen Drucker, Verleger und Buchhändler zu unterscheiden begann.
Eine Unterscheidung übrigens, die auch heute noch keineswegs völlig aufgehoben ist. Sie wissen, dass es bedeutende und traditionsreiche Verlage gibt, zu deren Unternehmungen auch heute noch leistungsfähige Setzereien, Druckereien und Buchbindereien gehören, denken Sie nur an die Beck’sche Druckerei in Nördlingen, denken Sie aber genauso an deutlich jüngere Verlage, wie Steidl in Göttingen, dessen Druckerei von internationalen Museen zur Katalogproduktion frequentiert wird.
Für die Zeitungsverlage ist die Zusammengehörigkeit von Druckerei und Verlag ohnehin selbstverständlich.
Bis ins 19. Jahrhundert gilt jedoch noch fast ausnahmslos, dass der Drucker auch der Verleger oder im Sinne unserer Frage der Verleger auch der Drucker der Werke ist.
Für das 18. Jahrhundert ist dann eine wichtige Veränderung festzustellen: Gab es zuvor noch keine verbindlichen Regeln, nach denen der Verleger über den Inhalt seiner Bücher verfügen konnte, so kristallisierte sich nun in der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft der Typus des selbständigen Autors heraus. Eines Autors, der sich nun als verfügungsberechtigte Autorität für seinen Text verstand und der eine Beteiligung an der ökonomischen Verwertung seiner Arbeit fordern konnte.
Dass ein ›Honorarium‹ fortan nicht mehr nur freiwillig oder gelegentlich gezahlter Ehrensold sein sollte, sondern, wie es heute heißt, eine ›Vergütung‹, deren Höhe möglichst dem Grundsatz der Angemessenheit zu entsprechen hat, das war damals noch keineswegs selbstverständlich.
Von hier war es aber noch ein weiter Weg bis zur Herausbildung und Kodifizierung des Urheberrechts, das schließlich im Welturheberrechtsabkommen vom 6. September 1952 festgelegt wurde. Dieses internationale Abkommen, dem mit wenigen Ausnahmen wie der Volksrepublik China und Nordkorea alle Staaten beigetreten sind, schützt das eigenständige Werk und sichert seinem Urheber die inhaltliche und wirtschaftliche Verfügungsgewalt darüber. Wir denken alle, dass das selbstverständlich ist, aber Verlage und Autoren müssen sich gerade in Deutschland derzeit mit einer Gesetzesnovelle herumschlagen, der die Vorstellung zugrunde liegt, dass geistiges Eigentum in öffentlichen Besitz gehört und als public domain im Internet kostenlos zugänglich sein sollte. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich diese Auffassung nicht teile. Vielmehr halte ich das bisherige Urheberrecht für eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften und für den Garanten einer produktiven geistigen Kultur.
Aber zurück in die Geschichte: An der Schwelle zur Herausbildung der heutigen Vertragsbeziehung zwischen Autor und Verleger standen auch die vielfältigen Versuche von Autoren, selbst in die Rolle des Verlegers einzutreten: 1766 gründeten Bode und Lessing ihren Verlag, in dem die Hamburgische Dramaturgie erschien. 1773 unternahm Klopstock in eigener Regie die Publikation der Deutschen Gelehrtenrepublik, und im gleichen Jahr betrieb Wieland die Gründung des Teutschen Merkur. All diese Versuche schlugen fehl und endeten nicht selten im wirtschaftlichen Desaster, häufig mit einem Schuldenberg bei den Autoren.
Lessing schrieb an seinen Bruder: »Ich stecke hier in Schulden bis über die Ohren und sehe schlechterdings noch nicht ab, wie ich mit Ehren wegkommen will.«[3] So war es dann auch. Er floh aus Hamburg, und weder sein Wolfenbütteler Gehalt als Bibliothekar des Herzogs noch die Versteigerung seiner gesamten privaten Bibliothek konnten ihn jemals von dieser Last befreien. Sie kennen diese traurige Geschichte aus den anrührenden Briefen, die er mit Eva König wechselte. Als er schließlich finanziell halbwegs auf den grünen Zweig zu kommen schien, da starb sie dann zusammen mit dem neugeborenen Söhnchen.
»Ich wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen«,[4] schrieb er an seinen Freund Eschenburg. (31. Dezember 1777)
Aber nicht nur um Honorare, nicht nur um die wirtschaftliche Beziehung zwischen Autor und Verlag geht es, wenn wir uns der Verlagsgeschichte zuwenden.
Verlagsgeschichte ist auch ein Teil der Literaturgeschichte: Verlage und Verleger stehen in den Zeiten ihrer Wirksamkeit nicht selten für Kulturen, für wissenschaftliche und künstlerische Strömungen, die sie bündeln, fördern, verteidigen oder durchsetzen. In diesem Sinne sind Verlage immer auch Teil eines komplexen Repräsentationssystems des zeitgenössischen Wissens und der ästhetischen Anschauungen einer Zeit.
Philipp Erasmus Reich beispielsweise verlegte mit Christian Gottlob Heyne, Johann Georg Sulzer, Johann Caspar Lavater, Karl Wilhelm Ramler, Niemeyer, Thümmel und natürlich seinen Stars Lessing und Wieland die großen Autoren der Aufklärung. Aufklärung im Sinne einer umfassenden Neugestaltung des Lebens und Denkens durch den Mut zum Gebrauch der eigenen Verstandeskräfte war sein Programm.
Als ein wichtiger Verlag der Aufklärung ist auch Johann Friedrich Hartknoch in Riga zu nennen, bei dem Herders Schriften erschienen und der 1781 Kants Kritik der reinen Vernunft herausbrachte.
Das wohl bekannteste Beispiel dafür, wie ein Verlag die bedeutendsten Geister seiner Zeit vereinigen und propagieren kann, ist vermutlich Cotta. Ein bescheidener Mann in seinen winzigen und mit Büchern vollgestopften Tübinger Geschäftsräumen. So beschreibt ihn Karl August Varnhagen von Ense im Tagebuch:
Ich glaubte meinen Augen nicht, als ich nach der Cottaschen Buchhandlung fragte, und man mich in ein Lädchen wies, wo ich mich fast schämte einzutreten; so winzig, eng und schmucklos hab’ ich neue Bücher noch nie wohnen sehen, alte wohl! Und noch dazu ist dies der Ort, wo die Schiller und Goethe recht eigentlich zuhause sind![5] (Tübingen 1808-1809)
Wie kein Verleger zuvor verstand es Cotta, in seinem Verlag die meisten Autoren der später so genannten ›klassischen‹ Literatur zu vereinigen. Neben Goethe und Schiller erschienen dort Jean Paul, Hölderlin, Uhland, Schwab und Fichte, Schelling und Schlegel – das geistige Deutschland seiner Zeit. Eben der »Ort, wo die Schiller und Goethe recht eigentlich zuhause sind!«.
Solche Verlagskulturen und programmatischen Zusammenballungen hat es seither immer wieder gegeben. Denken Sie an Julius Campe, den Verleger des Jungen Deutschland, der natürlich auch Heines Verleger war; ein Fuchs im Umgehen der Zensur; ein Meister in der schnellen Durchsetzung im Handel, ausgestattet mit sicherem Instinkt für den Markt.
Wenn »›die ersten Oefen zu knistern beginnen‹«, schreibt er im August 1851 an Heine, »dann ist Romanzero-Zeit«,[6] und so drängt er ihn zur schnelleren Fertigstellung des Manuskripts. Und er war Heines Freund, auch wenn der gelegentlich maulte: »Der Weg von Ihrem Herzen zu Ihrer Tasche ist sehr weit.«[7]
Ich könnte mit der Aufzählung noch lange fortfahren, aber das will ich Ihnen und mir ersparen: Mir geht es vielmehr darum, Sie auf ein Kriterium hinzuweisen, das uns bei den Verlegern des 20. Jahrhunderts noch beschäftigen soll: Nämlich, dass Verlage und Verlegerpersönlichkeiten fast immer für bestimmte literarische, politische oder wissenschaftliche Überzeugungen und Tendenzen gestanden haben. Je forcierter ihr Einsatz, desto größer war oftmals, wenn nicht gerade der wirtschaftliche Erfolg, so doch der Nachruhm. Änderten sich die Zeiten oder fehlte es an Ideen und Entschlossenheit, so verschwanden die einst großen Namen wieder. Damit müssen wir uns wohl abfinden, dass zwar die Bücher lange wirken, Verlage aber vergänglich sind.
Von den großen Namen am Beginn des 20. Jahrhunderts gehören Fischer, Rowohlt und Piper heute zu großen Medienkonzernen. Kurt Wolff gab seinen deutschen Verlag bereits in den zwanziger Jahren auf. Wir haben Verlage aufsteigen sehen, und wir werden es erleben, dass wichtige Verlage wieder herabsinken. So war es immer.
Aber lassen Sie mich noch einen Schritt ins 19. Jahrhundert tun, denn dies war – durchaus vergleichbar mit der letzten Dekade des 20. und der ersten des 21. Jahrhunderts – eine Zeit des rapiden Umbruchs in Buchhandel und Verlagswesen.
Noch hatte das Buch einen bildungselitären Status und war in seiner Wert-Kaufkraft-Relation weitgehend einer gehobenen Bildungsschicht vorbehalten, doch zugleich beginnt das Buch im 19. Jahrhundert die Konturen eines modernen Massenmediums anzunehmen.
Begünstigt durch die preußische Initiative zum Deutschen Zollverein ließ sich der grenzüberschreitende Buchhandel in den deutschen Territorien effizienter organisieren. Buchhändler und Verleger hatten sich bereits 1825 in Leipzig zum Börsenverein der Deutschen Buchhändler zusammengeschlossen.
Mit der sogenannten Kröner’schen Reform, benannt nach dem damaligen Vorsitzenden des Börsenvereins, dem Verleger Alfred Kröner, wurde 1887 eine Vereinbarung über den einheitlichen Verkaufspreis von Büchern in ganz Deutschland getroffen. Die Preisbindung wurde zum Fundament des Buchhandels, wie wir ihn heute kennen.
Und an eine andere Rahmenbedingung ist zu erinnern: Die Pressefreiheit war erstmals 1815 in der »Deutschen Bundesakte« fixiert worden, aber schon die Karlsbader Beschlüsse von 1819 machten dies wieder rückgängig. Sie verpflichteten den Verleger, jedes Druckwerk von bis zu 20 Bogen Umfang der Zensur vorzulegen. Eine Bestimmung, die sich natürlich in erster Linie gegen Zeitungen und Flugschriften richtete.
Ferdinand I. hob 1848 die Zensur in Österreich auf, und 1854 regelte der Deutsche Bund die Pressefreiheit, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. In der Folge der Reichsgründung von 1871 wurde weitgehende Pressefreiheit eingeräumt, auch wenn schon 1878 Bismarcks Sozialistengesetze Rückschläge bedeuteten.
Eine weitere wichtige Veränderung war selbstverständlich der technische Fortschritt. Rationalisierung im Satz, die Entwicklung von Linotype- und Monotype-Maschinen. Nun wurden nicht mehr einzelne nach Matrizen gegossene Lettern manuell zu Wörtern und Zeilen gefügt, sondern ganze Zeilen oder Seiten wurden mechanisch als Matrizen gesetzt und dann komplett in Blei gegossen. Das bedeutete eine erhebliche Beschleunigung des Vorgangs. Hinzu kam die weitere Mechanisierung der Drucktechnik mit Schnellpressen und neuen Verfahren der Papierherstellung.
Ein anderer entscheidender Wendepunkt für die literarischen Verlage war der Beschluss des Deutschen Bundes vom 9. November 1867, der festlegte, dass die Verlagsrechte für alle Autoren, die vor dem 9. November 1837 gestorben waren, mit diesem Tag erloschen. 1867 ging als ›Klassikerjahr‹ in die Geschichte des Buchhandels ein. Die Cotta’sche Buchhandlung verlor damit praktisch über Nacht alle Privilegien, die ihr den Rang als bedeutendster literarischer Verlag über viele Jahre gesichert hatten.
Der Buchhandel wurde nun von preiswerten Klassikerausgaben geradezu überschwemmt. Es erschienen die ersten Lieferungen von Meyers Bibliothek deutscher Nationalliteratur, von Hempels Nationalbibliothek sämtlicher deutscher Classiker und auch die ersten fünfunddreißig Hefte von Reclams Universal-Bibliothek.
Plötzlich waren Bücher für Pfennigbeträge zu kaufen. Ein Vorgang, der für die gesellschaftliche Veränderung und das Niederreißen von Bildungsschranken vermutlich wirkungsvoller war als alle Bildungsreformen der sechziger, siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, über die wir uns ja spätestens seit Pisa ohnehin keine Illusionen mehr machen.
Das Jahr 1867, das ›Klassikerjahr‹, ist die vielleicht folgenreichste Bedingung für die Entstehung einer literarischen Öffentlichkeit. Es markiert wie kaum ein anderer Zeitpunkt das, was Jürgen Habermas den »Strukturwandel der Öffentlichkeit« genannt hat.
Lassen Sie mich zusammenfassen: Wie ich es eingangs als Witz formuliert habe, ist es natürlich bei jeder verlegerischen Tätigkeit von zentraler Bedeutung, ob ein Verlag auf der Basis von vorhandenem Kapital gegründet wird oder ob er allein aus einer verlegerischen Vision heraus entwickelt wird und sich behaupten muss.
Ferner: Für die Verleger im 20. Jahrhundert gilt genau wie bereits im 18. und 19. Jahrhundert, dass Programmlinien und Verlagskulturen eine zentrale Bedingung für das Erreichen einer guten Marktposition sind.
Und lassen Sie mich hier ergänzen: Ein Verlag arbeitet in zwei Märkten. In einem Markt ist er Käufer, nämlich dort, wo es darum geht, Autoren und Werke für den Verlag zu gewinnen. Im anderen Markt ist er Verkäufer, nämlich dort, wo er seine Bücher im Handel platzieren will. In beiden Märkten muss sich die Zugkraft seiner Marke, seines Programmprofils bewähren, sonst bleibt der Erfolg aus.
Anton Kippenberg setzte einerseits auf tradierte Werte, allen voran auf Goethes Werke. »Einen Einzigen verehren« – das war sein Motto. Zugleich war er aber Pionier und Verfechter des schönen und luxuriösen Buchs. Er wurde mit seiner Erfindung der Insel-Bücherei zum kulturellen Stichwortgeber bildungsbürgerlicher Generationen und hat mit dieser Buchreihe, die übrigens als einzige einen regelrechten Fanclub hat, eine der beständigsten Marken der letzten 100 Jahre geschaffen.
Im 19. Jahrhundert entstehen durch die Pressefreiheit und die Aufhebung der Zollschranken schließlich die Rahmenbedingungen, die neben Mechanisierung und rapider technischer Innovation dem Buchhandel und dem Verlagswesen am Ausgang des Jahrhunderts ein völlig neues Gesicht geben.
Das Klassikerjahr 1867 und die Kröner’sche Reform von 1887 schließlich prägen die Ausgangssituation, welche die Verleger des 20. Jahrhunderts, die Visionäre und Realisten, bei ihren Verlagsgründungen vorfinden.
Keiner der Verlage, die das literarische Leben des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt haben, wurde deutlich vor 1887 gegründet. Die überwiegende Zahl der Verlage, über die wir hier sprechen, wurde erst nach der Jahrhundertwende gegründet. Und gleichzeitig: Keiner der literarischen Verlage, die unseren Begriff von der Literatur des 19. Jahrhunderts prägen, konnte seine herausragende Bedeutung in das 20. Jahrhundert hinüberretten. Sie sehen: Es gibt keine Bestandsgarantie für Verlage!
Bevor wir nun zu den großen Verlegern des 20. Jahrhunderts kommen, erlauben Sie mir noch eine weitere grundsätzliche Vorüberlegung.
Kaum eine Branche genießt in unserer Zeit ein vergleichsweise so hohes Sozialprestige wie die Verlagsbranche. In diesem Prestige laufen die unterschiedlichsten Aspekte sozialer und intellektueller Selbst- und vor allem Fremdzuschreibungen zusammen. Die Öffentlichkeit nimmt an den Events der Branche so regen Anteil, wie sie es sonst nur bei sportlichen und gelegentlich politischen Ereignissen von nationaler Bedeutung tut. Die Eröffnung der Buchmessen in Leipzig und Frankfurt findet breiten Raum in den 20-Uhr-Nachrichten, und das Schicksal einzelner Verlage wird von den Feuilletons der größten Zeitungen begrübelt, als stünde der Untergang des Abendlandes bevor.
Da ist es heilsam, sich vor Augen zu führen, dass die gesamte Buchbranche am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland einen lächerlich geringen Anteil hat.
Mit etwa 9 Milliarden Euro Jahresumsatz hat die gesamte Buchbranche nämlich ein Geschäftsvolumen, das deutlich unter dem von Aldi-Süd liegt.
Wie kommt es also, dass ausgerechnet den Verlegerinnen und Verlegern eine so große Aufmerksamkeit geschenkt wird? Wie kommt es, dass unter orientierungslosen und manchmal auch leicht verwirrten Jugendlichen der Berufswunsch Verleger oder Lektor relativ hoch im Kurs steht?
Das war nicht immer so, denn natürlich gibt es den notorischen Interessengegensatz zwischen Autor und Verleger. Es gibt das alte Vorurteil: Der Autor ist arm, und der Verleger ist reich. Auch heißt es nicht selten: »Die Verleger trinken Sekt aus den Hirnschalen der Autoren.«
Und auch Goethe dachte nicht immer freundlich über die Branche: »Die Buchhändler« – damit waren damals, wie gesagt, die Verleger gemeint – »sind alle des Teufels, für sie muß es eine eigene Hölle geben.«[8] Und Friedrich Hebbel bemerkte, dass es leichter sei, »mit Christus über den Wogen zu wandeln, als mit einem Verleger durchs Leben«.[9]
Und heute, nachdem auch die Gegensätze von Kapital und Arbeit niemanden mehr so richtig in Wallung bringen und selbst Günter Grass vergessen hat, dass er einmal für ein sozialistisches und basisdemokratisches Verlagsstatut mit Verteilung der gemeinsam erzielten Gewinne plädiert hat, heute also erfreuen sich Verlegerinnen und Verleger einer Wertschätzung wie kaum eine andere Gruppe mittelständischer Unternehmer.
Ich habe den Eindruck, dass die großen Verleger im 20. Jahrhundert ein positives Bild geprägt haben, von dem die Branche heute noch zehrt.
Die zuvor beschriebenen Veränderungen und Innovationsschübe des 19. Jahrhunderts haben, wie ich zu zeigen versuchte, die Bedingungen für die Herausbildungen desjenigen Verlegertypus geschaffen, den man in der Verlagsgeschichtsschreibung als den Typus des ›Kulturverlegers‹ bezeichnet. Diesen Typus, um es gleich mit einem Beispiel zu belegen, verkörpert Samuel Fischer in Reinkultur.
Am 24. Dezember 1859 wurde Samuel Fischer in einer oberungarischen Kleinstadt geboren. Das Städtchen war kulturell von den deutschsprachigen jüdischen Kleinbürgern geprägt. Es gab dort eine Buchhandlung, eine Lesegesellschaft und ein aufgeklärt-jüdisches Privatgymnasium. Es liegt nahe, dass Fischers geistige Prägung maßgeblich von den Klassikerausgaben nach 1867 beeinflusst war. Für das ostjüdische Kleinbürgertum war die deutsche Literatur, also die Kompetenz im Umgang mit der deutschen Sprache und Literatur die wichtigste Qualifikation, mit der das Ziel der Assimilation und des gesellschaftlichen Aufstiegs erreicht werden konnten.
Und ich glaube außerdem, dass ich diese Interpretation nicht überspanne, wenn ich behaupte, dass Fischers später so deutlich ausgeprägte Neigung zu repräsentativen Gesamtausgaben daher rührt. Er sah seine Autoren nicht als Autoren einzelner Bücher, sondern als Autoren von Werken, die er durch repräsentativ gestaltete und sorgfältig edierte Werkausgaben als ›Klassiker‹ propagieren konnte.
Es beginnt mit der großartigen Ibsen-Ausgabe, die, weil sie damals sogar in Schweden noch ungedruckte Stücke enthielt, das Vorbild für die später erschienene schwedische Gesamtausgabe wurde. Denken Sie an die Werkausgaben von Gerhart Hauptmann, der als junger naturalistischer Umstürzler begonnen hatte. Denken Sie an Die Weber – und vergegenwärtigen Sie sich Bismarcks Sozialistengesetze –, Die Ratten, Michael Kramer, Vor Sonnenaufgang, und dieser Autor findet sich schon wenige Jahre später in einer repräsentativen Werkausgabe, die – je nach Bedürfnis und Geldbeutel – in Pappe, Halbleinen, Ganzleinen oder Leder angeboten wurde.
Denken Sie an die Ausgaben von Arthur Schnitzler, Alfred Kerr, Richard Dehmel, Thomas Mann, Hermann Hesse oder Jakob Wassermann, George Bernard Shaw und Eduard von Keyserling, Hugo von Hofmannsthal oder Peter Altenberg …
Sie merken, ich komme ins Schwärmen. Also zurück zu den Anfängen: 1874 geht Fischer allein und völlig mittellos nach Wien. Er kennt niemanden dort und ist einer von den Tausenden, die aus dem Schtetl in die habsburgische Metropole strömen. Sechs Jahre bleibt er dort. Später hat er nicht viel über diese Zeit gesprochen. Wir kennen nicht einmal den Namen der Buchhandlung, in der er gelernt hat. Er muss unendlich viel gelesen haben und besucht die Abendkurse einer Handelsschule.
1880 geht er als Buchhandelsgehilfe nach Berlin und tritt in die »Central-Buchhandlung« von Hugo Steinitz ein. 1883 gründet er zusammen mit Steinitz seinen ersten Verlag, »Steinitz & Fischer«. Bei weitem ist das kein literarischer Verlag, so weit ist es noch nicht, und außer seinen buchhändlerischen Kenntnissen und seiner Arbeitskraft kann er kein Kapital einbringen. Steinitz & Fischer verlegen Eisenbahnkursbücher, Reiseführer und Fachzeitschriften, darunter den wirtschaftlich sehr erfolgreichen Berliner Hotel-Courier. In diesen Jahren lernt Fischer die damalige Literaturszene Berlins kennen, mit Autoren wie Carl Bleibtreu, Max Kretzer und August Scholz. Aber glauben Sie nicht, dass er für den Start seines eigenen Verlags auf diese Autoren setzt. Das hätte doch eigentlich nahegelegen. Nein. Im Gegenteil! Es ist sogar fast umgekehrt. Als er sich 1886 von Steinitz trennt und seinen Verlag gründet, setzt er zunächst die lukrativen Projekte fort, die aus dem früheren Verlag an ihn übergegangen sind. Er agiert planvoll und präzise. An finanzielle Experimente darf er nicht denken, denn noch immer fehlt ihm jeder größere ökonomische Rückhalt, aus dem er Risiken abfedern könnte.
Und nun geht er den entscheidenden Schritt: In der literarischen Konturierung seines eigenen Verlags setzt er weder auf die damaligen Autoren Berlins, mit denen er geselligen Umgang pflegt, noch setzt er auf die vielleicht am leichtesten konsumierbare und am besten zu vermarktende Gattung Roman. Er tut geradezu das Gegenteil. Das erste literarische Werk seines Verlags ist Ibsens Stück Rosmersholm. Die erste Auflage beträgt die damals üblichen 1.000 Exemplare. Es folgen Ibsens Wildente und Zolas Drama Thérèse Raquin sowie Tolstois dramatisches Sittenbild Die Macht der Finsternis. Wie konnte das gehen? Hatte denn jemals ein deutscher Verleger mit Bühnenwerken, zumal mit übersetzten Bühnenwerken, Geld verdient? Und das angesichts der Tatsache, dass Fischer zwar die Buchrechte besaß, nicht aber die lukrativen Bühnenrechte an diesen Texten.
Sechs Titel kann sich Fischer im literarischen Startprogramm leisten, ohne seine finanziellen Möglichkeiten zu überspannen, und er trifft damit eine programmatische Setzung.
Man kann über die Gründe seiner konzeptionellen Entscheidung nur Mutmaßungen anstellen, denn von ihm haben wir darüber keinen Bericht. Denkbar ist, dass seine ganz persönliche Theaterleidenschaft ausschlaggebend war. Ich neige aber zu einer anderen Deutung, nämlich, dass Fischer spürte, dass die literarische Erneuerung seiner Zeit nicht aus der erzählenden Prosa, sondern von der Bühne kommen würde. Er setzt konsequent auf die Bühnenwerke der Naturalisten. Mit untrüglichem Gespür für ihre innovative Kraft und ihren neuen, revolutionären Ton gelingt es ihm in kürzester Zeit, sein Unternehmen zum literarisch fortschrittlichsten Verlag auszubauen. Wohlgemerkt – auf bescheidenster ökonomischer Basis.
In nur wenigen Jahren erreicht er im literarischen Markt das Ansehen, der ›Cotta des Naturalismus‹ zu sein.
Ich berufe mich bei meiner Interpretation auf ein Gespräch zwischen Franz Pfemfert und Samuel Fischer, das 1914 in der Aktion gedruckt wurde und in dem Fischer sehr deutlich seine Position bestimmt:
Dem Publikum Werte aufzudrängen, die es nicht will, ist die wichtigste und schönste Mission des Verlegers. Setzt er sich für etwas ein, was in die Zukunft hinein Leben verspricht, so kann der Sieg, sofern seine Sache gut ist, früher oder später nicht ausbleiben.[10]
»Dem Publikum Werte aufzudrängen, die es nicht will …« –
Das ist es wohl, was wir meinen, wenn wir von Samuel Fischer als dem Typus des ›Kulturverlegers‹ in seiner vielleicht vollkommensten Ausprägung sprechen. An seiner überragenden Leistung gewinnen wir die Maßstäbe, die uns in der Bewertung, aber auch in der Analyse der »Realisten und Visionäre« helfen können.
Thomas Mann hat 1934 in einer rührend freundschaftlichen Rede »In memoriam S. Fischer« gesagt:
Ich war ein elfjähriges Kind, als er in Berlin seinen Verlag gründete. Zehn Jahre später war es der Traum jedes jungen Literaten, ein Buch bei S. Fischer zu haben, und meiner auch. Als mir dann […] dieser Vorzug zuteil wurde, meine ersten Novellen und die »Buddenbrooks« bei Fischer erschienen und ich in persönliche Beziehungen zu ihm trat, bewohnte er schon eine elegante Etage in der Fasanenstraße, wo ich auf Abendgesellschaften Hauptmann, Rittner, die Lehmann, seinen klugen Lektor Moritz Heimann traf […]. Nicht lange mehr, und es kam die Grunewaldvilla, […] das eigene Auto, das den kleinen Einwanderer von einst alltäglich in sein weitläufiges Geschäftshaus in der Bülowstraße trug, es kam die Klassizität, die Zeit der Gesamtausgaben.[11]
Und noch etwas: Thomas Mann ist sich völlig bewusst, dass sein wirtschaftlicher Erfolg maßgeblich von Fischers bedachter und kluger Geschäftsführung abhing, einer Bedachtsamkeit, der es im richtigen Moment jedoch nicht an mutiger und zupackender Entscheidungskraft mangelte.
Und weiter sagt Thomas Mann: »Er [Fischer] war keine katilinarische Existenz, keine Märtyrernatur, die in einer Dachstube endet, wie sie begonnen. Er war von Natur ein Glückskind, für die Sonnenseite des Lebens geboren.«[12]
Das war gewiss richtig beobachtet und doch vielleicht auch nicht ganz zutreffend, denn Fischers Energie und Tatkraft war immer auch einer tiefen Melancholie abgerungen. Einer Melancholie, die sich 1913 durch den unerwarteten Tod des sehr geliebten einzigen Sohns bis zur Depression steigerte. Fischer war sicher nicht der vitale und kraftstrotzende, ins Gelingen verliebte Impresario des Literaturbetriebs, als den wir dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Siegfried Unseld erlebt haben. Fischers Schwiegersohn und Nachfolger Gottfried Bermann Fischer war dies viel eher und diese Eigenschaften musste er haben, um mit immer neuen Ideen nach 1933 den Verlag zunächst nach Wien, dann Amsterdam und Stockholm und schließlich in Amerika über die Zeit zu retten, um ihn nach dem Krieg endlich wieder nach Deutschland zurückbringen zu können.
Lassen Sie mich noch auf einen ganz spezifischen Sachverhalt zu sprechen kommen: Schon 1890, also im dritten Jahr der eigenen Verlagsproduktion, gründet Fischer eine Zeitschrift mit dem Titel Freie Bühne für modernes Leben. Herausgeber ist der damals einflussreiche Theaterkritiker Otto Brahm, ein enger Freund und Vertrauter Fischers. Aus der Freien Bühne wird dann wenige Jahre später die Neue Rundschau, die noch bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das Flagschiff unter den deutschen Literatur- und Kulturzeitschriften sein wird.
Diese Zeitschrift scheint mir insofern wichtig und zukunftsweisend, weil Fischer sie konsequent als Instrument zur Bekanntmachung und Einführung neuer Autoren und Werke nutzt. Neue Namen stehen hier neben den bereits Etablierten und profitieren somit von deren Glanz. Hier bereitet der Verlag seine Debüts vor, hier werden die Linien der Kritik aufgebaut, und hier wird die Rezeption quasi vorformuliert. Von den Anfängen mit fast ausschließlich Bühnenwerken entwickelt sich die Neue Rundschau rasch zu einem Organ, das allen Genres offensteht und in dem sich die brillantesten Essays der ersten Jahrhunderthälfte finden. Die Neue Rundschau ist ein Instrument der Verlagswerbung, das auf inhaltliche Überzeugung und keineswegs auf flotte Sprüche des Marketings setzt. Bis zum Lebensende hütet Fischer die Zeitschrift wie seinen Augapfel, und es ist kein Zufall, dass man bei der Wahl des – sagen wir – Statthalters für die emigrierte Familie Fischer ausgerechnet auf den damals leitenden Redakteur der Neuen Rundschau, nämlich Peter Suhrkamp, zurückgreift, der den arisierten Verlag in Deutschland im Sinne der früheren Eigentümer treuhänderisch mit denjenigen Autoren weiterführen soll, die nicht verboten und vertrieben sind.
Meine Damen und Herren, es ist Ihnen nicht verborgen geblieben, wer der Held dieser Erzählung ist. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich demjenigen Verleger so breiten Raum in meinem Vortrag gegeben habe, der nach meinem Verständnis den für das 20. Jahrhundert herausragenden Typus des ›Kulturverlegers‹, des »Visionärs und Realisten« am vollkommensten repräsentiert. Samuel Fischer ist der Verleger, an dessen Werk wir nicht vorbeikommen und zu dem sich jeder gedanklich in Beziehung setzen muss, der im 20. Jahrhundert in diesen herrlichen Beruf eintritt.
Über der Tür von Siegfried Unselds Arbeitszimmer hing das Foto von Peter Suhrkamp, der Samuel Fischers Statthalter und dann quasi Nachfolger war. Unseld hat sich, und das ist durchaus folgerichtig, gewissermaßen als Fischers ›Enkel‹ und Suhrkamps ›Sohn‹ und bestimmt auch als Fortsetzer und Vollender ihres Werkes gesehen. Der Abstand zu seinem Tod ist noch zu kurz, als dass ein gerechtes Urteil darüber heute möglich wäre.
Sicher ist nur so viel – und das kann ich aus der Erinnerung des einen Jahres unserer Zusammenarbeit sagen –, sicher ist so viel, dass Unseld immer wieder in schwierigen Entscheidungen auf S. Fischer und Suhrkamp zu sprechen kam, gleichsam als wollte er sich bei ihnen vergewissern oder doch zumindest aus ihrem Handeln die Kriterien seiner eigenen Entscheidungen ableiten. Und doch steht Unseld als herausragende Verlegerpersönlichkeit der zweiten Jahrhunderthälfte für einen anderen Typus. Er ist nicht Gründer, sondern Nachfolger, der auf ein ökonomisch zwar nicht sehr großes, aber doch inhaltlich geradezu legendäres Fundament bauen konnte. Dieses ständig auszuweiten und als »Verpackungskünstler«, wie Peter Suhrkamp ihn einmal genannt hat, dem Publikum ständig neu anzubieten und zu immer neuen Verkaufserfolgen zu führen, ist ein wesentlicher Teil seines Erfolgs.
Aber in einem anderen Sinne war Siegfried Unseld paradigmatisch. Obwohl er nie alleiniger Inhaber des Verlags war, über die längste Zeit nicht einmal die Mehrheit der Geschäftsanteile besaß, hat er sich öffentlich immer als »persönlich haftender Gesellschafter« bezeichnet. Das ist bei Kapitalgesellschaften zwar vom Handelsrecht meistens auch gar nicht anders vorgesehen, aber Unseld hat daraus einen besonderen Nachweis sowohl für seine Entschlossenheit als auch für seine umfassende Verantwortung abgeleitet. Verantwortung aber für Autoren und Werke, der Entschluss, sich für literarische Werte einzusetzen und diese notfalls auch gegen den herrschenden Trend durchzusetzen, persönlich für sie zu haften, das ist es, was die großen Verleger immer ausgezeichnet hat.
Verantwortung in diesem umfassenden Sinne kann ein angestellter Verlagsleiter kaum übernehmen, und das zeichnet die »Visionäre und Realisten« auch heute noch aus.
Mit seiner Taschenbuchreihe der edition suhrkamp, für die Willy Fleckhaus die geniale Idee der Regenbogenfarben hatte, mit dieser Edition, die ihm bis ans Lebensende außerordentlich wichtig war, hat Siegfried Unseld dem Verlag, wenn Sie so wollen, das ›funktionale Äquivalent‹ zu Fischers Neuer Rundschau gegeben. Und ähnlich müssen wir die bereits 1954 gegründete Zeitschrift Akzente des Hanser Verlags bewerten, die wohl einzige Literaturzeitschrift in der Obhut eines Verlages, die noch heute die Funktion erfüllen kann, die Fischer in der Neuen Rundschau sah.
Mit Walter Höllerer hatte die Zeitschrift über Jahre einen Lotsen auf den unruhigen literarischen Gewässern an Bord, der von hier aus das Programm des Verlags sowohl mitbestimmen als auch unterstützen konnte.
Michael Krüger, der heutige Hanser-Verleger, hat es so beschrieben: »In Walter Höllerer hatte ich einen Freund und Mentor, der mir überall Einblick verschaffte. Er war einer der Herausgeber der Zeitschrift Akzente […] beim Hanser Verlag.«[13]
Mit Michael Krüger tritt abermals, wie zuvor Peter Suhrkamp, ein junger Mann, der sich zunächst als Drucker und Buchhändler in den literarischen Kreisen von London und Berlin getummelt hat, aus dem Umfeld der Zeitschrift in das Lektorat des Verlags ein.
Über seine Laufbahn als Verleger sagt Krüger:
Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Verlag zu gründen, und immer bewundert, wenn andere das konnten. […] Das sind alles sehr bewunderungswürdige Kollegen, das sind aber auch alles Leute, die irgendwo ein bisschen Geld herumliegen hatten oder ein Erbe. Und da ich immer über viele Ideen, jedoch nie über Geld verfügte, hat sich das nicht ergeben.[14]
Wahrscheinlich macht es sich Michael Krüger mit dieser Beschreibung auch etwas zu einfach, und ich weiß nicht genau, an welche Kollegen er hier gedacht haben mag. An Samuel Fischer bestimmt nicht, denn genau wie Reinhard Piper stand am Beginn seiner Laufbahn kein großes Vermögen. Und unter den Jüngeren war Klaus Wagenbach nicht wohlhabend, und weder Egon Ammann noch Klaus Schöffling sind, soweit ich weiß, reich.
Aber es ist natürlich richtig, dass sowohl unter den Verlagsgründungen vor dem Ersten Weltkrieg als auch unter den späteren ›Kulturverlegern‹ häufig solche waren, die sich auf bedeutende Vermögen stützen konnten. Denken Sie an Albert Langen in München, an Kurt Wolff, dem neben seinem eigenen auch das Vermögen seiner Frau Elisabeth Merck, aus der sehr reichen Darmstädter Chemiefabrikantenfamilie, zur Verfügung stand, oder an Alfred Walter Heymel, den Gründer der »Insel«.
Ernst Rowohlt hingegen und Eugen Diederichs waren nicht wohlhabend, als sie ihre Verlage gründeten. Und auch Anton Kippenberg musste sich aus bescheidenen Anfängen emporarbeiten.
Bei allen unterschiedlichen Voraussetzungen verbindet sie jedoch ein zentrales Movens: Sie alle sind durchdrungen von einer Literatur- oder Kunstrichtung, die sie erkennen und mit aller Kraft propagieren und durchsetzen wollen.
»Dem Publikum Werte aufzudrängen, die es nicht will, ist die wichtigste und schönste Mission des Verlegers« – so hat es Samuel Fischer formuliert, und dieser Satz wetterleuchtete in der einen oder anderen Form in den Köpfen derer, zu denen wir heute als den großen Verlegern des 20. Jahrhunderts aufblicken.
Nach Siegfried Unselds Tod ist es wohl Michael Krüger, dem die Rolle ›des deutschen Verlegers‹ gleichsam zugewachsen ist. Neben seinem untrüglichen Gespür für literarische Qualität und seinem Sinn für die Eigenart neuer literarischer Stimmen ist es die Freundschaftsbegabung, die ihn mit seinen Autoren und dem ganzen Gewimmel des Literaturbetriebs verbindet.
Auf seine Weise ist Michael Krüger ein Phänomen, und alle rätseln, wie er schafft, was er schafft, als Verleger, Lektor, Autor, Freund, Festredner usw. usw.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die großen Verleger des 20. Jahrhunderts – waren sie »Visionäre und Realisten«? Ich glaube schon, denn das eine hätte ohne das andere nie einen glücklichen Fortgang nehmen können.
»Visionäre und Realisten« also, und damit ist der Titel der schönen Ausstellung mehr als gerechtfertigt. »Visionäre und Realisten« waren sie, und das sollten wir Jüngeren uns bewahren, um Ihnen die »Werte aufzudrängen«, die Sie nicht wollen, denn das »ist die wichtigste und schönste Mission des Verlegers.«
»Offen sein für das Heutige,offen bleiben für das Gestrige«
Die Anfänge des Kurt Wolff Verlagszwischen Goethezeit und Expressionismus
Nicht erst seit der grundlegenden Studie von Wolfram Göbel[1] hat sich das Interesse an Kurt Wolff und seinem Verlag ganz überwiegend auf Aspekte der »Wirkungsgeschichte«[2] konzentriert. Dabei stand die Frage nach der Bedeutung dieses Verlags im »literarischen Leben«[3] und besonders im Hinblick auf die Verbreitung und Durchsetzung der Literatur des Frühexpressionismus im Vordergrund. Bereits im Zuge der Wiederentdeckung der im Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Autoren wurde der Kurt Wolff Verlag als der Verlag des Expressionismus schlechthin angesehen. Seither steht die Buchreihe Der Jüngste Tag gleichsam als pars pro toto für die programmatische Ausrichtung dieses Verlags. Zwar bietet Der Jüngste Tag mit seinen 86 Nummern in 73 Bänden, die zwischen 1913 und 1921 erschienen, einen »repräsentativen Querschnitt durch die expressionistische Literatur«[4] und ist mit seiner großen Zahl von literarischen Debüts zweifelsohne die wichtigste expressionistische Buchreihe, dennoch greift die Fokussierung auf den Jüngsten Tag für eine Beschreibung des Kurt Wolff Verlags in seiner literaturhistorischen und literatursoziologischen Bedeutung und besonders für eine verlagsökonomische Betrachtung entschieden zu kurz.
Dass sich allerdings auch für die Buchreihe Der Jüngste Tag inzwischen eine verkürzende Sichtweise eingebürgert hat, zeigt allein schon der Umstand, dass als verbindliches Ausstattungskennzeichen heute üblicherweise der schwarze Umschlagkarton mit den geklebten farbigen Titelschildern angesehen wird. Tatsächlich waren die Bände aber sowohl in ihrer Umschlagtypographie als auch in der gesamten Ausstattung zunächst durchaus heterogen. Während es in den ersten Jahren Umschläge gab, die auf hellem Karton mit Lithographien gestaltet waren, kamen daneben auch rein typographische Umschläge vor. Als Ausstattungsvarianten finden sich Broschuren neben Papp- und Halbpergamentbänden. Die Verwendung des einheitlichen schwarzen Umschlagkartons war erst eine Reaktion auf die Materialknappheit während des Ersten Weltkriegs.
Ebenso wie sich die historische Perspektive in der Betrachtung des Kurt Wolff Verlags auf die schwarzen Hefte des Jüngsten Tags verengt hat, ist es evident, dass auch das ökonomische Geschehen in den Jahren zwischen der Übernahme des Ernst Rowohlt Verlags durch Kurt Wolff am 1. November 1912 bis zum Verkauf des Verlags im Jahr 1930 wesentlich von anderen Titeln und Reihen als ausgerechnet von der Buchreihe Der Jüngste Tag bestimmt war. Der überraschende Bestsellererfolg von Gustav Meyrinks Roman Der Golem (1915) etwa, von dem bis 1924 mehr als 160.000 Exemplare verkauft wurden, oder die Werke Rabindranath Tagores, die sich nach der Zuerkennung des Nobelpreises 1913 zunächst durchaus gut, nach Kriegsende dann aber bis 1923 in der damals geradezu unvorstellbaren Zahl von über einer Million Exemplaren verkauften, oder schließlich der große Erfolg von Heinrich Manns Roman Der Untertan – diese und andere Titel haben zweifelsohne mehr zum Erfolg des Verlags beigetragen als die legendäre Reihe Der Jüngste Tag.
Kurt Wolff selbst hat in seinen letzten Lebensjahren oft abwehrend auf die verengende und vereinnahmende Zuschreibung reagiert, vor allem der »Verleger des Expressionismus«[5] gewesen zu sein. Mehr noch: Er nannte dies seinen »verfluchten, verhaßten Ruhm«.[6] Dennoch hat er im Gespräch mit Herbert G. Göpfert eingeräumt:
Ich will auch gar nicht abstreiten, der Verleger des Expressionismus gewesen zu sein, aber ich möchte mir doch erlauben, daran zu erinnern, daß unter dem Namen Kurt Wolff Verlag eine Fülle von Büchern erschienen ist, die aber auch gar nichts mit dem Expressionismus zu tun haben.[7]
Im weiteren Gesprächsverlauf führt Wolff dann aus, ihn fasziniere der Gedanke, dass für seine intellektuelle Biografie maßgebliche Anregungen und Einflüsse aus der persönlichen Anknüpfung und familiären Verbindung in die Goethezeit herrührten. »Da war ich ja durch meine Großmutter noch in den Freundeskreis der goetheschen Welt einbezogen.«[8] Damit waren sowohl die bildungsbürgerlichen Reminiszenzen seiner Familie mütterlicherseits an den Freundeskreis um Goethes Schwiegertochter Ottilie und Adele Schopenhauer gemeint als auch frühe Lektüreeindrücke und die vielfältigen Verbindungen seines Elternhauses in das Musikleben des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die Verbindung von literarischer Gegenwart und Vergangenheit also, scheint Wolff angezogen zu haben.
Einerseits ist es sein Wunsch, in seinem Verlag »Geist und Herz seiner Zeit«[9] literarisch repräsentiert zu finden, andererseits empfindet er Stolz auf die Teilhabe an einer lebendigen Tradition.
Einerseits ist Wolff von dem Wunsch begeistert, die Gegenwart literarisch »in der ganzen Vielfältigkeit ihrer Erscheinungen, ihrer Hysterie und Bizarrerie, ihrer Sehnsucht nach Brüderlichkeit und Güte, ihrer Liebe zum Menschen, und ihrem Haß gegen den Bürger«[10] zu erfassen, andererseits ist er überzeugt, dass es keine Entwicklung ohne Vergangenheit gibt und der Künstler, »um selbst Stil zu geben, erst Ergriffenheit von historischem Stil empfunden«[11] haben muss.
In dieser Formel von »Liebe zum Menschen, und ihrem Haß gegen den Bürger«,[12] die Kurt Wolff bereits 1917 in einem Brief an Rilke als Maßstab seines verlegerischen Handelns nennt, erfasst er das soziale Pathos von Revolution und Veränderung und die Phantasie vom Weltende als den inneren Zusammenhang der expressionistischen Literatur vermutlich zutreffender, als ein pauschalisierender Epochenbegriff dies könnte. Zugleich ist er aber stolz auf die Bildungstradition seiner Herkunft, die sich durch die Verbindung zu seiner ersten Ehefrau, Elisabeth Merck, noch mehr der Welt Goethes annähert.
Begeisterungsfähigkeit und Aufnahmebereitschaft für das Neue, das »Heutige« und gleichzeitig »offen bleiben […] für das Gestrige. Jedenfalls ist das das Wunschbild für mich als Verleger.«[13]
Dieser Ambivalenz zwischen den Polen der radikalen Moderne und der Goethezeit korrespondiert in Kurt Wolffs Biografie zunächst auch eine Ambivalenz der Berufsentscheidungen.
In Marburg beginnt er 1906 das Studium der Germanistik, unterbricht es dann aber für den einjährigen Militärdienst, den er beim Großherzoglich Hessischen Artillerieregiment in Darmstadt ableistet. Dort lernt er die wohlhabende Chemiefabrikantenfamilie Merck kennen, direkte Nachfahren des Sturm-und-Drang-Dichters und Goethefreundes Johann Heinrich Merck. Auch knüpft er Verbindungen zu Friedrich Gundolf, durch dessen Vermittlung er Stefan George begegnet. Ein erster Kontakt zu Karl Wolfskehl entsteht. Nach der Militärzeit, auch das vermutlich ein Zeichen seiner beruflichen Unentschlossenheit, volontiert Kurt Wolff für ein halbes Jahr in einer Bank in São Paulo. Im Sommer 1908 setzt er das Studium in München fort und wechselt im Winter 1908/09 an die Universität Bonn. Im September 1909 heiratet er, zweiundzwanzigjährig, die achtzehnjährige Elisabeth Merck. Das Paar übersiedelt nach Leipzig und etabliert dort einen großbürgerlichen Haushalt, während Kurt Wolff sein Studium fortsetzt.
Zunächst sprechen alle Anzeichen dafür, dass Kurt Wolff eine akademische Laufbahn einschlagen wird. 1909 gibt er im Insel Verlag eine zweibändige Ausgabe der Schriften und Briefe von Johann Heinrich Merck heraus.[14] Die Auswahl ist kenntnisreich und umsichtig getroffen, wenn auch besonders auf das Interesse an Merck als dem gebildeten Freund und Berater des jungen Goethe konzentriert, die »gute Zeit, als er mit Merck jung war, und die deutsche Literatur noch eine reine Tafel war, auf die man mit Lust viel Gutes zu malen hoffte«.[15] Diese Edition ist die erste umfassende Ausgabe von Mercks Werken und Briefen und geht deutlich über frühere Editionen hinaus.
Noch im selben Jahr erscheinen, ebenfalls von Kurt Wolff nach der Handschrift ediert, im Insel Verlag die Tagebücher der Adele Schopenhauer.[16] Die beiden Bände in Kleinoktav sind mit entzückenden »winzigen, komplizierten, vielverästelten« Reproduktionen der von ihr selbst geschnittenen Silhouetten illustriert. Jeder Band enthält ca. 30 Seiten mit knappen und äußerst kenntnisreichen Anmerkungen von Wolff.
Ob Kurt Wolff tatsächlich 1908 im Insel Verlag volontierte oder ob sich die Zusammenarbeit mit Anton Kippenberg auf die Arbeit an den beiden Editionen beschränkte, ist schwer zu entscheiden. Im Rückblick hat Kurt Wolff seinen Weg in den Beruf des Verlegers gerne besonders gradlinig dargestellt, und die Zusammenarbeit mit dem renommierten Insel-Verleger wird ihm zweifelsohne Einblicke in den Verlagsbuchhandel eröffnet haben.
In den Winter 1908/09 fällt vermutlich auch der Beginn von Kurt Wolffs Engagement als stiller Teilhaber im Ernst Rowohlt Verlag, der allerdings von den Geschäftspartnern zunächst wohl kaum mit professioneller Absicht betrieben wird, denn Rowohlt lässt den Verlag erst zweieinhalb Jahre später, nämlich am 30. Juli 1910, in Leipzig ins Handelsregister eintragen.[17] Das ist umso plausibler, als Rowohlt 1908 als Buchhandelsvolontär in München lediglich ein Buch mit den Gedichten eines befreundeten Bremer Anwalts in einer Auflage von kaum mehr als 200 Exemplaren drucken ließ und im privaten Versand verkaufte. 1909 erscheint nur die Kater-Poesie von Paul Scheerbart in einer Auflage von 800 Exemplaren. Inzwischen ist Ernst Rowohlt Geschäftsführer der Zeitschrift für Bücherfreunde im Verlag W. Drugulin. 1910 beginnt dann eine rege Buchproduktion mit immerhin 19 Titeln, die sich, abgesehen von einer Luxusausgabe von Max Dauthendeys Schwarze Sonne. Phallus und Paul Scheerbarts Das Perpetuum mobile. Die Geschichte einer Erfindung, lediglich auf zwei Säulen stützte, nämlich Werke des von Ernst Rowohlt und Kurt Wolff gleichermaßen bewunderten Herbert Eulenberg und die ersten sechs Drugulin-Drucke.
Die Bewunderung für den Dramatiker Herbert Eulenberg teilte Kurt Wolff mit seinem akademischen Lehrer Georg Witkowski. Dieser hatte Eulenberg als Festredner zur Leipziger Schiller-Feier eingeladen und durch den Auftritt des »modernsten Dichters« einen regelrechten Skandal provoziert, in dessen Folge der gesamte Vorstand des Schiller-Vereins zurücktrat. Das Publikum war empört, »an Stelle des konventionellen überedlen Dulders den wirklichen Schiller, den rothaarigen Schöpfer so vieler Bösewichter, der in sich selbst etwas von Franz Moor und Spiegelberg haben mußte, dessen wilde Leidenschaft alle Dämme der Moral zu durchbrechen drohte«,[18] gezeigt zu bekommen. Witkowski, der wegen seiner jüdischen Herkunft erst in der Weimarer Republik einen regulären Lehrstuhl in Leipzig erhielt, nahm an der modernen Literatur geradezu enthusiastischen Anteil. 1922 bewirkte er als Sachverständiger im Prozess um Schnitzlers Reigen einen Freispruch, womit er den Hass der Nazis auf sich zog, die ihn 1933 unter demütigenden Umständen aus dem Amt jagten und ins Exil trieben.
Ein weiterer akademischer Lehrer Kurt Wolffs war Albert Köster. Neben Arbeiten über Schiller als Dramaturg und Kaspar von Stieler, den Dichter der geharnischten Venus, hatte er die Briefe der Frau Rath Goethe ediert, eine Gesamtausgabe der Werke von Theodor Storm besorgt und zwei Bände der »Jubiläums Ausgabe« von Goethes Werken herausgegeben.
Gemeinsam mit Walter Hasenclever und Kurt Pinthus hört Kurt Wolff die Vorlesungen von Albert Köster. Aus Kösters Kolleg rührt die Freundschaft, die später in eine enge Zusammenarbeit mit diesen beiden wichtigen Lektoren und Beratern seines Verlags münden sollte.
Noch für das Jahr 1911 ist überliefert, dass Kurt Wolff neben der nun schon auf 33 Titel angewachsenen Produktion des Ernst Rowohlt Verlags noch intensiv an einer Dissertation über Albrecht von Haller arbeitete. Weder hat sich jedoch ein Exemplar dieser Arbeit erhalten, noch lässt sich ermitteln, aus welchen Gründen der Abschluss eines Promotionsverfahrens bei Albert Köster scheiterte. Akademische wie auch persönliche Differenzen kommen hierfür in Betracht. So ist es bemerkenswert, dass Georg Witkowski in seiner im Exil verfassten Autobiografie einerseits mit anhaltender Begeisterung vom literarischen Leben im Leipzig der Vorkriegszeit spricht, sich anerkennend über viele Autoren und Verleger äußert, Kurt Wolff jedoch nur ein einziges Mal erwähnt und ihn mit der zweifelhaften Bezeichnung versieht, er sei ein »als Ästhet angehauchter wagemutiger Geschäftsmann«[19] gewesen. Wie passt das zu den Schilderungen des literarischen Lebens, das der Verlag und das Ehepaar Wolff in Leipzig um sich entfalteten?
Albert Köster wiederum, dessen Herausgebertätigkeit in geradezu natürlicher Interessenverbindung zu Wolffs immerhin doch beachtlichen Editionen hätte stehen müssen, könnte daran Anstoß genommen haben, dass Kurt Wolff 1911, wenn auch in einem Privatdruck, Goethes gegen Wieland gerichtetes Pasquill Götter, Helden und Wieland[20] edierte. Wolff bearbeitete damit abermals einen Text, den sein akademischer Lehrer nur wenige Jahre zuvor in einer maßgeblichen Werkausgabe herausgegeben und kommentiert hatte. In seinem eleganten Nachwort spart Wolff nicht mit Kritik an der zeitgenössischen Forschung, die in Goethes Iphigenie eine späte Revision der Polemik gegen Wielands Alceste sehen wollte. Auch wenn er in seiner Darstellung der Auseinandersetzung mit Wieland und der späteren Annäherung der beiden Dichter in Weimar zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt wie Köster und sich auch in der Bewertung der ästhetischen Positionen kaum von diesem unterscheidet, enthält Kurt Wolffs Nachwort doch eine entscheidende Wendung, die angesichts der zeitgenössischen Goetheverehrung unter den Germanisten Anstoß erregt haben dürfte:
Es wäre reizvoll, über die siebziger Jahre hinaus den Beziehungen der beiden Dichter nachzugehen, zu verfolgen wie und wo sich ihre Naturen anzogen, wo sie sich abstießen, wie der Feminine noch im Alter den Ton des Alceste anschlug, aber als Mensch noch auf Kleist zu reagieren vermochte, während Goethe, antiker Form sich mehr und mehr nähernd, zeugen, nicht empfangen wollte und so verschlossen und stumpf wurde für die Jungen, Kommenden.[21]
»Verschlossen und stumpf für die Jungen, Kommenden«, das ist ein ungewöhnlich kritischer Ton für die Goetheverehrung jener Jahre, und es wäre nicht weiter erstaunlich, wenn der Leipziger Ordinarius Albert Köster sich dies im Hinblick auf Goethe verbeten hätte. Aber natürlich sind dies nur Mutmaßungen, wiewohl das Interesse Kurt Wolffs an der Goethezeit und an den Autoren des Sturm und Drang, deren umfassende Edition erst von dem später in Auschwitz ermordeten Erich Loewenthal konzipiert wurde, sich gerade auf diesen Aspekt konzentrierte.
In dieses Konzept fügt sich auch die dritte von Kurt Wolff besorgte umfangreiche Edition, die Ausgabe von Friedrich Maximilian Klingers Dramatischen Jugendwerken.[22] Drei umfangreiche Bände versammeln ein dramatisches Werk, das sich ganz auf Goethe als den »Gott der jungen Generation« bezieht, der »alsbald neben den anderen Gott, neben Shakespeare, gleich berechtigt, gleich mächtig trat.«[23]
Insgesamt zeigt sich also, dass Kurt Wolff keineswegs so gradlinig und zielgerichtet und von Enthusiasmus getrieben, seinen Weg in den Verlegerberuf fand. Vielmehr hat es den Anschein, dass eine zunächst beabsichtigte und durch erste Leistungen begonnene akademische Laufbahn sich aus Gründen, die wir heute nicht eindeutig ausmachen können, nicht weiterverfolgen ließ.
Sicher trifft zu, was Wolff mehrfach gesagt hat: »Ich war halt passioniert für’s Lesen, schon als Junge. Ich liebte Bücher, auch schöne Bücher, versuchte zu sammeln.«[24] Dass er aber »völlig unproduktiv war« und trotzdem »beruflich mit dem Buch zu tun haben«[25] wollte, lässt sich mit dem Befund von Wolffs wissenschaftlicher und editorischer Tätigkeit nicht recht in Einklang bringen. Auch klingt seine Bemerkung »Ich glaube nicht an die Wichtigkeit des Dr. phil.«[26] vor diesem Hintergrund nicht restlos überzeugend.
Ein Blick auf Wolffs weitere Programmarbeit zeigt, dass er neben den modernen literarischen Strömungen immer wieder den programmatischen Rückgriff auf die Tradition sucht. Dabei sind es dann häufig solche Autoren und Werke der deutschen Literatur, die wie die Werke des Sturm und Drang für Jugend, Aufbruch und ästhetische Erneuerung stehen.
Klopstocks Oden in der mustergültigen zweibändigen Edition von Paul Merker erscheinen 1913;[27] 1914 erscheint Jakob Michael Reinhold Lenz’ Über Soldatenehen erstmalig nach der Handschrift ediert von Karl Freye[28] und im selben Jahr eine dreibändige Maler-Müller-Ausgabe, herausgegeben von Otto Heuer[29] – die Liste der vergleichbaren Titel ließe sich fortsetzen, besonders wenn man die vom Kurt Wolff Verlag übernommenen Verlage Meyer und Jessen und den Hyperion Verlag in die Betrachtung einbezieht.
Für ein angemessenes Verständnis der verlegerischen Leistung von Kurt Wolff und für das Verständnis seiner Motive und programmatischen Zielsetzungen scheint es jedoch angesichts dieser Zusammenhänge wichtig, sich von der verengten Perspektive auf die Literatur des Frühexpressionismus und besonders auf die Buchreihe Der Jüngste Tag zu lösen. Vielmehr ist Wolffs Devise ernst zu nehmen, wenn er sagt: »Wir müssen so offen sein für das Heutige, wie wir offen bleiben sollten für das Gestrige. Jedenfalls ist das das Wunschbild für mich als Verleger.«[30]
Wer bestimmt den Wert?
Über die Beziehung von symbolischem undökonomischem Kapital in der Verlagswirtschaft
(In der Ankündigung des Vortrags findet sich ein kleiner Setzerfehler: Das ursprünglich genannte Wort Verlagswirtschaft wurde durch das Wort Verlagsgesellschaft ersetzt. Mich hat das gefreut, weil dadurch schon der Hinweis auf Luhmanns Die Wirtschaft der Gesellschaft als Stichwort gegeben ist. Und tatsächlich werde ich später auf Luhmann oder genauer auf Parsons zurückkommen, deren systemtheoretische Überlegungen zur Kultur- und Geldtheorie ich in dem von uns zu diskutierenden Zusammenhang bedeutsam und zielführend finde.
In diesem Sinne also erst einmal vielen Dank an den Setzer. Vielleicht war’s ja auch eine kluge Setzerin?
Sie kennen sicher Lichtenbergs Aphorismus: »Anstatt Angenommen las er immer Agamemnon. So sehr hatte er den Homer studiert.«[1] So geht es wohl oft.)
Aber nun zur Sache:
»Dem Publikum Werte aufzudrängen, die es nicht will, ist die wichtigste und schönste Mission des Verlegers«[2] – das ist ein Satz, der gleichsam in nuce das Spannungsfeld zwischen symbolischem und ökonomischem Wert umreißt und in seiner extremen Polarität ausmisst.
Dieser Satz stammt von keinem Geringeren als dem großen Samuel Fischer, der als der ›Cotta der Naturalisten‹ in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. und vollends dann im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts seinen Verlag in eine führende – und das meint hier nicht nur künstlerisch avancierte, sondern ökonomisch führende Position unter den belletristischen Verlagen seiner Zeit brachte.
In seiner anrührenden und freundschaftlichen Rede »In memoriam S. Fischer« hat Thomas Mann nach Fischers Tod gesagt:
Ich war ein elfjähriges Kind, als er in Berlin seinen Verlag gründete. Zehn Jahre später war es der Traum jedes jungen Literaten, ein Buch bei S. Fischer zu haben, und meiner auch. Als mir dann […] dieser Vorzug zuteil wurde, meine ersten Novellen und die »Buddenbrooks« bei Fischer erschienen und ich in persönliche Beziehungen zu ihm trat, bewohnte er schon eine elegante Etage in der Fasanenstraße, wo ich auf Abendgesellschaften Hauptmann, Rittner, die Lehmann, seinen klugen Lektor Moritz Heimann traf […]. Nicht lange mehr, und es kam die Grunewaldvilla, […] das eigene Auto, das den kleinen Einwanderer von einst alltäglich in sein weitläufiges Geschäftshaus in der Bülowstraße trug, es kam die Klassizität, die Zeit der Gesamtausgaben.[3]
»Dem Publikum Werte aufzudrängen, die es nicht will […]« – dieser Satz findet sich in einem Gespräch, das Samuel Fischer 1914 mit Franz Pfemfert, dem Herausgeber der Zeitschrift Die Aktion, geführt hat. Die Aktion stand neben ihrer literarischen Bedeutung für die damals jüngste Dichtung, den Expressionismus, politisch für eine undogmatische linke Position, verbunden mit einer unübersehbaren Sympathie für den Anarchismus.
Im Juli 1914 hatte Die Aktion ein ganzes Heft der Würdigung von Samuel Fischers Lebenswerk gewidmet. Alle Beiträge stammten aus in Vorbereitung befindlichen Büchern seines Verlags. Selbst das Lektorat, der berühmte, der legendäre Moritz Heimann, war mit einem Text vertreten. Ich betone dies so nachdrücklich, weil ich jeden Zweifel an der Authentizität und an der Autorisation des Gesprächstextes ausräumen will.
»Dem Publikum Werte aufzudrängen, die es nicht will, ist die wichtigste und schönste Mission des Verlegers.« Und Fischer fährt fort: »Setzt er sich für etwas ein, was in die Zukunft hinein Leben verspricht, so kann der Sieg, sofern seine Sache gut ist, früher oder später nicht ausbleiben.«[4]
Samuel Fischers Credo im Hinblick auf die eigentliche und genuine Aufgabe des Verlegers, auf den »Beruf« des Verlegers im Sinne Max Webers, steht unmissverständlich für eine Werttheorie, die nicht nur nicht aus den Gegebenheiten des Marktes abgeleitet ist, sondern eine autonome Setzung darstellt, die sich nahezu im Widerspruch zu den Vorgaben des Marktes konstituiert. Der Markt ist, was das Publikum will. Samuel Fischer hingegen postuliert eine programmatische Haltung geradezu mit dem Rücken zum Publikum. Aber er bleibt nicht bei dieser Position, denn er antizipiert zugleich, dass die Wertsetzung oder Wertbehauptung durch den Verleger langfristig zum Erfolg, zum »Sieg«, führen müsse.
Historisch spricht aus dieser Behauptung Samuel Fischers eigene Erfahrung. Schließlich hatte er nicht mit einer etablierten und Umsatz versprechenden Literatur, sondern mit einer abseitigen, randständigen, jungen und provokanten literarischen Strömung, dem Naturalismus, auf dem Umweg über die Bühnen den literarischen Buchmarkt erobert. Fischers Erfolg war also nicht mit dem gängigen und erwartbaren Produkt, mit konventioneller erzählender Prosa, mit Romanen, erreicht worden, sondern mit Dramentexten, die auch damals zunächst nicht besonders renditeversprechend waren.
Andererseits: Thomas Mann beschreibt es eindrucksvoll. Fischers Handeln war ganz zweifellos auf den wirtschaftlichen Erfolg gerichtet. Sein Verlag vereinigte in sich eine immanente kulturelle Wertdefinition oder Wertsetzung mit dem wirtschaftlichen Prinzip des Nutzens. Es war mithin nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern offensichtlich intendiert, dass sich die Wertsetzung aus der Sphäre des kulturellen oder symbolischen Kapitals in die Sphäre der Wirtschaft und ihr Medium, das Geld, transformierte.
Wenn wir die Geschichte des Aufstiegs des S. Fischer Verlags zu einem der wenn nicht zu dem herausragenden literarischen Verlag zwischen 1890 und 1933 betrachten, so ist es vollkommen unabweislich, dass sich hier eine äußerst komplexe Interaktion von kulturellem und ökonomischem System vollzogen hat, die in dieser Ausprägung nur möglich war, weil beide Systeme im Sinne vollständiger Integrität zusammenwirkten.
Es sei an dieser Stelle nur am Rande angemerkt, dass die gesellschaftlichen Zuschreibungen, Wertungen und Kodierungen im Hinblick auf den Beruf des Verlegers heute noch ganz überwiegend in einem Widerspruch von kultureller und ökonomischer Sphäre erfolgen. Der Verleger hat mutig zu sein, womit wohl gemeint ist, dass er sich möglichst in halsbrecherische Spekulationen verstricken soll, um sein Kairos zu erfüllen.
So wie nach gängigem Vorurteil der Künstler seine Produktivität, seine schöpferische Kraft, so soll möglichst auch der Verleger sein Kapital wie Herzblut im Angesicht der Ewigkeit zum Opfer bringen. Tut er das nicht, wird er als der kulturlose Kapitalist – der er ja vielleicht ist – diskreditiert. Dass aber ein anhaltender und stabiler Erfolg von Autoren und Werken eigentlich nur von ökonomisch prosperierenden Verlagen bewirkt und prolongiert werden kann, wird dabei allzu gern vergessen. Dieser Umstand hat auch dazu geführt, dass sich immer wieder ein Typus des Verlegerdarstellers herausgebildet hat, auf den gerade die kulturellen Zuschreibungen des kunstsinnigen und opferbereiten Mäzens oder aber die romantischen Kodierungen des Künstlers eine große Attraktivität ausüben. In dieser Sphäre der Verlagslandschaft wird der ökonomische Misserfolg beinahe zum Programm erhoben. Gelegentlich wird sogar die eigene kaufmännische Inkompetenz als Distinktionsmerkmal im Sinne gesteigerter kultureller Kompetenz und Glaubwürdigkeit ins Feld geführt.
Aber das ist hier nur eine illustrative Randbemerkung.
Zurück zu unserem Beispiel Samuel Fischer, der übrigens in den gleichsam genealogische Selbstkonstruktionen bedeutender Verleger des 20. Jahrhunderts eine Sonderstellung einnimmt. Bald nach seinem Tode wurde der Verlag unter der Leitung seines Schwiegersohns Gottfried Bermann Fischer ins Exil getrieben. Der noch von Samuel Fischer in die Redaktion der damals wichtigen Neuen Rundschau berufene Peter Suhrkamp verstand sich zunächst als der Statthalter der emigrierten Familie Fischer. Und nachdem der zwangsarisierte Verlag nicht mehr unter jüdischem Namen firmieren durfte, war es der Name des Arisierungstreuhänders, unter dem die Verlagsgeschäfte bis nach dem Kriegsende weitergeführt wurden. Dass es nach der Rückkehr Gottfried Bermann Fischers zum Konflikt und schließlich zur Aufteilung in den zuvor emigrierten S. Fischer Verlag und den aus der Arisierung hervorgegangenen Suhrkamp Verlag kam, gehört zu den Aporien der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dass Siegfried Unseld sich als den legitimen Erben Peter Suhrkamps verstand und damit gleichsam in die symbolträchtige genealogische Position des wahlverwandten Enkels Samuel Fischers eintrat, ist wiederum geradezu paradigmatisch für die Verschiebung von Täter- und Opferidentitäten in der Nachkriegszeit. Aber auch dies ist eher eine Randbemerkung, die allenfalls dadurch an dieser Stelle meiner Überlegungen ihre Funktion hat, dass sie belegen kann, in welchen komplexen Sinn- und Wertzuschreibungen symbolisches Kapital akkumuliert werden kann und über Jahrzehnte als zentraler Bestandteil der Wertbestimmungen durch Verlage und Verleger wirksam ist. Die Wertsetzung, die im gesellschaftlichen Subsystem der Verlagswirtschaft und des Literaturbetriebs allein durch die Markenbezeichnung »verlegt bei S. Fischer« oder »verlegt bei Suhrkamp« evoziert wird, sollte auch heute noch in ihrer Bedeutung keineswegs unterschätzt werden.
Allerdings ist es auch möglich, den Erfolg, den Aufstieg und die nachhaltige Wertbindung im Programm des S. Fischer Verlags mit ausschließlich ökonomischen Kriterien zu beschreiben:
Im Handel ist es eine klassische Figuration, dass der Kaufmann eine Ware zu günstigen Einstandspreisen erwirbt und ihr durch verkäuferische Aktivitäten einen deutlich höheren Wiederverkaufspreis im Markt verschafft. Die kaufmännische Wertsteigerung, die sich zwischen Beschaffungsmarkt und Absatzmarkt vollzieht, ist die klassische Form des Warenverkehrs. Das Recht zur Verwertung des Werks eines gänzlich unbekannten Autors ist für den Verleger billiger und umfassender zu erwerben als das Recht an einem eingeführten und marktgängigen Werk. Während einerseits die anzunehmende geringere Rendite mit dem günstigeren Einstandspreis korreliert, ist andererseits die vermeintlich größere und sicherere Renditeerwartung naturgemäß nur mit einem höheren Einstandspreis und höherem Risiko zu erlangen.
Indem Samuel Fischer die unbekannten Naturalisten, allen voran Gerhart Hauptmann, im Markt etablierte, erzielte er bei höherem Risiko eine signifikant höhere Rendite. Ähnlich kann man den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg mit dem Werk Thomas Manns beschreiben. Auch wenn mit Buddenbrooks die zweite Buchveröffentlichung Thomas Manns eine erhebliche Investition in die Herstellungskosten der zweibändigen Ausgabe bedeutete, kann man doch mit größtem Recht sagen, dass dieser Einstandspreis auf das Werk eines keineswegs etablierten Autors seine Rendite inklusive aller Risikoaufschläge erbracht hat.
Was der Kritiker Samuel Lublinski über den literarischen Rang von Buddenbrooks gesagt hat, lässt sich identisch in die ökonomische Sphäre übertragen: »Dieses Werk wird wachsen mit der Zeit.«[5]
Der von Fischer antizipierte Wert, über dessen Marktfähigkeit sich vorher wohl kaum gesicherte Aussagen treffen ließen, hat im klassischen Sinne durch das Zutun des Verlags eine signifikante Wertsteigerung und Rendite erbracht.





























