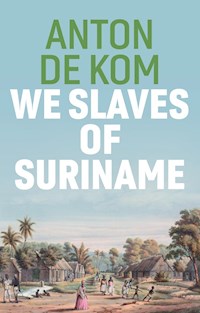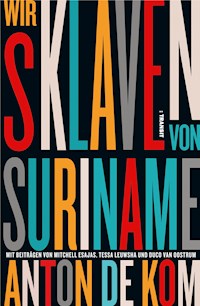
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1934 veröffentlichte Anton de Kom Wir Sklaven von Suriname. Das Buch ist eine literarische Provokation und eine persönliche, leidenschaftliche Anklage gegen Rassismus und Ausbeutung. Es gilt als das erste Buch, das die Geschichte Surinames aus antikolonialer Sicht beschreibt, verfasst von einem Nachfahren von Versklavten, die die Folgen der Kolonialherrschaft am eigenen Leib erfahren haben. De Kom schildert eindrucksvoll, mit welchen Mitteln die niederländischen Kolonialherren die eingeborene Bevölkerung sowie die Versklavten und deren Nachfahren allein um des Profits willen unterdrückt haben und wie sich diese gegen die unmenschliche Behandlung aufgelehnt haben. Mit viel Hintergrundwissen schreibt er über das Grauen, aber auch über den Mut, die Selbstachtung und den Freiheitswillen. Über 150 Jahre Jahre nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei und über 80 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung hat dieses Buch nichts von seiner Aussagekraft verloren. Anton de Kom steht exemplarisch für das erstarkende Selbstbewusstsein, für Antikolonialismus und Antirassismus bis heute und insofern in einer Reihe mit Martin Luther King, Malcolm X, Frantz Fanon oder Rosa Parks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anton de Kom
WIR SKLAVEN VON SURINAME
Aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann
Der Verlag bedankt sich sehr für die Förderung dieser Publikation durch die Niederländische Literaturstiftung.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds unterstützt.
Erstdruck 1934
21. Auflage Dezember 2020
© 1999 Erven A. Kom
© 2020 Vor- und Nachworte:
Tessa Leuwsha, Mitchell Esajas, Duco van Oostrum
Originalausgabe:
Anton de Kom, Wij Slaven van Suriname
Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam/Antwerpen 2020
© 2021 für die deutsche Ausgabe:
TRANSIT Buchverlag
Postfach 120307, 10593 Berlin
www.transit-verlag.de
Umschlagentwurf © David Drummond
Layout: © Gudrun Fröba
eISBN 978 - 3- 88747 - 404-1
INHALT
Vorbemerkung des Verlages
Tessa Leeuwsha: Frimangron
Judith de Kom: Vorwort zur dritten Auflage 1981
ANTON DE KOM: WIR SKLAVEN VON SURINAME
SRANAN, UNSER VATERLAND
DAS ZEITALTER DER SKLAVEREI
Die Ankunft der Weißen
El Dorado
Die ersten Siedlungen
Die holländische Herrschaft
Der Sklavenhandel
Der Markt
In Sklaverei
Die Sklavin
Die Herren
Die Strafen
Die Geschichte des Vaterlands
Van Aerssen van Sommelsdyck (1683-1688)
Das Gesindel
Die Waldzüge
Mr. Johan Jacob Mauricius (1742-1751)
Gouverneur Crommelin (1752-1768)
Gouverneur Nepveu (1770-1779)
Buku (zu Staub zerfallen)
Das letzte Kapitel des Widerstands
Suriname unter britischer Herrschaft
Das große Feuer
Das Los der Ethiker
Weiße Kolonisation
Ein aussichtsloser Kampf
Die Parade der Gouverneure
Die Abschaffung der Sklaverei
Die Freiheit?
Der große Ausverkauf
DAS ZEITALTER DER »FREIHEIT«
So leben wir
Das Wesen der Autonomie
Fin de siècle
Vertragsarbeit
Freie Arbeit
Die Jagd nach Gold
Die großen Kulturen
Wo sind die Millionen?
Bilanz
WIEDERSEHEN UND ABSCHIED
Anmerkungen
Duco van Oostrum: Der Atem der Freiheit
Mitchell Esajas: Wie Anton de Kom seit jeher Generation um Generation inspiriert
Biografische Angaben
Literarische Werke und ihre Urheber sind ein Produkt ihrer Zeit. Obwohl Anton de Kom seiner Zeit weit voraus war und Wir Sklaven von Suriname ein zeitloses Meisterwerk ist, bilden er und sein Buch hier keine Ausnahme. Gesellschaften und Kulturen verändern sich, und dies drückt sich auch in der Sprache und im Vokabular aus. Einige Wörter haben mittlerweile einen anderen Gefühlswert und sind anno 2021 einfach unpassend, so z.B. das von de Kom häufig gebrauchte Wort »Neger«. Der Verlag ist sich dessen bewusst, meint aber, ein historisches literarisches Werk sollte unangetastet bleiben.
Deshalb haben wir uns dafür entschieden, Anton de Koms Text aus dem Jahr 1934 in seiner ursprünglichen Fassung übersetzen zu lassen.
Zu den Anmerkungen: Die im Text mit Sternchen markierten Anmerkungen stammen in der Regel von der Übersetzerin. Wenn nicht, wird der Name des jeweiligen Autors genannt. Die mit Ziffern markierten Anmerkungen von Anton de Kom befinden sich am Ende seines Textes.
Tessa Leuwsha
FRIMANGRON
Ich stehe in Paramaribo vor Anton de Koms Geburtshaus. Es ist ein Eckhaus im Stadtviertel Frimangron. Auf dem Gehweg davor befindet sich ein Gedenkstein mit einer Plakette, auf der ein Zitat des berühmten surinamischen Widerstandskämpfers eingraviert ist: »Sranan, mein Vaterland, einmal hoffe ich, dich an dem Tag wiederzusehen, an dem alles Elend von dir abgewendet sein wird.« Das halb verfallene Holzhaus besteht aus einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Die grau gewordenen vertikalen Holzbretter hängen schief an den Nägeln, das Wellblechdach ist teilweise eingestürzt. Ein Fensterladen steht offen, die Gardine ist zur Seite geschoben: Das Haus ist bewohnt. Nebenan verbirgt sich hinter einem Bananenbaum ein weiteres kleines Haus. Auf dem Weg zwischen den Häusern taucht ein hagerer schwarzer Mann auf. Sein Haar und der Bart sind grau. Er trägt ein T-Shirt, das ihm genau wie die Badelatschen viel zu groß ist. In der Hand hält er eine in Zeitungspapier eingewickelte Blume. Er setzt sich auf den Gehweg vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie de Kom. Für wen diese Blume wohl bestimmt ist? Um mich kümmert er sich nicht – schließlich stehen viele Menschen vor diesem Haus, um es zu fotografieren.
In den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts warteten hier hunderte Menschen darauf, mit Anton de Kom zu sprechen. Arbeitslose und Arbeiter, die mit ihrem kargen Lohn über die Runden kommen mussten. Nach Abschaffung der Sklaverei 1863 hatte der niederländische Staat im ehemaligen Britisch- und Niederländisch-Indien Vertragsarbeiter für die Plantagen in Suriname angeworben. Mit dem Niedergang der Landwirtschaft strömten diese Arbeiter, gleich den ehemaligen Versklavten, nach Paramaribo. Aber auch in der Hauptstadt mangelte es an Arbeit und herrschte große Armut. Dennoch hofften sie, am Tisch hinter dem Haus von dem Mann empfangen zu werden, der mit dem frischen Wind des Widerstands aus Holland zurückgekehrt war.
Cornelis Gerhard Anton de Kom wurde 1898 in Paramaribo geboren. Er erwarb ein Buchhalterdiplom und arbeitete für einige Zeit im Büro der Balata Compagnie, einer Firma, die den Abbau von Balata, einer Kautschuksorte, vorantrieb. De Kom nahm sich dem schweren Los der Balata-Bleeders an, der überwiegend kreolischen Arbeiter, die im erstickend heißen Urwald die Gummibäume abzapften. 1920 kündigte de Kom, fuhr in die Niederlande und heiratete dort die Niederländerin Petronella Borsboom. Als einer der wenigen Schwarzen in den Niederlanden kam er schließlich mit nationalistischen Javanern in Kontakt, die die Unabhängigkeit Niederländisch-Indiens anstrebten: Indonesien. De Kom übernahm diesen Freiheitsgeist und begann, Artikel für De Communistische Gids zu schreiben, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei der Niederlande, die damals die einzige politische Partei mit einem Bekenntnis zum Antikolonialismus war. Seine Artikel, aber auch der revolutionäre Tenor seiner Rede fanden ihren Weg zur Arbeiterbewegung in Suriname. Besonders seine Kritik an der Lohnkürzung für Vertragsarbeiter machte ihn bei dieser Gruppierung populär.
Als de Kom 1932 gemeinsam mit seiner Frau und ihren vier Kindern per Schiff nach Suriname zurückkehrte, um seine kranke, jedoch noch während der Reise verstorbene Mutter zu besuchen, sahen seine Genossen im Geiste der Ankunft sehnsüchtig entgegen. Hinter dem elterlichen Haus richtete er eine Beratungsstelle ein und notierte gewissenhaft die Beschwerden der unzufriedenen Surinamer. Vor allem Javaner, die sich durch die anderen Bevölkerungsgruppen benachteiligt fühlten, suchten Rat bei »Papa de Kom«, ein Spitzname, den sie ihm schnell verpasst hatten. De Kom würde sie wie ein Messias zurück nach Java führen, so das glühende Verlangen. In Wir Sklaven von Suriname schreibt de Kom: »Unter dem Baum aber, an meinem Tisch vorbei, zieht die Parade des Elends. Parias mit eingefallenen Wangen. Hungerleider. Menschen ohne genügend Widerstand. Offene Bücher, in denen sich die mühsam erzählte Geschichte von Unterdrückung und Entbehrung sogleich lesen lässt.« (S. 178) De Kom wollte die gesammelten Beschwerden der Kolonialverwaltung vorlegen, doch die Unruhe, die er mit seinem Büro auslöste, missfiel Gouverneur Abraham Rutgers. Am 1. Februar 1933 zog Anton de Kom mit einigen Anhängern zum Gouvernement. Dort wurde er wegen des Verdachts, einen Umsturz zu planen, verhaftet.
Von der Straße aus kann man den Hinterhof nicht einsehen. Die Seitenwand des Hauses ist mit Zinkblech zugenagelt, ein großer Mangobaum stützt sich zum Teil auf das Dach. Vor dem Nachbarhaus fegt eine Frau Laub und Fallobst zusammen. Sie trägt einen rosafarbenen Rock, einen engen Pulli, eine Kappe und eine Sonnenbrille. Wahrscheinlich hat sie wie der größte Teil der Surinamer das Outfit in einem der billigen chinesischen Klamottenläden gekauft, die Paramaribo überschwemmen. Der kleinere Teil der Bevölkerung mit einem größeren Einkommen kauft seine Kleidung im Ausland oder im Internet. In mancher Hinsicht scheint sich zwischen dem Paramaribo, in dem de Kom Anfang des vergangenen Jahrhunderts aufgewachsen ist, und der Stadt von heute nicht viel verändert zu haben. Nur dass die Reichen nicht mehr in den weißgrünen Herrenhäusern im alten Stadtzentrum wohnen, sondern in modernen Steinvillen der grünen Wohnviertel wie Mon Plaisir und Elisabeths Hof.
Dass gerade ein Arbeiterviertel wie Frimangron einen Revolutionär wie de Kom hervorgebracht hat, ist nicht verwunderlich. Schon in der Sklavenzeit zogen die Versklavten, denen es gelungen war, sich freizukaufen, in das damals brachliegende Gebiet am Stadtrand. Früher hatte das ehemalige Hauspersonal in Sklavenbaracken hinter den Herrenhäusern gehaust. Frimangron bedeutet »Erdboden der freien Menschen«. An den langen Sandstraßen zimmerten sich die neuen Bürger einfache Häuschen und übten Handwerksberufe aus. Die Pontewerfstraat war die wichtigste Straße des Viertels. Aus den kleinen Werkstätten klangen das Sägen der Zimmerleute und das Klopfen und Ticken von Schuhmachern, Gerbern und Blechschmieden. Die Frauen arbeiteten als Wäscherinnen und Büglerinnen für die weiße und hellhäutige Elite, die in der niederländischen Kolonie das Sagen hatte. In dieser Straße, die seit Anfang der achtziger Jahre nach Anton de Kom benannt ist, steht sein Geburtshaus.
Auf dem Gehweg, auf dem der alte Mann sitzt, wird auch Anton de Kom in seiner Jugend regelmäßig Zeit verbracht haben. Sein Vater war noch Sklave gewesen, seine Großmutter erzählte ihren Enkelkindern »vom Leid der Sklaverei«, wie de Kom es in seiner scharfen Klageschrift Wir Sklaven von Suriname schreibt. Er publizierte das Buch 1934, ein Jahr, nachdem die Kolonialverwaltung ihn aus Suriname verbannt hatte.
De Kom war ein guter Schüler und hatte schon in jungen Jahren die Fähigkeit entwickelt, Unrecht nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen. Die Kinder in seinem Viertel mussten meist barfuß laufen, sie waren in Lumpen gekleidet und trieben sich auch nach der Dämmerung draußen herum. Zwar gab es eine Schulpflicht, doch die wenigsten Eltern hatten die Mittel, das Schulgeld aufzubringen, geschweige denn, anständiges Schuhwerk und Schulkleidung zu kaufen. Es kostete die Eltern schon größte Mühe, ihren Kindern täglich etwas Reis mit gesalzenem Fisch aufzutischen. Wer die Gelegenheit bekam, stellte sein Kind als kweekje zur Verfügung: bei einer gut situierten Familie gegen Kost und Logis das Haus fegen, den Garten rechen und Wassereimer schleppen. Kinderarbeit war üblich. Anton de Kom hatte es vermutlich ein wenig besser. Seinem Vater gelang es als Kleinbauer, mit der Landwirtschaft ein halbwegs gutes Auskommen zu haben. Zudem arbeitete er als Goldgräber. Der junge Anton muss allerdings gelegentlich auf dem imposanten Oranjeplein gewesen sein, in dieser anderen Welt im Herzen der Stadt, wo vor dem vornehmen Gouverneurspalast das Denkmal von Königin Wilhelmina stand, auch wenn sie ihre Kolonie niemals besuchte. Unter den Tamarinden am Platz flanierte das wohlhabende Bürgertum, herausgeputzt in Kostümen oder langen weißen Kleidern. In Frimangron waren alle schwarz. Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert.
Eines Sonntagmorgens fahre ich über den Anton Dragtenweg, den hübsche Häuser mit Aussicht auf den Suriname-Fluss säumen, zum Viertel Clevia. Seite an Seite stehen dort Bruynzeelhäuser mit kleinen Vor- und Hintergärten. Ich parke vor einem frisch geschmirgelten Zaun. »Ich streiche gerade die Haustür«, hatte Cees de Kom am Telefon ein wenig atemlos gesagt. Anton de Koms 91-jähriger Sohn wirkt noch immer sehr rege. Er lässt mich vorangehen, die Treppe hinauf zum Balkon. Seine ein Jahr jüngere Ehefrau schüttelt mir energisch die Hand. Cees de Kom und ich haben etwas gemeinsam, wir sind beide Halbblüter. Beide haben wir einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter. Mulatte war einst der korrekte Terminus für Menschen wie uns. Immer wenn ich Cees treffe, wie bei der Premiere des Films über das Leben seines Vaters, versäumt er es nicht, mich auf diese Gemeinsamkeit hinzuweisen. Wenn etwas sein Leben bestimmt hat, dann dass er als halb angesehen wird.
Cees wurde 1928 geboren. Er war vier Jahre alt, als die Familie in Suriname eintraf. Nach der Festnahme seines Vaters zogen am 7. Februar 1933 unzählige Demonstranten zum Gouvernement, um seine Freilassung zu fordern. Die Polizei eröffnete das Feuer. Es gab zwei Tote und zweiundzwanzig Verwundete. De Kom saß drei Monate im Fort Zeelandia ein, ausgerechnet in jener von den Niederländern erbauten Festung, in der Sklavenhalter gegen Bezahlung ihre vermeintlich unwilligen Versklavten hatten züchtigen lassen. Die grausame Folter durch den Spanischen Bock, die Peitschenhiebe, das Rädern und letztlich lebendig verbrannt zu werden: Wenn es um Körperstrafen ging, übertrafen die holländischen Kolonisatoren die englischen und französischen. Die Arrestzelle musste den Widerstandsgeist in Anton de Kom weiter angefacht haben.
Nach seiner erzwungenen Rückkehr in die Niederlande behielt ihn der Geheimdienst im Auge. Man hielt de Kom für einen Kommunisten, auch wenn er nie Mitglied der Communistische Partij gewesen war. Er hatte größte Mühe, Arbeit zu finden. »Ich erinnere mich daran, dass mein Vater immer am Schreiben war«, sagt Cees, »mit einem Bleistift, den er aus Sparsamkeit bis zum Stummel aufbrauchte. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, ging er in den Widerstand und schrieb für die illegale Presse. Am 7. August 1944 wurde er von der Gestapo verhaftet. In der Hoffnung, er käme zurück, saß meine Mutter stundenlang am Fenster. Aber er kam nicht. Mein Bruder und ich wurden nach Deutschland transportiert, um auf einem Bauernhof zu arbeiten. Nach unserer Rückkehr mussten wir gleich wieder aufbrechen, nach Niederländisch-Indien, um dort Ordnung und Frieden wieder herzustellen, wie der Auftrag lautete. Dabei hatte mein Vater doch mit den indonesischen Freiheitskämpfern sympathisiert! Ich schrieb ein Bittgesuch an den Verteidigungsminister, um nicht fort zu müssen. Nach der Befreiung hatte meine Mutter noch immer nichts von meinem Vater gehört. Die letzte Nachricht war, dass er sich im deutschen Konzentrationslager Neuengamme befand. Ohne Neuigkeiten von ihm wolle ich sie nicht allein lassen, schrieb ich, aber damit hatte der Staat keine Eile. Erst 1950 kam das offizielle Schreiben: Mein Vater war am 24. April 1945 im Konzentrationslager gestorben.« Cees weist in das Vorderzimmer. »Und auf dem Stuhl dort ist meine Mutter gestorben, sie schlummerte einfach ein. Wir wohnten damals schon Jahre in Suriname. Und sie verbrachte die Ferien bei uns.« Vor einiger Zeit fand er es an der Zeit, seine Memoiren zu schreiben. »All der Ballast, den man mit sich herumschleppt.« Er reicht mir einen dicken Packen Papier, eingefasst in ein Ringbuch. Twee culturen, één hart (Zwei Kulturen, ein Herz) lautet der Titel, darunter prangt die Zeichnung von zwei ineinander verschlungenen Kreisen: die Eheringe seiner Eltern.
»In den Niederlanden habe ich meinen Namen einfach mit K geschrieben. Hier habe ich Cees daraus gemacht, das klingt beschwingter, weniger holländisch, denn in den Niederlanden fand ich nichts von meiner surinamischen Kultur wieder.« Als Junge saß er einmal mit seinem Vater in der Straßenbahn, als eine Frau auf Anton de Kom deutete und zu ihrem Kind sagte: »Schau, das ist der schwarze Mann. Pass bloß auf, sonst kommt er dich bald holen.« Es gab auch Kinder, die es auf Cees abgesehen hatten: »Kauf dir bloß keine Seife, du bleibst eh schmutzig«, riefen sie. Und später, immer noch in den Niederlanden, als er für die PTT arbeitete, den Staatsbetrieb für Postwesen, Telegrafie und Telefonie, und mit Kollegen über kulturelle Unterschiede sprach, sagte ein Niederländer unbeholfen: »Wenn ich in Groningen bin, habe ich für die Menschen dort auch einen fremden Akzent.« Bei der Umbettung der sterblichen Überreste seines Vaters am 18. August 1960 auf den Ehrenfriedhof für Kriegsgefallene in Loenen wurden alle Namen vorgelesen, nur der von de Kom nicht. Die Erklärung: ein technischer Defekt. »Immer diese hinterhältigen Gemeinheiten«, seufzt Cees. Immer der Unterlegene sein, nicht verstanden werden – darauf hatte er keine Lust mehr. Sechs Jahre später fuhr er mit seiner Familie auf der MS Oranje Nassau in das Land seines Vaters. Dieselbe Reise, die seine Eltern etwa dreißig Jahre zuvor unternommen hatten. Doch auch in Suriname zeigte sich, dass das Eigene nicht immer genügend geschätzt wird. »Fast alle Bücher, die man hier liest, kommen aus den Niederlanden.« Die Familie ist über eine Stiftung Eigentümerin von Anton de Koms Geburtshaus. Die Mittel fehlen, um es zu restaurieren. Die Behörden kümmert es nicht.
Die niederländische Knute hinter sich zu lassen, das stand de Kom vor Augen, als er sein zum Klassiker gewordenes Buch geschrieben hat: »Kein Volk kann aber zu voller Blüte gelangen, das erblich mit einem Minderwertigkeitsgefühl behaftet ist. Deshalb möchte dieses Buch die Selbstachtung der Surinamer wachrütteln.« (S. 60) 2020, dem Jahr, in dem Suriname seit 45 Jahren unabhängig ist, haben diese Worte nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Mit Wir Sklaven von Suriname war de Kom seiner Zeit weit voraus. Nicht nur für die Surinamer, auch für die Niederländer. Das Land, über das die Niederländer über 300 Jahre regiert haben, bildete lange einen blinden Fleck in der Kolonialgeschichte. Erst seit ein paar Jahren nimmt Suriname einen bescheidenen Platz im kollektiven Bewusstsein ein. Eine Veränderung, die nur ruckweise verläuft. Und die Geschichte kommt nicht ohne Auswüchse daher. Als ich in den 1970er-Jahren in Amsterdam aufwuchs, schrieb ich in meiner Kinderhandschrift einen Brief an die Redaktion meiner Lieblingsmädchenzeitschrift Tina. Ich war zwölf Jahre alt. Nach einem Kompliment über die Zeitschrift fragte ich, warum es nie ein schwarzes Mädchen auf das Titelbild schaffe? Jeden Tag suchte ich im Briefkasten nach einer Antwort. Dass ich sie nie erhielt, traf mich tief.
Das Werk von Anton de Kom beeindruckt nicht nur durch seine enorme Aussagekraft, sondern auch durch den Mut, mit dem er Missstände zur Sprache gebracht hat. Es ist eine Anklage gegen den nüchternen Unternehmergeist, die Kleinkrämermentalität, mit denen man ein Land und sein Volk ausgequetscht hatte. Es ist keine schöne Geschichte, aber es ist sehr wohl unsere gemeinsame Geschichte. Die holländischen Vorfahren soffen, hurten und folterten in der Kolonie nur so drauflos, auch aus Langeweile und Frustration wegen des öden Plantagenlebens. Das Ausmaß dieser Dekadenz war im eigenen puritanischen Vaterland undenkbar. De Kom, der in Suriname Geschichtsunterricht über die berühmten niederländischen Seeräuber wie Piet Hein und Michiel de Ruyter erhielt und der die Namen der Gouverneure, die seine afrikanischen Vorfahren in den Schiffsbäuchen verschleppt hatten, auswendig lernen musste, versuchte, tief in die Psyche der Sklavenhalter einzudringen. Er ist ihnen immerzu auf den Fersen und rückt ihnen auf den Pelz, ohne auch nur einen Moment den Druck herauszunehmen. Man kann sich de Kom schreibend vorstellen, weit vorgebeugt auf der Stuhlkante, den Bleistiftstummel auf das Papier drückend. Seine Sprache ist geschmeidig, essayistisch und manchmal lyrisch, mit erstaunlichen Sprachbildern. Von der Handwerkskiste eines Schriftstellers Gebrauch machend, haucht er seinem Werk Farbe und Gefühl ein. Und nirgends vergisst er seinen Hintergrund, wie es treffsicher in einem Odo, einem surinamischen Sprichwort, zum Ausdruck kommt: Im Schnabel eines Vogels kann die Kakerlake ihr Recht nicht geltend machen.
Wann hat das Verschweigen dieser Seite der Geschichte eigentlich angefangen? Wer davon sprach, konnte lange Zeit mit einer schulmeisterlichen Antwort rechnen, wie etwa: »Naja, überlege mal, was die Franzosen und die Briten getan haben, und sogar die Afrikaner!« Wie die Ausrede eines Käufers von Diebesgut. Einmal ertappt, weist dieser eifernd auf den Hehler und den Dieb: Nicht ich, sie! Und doch: Wo keine Nachfrage, da kein Angebot. Hier und da werden Denkmäler errichtet, die an das Leid erinnern. Man bringt erklärende Texte zu in Ungnade gefallenen Kolonialherren an. Sich aber umzudrehen und dem eigenen Monster in die Augen zu starren, das bereitet noch immer Mühe.
Wir Sklaven von Suriname hält uns auch heute noch einen Spiegel vor. Das Buch verbreitet die Botschaft von Macht versus Minderheit, von Kapital versus Armut. Spielend leicht lassen sich Parallelen zur Gegenwart ziehen: die miserable Situation von Flüchtlingen im Westen, auch in den Niederlanden. Chinesen, die mit einem Kartell im Nacken von früh bis spät in Geschäften stehen. Drogenbanden, die in Lateinamerika Bürger erpressen, Frauenhandel, Kinderarbeit in asiatischen Textilfabriken. Es sind immer Systeme, die den Rahmen schaffen, aus denen Individuen ihren Vorteil ziehen. Unterdrückung gründet sich auch ausdrücklich auf Stereotypen: Wir gegen die unbekannten, fremden Anderen. Der Vormarsch rechter Populisten in der Welt basiert zu einem wesentlichen Teil auf diesem Wir-Sie-Denken. Der andere ist faul oder kriminell oder beides. »Wollen wir mehr oder weniger Marokkaner?«, fragt Geert Wilders. Noch entschiedener klingt die Parole: Sei normal oder hau ab. America first, aber wem gehört Amerika eigentlich? Aus dieser Position spricht ein vermeintlicher Anspruch auf Eigentum. De Kom durchschaute diese Sichtweise nur allzu gut. Hinter dem anonymen Wort Sklave fügte er zwischen zwei Anführungszeichen »unsere Väter« hinzu. Unsere Väter, nicht einfach nur namenlose Wesen.
Welche Aktivisten in der Welt gibt es nach Anton de Kom, Mahatma Ghandi, Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X und Nelson Mandela, die für die als selbstverständlich angesehenen Menschenrechte kämpfen? Sind die Appelle laut genug? Anton de Kom deckte die Mechanismen hinter dem Phänomen der Unfreiheit auf. Hinter der Armut.
Auf dem Gehweg vor der berühmtesten Hütte von Paramaribo lässt die Blume in der Hand des alten Mannes wegen der Hitze ihren Kopf hängen. Er steht auf und schlurft mit den zu großen Badelatschen die Straße hinunter.
Judith de Kom
VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE (1981)
»Die Wahrheit facht den Sturm gegen sich an,der die Saat in die Weite trägt.«
Tagore
»Kein Volk kann aber zu voller Blüte gelangen, das erblich mit einem Minderwertigkeitsgefühl behaftet ist. Deshalb möchte dieses Buch die Selbstachtung der Surinamer wachrütteln«. Dies schreibt Anton de Kom in dem Kapitel »Die Geschichte des Vaterlands«. (S. 60)
Er ahnte, dass das surinamische Volk, belastet mit dem Kolonialerbe, einen langen und schweren Weg vor sich hatte, um sich zu einer vollwertigen Nation zu entwickeln.
Wir Sklaven von Suriname ist zum Teil ein politischer Kommentar zur Geschichte Surinames und zum Teil ein Schrei nach Gerechtigkeit. Das Buch ist, und das ist vielleicht das Wichtigste, von einem Landsmann geschrieben, der aufgrund seiner abweichenden Auffassungen die koloniale Unterdrückung am eigenen Leib erfahren musste.
Anton de Kom wird 1898 in Paramaribo geboren.
»Er war ein ruhiges Kind. Als Junge ein regelrechter Bücherwurm«, erzählen Verwandte.
Sein Vater ist Goldsucher. Nach dem Rückgang der Goldgewinnung wendet er sich der Landwirtschaft zu. Die Familie besteht aus sechs Kindern, drei Jungen und drei Mädchen. Anton ist der älteste Sohn. Er besucht die Paulusschool in Paramaribo, eine Grund- und Sekundarschule, was damals, 1910, eine Ausnahme ist.
Zeugnisse besagen, dass er ab 1916 als Büroangestellter bei dem Gerichtsvollzieher H.C. Cooke und drei Jahre bei den Balata Compagnieën Suriname en Guyana angestellt ist.
Letztgenannte Arbeitsstelle bringt ihn in Kontakt mit den Balata-Bleeders. Dies ist auch seine erste Konfrontation mit der Ausbeutung. Ein Arbeiter, der ihn gekannt hat, sagt: »Er saß im Büro und kämpfte für uns. Er sorgte dafür, dass wir den Lohn erhielten, der uns zustand.«
Im Juni 1920 fährt de Kom in die Niederlande und tritt freiwillig in den Dienst des 2. Husarenregiments ein. Nach nur einem Jahr verlässt er das Militär und findet eine Stelle als Büroangestellter. Im Januar 1926 heiratet de Kom Petronella C. Borsboom. Dieser Ehe entstammen drei Söhne und eine Tochter.
Als einer der wenigen Schwarzen in den Niederlanden kommt er in den 1920er-Jahren mit den nationalistischen Studenten aus dem heutigen Indonesien in Berührung, wie Mohammed Hatta, der später bei der politischen Bewusstwerdung und Befreiung Indonesiens eine so wichtige Rolle spielen wird. Auch durch sie entwickelt sich de Koms politisches Bewusstsein. Der Aufstieg der Black-Power-Bewegung in Amerika, unter anderem mit dem Auftreten Marcus Garveys, trägt ebenfalls dazu bei. Er kommt in Kontakt mit linken niederländischen Schriftstellern und entwickelt sich zu einem guten Redner. Er hält Vorträge über Suriname, sein Land, und gegen den Kolonialismus.
»Ein sozial engagierter Mann, still und bescheiden, der aber heftig auf Unrecht und Ausbeutung reagierte«, sagen Menschen, die ihn gekannt haben.
Im Dezember 1932 kehrt de Kom aus familiären Gründen in sein Vaterland zurück.
Die soziale Situation dort ist menschenunwürdig. Seit 1920 hat sich nichts geändert: hohe Kindersterblichkeit, Unterernährung, Arbeitslosigkeit, Baracken, schlechtes Gesundheitswesen. De Kom gründet eine Beratungsstelle. Er hört sich die Klagen der Menschen an und spornt sie an, solidarisch zu sein und sich zu organisieren.
Dies alles wird von der Kolonialmacht als Bedrohung gesehen. Sie greift ein und verhaftet de Kom.
Am 7. Februar 1933 ziehen hunderte Kreolen, Hindustani und Javaner zum Generalanwalt, um die Freilassung des Mannes zu fordern, der für ihre Rechte eintritt. Unerwartet eröffnet die Polizei das Feuer. Es gibt zwei Tote und viele Verletzte.
Nach drei Monaten Haft ohne Verurteilung wird de Kom im Mai 1933 auf ein Schiff zurück in die Niederlande gesetzt. Die Ausweisung, sein politisches Engagement und die Krisenjahre machen das Leben für ihn und seine Familie alles andere als leicht.
Im Krieg widersetzt er sich heftig dem Faschismus. Er schreibt für die illegale Presse. In der Folge wird er im August 1944 von den Deutschen verhaftet und in ein Konzentrationslager nach Deutschland deportiert, wo er im April 1945 stirbt. Mitgefangene erzählen später, wie mutig de Kom die Demütigungen seiner Gefangenschaft ertrug. Unablässig sprach er über sein geliebtes Suriname.
Seine Grundüberzeugung, die absolute Ablehnung von Armut, Unterdrückung und Ausbeutung, ist in seinem Buch Wir Sklaven von Suriname stets präsent.
Seine Lebensgeschichte enthält trotz aller Traurigkeit eine positive, optimistische Botschaft.
De Kom ist es für kurze Zeit gelungen, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Kampf für ein menschenwürdiges Dasein zu vereinen!
Mögen die Surinamer daraus bleibende Inspiration und Hoffnung schöpfen.
Judith de Kom,im Namen der Familie de Kom,März 1981
Anton de Kom
WIR SKLAVEN VON SURINAME
»SRANAN«, UNSER VATERLAND
Vom 2. bis zum 6. Grad südlicher Breite und vom 54. bis 58. Grad westlicher Länge, zwischen dem Blau des atlantischen Ozeans und der Unwegsamkeit des Tumuk-Humak-Gebirges, das die Wasserscheide mit dem Amazonasbecken bildet, begrenzt durch die breiten Ströme Corantijn und Marowijne, die uns von Britisch- und Französisch-Guyana trennen, reich an ausgedehnten Wäldern, in denen der Grünherz, der Barlak, der Kapokbaum und der edle Braunherz wachsen, reich an breiten Flüssen, an denen Reiher, Wieswiesies, Ibisse und Flamingos ihre Brutplätze finden, reich an Naturschätzen, an Gold und Bauxit, an Kautschuk, Zucker, Bananen und Kaffee … arm an Menschen, ärmer noch an Menschlichkeit.
Sranan – unser Vaterland.
Suriname, wie die Holländer es nennen.
Die zwölfte und reichste … nein, ärmste Provinz der Niederlande.
Zwischen der Küste und den Bergen schlummert unsere Mutter, Sranan, seit Tausenden und Abertausenden von Jahren. In ihrem unbekannten Binnenland hat sich in den dichten Wäldern seit damals nichts verändert.
Die Urwälder im Hochland scheinen in ewigem Schweigen erstarrt, erst bei Einbruch der Nacht erwacht ihre verborgene Musik, gespielt von tausenden summenden Insekten. Romantischer, doch zugleich auch wilder, ist die Landschaft in den Savannen und entlang der Ufer der Flüsse. Die Schlingen der Lianen, die wie Draperien von den Bäumen hängen, versperren den Weg, wilde Orchideen blühen, hier leben die scheuen Patjieras, Kapuzineraffen balancieren auf den Ästen, Papageien stoßen ihre schrillen Schreie aus, der Jaguar lauert. Mit spitzer Zunge sucht ein Gürteltier nach Ameisen.
Seit tausenden Jahren waren Mutter Sranans dunkle Wälder unberührt und unerforscht. Sonderbare Tiere, deren Namen man im Westen kaum kennt, leben hier: Kleine Ameisenbären, Baumstachler, die Vireos, die Tanagras, die Tiegrinmans und die Blaudachse, Pfefferfresser sitzen oben in den Palmenkronen und Tagfalter schwirren umher, die glitzernd blauen Morphos, die gelben und orangefarbenen Callidryas erheben sich bis hoch in die Wipfel der Bäume.
Menschen?
Menschen, die sich an dieser Schönheit erfreuen können, gibt es kaum.
Landeinwärts leben die Warans, die Arawaks und die Kariben, schwache, vom Aussterben bedrohte Indianerstämme, machtlose Nachkommen der Urvölker, die von den Weißen aus den schönsten Orten verdrängt wurden. Im Hochland fertigen die Trios und die Ojanas Perlenketten und kunstvolles Flechtwerk, ihr feiner Tanzschmuck zeugt von einem angeborenen Sinn für Schönheit.
Ungefähr 2450 Indianer und ungefähr 17 000 Marrons, die Buschneger, über die wir später noch sprechen werden, leben hier.
Also höchstens zwanzigtausend Menschen bevölkern Sranans Landesinnere, das knapp fünf Mal so groß ist wie die Niederlande. Ansonsten tummeln sich in den Wäldern nur Agustis und Faultiere, Mandrillen, Tapire und Wasserschweine, Brüllaffen, Ameisenbären und Anakondas.
An Mutter Sranan ist die Geschichte vorübergezogen. Drei Jahrhunderte holländische Kolonisation haben ihr Binnenland unberührt gelassen, die Stromschnellen ihrer Flüsse treiben keine Turbinen an, die fruchtbaren Böden sind nicht besät, die reichen Schätze der Wälder nicht abgebaut. In bitterster Armut und in jämmerlicher Unwissenheit leben die wilden Stämme inmitten einer Natur, in der der Überfluss ungenutzt verlorengeht.
Weiße wagen sich selten in diese Wildnis, in der nur die Indianer und Marrons die Wege kennen. Entlang der Flussläufe dringt manchmal ein französischer Libéré, ein britischer Rowdy, ein holländischer Forscher ins Landesinnere vor. Sie setzen ihr Messer an die blanke Rinde der Bolletries und lassen den kostbaren Milchsaft fließen. Doch der Libéré kehrt zur Küste zurück, in seinem Whiskyrausch trinkt sich der Rowdy an einem einsamen Lagerfeuer zu Tode, der Holländer lässt sich von den Marrons in einem Kanu den Fluss hinabfahren. Die Wildnis bleibt zurück, die Wunden des Kautschukbaums verheilen, das verlassene Lager wird von Schlingpflanzen überwuchert.
Im Binnenland von Sranan findet sich nicht die leiseste Spur von holländischem Einfluss, holländischer Energie, holländischer Kultur, an keinem Weg, keiner Brücke, keinem Haus steht holländische Geschichte geschrieben. Die Weißen kannten nur die Furcht vor der Wildnis, in der die entlaufenen Sklaven Zuflucht suchten.
Einzig ein paar armselige verwahrloste Bahngleise, die ins Nirgendwo führen und niemals vollendet wurden, zeugen von einem kurzen wahnsinnigen Goldtraum.
Die weiten Flächen der Savannen, die Wälder und hohen Granitberge von Mutter Sranan schlummern seit hundert Jahrhunderten.
Für sie wurde noch keine Geschichte geschrieben.
Nur auf dem schmalen Küstenstreifen, hier und da an den Mündungen der großen Flüsse und auf den allerfruchtbarsten Alluvialböden weht das Rot, Weiß und Blau der holländischen Flagge.
Rot –
»Schauen Sie, Mutter«, sagt der kleine weiße Junge aus dem wunderbaren Buch Omdat ik zwart ben (Weil ich schwarz bin) von Madeleine Pax verwundert – »schauen Sie nur, auch die Neger haben rotes Blut!«
Weiß –
Die Farbe von Crommelins Friedensverträgen.
Und Blau? –
Ist es die Farbe unseres Tropenhimmels, zu dem wir durch die dunklen Blätter unserer Bäume aufblicken, um am funkelnden Glanz der Sterne das Versprechen für ein neues Leben abzulesen?
Nein, es ist das tiefe Blau des Atlantiks, über den einst die Sklavenbeschaffer ihre afrikanische Beute, ihre lebende Handelsware, unsere Eltern und Großeltern, in ihr zukünftiges Vaterland Sranan transportierten.
DAS ZEITALTER DER SKLAVEREI
DIE ANKUNFT DER WEISSEN
»Das alte Volk, das zum eigenen Verderb gastfreundlich zu den übermütigen Männern einer spanischen Karavelle war, und zu einem Mann, der Christusträger hieß. Ein gejagtes Volk …«
Albert Helman
»Glücklich [ist] das Volk«, sagt ein französischer Schriftsteller, »das keine Geschichte kennt.«
Die Geschichte Surinames beginnt 1499 mit der Entdeckung der Wilden Küste (Guyana) durch die Weißen.
Wir wissen von Hartsinck1, wie es in jenen Tagen an der Wilden Küste aussah. Dort wohnte damals ein Indianervolk, das Herr und Gebieter über sein eigenes Reich gewesen war. »Gastfreundlich«, schreibt Wolbers in seiner Geschiedenis van Suriname (Geschichte von Suriname)2, »empfingen sie häufig Besuch von anderen Stammesgenossen, wobei sich das Gespräch immer um ihre liebkosten Passionen drehte, die Jagd und den Fischfang. Sie besaßen eine angeborene Ehrlichkeit und einen Gerechtigkeitssinn, beides findet sich in all ihren Handlungen wieder. Sie waren anständig und freundlich, was man bei unzivilisierten Völkern nicht erwartet hätte. Wenn sie Gespräche führten, dann immer ruhig und leise, nie sprachen sie verächtlich. Sie kannten den Lauf der Sterne recht gut, was ihnen beim Aufspüren der Wege durch die Wildnis von großem Nutzen war.«
Diese Schilderung stimmt noch heute mit Berichten von Entdeckungsreisenden über den Charakter ihrer Nachkommen, den Trios und den Ojanas, überein. Auch für sie gilt, dass sie bedächtige Menschen sind, bei denen heftige Gefühlsausbrüche oder unbändiges Lachen selten vernommen werden, auch bei ihnen rühmt man die großzügige Gastfreundlichkeit, den Mut und die Tatkraft. Zudem sind sie ausgezeichnete Bootslenker und vorzügliche Kenner des Urwalds. Und doch stellen sie nichts anderes dar als ein in seiner natürlichen Entwicklung gebremster Rest dessen, was einmal ein selbstständiges und glückliches Volk gewesen ist.
Was trieb die Weißen nur an diese »wilden« Küsten? Welche Berufung hat sie beseelt? Welche Botschaft, welches Glück, welche Kultur hatten sie diesem freien und glücklichen Volk zu bieten? Kamen sie, die ersten Spanier, die unsere Küste besuchten, um Guyana die Segnungen von Autodafé und Inquisition zu schenken? Brachten sie, im Namen Jesus Christus, jene Duldsamkeit, die Spanien damals Juden und Mohren entgegenbrachte, oder kamen sie mit der weißen Kultur des Rades, des Scheiterhaufens und anderer Torturen? War das die Rechtfertigung für ihre Invasion? Oder kamen sie mit dem Gelb und Rot ihrer Fahnen, um die Botschaft zu verkünden, dass Gold immer mit Blut gekauft wird?
Lassen wir die Tatsachen sprechen.
1492 entdeckte Columbus Amerika, und bald übten die übertriebenen Schilderungen vom neuen Land mit seinen Reichtümern eine unwiderstehliche Anziehung auf Europäer jeglichen Ranges und Standes aus.
Über sie schreibt Professor Werner Sombart in Der Bourgeois3:
»Eine Spielart der Seeräuberei waren die Entdeckungsfahrten, die namentlich seit dem 15. Jahrhundert häufiger wurden. Mochten bei ihnen allerhand ideale Motive mitsprechen: wissenschaftliche oder religiöse Interessen, Ehrgeiz, Abenteurerlust u.a.: die stärkste (und oft genug einzige!) Triebkraft blieb doch immer die Gewinnsucht. Es sind im Grunde alles wohlorganisierte Beutezüge, die der Plünderung in den überseeischen Gebieten galten. Zumal nachdem Columbus seine Entdeckungen gemacht hatte, als er von seinen Fahrten veritablen Goldstaub und die Wundermär vom vergoldeten Prinzen heimgebracht hatte, war das Goldland El Dorado das ausgesprochene oder stillschweigende Ziel aller dieser Expeditionen … Nun verbanden sich das abergläubische Schatzgräbertum und die abergläubische Goldsucherei mit der abergläubischen Hoffnung auf ein Land, in dem man das Gold mit Scheffeln einheimsen könnte, zu einem unwiderstehlichen Eroberungsdrange.
Was uns vor allem an dieser Stelle interessiert, sind die eigenartigen Menschen, die an der Spitze dieser Unternehmungen standen. Es sind kraftstrotzende, abenteuerlustige, sieggewohnte, brutale, habsüchtige Eroberer ganz großen Kalibers, wie sie seitdem immer mehr verschwunden sind.
Diese genialen und rücksichtslosen Seeräuber, wie sie namentlich England während des 16. Jahrhunderts in reichster Fülle aufweist, sind aus demselben Holz geschnitzt wie die Bandenführer in Italien, wie die Can Grande, Francesco Sforza, Cesare Borgia, nur daß ihr Sinn stärker auf Erwerb von Gut und Geld ausgerichtet ist, daß sie dem kapitalistischen Unternehmer schon näher stehen wie diese …
Man wird fragen, wie ich dazu komme, diese Eroberer und Räuber für den Kapitalismus zu reklamieren?
Die Antwort ist einfach: nicht, weil sie selbst eine Abart von kapitalistischen Unternehmern waren, als vielmehr und vor allem deshalb, weil der Geist, der sie erfüllte, derselbe Geist war, der jeden großen Handel, jede Kolonialwirtschaft bis ins 18. Jahrhundert hinein beseelt hat. Diese sind ihrem innersten Wesen nach ebenso Abenteurer- und Eroberungszüge wie die Seeräubereien und Entdeckungsfahrten, von denen wir eben Kunde erhalten haben. Abenteurer, Seeräuber, Kaufmann großen Stils (und das ist er nur, wenn er über See fährt) gehen unmerklich ineinander über.«
EL DORADO
El Dorado.
Goldland.
Noch immer hat das Wort nichts von seinem wundersamen Reiz verloren.
Noch tritt auf dem großen Passagierschiff ein junger Arzt in die Nacht hinaus, die Augen geblendet von den Lichtern des Ballsaals, seine Gedanken swingen im trunkenen Takt der Jazzband, ihm ist, als wäre er als einzig Lebender einem rauschenden Fest von Schaufensterpuppen entkommen.
Er beugt sich über die Reling und kühlt seine Schläfen im Nachtwind. Ein immer wieder aufleuchtendes Licht aus einem der Bullaugen wirft bizarre Blitze auf die dunklen Wellen.
Goldadern in Granit.
El Dorado.
Im Brausen der Wellen vernimmt der junge Arzt den fernen Gesang der Bukaniere, den der Nachtwind aus vergangenen Jahrhunderten mit sich führt.
Tagsüber sitzt er in seiner Kabine und stellt auf geschmackvollem Schiffspapier Rezepturen zusammen, für amerikanische Damen, die an der Seekrankheit leiden, oder für ältere Herren mit Leberbeschwerden.
Nachts, wenn die Jazzband verstummt und der Seewind wieder zu hören ist, wenn aus dem Rauchsalon nur noch das heisere Gezeter einiger betrunkener Plantagenbesitzer zu ihm dringt, erwacht in seinem Herzen der Wahnsinn von El Dorado.
Nachts vergisst er sein adrettes Hemd, seinen Smoking, seinen Stand.
Dann fühlt er sich seinen Vorfahren nahe, den wilden Räubern, die in den Schiffsräumen Gold stapelten, den Abenteurern, den Pfundskerlen, den Sklavenjägern.
Unter der grauen Asche des alltäglichen Trotts glüht im Herzen eines jeden jungen Weißen der Wahnsinn, das fiebrige Verlangen nach El Dorado.
1499 erreichten Alonzo de Hojeda und Juan de la Coasa die Küste von Guyana. Etwa zur selben Zeit entdeckte Pinzon die Mündung des Amazonas und den östlichen Teil Guyanas. Das Gerücht verbreitete sich, dass es tief im Inneren ein Land mit unermesslichen Reichtümern an Gold und Edelsteinen geben soll, und dass der Ufersand eines unendlich großen Sees, Parima genannt, gänzlich aus Goldstaub bestehe.
Angelockt von diesen Gerüchten unternahm Domingo de Vera 1593 eine Fahrt nach Guyana, das er am 23. April 1594 mit einem feierlichen Festakt für Spanien in Besitz nahm. Anführer und Soldaten knieten vor einem Kreuz nieder und sandten ein Dankgebet zum Himmel. »Dann nahm Domingo de Vera eine Tasse Wasser und trank sie aus, er nahm eine zweite und goss sie über den Boden aus, so weit er nur konnte, zog sein Schwert und schnitt das Gras um sich herum sowie einige Baumzweige, während er sprach: Im Namen Gottes nehme ich dieses Land in Besitz für Seine Majestät Don Philipp, unseren legitimen Herrscher!«4
Dies nur als ein erstes Beispiel für den Missbrauch des Namen Gottes im kolonialen Trauerspiel. Später wurde in christlichen Büchern oft behauptet, der Neger sei kein Mensch, weil der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, und Gott diesen Schriftgelehrten zufolge nicht schwarz sei …
Lasst uns an dieser Stelle, als Neger, versichern, dass auch wir nicht glauben, nach dem Abbild eines Gottes geschaffen zu sein, dessen Segen von den Weißen jener Tage immer dann erbeten wurde, wenn sie sich Land, Leib und Gut von den farbigen Völkern aneigneten.
Die hohen Erwartungen der spanischen Goldsucher haben sich nicht erfüllt. In der Annahme, dass in den Küstengebieten kein Gold zu finden sei, weil es die Eingeborenen im Landesinnern versteckt hätten, zogen die Weißen mit gezückten Waffen durch das Binnenland und ließen dort, wo sie auf Widerstand trafen, Bluthunde los, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind.
Doch El Dorado haben sie nicht entdeckt.
Dafür rächten sich die Abenteurer bitterlich an den Eingeborenen, beraubten sie ihrer Freiheit und legten sie in Ketten, zwangen sie zur Arbeit, geißelten und misshandelten sie.
Und als sich die eingeborene Rasse als zu schwach erwies, die Schätze heranzuschaffen, von denen die Weißen in ihrem Wahn gemeint hatten, sie seien zum Greifen nahe, als sie zu Tausenden unter den Schlägen und Misshandlungen starben, da erinnerte man sich auch in Suriname an den Rat von Las Casas5