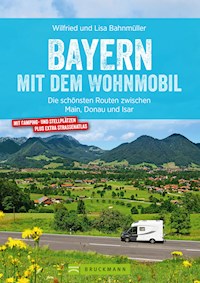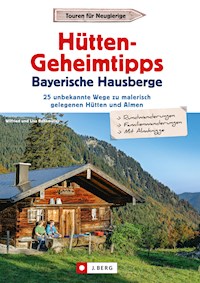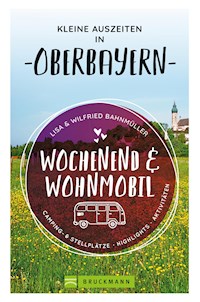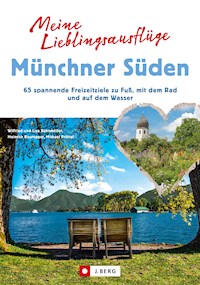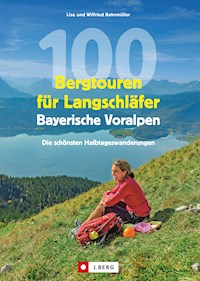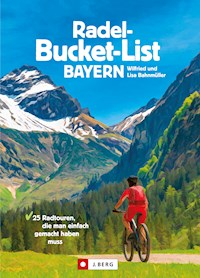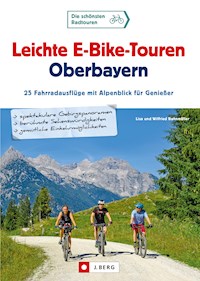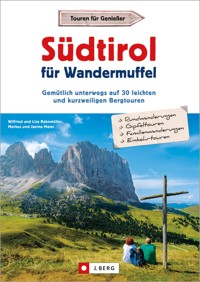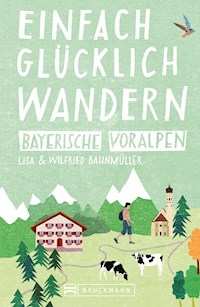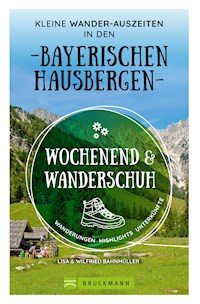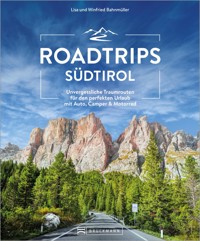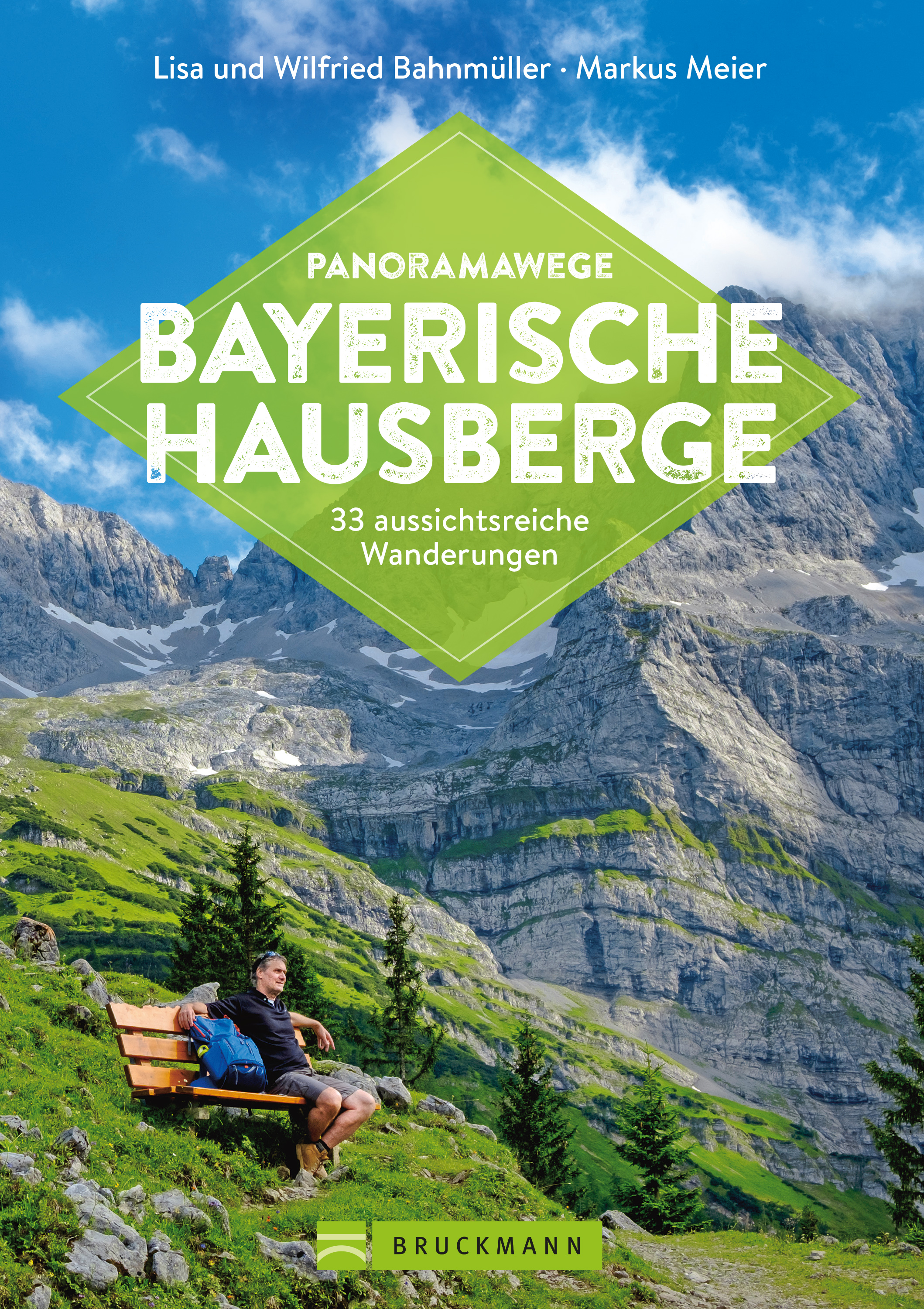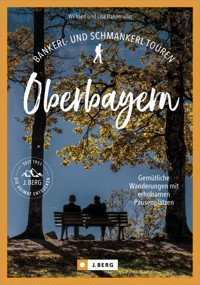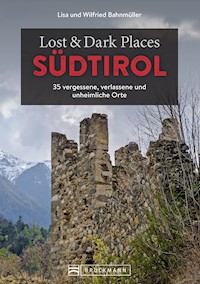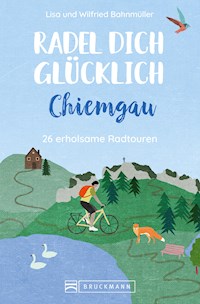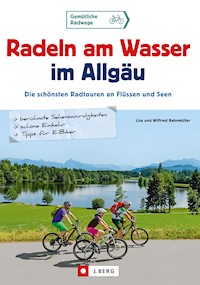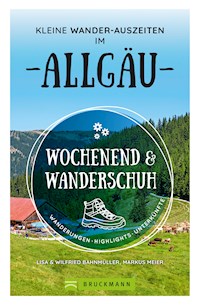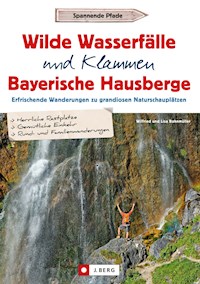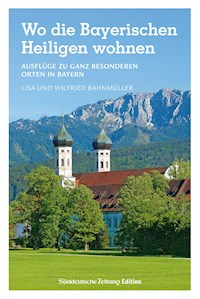
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruckmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wandern und spazieren hat für viele auch etwas Besinnliches. Warum also nicht den Ausflug zu Fuß mit noch mehr Besinnung verbinden und zu den Wirkungsstätten der bayerischen Heiligen reisen? Oder wussten Sie, was der iro-schottische Missionsbischof Kilian mit Würzburg zu tun hat? Was es mit der Fischlegende und dem Heiligen Ulrich auf sich hat? Was Quirinus von Rom mit dem Tegernsee verbindet? Dieser besondere und besinnliche Ausflugsführer verrät es Ihnen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wo die Bayerischen Heiligen wohnen
AUSFLÜGE ZU GANZ BESONDEREN ORTEN IN BAYERN
LISA UND WILFRIED BAHNMÜLLER
Inhalt
Bayerische Heilige
Bayerns fränkische undostbayerische Heilige
1Bischof Kilian von Würzburg
Kolonat, Totnan, Kilian – Schutzpatrone der Franken
2Das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde
Herzog, König, Kaiser, Heiliger – eine Herrscher-Karriere
3Sola mit dem Esel
Rettender Missionar im oberen Altmühltal
4Willibald von Eichstätt
Englischer Familienclan fern der Heimat
5Wolfgang von Regensburg
Bischof, Schuldirektor – und Weltmeister im Axtwurf
6Hermann von Bischofsmais
Wunder, Weissagungen – und ein unheiliger Namensvetter
7Konrad von Parzham
Bauer, Kapuzinerbruder und Pförtner
Heilige aus Schwaben,Oberbayern und dem Allgäu
8Ulrich von Augsburg
Staatsmann, kluger General und Beschützer des Volkes
9Radegundis von Wellenburg
Schwäbische Magd und Wolfsheilige – oder Legendenkopie?
10Crescentia von Kaufbeuren
Gemobbt, geliebt und letztendlich geheiligt
11Magnus von Füssen
Mittelalterlicher Entwicklungshelfer am Alpenrand
12Korbinian von Freising
Bärenbändiger und Bischof wider Willen
13Alto von Altomünster
Ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen zum Heiligen Alto
14Edigna von Puch
Kultplatz und Heiligkeit – eine Königstochter im hohlen Baum
15Graf Rasso von Grafrath
Reliquiensammler und Held unter der bayerischen Raute
16Mechtild von Dießen
Äbtissin, Adelige und Helferin gegen Migräne
17Nantovinus von Wolfratshausen
Vom verleumdeten Pilger zur Berühmtheit
18Anastasia und das Kloster Benediktbeuern
Die römische Märtyrerin und das Wunder vom Kochelsee
19Quirin vom Tegernsee
Gesucht, gefunden: Ein Klosterheiliger sollte es sein!
20Emmeram in Kleinhelfendorf
Vom Regensburger Herzogshof zum oberbayerischen Komplott
21Marinus und Anianus
Onkel und Neffe in der Einsiedelei am Irschenberg
22Irmengard von Frauenchiemsee
Heute noch geschätzte Selige von höchstem Adel
Register
Impressum
Die Heiligen
1Bischof Kilian von Würzburg
2Das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde
3Sola mit dem Esel
4Willibald von Eichstätt
5Wolfgang von Regensburg
6Hermann von Bischofsmais
7Konrad von Parzham
8Ulrich von Augsburg
9Radegundis von Wellenburg
10Crescentia von Kaufbeuren
11Magnus von Füssen
12Korbinian von Freising
13Alto von Altomünster
14Edigna von Puch
15Graf Rasso von Grafrath
16Mechtild von Dießen
17Nantovinus von Wolfratshausen
18Anastasia und das Kloster Benediktbeuern
19Quirin vom Tegernsee
20Emmeram in Kleinhelfendorf
21Marinus und Anianus
22Irmengard von Frauenchiemsee
Zeichenerklärung zu den Tourenkarten
Wandertour
Tourenvariante
Richtungspfeil
Ausgangs-/Endpunkt der Tour
Bahnlinie mit Bahnhof
S-Bahn
Tunnel
Seilbahn, Gondelbahn
Bushaltestelle
Parkmöglichkeit
Hafen
Autofähre
Personenfähre
Flugplatz
Kirche
Kloster
Burg/Schloss
Ruine
Wegkreuz
Denkmal
Turm
Leuchtturm
Windpark
Windmühle
Mühle
Hotel, Gasthof, Restaurant
Jausenstation
Schutzhütte, Berggasthof (Sommer/Winter)
Schutzhütte, Berggasthof (Sommer)
Unterstand
Grillplatz
Jugendherberge
Campingplatz
Information
Museum
Bademöglichkeit
Bootsverleih
Sehenswürdigkeit
Ausgrabung
Kinderspielplatz
schöne Aussicht
Aussichtsturm
Wasserfall
Randhinweispfeil
Maßstabsleiste
Wie in Bischofsmais (siehe ab S. 46) lassen sich einige Heilige mit Wanderungen durch herrlichste bayerische Landschaften besuchen.
Bayerische Heilige
In kaum einer anderen Region Deutschlands spielt die Heiligenverehrung eine so große Rolle wie in Bayern. Das mag nicht unbedingt daran liegen, dass die Bayern grundsätzlich frömmer wären als die Menschen in anderen Gegenden. Aber weite Teile Bayerns waren über Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich landwirtschaftlich geprägt, die Menschen lebten verstärkt im Rhythmus der Jahreszeiten und mussten mit Naturereignissen zurechtkommen. Dadurch entstand ein Reigen an Brauchtumstagen, der gut mit Heiligenverehrungen einherging.
Die Heiligen waren und sind seit vielen Jahrhunderten Vorbilder des Glaubens. Den Anfang bildeten schon wenige Hundert Jahre nach Abzug der Römer die ersten Christen, Missionare und Bischöfe, die den christlichen Glauben ins heidnisch geprägte Germanien brachten. Später wurden herausragende Gestalten der Kirche verehrt, gern verbunden mit einem regen Reliquienhandel, sodass auch römische Märtyrer Einzug in Bayern hielten. Hinzu kommen noch jede Menge Lokalheilige, deren Geschichte sich teilweise allerdings nur schlecht nachweisen lässt.
Dabei war es gar nicht so einfach, heiliggesprochen zu werden. Meist bedurfte es schon einiger Wunder, die bezeugt werden mussten. Aber spätestens, wenn ein Papst oder ein Bischof die Gebeine eines Verstorbenen erheben ließ, war das ein besonderes Zeichen, dem die Heiligsprechung fast automatisch folgte.
Grundsätzlich passen die Heiligen zur Mentalität der Bayern perfekt. Mit Geschichten und Legenden umwoben, barock angehaucht, manchmal verspielt, verbunden mit Festen und Prozessionen lassen sich die Heiligen in Bayern gern und ausgiebig feiern. Aber natürlich wurden die Heiligen vor allem um ihre Fürbitte gebeten. Von den verstorbenen Glaubensvorbildern erhofft(e) man sich Hilfe und manchmal auch wahre Wunder. Es war vielleicht immer einfacher, sich an einen der Stellvertreter Gottes zu wenden als direkt an den Schöpfer selbst, das zeigt auch die große Marienverehrung der Bayern. Die Heiligen mit ihren Lebensgeschichten waren und sind der bayerischen Bevölkerung wohl einfach näher.
Man merkt jedoch deutliche Unterschiede zwischen dem protestantisch geprägten Norden und dem katholischen Süden, wie unsere Geschichten in diesem Buch aufzeigen. Gefühlt fehlen hierbei wohl einige Heilige, die im bayerischen Brauchtumsjahr eine wichtige Rolle spielen. Aber die Heiligen Leonhard und Martin sind eigentlich Franzosen, die Heiligen Benedikt und Antonius, den man in fast jeder Kirche antrifft, sind Italiener, die Heilige Notburga stammt aus Tirol, und auch die drei »Heiligen Madel« Barbara, Margaretha und Katharina, die man so oft in den Kirchen findet, stammen nicht aus Bayern, sondern aus Kleinasien.
Wir haben uns »echte« bayerische Heilige und ein paar Selige gesucht, die fest mit ihrem Wohnort verbunden sind. Wer Lust hat, sie und ihre Geschichten besser kennenzulernen, kann ihre Verehrungsstätten mit Spaziergängen oder Wanderungen aufsuchen – gleich einer kleinen persönlichen Prozession oder Wallfahrt, bei der wir uns schon auf den Besuch einstimmen.
Entschuldigen möchten wir uns bei all den bayerischen Heiligen, die es nicht mehr in dieses Buch geschafft haben: der Heilige Tertulin in Schlehdorf, Afra und Simpert aus Augsburg, Zeno aus Bad Reichenhall, Gunther aus Niederalteich, Englmar aus dem Bayerischen Wald, Sebaldus aus Nürnberg sowie Gunthildis, Achahildis oder Richhildis oder die jüngeren Heiligen wie Pater Rupert Mayr oder Anna Schäfer – es gäbe noch so viele Geschichten mehr über sie alle zu erzählen.
Herzlichst,
Lisa und Wilfried Bahnmüller
Auch die Patrona Bavariae, die Heilige Gottesmutter Maria, die in ganz Bayern als Schutzpatronin verehrt wird, wollen wir nicht vergessen. Ihr sind nicht nur zahlreiche Kirchen geweiht, sie wacht auch auf so mancher Mariensäule, wie z. B. in Wemding, über die Bewohner.
Bayerns fränkische und ostbayerische Heilige
Die Heiligenverehrung im Norden und Osten Bayerns wurde durch die großen Fürstbistümer Würzburg, Bamberg, Regensburg und Passau geprägt, die ausnahmslos zum katholischen Glauben standen. Als Gegenpol gab es aber auch viele Adelssitze, die sich zum Protestantismus bekannten. In ihren Territorien verschwand die Heiligenverehrung fast völlig.
Die Würzburger Festung Marienberg über dem Main (siehe ab S. 10)
1
Bischof Kilian von Würzburg
KOLONAT, TOTNAN, KILIAN – SCHUTZPATRONE DER FRANKEN
Wie viele andere bayerische Heilige stammen auch Kilian und seine Begleiter Kolonat und Totnan aus der Riege der iro-schottischen Missionare. Ursprünglich waren es sogar elf Begleiter, die sich in Franken niederließen. Im Gedächtnis blieb jedoch vor allem Kilian.
Den wenigen schriftlichen Aufzeichnungen nach kam Kilian 686 mit seinen Begleitern ins Frankenland. Er stammte wohl aus Irland, und man nimmt an, dass der Name Kilian der keltischen Urform Ceallach entstammt und »Kämpfer« bedeutet. In Germanien war ihre Hilfe sehr willkommen, nicht so sehr wegen der Missionierung im christlichen Glauben, aber die gut ausgebildeten Männer brachten viel Wissen und praktische Kenntnisse in den Bereichen Land-, Holzwirtschaft und Viehzucht mit. Das war dringend nötig, denn nach dem Rückzug der Römer blieb die Kultivierung und Zivilisierung in Germanien auf der Strecke.
So kann man wohl feststellen, dass sich die Mönche als Entwicklungshelfer betätigten – und da nahm man es gern in Kauf, dem alten Glauben an heimische Naturgötter abzuschwören und sich taufen zu lassen. Zur Zeit Kilians regierte in Franken Herzog Gosbert, der mit seiner Schwägerin Galiana verheiratet war. Er hatte sich ebenfalls taufen lassen, jedoch war nach kirchlichem Recht die Ehe mit seiner Schwägerin nicht rechtens, und er sollte sich von ihr trennen. Das wiederum fand Galiana, die betroffene Ehefrau, wenig amüsant, und so ließ sie kurzerhand, als sich Gosbert 689 auf einer Reise befand, die drei christlichen Missionare Kilian, Totnan und Kolonat ermorden. Der Legende nach wehrten sich die drei nur mit der Bibel gegen die Schwerter der Meuchelmörder. Diese hingegen vertuschten den Überfall, verwischten alle Spuren und verscharrten die Leichen einschließlich ihrer Bibeln, Kreuze, Kelche und Hostien unter einem Pferdestall.
Kopie des Hl. Kilian nach Riemenschneider in der Neumünsterkirche
Altarraum im Würzburger Dom St. Kilian
Das mächtige Würzburger Bistum konnte sich ein Schloss als Residenz leisten.
Auf der Mainbrücke begrüßt uns der Heilige Kilian.
Entlang des Mains macht der Stadtspaziergang Spaß.
Als sich der Herzog nach seiner Rückkehr nach Kilian erkundigte, wurde zunächst die Tat verleugnet. Aber die Mörder und auch Galiana verfielen dem Wahnsinn, und so kam das grausame Geschehen ans Tageslicht. Das wiederum deutete man als Sieg des christlichen Glaubens. Gut 50 Jahre später wurden die Gebeine der drei Märtyrer am 8. Juli 743 gehoben und würdevoll bestattet. Langsam setzte die Verehrung der Heiligen ein, und Kilian wurde zum Apostel der Franken – zudem ist Würzburg bis heute Bischofssitz geblieben.
Nach einigen weiteren Erhebungen u. a. im Beisein Karls des Großen fanden die sterblichen Überreste der Heiligen schließlich im Würzburger Neumünster ihre letzte Ruhestätte, einem Vorgängerbau der heutigen Neumünster-Kirche. Nur während des Zweiten Weltkriegs wurden sie vorübergehend noch einmal ausquartiert und zum Schutz vor Bombenangriffen nach Gerolzhausen gebracht – rückblickend auf den 16. März 1945, als fast ganz Würzburg von Bomben zerstört wurde, eine gute Entscheidung. Heute teilen sich der Dom und die Neumünster-Kirche die Gebeine der Heiligen: Ersterer trägt den Namen St. Kilian und beherbergt im Hochaltar die Reliquien des Apostels in einem gläsernen Schrein, während im Neumünster die Kopien der Riemenschneider-Holzfiguren der drei Heiligen sowie die Kiliansgruft unter der Kirche zu finden sind.
Stadtspaziergang durch Würzburg
Um auf den Spuren des Heiligen Kilian zu wandeln, bietet sich ein Spaziergang durch Würzburg an, mit dem wir zugleich auch die Geschichte der Stadt erkunden. Würzburgs Besiedlung reicht bis in die vorgeschichtliche Zeit zurück. So fand sich auf dem Marienberg, wo heute die Festung steht, eine keltische Fliehburg aus der Zeit um 1000 v. Chr. Ausgehend von der Alten Mainbrücke, wo uns die Missionare um Kilian sowie viele andere Größen aus Würzburgs Vergangenheit in Form von Statuen begegnen, spazieren wir geradeaus auf der Domstraße direkt zum Kiliansdom, der tagsüber frei zugänglich ist. Neben dem Altar mit den darin eingebetteten Schädeln der Märtyrer sind die beiden spätgotischen Epitaphien der Fürstbischöfe Lorenz von Bibra und Rudolf II. von Scherenberg, die Tilman Riemenschneider gestaltet hat, besonders sehenswert. Nördlich vom Dom, nur durch das Museum und den Kiliansplatz getrennt, steht das Neumünster mit seiner Kiliansgruft. Vom Dom aus erreicht man durch die Hofstraße die Fürstbischöfliche Residenz. Dieser Repräsentationsbau gehört zu den Höhepunkten der europäischen Barockarchitektur und lohnt einen Besuch. Frei zugänglich ist der weite Schlossgarten, in dem sich immer wieder neue Sichtachsen zum Schloss hin ergeben.
Vom Residenzplatz aus erreicht man über Theater-, Spiegel- und Eichhornstraße den Marktplatz mit der Marienkapelle. An ihrem Eingang empfangen uns die Figuren von Adam und Eva – auch diese beiden schuf Tilman Riemenschneider nach der Fertigstellung der Marienkapelle 1493. Allerdings sehen wir heute nur die Kopien, die Originale befinden sich im Mainfränkischen Museum auf der Festung Marienberg.
Vom Marktplatz ist es nicht mehr weit bis zurück zur Alten Mainbrücke. Dort dürfen wir uns ein Gläschen Wein in der Alten Mainmühle gönnen – entweder im Restaurant oder wir genehmigen uns einen sogenannten Brückenschoppen, eine echte Würzburger Institution: Direkt auf der Brücke, inmitten des quirligen Altstadtlebens und unter dem wachsamen Auge des Heiligen Kilian, schmeckt ein gut gekühlter Weißwein besonders gut.
Das Museum am Dom verbindet den Würzburger Dom und das Neumünster.
Auf einen Blick
HEILIGE/R
Hl. Kilian von Würzburg
ATTRIBUTE
Als Bischof mit Schwert und Abtstab
GEDENKTAG
8. Juli
AUSGANGSPUNKT UND ANFAHRT
Alte Mainbrücke in Würzburg
GPS: 49.793065, 9.926522
Bus & Bahn: Mit der Bahn zum Hauptbahnhof Würzburg nördlich der Altstadt, dann entweder mit der Tram direkt zum Dom oder zu Fuß über Kaiserstraße und Juliuspromenade zum Mainkanal und von dort auf dem schönen Uferweg nach Süden zur Alten Mainbrücke
Auto: Würzburg ist gut über die A 3 zu erreichen, dann mit dem Auto in die Innenstadt – gute Parkplätze gibt es südlich der Alten Mainbrücke am Ostufer oder nördlich der Friedensbrücke am Westufer (großer Parkplatz Talavera).
GEHZEIT UND SCHWIERIGKEIT
Einfacher Stadtspaziergang von gut 3 km Länge, für den man jedoch aufgrund der zahlreichen Besichtigungsmöglichkeiten viel Zeit einplanen sollte.
EINKEHR
In Würzburg gibt es sehr viele Restaurants, Gasthäuser, Cafés und Weinhäuser. Nett sitzt man im Brauerei-Gasthof Alter Kranen am Mainufer. Die Weinstube im Juliusspital an der Juliuspromenade serviert neben sehr guter fränkischer Küche auch den berühmten Wein des historischen Juliusspitals.
INFORMATION
wuerzburg.de
2
Das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde
HERZOG, KÖNIG, KAISER, HEILIGER – EINE HERRSCHER-KARRIERE
Zwei überragende Gestalten prägen die Übergangszeit der ersten Jahrtausendwende: Kaiser Heinrich, der später als »der Heilige« bezeichnet wird, und seine selbstbewusste Gemahlin Kunigunde, die ebenfalls heiliggesprochen wurde.
Das Kaiserpaar war bei der Bevölkerung überaus beliebt, was sich u. a. darin manifestierte, dass nach der Heiligsprechung viele Neugeborene den Namen Heinrich oder die Ableitung Heinz, Horst oder Heimo erhielten. Dies gilt auch für Kunigunde, deren Name erst im 19. Jahrhundert etwas in Vergessenheit geraten ist. Es ist schwer, nach 1000 Jahren den wahren Hintergrund für diese Popularität aufzuklären. Sicher spielte dabei eine erhebliche Rolle, dass sich Heinrich hauptsächlich auf sein Reichsgebiet nördlich der Alpen konzentrierte und zudem die Bindung zur Kirche stärkte und dadurch die Macht des Adels einschränkte. Als Gegenleistung mussten ihn auf seinen zahlreichen Reisen die Klöster und Bistümer beherbergen sowie auch einen Teil des Heeres stellen.
Geboren wurde Heinrich 973 als Sohn des bayerischen Herzogs Heinrich des Zänkers. Mit 22 Jahren heiratete er Kunigunde von Luxemburg. 1002 wurde Heinrich in Mainz zum deutschen König geweiht, und noch im selben Jahr erhielt auch seine Gemahlin die Königswürde. Sie nahm von Anfang an aktiv an den Regierungsgeschäften teil, was ungewöhnlich für die damalige Zeit war, aber von Heinrich unterstützt wurde. Während ihrer Regentschaft gründeten sie 1007 das Bistum Bamberg und statteten es mit zahlreichen Reliquien und Büchern, mit Gold, Juwelen und Gütern aus. Dafür gab es einen triftigen Grund: Nach zwölf Jahren Ehe hatte sich der Kinderwunsch des Kaiserpaars noch nicht erfüllt, und ihnen wurde klar, dass sie wohl auch in Zukunft keinen Nachwuchs zu erwarten hatten – mit der Gründung des Bistums war die spätere Erinnerung an sie, auch ohne leibliche Erben, dann allerdings gesichert.
Die Kaiserin unterzieht sich der Feuerprobe – zu sehen auf einem alten Tafelbild im Historischen Museum.
Hochgrab des Kaisers Heinrich II. von Tilman Riemenschneider im Dom St. Peter und Georg von Bamberg
Am Hochgrab ist die Feuerprobe mit den glühenden Pflugscharen ebenfalls dargestellt.