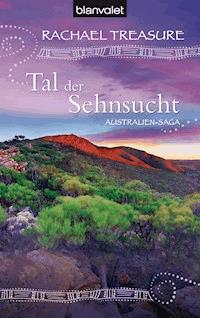5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Australien – das Traumland der deutschen Leserinnen!
Australien, im Outback. Rebecca bricht es das Herz, die elterliche Farm »Waters Meeting« verlassen zu müssen. Doch wieder hat es einen entsetzlichen Streit mit ihrem Vater über die Führung der Farm gegeben, und so macht sich Rebecca nach Norden auf, um dort ein Jahr als Cowgirl zu verbringen. Als sie sich in Charlie verliebt, steht sie vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens: Welche Liebe wiegt schwerer? Die zu Charlie oder zu ihrer Heimat?
Wilde Abenteuer vor einer atemberaubenden Landschaftskulisse und große Gefühle zwischen starken Frauen und handfesten Männern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Im Outback von Australien. Als Rebecca Saunders, genannt Bec, nach ihrem Schulabschluss auf die elterliche Farm »Waters Meeting« zurückkehrt, hat sie nur einen Wunsch: Sie möchte ihr Jahrespraktikum als »Jillaroo«, als Cowgirl, absolvieren und danach Agrarwissenschaften studieren. So würde sie genügend Know-how erwerben, um später die Familienfarm mit modernen Methoden führen zu können. Doch sie hat nicht mit dem unerbittlichen Widerstand ihres Vaters gerechnet, der sie eher als Lehrerin oder Krankenschwester sieht. In Wahrheit, so weiß Bec, will er sie nicht an seiner Seite haben, weil sie ihm seine Unzulänglichkeiten vor Augen führt. Das Zerwürfnis mit ihm scheint endgültig, als er sie nach einem Streit von der Farm jagt.
Rebecca aber will sich nicht von ihrem Traum abbringen lassen. Entschlossen geht sie in den Norden und findet eine Stelle als Jillaroo auf einer Schaffarm. So nimmt das Schicksal seinen Lauf. Denn dort macht Bec Bekanntschaft mit Charlie Lewis. Er ist nicht nur ein charismatischer Partykönig und zum Verlieben attraktiv, sondern teilt als Sohn eines Getreidefarmers auch Rebeccas Liebe für ein Leben auf dem Land. Kaum aber beginnt sie sich eine Zukunft mit Charlie auszumalen, geschehen zwei Tragödien, und Rebecca steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: Welche Liebe wiegt schwerer? Die zu Charlie oder die zu ihrer Heimat »Waters Meeting«, wo sich die Wasser finden?
Autorin
Rachael Treasure wurde 1968 in Hobert/Tasmanien geboren. Sie studierte Agrarwissenschaft und Journalistik und arbeitete für eine Reihe regionaler Zeitungen und Zeitschriften. Bei einer ihrer zahlreichen Reisen im In- und Ausland lernte sie ihren Mann John kennen, einen Viehzüchter in fünfter Generation. Mit ihm und Tochter Rosie lebt sie auf einer Farm im Süden Tasmaniens, wo sie Pferde, Kelpie-Hunde und Merinoschafe züchten.
Von Rachael Treasure bereits erschienen:
Tal der Sehnsucht (36563) · Wo der Wind singt (Blanvalet HC, 0282)
Inhaltsverzeichnis
1. Teil
Kapitel 1
Rebecca Saunders pfiff ihrem Hund.
»Mossy, ganz zurück.«
Im goldenen Morgenlicht umrundete der kleine, leichtfüßige Kelpie wie schwebend die Schafherde im Sammelpferch. Nichts als das Klirren von Mossys Halskette war zu hören, als sie in einen leichten Trab fiel und sich dann flach auf den staubigen Boden kauerte. Die Schafe drängten sich enger zusammen und drehten die Köpfe Mossys reglosem rotbraunen Leib zu. In dem sicheren Wissen, dass Mossy die Herde zuverlässig auf den Hof bringen würde, kehrte ihr Bec den Rücken zu und öffnete das Tor. Sie hängte die Kette aus, schleifte das rostige, quietschende Gatter durch den Staub und befahl Mossy mit einem Pfiff, sich den Schafen zu nähern. Rebecca beobachtete, wie das Meer von Mutterschafen mit dem Widder in der Mitte langsam auf sie zutrieb. Der Widder hielt den Kopf hoch erhoben und hatte die Lippen zurückgezogen. Seine Hörner umringelten wie eine Richterperücke sein Gesicht in einer pompösen Spirale. Bec betrachtete ihn stirnrunzelnd. Seine Hoden gefielen ihr gar nicht. Fast die ganze Nacht waren sie ihr im Kopf herumgegangen.
Sie erinnerte sich lebhaft, wie ihr wettergegerbter, drahtiger Großvater beide Hände ausgestreckt und die knotigen Finger in der Luft zusammengekrallt hatte.
»Zwei volle Bierdosen«, hatte er gesagt. »Wie zwei volle Bierdosen. Genauso soll’n sie sich anfühlen.« Dann hatte ihr Großvater den schweren Hodensack eines seiner Widder angehoben und in beiden Handflächen gewogen.
»Hier, Mädchen, fühl mal.«
Warum also, überlegte Bec an diesem Morgen, trug der Widder, für den ihr Vater eben erst 2000 Dollar gezahlt hatte, eine volle Bierdose und ein Minibar-Fläschchen in seinem Hodensack herum? Hätte ihr Vater doch nur auf sie gehört.
Während sie energisch in Richtung Hof ging, fragte sie sich, ob sie ihn wohl überreden konnte, den Widder zurückzugeben. Wieder sah sie den Schafbockzüchter im Tweedmantel vor sich, dem die grauen Haare aus Nase und Ohren wucherten. Unglaublich, aber der Mann sprach immer noch mit englischem Akzent.
»Jo, das ist ein feiner, aufrechter Zuchtbock«, hatte der Züchter verkündet, als würde er mit der Königin persönlich plaudern. Dann hatte er die Arme vor dem Bauch verschränkt und das Kinn vorgereckt. »Prächtig gewachsen und mit einem edlen Schädel.«
»Wichser«, sagte sie laut zu dem Bild in ihrem Kopf. Wenn sie den Blindgänger von Bock doch nur zurückbringen und das Geld für einen leistungserprobten Widder ausgeben könnten, einen, der garantiert etwas in ihrer Herde bewirkte. Doch damit wäre ihr Vater niemals einverstanden, das wusste Rebecca genau.
Gerade als sie das rissige Holztor zum größten Pferch öffnete, hörte sie eine Explosion von wildem Gebell und galoppierenden Hufen, die eine riesige Staubwolke aufwirbelten.
»Verflixt noch eins, Dad.« Bec schüttelte seufzend den Kopf und verdrehte die Augen.
Ihr Vater Harry Saunders zwängte sich durch den Drahtzaun und brüllte dabei: »Mate, Spot, Mardy … Zurück! Kommt zurück! Ihr Drecksköter! Mardy! Hierher! Raus da!«
Seine bunt zusammengewürfelte Meute von Hütehunden hatte in Teamarbeit ein einzelnes Schaf aus der Herde gelöst und jagte es jetzt böse schnappend in Richtung Zaun. Die kleine Mossy tat ihr Bestes, um die Herde zusammenzuhalten, obwohl die übrigen Hunde dicht an den Schafen vorbeirannten und sie in Aufruhr versetzten.
»Jesus, Dad. Bist du sicher, dass du diese ganzen Tölen brauchst? Ich hatte sie praktisch schon im Pferch.« Sie nahm die Hände hoch, um ihre Augen gegen die Sonne abzuschirmen, und spähte mit zusammengekniffenen Augen auf die im Kreis laufende Herde. »Nicht zu gebrauchen die Truppe!«
Ihr Vater hielt, glühend rot im Gesicht, Mardy am Halsband zurück. Der junge Hund starrte wie gebannt auf die Schafe und ließ hechelnd die Zunge seitlich aus dem Maul hängen. Mardy war so versessen darauf zu arbeiten, dass er gar nicht merkte, wie er gewürgt wurde.
»Komm mir nicht so, Mädel.« Ihr Vater deutete warnend mit dem Finger auf sie. Um zu beweisen, was sie meinte, stieß Bec einen kurzen Pfiff aus und rief leise: »Mossy, komm her zu mir.« Mossy drehte Bec ein Ohr zu, sah sie an und kam gehorsam angetrottet. Rebecca wandte ihrem Vater den Rücken zu. Sie wusste, wie zuwider es ihm war, dass ihre Hunde so gut abgerichtet waren, aber sie bedauerte ihn um seine untrainierten Hunde.
»Dann bring die blöden Biester selbst in den Pferch«, murmelte sie vor sich hin.
»Was hast du gesagt, Mädel? Was hast du zu mir gesagt?«
Ohne auf ihn zu hören, marschierte sie davon, um die verhedderten Schläuche und Drenchpistolen zum Entwurmen der Schafe zu entwirren, die in einem großen Haufen auf dem Boden des Geräteraumes neben dem Scherstall lagen.
Nach einer Weile erschien die massige Silhouette ihres Vaters in der Tür zum Schuppen. Sein Schatten breitete sich über die ausgetretenen, alten Dielen.
»Du weißt, dass wir dich heute nicht auf dem Hof brauchen, Bec«, verkündete der Umriss. Ihr Vater trat in den schummrigen Schuppen. »Deine Brüder kommen herunter, sobald sie die Pumpe repariert haben. Sie können das Drenchen übernehmen, und ich bringe die Herde rein.« Er schaffte es nicht, seiner Tochter ins Gesicht zu sehen.
»Aber Dad, ich habe dir doch gesagt, ich bin fertig mit der Schule … Ich bin zurückgekommen, um hier zu arbeiten. Und zwar endgültig.« Rebecca lud mit einem lauten Scheppern ein Zwanzig-Liter-Fass mit Entwurmungsmittel auf der Holzbank im Geräteraum ab.
»Bec, du weißt selbst, dass wir auf der Farm nicht genug Platz für alle drei Kinder haben. Wir haben das schon besprochen. Meine Tochter wird auf keinen Fall eine sogenannte Landwirtschaftskarriere einschlagen. Das hat keine Zukunft.«
»Aber für deine Söhne hat es Zukunft?« Bec drehte sich zu ihm um und stemmte die Hände in die Hüften.
Harry setzte den vom Schweiß fleckigen Hut ab und fuhr sich mit den Fingern durch das ergrauende Haar.
»Das ist was anderes, Bec. Die Jungs können nichts anderes … Sie wurden dazu erzogen … Die Jungs können es schaffen, die Station wieder auf die Beine zu bringen.«
»Und ich nicht?« Bec baute sich vor ihm auf.
»Es ist nur zu deinem Besten, Rebecca.« Er wandte den Blick ab und schaute konzentriert auf die Drenchpistole auf der Bank, mit der den Schafen das Entwurmungsmittel ins Maul gespritzt wurde. »Die besten Chancen hast du, wenn du einen Abschluss als Lehrerin oder Krankenschwester machst und dann einen netten Farmer heiratest, der nicht bis zum Hals in Schulden steckt oder sich aus einer Schlammschlacht von Scheidung freikaufen muss und … dann kannst du …«
»Was für eine Schafsscheiße, Dad!«, explodierte Bec. »Du solltest dich hören! Weißt du eigentlich, wie verflucht sexistisch du klingst? Ich bin hier geboren, und ich werde hier bleiben … Ich habe genauso ein Anrecht auf die Farm wie Mick und Tom.«
Sie schleuderte das um einen leeren Entwurmungskanister gewickelte Knäuel von Schläuchen auf den Boden. »Auf gar keinen Fall werde ich Krankenschwester oder Lehrerin, nur damit ich ein konservatives Sexistenschwein heiraten kann, das von mir erwartet, den ganzen Tag Scones zu backen oder mit seiner Mum zum Landfrauenbund zu gehen. Das kannst du vergessen … genauso wie alles andere, was du dir vorstellst.«
»Wag es nicht, so mit mir zu reden, Mädel.« Harry hatte ihr den Rücken zugewandt, und Bec konnte sehen, wie sich seine Schultern vor Ärger verkrampften, während er gleichzeitig vorgab, an der Drenchpistole die richtige Dosis einzustellen. Sie wusste, dass sie ihn in die Enge trieb, und trat auf ihn zu.
»Dad. Ich werde das bestimmt nicht tun. Lehren. Oder als verflixte Krankenschwester arbeiten. Wie kannst du nur so … so … verdammt starrsinnig sein. Mein Gott, Dad! Mum ist Tierärztin, Herrgott noch mal! Du weißt selbst, wie es berufstätigen Frauen ergeht, die auf einer Farm landen … wie sie sich abhetzen müssen, um es ihren Männern und Familien recht zu machen und gleichzeitig mit ihrer Arbeit zu Rande zu kommen. Lass es nicht an mir aus, wenn du nicht damit umgehen konntest, dass Mum ihren eigenen Kopf hat … und ihr eigenes Leben!«
»Lass deine Mutter da raus!« Er drehte sich wieder zu seiner Tochter um. »Wenn du nicht so viel Zeit mit deiner Hundeausbildung und deinen Pferden verplempert und dafür fleißiger gelernt hättest, hättest du auch Tierärztin werden können, Rebecca. Das ist deine eigene Schuld.«
»Ich wollte doch nie Tierärztin werden! Ich wollte immer nur zurück nach Waters Meeting und diese Farm so führen, wie sie geführt werden sollte.«
»Was soll das wieder heißen?« Harry knallte die Drenchpistole auf die ölfleckige Holzbank. »Willst du damit sagen, ich führe die Farm nicht so, wie es sich gehört?«
»Jeder kann sehen, dass diese Farm noch im Mittelalter steckt. Mick und Tom sind zu verängstigt, als dass sie dich fragen würden, ob sie die Bücher prüfen dürfen. Ständig drohst du, du würdest sie rauswerfen, wenn sie nicht auf Kommando strammstehen. Du hast keine Ahnung, was sie dir alles erzählen würden, wenn sie den Mumm dazu hätten … wie zum Beispiel, dass der Schönling von Schafbock, den du gekauft hast, ein Blindgänger ist. Sie haben Schiss vor dir. Genauso, wie du vor Grandad Schiss hattest.«
Rebecca sah einen Muskel im Kiefer ihres Vaters zucken, als sie ihren Großvater erwähnte. Sie wusste, dass sie sofort gehen und ins Haus verschwinden sollte. Aber sie war noch nicht fertig.
»Weil du nicht loslassen kannst, Dad, gehen wir allmählich alle den Bach runter. Lass dir gesagt sein, ich werde weder Lehrerin noch Krankenschwester. Ich habe mich für nächstes Jahr auf einem Landwirtschaftscollege angemeldet und werde dort ein Diplom in Agrarwissenschaft machen, dann werde ich heimkommen und den Laden hier in Schwung bringen. Aber bevor ich dorthin gehe, brauche ich ein Jahrespraktikum als Jillaroo, das ich hier und jetzt, auf dieser Farm absolvieren werde.«
»Den Teufel wirst du tun.« Ihr Vater richtete sich zu seiner vollen Größe auf, machte einen Schritt auf sie zu und zielte mit einem schwieligen Finger auf ihr Gesicht.
»Jetzt lass dir eines gesagt sein, meine kleine Miss Naseweis – du wirst hier keine Erfahrungen für deinen nutzlosen, großkotzigen Collegekurs sammeln. Entweder respektierst und befolgst du meine Wünsche, oder du kannst auf der Stelle dein Bündel packen, deine kostbaren Zuchthunde einsammeln und von meinem Grundstück verschwinden. Aber dann wirst du nicht an diesen Teil des Flusses zurückkehren, so lange ich hier lebe.«
Tränen traten in Becs Augen, doch ihr Vater war noch nicht fertig.
»Deine Brüder werden froh sein, dich von hinten zu sehen, Miss Selbstgerecht. Ich wollte damals sowieso kein drittes Kind. Ich sagte deiner Mutter, nein, es wird schwer genug, hier zwei Jungs durchzubringen, von einem dritten Balg ganz zu schweigen … und noch dazu ein Mädchen. Und jetzt geh mir aus den Augen.«
Rebecca spürte, wie ihre Unterlippe zu beben begann, und biss eisern darauf, um sich nicht anmerken zu lassen, wie verletzt sie war. Seit sie denken konnte, war sie stets das Mädchen ihres Großvaters gewesen – nie das ihres Vaters. Seit sie denken konnte, hatte immer Grandad sie in eine Decke gewickelt und vor sich hoch in den Sattel gehoben. Gemeinsam waren sie losgeritten, hinauf in die Berge, um nach verirrten Schafen zu suchen. Unterwegs hatte er ununterbrochen gebrummelt, ihr von der Welt um sie herum erzählt, von den Tieren und Bäumen und wie man ein Schaf findet und einen Hund ausbildet. Sie konnte sich nicht entsinnen, dass ihr Vater je dabei gewesen wäre, dass er ihr beigebracht hätte, wie man Schafe schert oder ein Kalb an den Beinen fesselt oder auch nur Tee auf einem offenen Feuer kocht. Je mehr Liebe und Aufmerksamkeit Rebecca von ihrem Großvater geschenkt bekam, desto mehr zog sich Harry zurück. Über die Jahre wuchs der Groll der beiden Männer aufeinander immer mehr, und das Schweigen zwischen ihnen heizte sich immer weiter auf. Schließlich entzündete es sich und traf erst Harrys Frau Frankie und später seine Tochter.
Doch jetzt, als Rebecca im Scherstall ihrem Vater gegenüberstand, war für sie das Maß voll. In einem wütenden Schwall sprudelten die Worte aus ihrem Mund, während ihr Gesicht sich in tiefer Trauer verzerrte. Der Rest des Schuppens verschwamm vor ihren Augen, als sie ihn tobend anschrie:
»Kein Wunder, dass Mom dich verlassen hat! Du willst es einfach nicht begreifen, oder? So wirst du noch alles verlieren!«
»Halt deinen anmaßenden kleinen Schnabel, und geh mir aus den Augen. Bis Mittag bist du hier verschwunden, oder ich erschieße alle deine elenden Köter. Mir reicht es jetzt.« Er krallte die Finger zornig in Becs Schultermuskeln und schob sie auf den Eingang zu. Erschrocken über den brutalen Griff, stolperte sie die Stufen hinab. Sie sah zu ihrem Vater auf und wollte ihn anbrüllen, doch kein Laut kam über ihre Lippen. Mossy kam winselnd angetrabt und blieb an ihrer Seite stehen. Rebecca sah ihrem Vater in die starren Augen. Kälte schlug ihr daraus entgegen. Und Hass. Sie wusste, dass es ihm ernst war. Die vielen Zusammenstöße mit ihm seit ihrer Kindheit hatten sie gelehrt, ihr Glück und ihre Kraft ausschließlich aus den Bergen, dem Boden, den Pflanzen und aus diesem wunderschönen Fluss zu schöpfen. Tief im Herzen wusste sie, dass ihr Vater sie ablehnte, weil sie eine Leidenschaft und eine Verbundenheit mit dem Land fühlte, die ihm auch nach vielen Jahren als Farmer verschlossen blieben. Sie konnte sich ganz und gar in der Welt ihrer Hunde verlieren. Sie trainierte sie, liebte sie, studierte sie und sprach mit ihnen. Sie blickte ihnen tief in die braunen Augen und erschloss damit ihre Seele. Die Hunde waren für sie eine Zuflucht vor dem brodelnden Groll ihres Vaters und seiner Unfähigkeit, ihr Liebe zu zeigen.
Nun, da ihre Mutter Frankie nicht mehr da war, um ihrem Vater eine beschwichtigende Hand auf die Schulter zu legen, müsste sie gehen, das war ihr jetzt klar. Sie wandte sich von seinem Blick ab und lief aus dem Schuppen. Mossy trottete ihr nach und sprang an ihrer Seite hoch, um ihr in einer tröstenden Geste die Hand abzulecken.
Beinahe heulend schleuderte Bec in ihrem Zimmer ihre Sachen in den verschlissenen Rucksack. Die Schluchzer blieben ihr brennend in der Kehle stecken. Sie rannte die Treppe hinunter und aus dem dunklen Haus. Nachdem sie ihre Taschen und den Schlafsack hinten in ihren alten Subaru-Pick-up gepackt hatte, winkte sie ihren drei Hunden, auf die Ladefläche zu springen. Die Tiere sahen sie besorgt an, als sie einen nach dem anderen an die kurze Haltekette legte. Zitternde Hände drehten den Zündschlüssel im Schloss. Jetzt wich das Schluchzen gepresstem zornigen Schimpfen, und sie hämmerte im Fahren mit der Hand auf das Armaturenbrett ein. Als ihre Mutter damals ihr Zeug gepackt und sie zurückgelassen hatte, war Bec in der Schule gewesen. Sie fragte sich, ob ihre Mutter dabei geschluchzt oder geheult hatte oder ob sie nur schweigend mit stolz erhobenem Kopf davongefahren war. Im Rückspiegel sah Bec hinter einem Staubschleier, wie ihr Vater mit geballten Fäusten im Tor zum Scherstall stand.
Auf der Koppel neben der Zufahrt warf ihre schwarze Stute den Kopf herum und galoppierte auf Höhe des Subarus neben dem Zaun her. Als der Pick-up über den Gitterrost ratterte, stemmte sich die Stute im letzten Moment in den Boden und kam nur eine Handbreit vor dem Eckpfahl zum Stehen.
Rebecca ertrug es nicht, von der am Hang verlaufenden Straße in das verschlafene grüne Tal hinabzublicken. Es brach ihr das Herz, ihren Fluss verlassen zu müssen. Waters Meeting. Ihre Heimat.
Harry hatte schweigend beobachtet, wie seine Tochter von ihm weg- und die Anhöhe hinauf auf das große Steinhaus zugerannt war. Der leichtfüßige Hund war ihr um die Füße getanzt und hatte dabei immer wieder zu ihr aufgesehen. Wie oft hatte er beobachtet, wie sie heimlich Tränen weggewischt hatte? Noch heute konnte er ihr Kindergesicht vor sich sehen, das ihn zornrot angeschrien hatte, nachdem er wieder einmal Nein gesagt hatte.
Nein, sie konnte nicht mitkommen, wenn auf der Hochebene die Herden zusammengetrieben wurden. Nein, er würde sie nicht zu einem Hunde-Trial fahren. Nein und nein. Nein. Immer, wenn Harry Nein sagte, lief sie zu ihrem Großvater, der Ja sagte. Harry merkte, wie ihm das schlechte Gewissen zusetzte. Das schlechte Gewissen, seine Familie und die Farm nicht richtig geliebt zu haben. Immer war er zu beschäftigt für Bec gewesen. Ganze Tage hatte er im Maschinenschuppen vor sich hingebrütet. Oder sich irgendwo im Haupthaus oder einem der Nebengebäude versteckt, um seinem Vater aus dem Weg zu gehen. Oder mit dem Traktor die Saat ausgebracht und dabei nicht von den üppig grünen Schösslingen geträumt, die der Regen austreiben lassen würde, sondern davon, woanders zu leben, Ingenieur oder Architekt oder gar Pilot zu sein. Nur nicht hier, gefangen auf dieser Farm und unter einem Dach mit seinem Vater.
Nie hatte er ein nettes Wort oder ein Lob aus dem Mund seines alten Herrn gehört. Sie waren Viehzüchter. Sie waren Bauern. Da wurde nicht gequatscht. Wenn Harry als junger Mann die Rinder zu scharf angetrieben hatte, bis sie mit hängender Zunge, Schaum vor dem Maul und schweißdampfendem Rücken auf dem Hof angekommen waren, hatte sich Harrys Vater nur angewidert abgewandt. Jene natürliche Begabung als Viehzüchter, die niemals erlernt werden konnte, hatte eine Generation übersprungen. Harry besaß sie einfach nicht. Sein Vater gab ihm das Gefühl, in seinem eigenen Heim ein Außenseiter zu sein, er konnte nicht einmal einfach gehen. Harry war der einzige Sohn, und seine Lebensaufgabe war es, die Farm zu übernehmen. So liefen die Dinge eben.
Harry hatte zugesehen, wie Rebecca das Tor hinter sich zugeknallt hatte und durch den üppigen grünen Garten gestapft war. Gleich darauf war sie auf die Veranda getreten und in dem alten Haus verschwunden. Blinzelnd hatte er zu ihrem Zimmerfenster im Obergeschoss aufgeblickt und dann seufzend die Augen geschlossen. Wieso machte ihn seine Tochter nur immer so wütend? Warum konnte er ihr keine Chance geben?
Plötzlich hörte er draußen seine Hunde aufgeregt bellen, die Mutterschafe im Sammelpferch fielen ihm wieder ein. Harry lief durch den Schuppen in die gleißende Sonne hinaus.
»Verflixte Köter.«
Wie satt gefressene Wölfe spielten die Hunde zum Zeitvertreib mit den Schafen. Sie jagten die Mutterschafe vor und zurück, bis sie sich ängstlich ans Gatter drängten. Ein paar schwächere Tiere waren schon zu Boden gegangen, unter dem massiven Druck der Herde in den Staub gepresst. Mardy bestieg, auf den Hinterbeinen balancierend, gerade ein Schaf, das gegen das Gatter gepresst wurde. Die weißen Vorderpfoten umgriffen die Hüfte des Schafes, und sein welpenhaftes Becken schob sich aufgeregt vor und zurück. Seine Augen waren vor Lust ganz glasig, und die rosa Zunge hing ihm seitlich aus dem Maul.
Sobald sich Harry näherte, zerstreuten sich die älteren Hunde, quetschten sich unter den Querstangen der Einzäunung durch und verzogen sich außer Sichtweite. Nur der junge Mardy setzte weiterhin dem Schaf zu.
»Schluss damit. Du dreckige Töle!« Harry packte eine Hand voll Fell und Welpenhaut und riss den jungen Hund von dem Schaf weg. Der Welpe warf sich erschrocken vor Harry auf den Rücken, wedelte hektisch mit dem Schwanz und pinkelte über sich selbst und Harrys Stiefel. Harry beugte sich vor und hob Mardy am Nackenfell hoch. Dann presste er den Leib des Welpen so fest gegen den Boden, dass dem Tier alle Luft aus der Lunge gedrückt wurde und das Winseln wie ein erstickter Schrei klang.
»Schluss damit!«, brüllte er und rüttelte den Hund erneut durch, ehe er ihn wie ein Holzscheit über den Zaun schleuderte. Mardy überschlug sich zweimal im Staub, kam auf die Füße, krümmte sich vor Schmerzen zusammen und schlich, den Schwanz bis zum Bauch eingezogen, in den Schatten des Scherstalles davon.
Immer noch bebend vor Wut war Harry in den Geräteraum zurückgekehrt, um die Drenchpistolen vorzubereiten. Die weiße Flüssigkeit schoss durch den durchsichtigen Plastikschlauch, sobald er die Düse an der Pistole öffnete. Er hatte die Dosis höher eingestellt, weil die Mutterschafe schwer aussahen. Bemüht, nicht darauf zu achten, wie sehr seine Hände zitterten, hatte er sich den Kanister auf den Rücken geschnallt und im selben Augenblick gehört, wie Rebeccas Pick-up ansprang und der Motor zu grummeln begann. Er hatte zum Eingang des Schuppens gesehen, wo die strahlende Sonne ein Rechteck auf die Holzbohlen malte. Im selben Moment hatte er den Kanister wieder abgesetzt und war zum Tor gelaufen, um nach dem Pick-up zu schauen. Ihre Hunde waren auf der Ladefläche. Und ihr Beutel. Das kleine weiße Gefährt war über den Gitterrost an der Hauskoppel gerattert und an ihm vorbeigeschossen. Im Vorüberfahren hatte Harry noch einen Blick auf ihr Profil erhaschen können. Die Zähne krampfhaft zusammengebissen, den Mund in Pein verzogen. Beim zweiten Rost hatte Rebecca nicht einmal mehr abgebremst, sondern war, einen Staubschleier hinter sich herziehend, die Straße hinabgerast.
Sie war weggefahren. Diesmal hatte sie die Farm tatsächlich verlassen. Das hatte er nicht erwartet. Genauso wenig wie damals bei Frankie hatte er das erwartet. Beide waren strahlende Sterne am Himmel, Mutter wie Tochter, beide waren so voller Lachen und Lebenslust. Jedes Mal hatten sie mit einem Scherz die zornigen Lücken gefüllt, die Harry in der großen, düsteren Villa aufgerissen hatte. Frankie und Bec hatten immer zu reden verstanden. Immer wieder hatte Frankie für die beiden Jungs das Wort ergriffen. Wie ein Dolmetscher hatte sie regelmäßig zwischen Harry und Mick und Tom vermittelt. An dem Tag, als sie abfuhr, hatte sie sich wütend darüber ausgelassen, dass er nicht lieben könne, dabei hatten die ganze Zeit über jene Worte in Harrys Kopf festgesessen, die nur nicht über seine Lippen kommen wollten. »Geh nicht, Frankie«, hatte er sagen wollen. Er hatte alles durchsprechen wollen. Er liebte sie. Für sie hätte er sogar die Farm verkauft. Aber die Worte wollten nicht kommen. Sie blieben eisern in seinem Kopf. Stattdessen hatte er reglos dagestanden und zugesehen, wie seine Frau abfuhr. An einem grauen Montagmorgen war sie davongefahren und hatte ihn zurückgelassen. Mit den Kindern und der Farm und diesem riesigen, dunklen Loch, das sein Leben war. Und natürlich mit dem Schweigen, das zurückgeblieben war.
Harry ballte die Fäuste, während sein Leib in langsamen Wellen zu beben begann. Ein heiseres, aus seiner Lunge aufsteigendes Ausatmen verwandelte sich in ein erschütterndes Schluchzen. Er stemmte eine große Hand gegen den rissigen Türrahmen, um sich aufrecht zu halten, und schlug die andere vor die Augen, als könnte er dadurch seine Scham mildern. Die Scham, Rebecca so wehgetan zu haben. Die Scham, seine Söhne zu erdrücken.
Er war dabei, seine Familie zu verlieren. Und sein Land dazu. Langsam stieg er die wacklige Vortreppe des Scherstalles hinunter und ließ sich auf der untersten Stufe nieder, den Kopf in die Hände gestützt. Aus dem dunklen Balkengitter darunter blickten ihn zwei verängstigte braune Augen an. Leise flüsterte er: »Hierher, Welpe. Komm her, Mardy. Tut mir leid, Kumpel.«
Mick und Tom rasten auf dem verschlammten Quad auf die Pferche zu. Über Micks Schulter hinweg konnte Tom seinen Vater von Schafen umgeben im Laufgatter stehen sehen. Mick parkte das Quad im Schatten eines knorrigen alten Eukalyptusbaumes und wartete ab, bis Tom abgestiegen war. An der Art, wie sein Vater die Schafe behandelte, konnte Tom sehen, dass der Alte eine Stinklaune hatte.
Mit gesenktem Kopf ging Tom auf das Ende des Laufgatters zu und bückte sich, um die Schultergurte eines Drenchkanisters zu nehmen.
»Kommst du durch, Dad?«
»Ich wäre schon längst durch, wenn ihr beide früher aufgetaucht wärt.« Harry zwängte die Metalldüse der Drenchpistole in das Maul eines Schafes und schoss einen Strahl Entwurmungsmittel in den Rachen des Tieres. Die Schafzähne schlugen klappernd gegen die Düse, als Harry die Pistole wieder herauszog und vorwärts watete, um nach dem Kopf des nächsten Schafes zu greifen. Er sah seinen Sohn kein einziges Mal an, aber Tom hatte es dennoch bemerkt. Er hatte zu große Angst, als dass er gefragt hätte, warum die Augen seines Dads so rot waren und sein Gesicht so abgezehrt und grau wirkte. Er hätte gern gefragt: » Was ist mit dir, Dad?«, aber solche Fragen stellte man Harry nicht. Über das Wetter oder den Fluss oder die Woll- und Rindfleischpreise konnte Tom mit seinem Vater reden, aber ganz sicher nicht über Gefühle. Nicht mit Harry.
Er schwang den Kanister auf seine breiten Schultern und ging an das Sortiertor am Ende des Laufgatters, um sich die Schafe vorzunehmen, die dort warteten. Er konnte kaum glauben, dass sein Vater geweint hatte. Das schockierte Tom.
Mick lehnte am Geländer, die Arme vor der breiten Brust verschränkt, und bekam nichts von der Laune seines Vaters mit. Mick hatte dem Vorbild seines Vaters nachgeeifert. Er setzte keine Worte, sondern lieber seine Größe und sein Gewicht ein, um Präsenz zu zeigen.
»Wo steckt Bec? Die könnte die nächste Herde zusammentreiben, während ich mich ans Pflügen mache«, sagte Mick.
»Die treibt heute nicht. Jetzt mach los. Bis du die nächste Herde reingebracht hast, sind wir mit denen hier durch.«
Mick tat die barsche Bemerkung seines Vaters mit einem Achselzucken ab und schlenderte zu seinem Quad zurück. Tom biss die Zähne zusammen. Sie hat wieder mit Dad gestritten, dachte Tom. Typisch.
Tom musste bis nach dem Essen warten, bevor er nach seiner Schwester suchen konnte. In der Küche stopfte er sich einen trockenen Brotkanten in den Mund und stand vom Tisch auf. Sein Blick fiel auf seinen Vater und auf Mick.
Mick saß zusammengesunken an dem schweren Holztisch, der mitten im Raum stand. Eine altmodische Holzuhr stand laut tickend auf dem Kaminsims hinter ihm. Das Pendel schwang hinter den goldenen Schilfstängeln, mit denen das Glas bemalt war, hin und her. Mick biss geräuschvoll in eine Karotte und ließ langsam kauend den Blick über die Fahrzeug-Kleinanzeigen in der Zeitung wandern.
Seit Frankie in die Stadt gezogen war, verbrachte Harry nur noch wenig Zeit in der Küche. Früher hatte er meist dort gesessen, wo mittlerweile Mick saß. Stattdessen war Harry während der Mittagspause lieber in dem verglasten Wintergarten, der ans eine Ende der Küche angebaut worden war. Frankie hatte auf den Anbau bestanden, damit etwas Helligkeit in das alte Haus kam. Sie hatte das schon bei ihrer Hochzeit verlangt und den Anbau endlich durchgesetzt, als alle Kinder in der Schule waren und Harrys Mutter gestorben war. Der Wintergarten bestand aus riesigen, in Stahl gefassten Glasscheiben und einer großen Schiebetür, die direkt in den schattigen alten Garten führte. Im Lauf der Jahre hatten Weinranken und Glyzinien den Anbau überwuchert und den Anblick von verschnörkelten grünen Ranken, Trauben und hängenden Blütendolden im Haus geboten.
Tom betrachtete seinen Vater, der jetzt dort saß. Er musste daran denken, wie er selbst als Kind auf einem sonnigen Fleck in dem brandneuen Raum gesessen hatte. Er war nicht zur Schule gegangen, weil er Windpocken hatte. Frankie hatte große Bögen Butterbrotpapier und Wachsmalkreiden auf dem Schieferboden ausgebreitet.
»So, Tom. Versuch dein Glück damit. Vielleicht findest du ja deine Berufung. Man kann nie wissen.« Als Frankie wieder in den Raum gekommen war und die wirbelnden Farben der Fische, den Meeresgarten und das Unterwasserschloss gesehen hatte, waren ihr Tränen in die Augen getreten, und sie hatte die Hand vor den Mund gepresst.
Als kleiner Junge hatte sich Tom immer gefragt, warum seine Gemälde seine Mutter zum Weinen brachten. Erst viel später, als er älter war, hatte er begriffen, dass sein künstlerisches Talent sie jedes Mal verzückte und gleichzeitig verstörte, weil sie wusste, dass sein Vater seine Zukunft längst vorgezeichnet hatte.
Als Harry an jenem Tag die Zeichnungen seines Sohnes zusammengeknüllt und in den Ofen gesteckt hatte, hatte Frankie begonnen, ihren Mann für seinen Zwang, seine Söhne zu dominieren, zu verabscheuen. Es war jener Tag, an dem ihr aufgegangen war, dass er jene Muster des Vaterseins wiederholen würde, die er selbst erlebt hatte. Diese Aussicht hatte sie mit einer stillen, endlosen Furcht erfüllt.
Jetzt lag Harry ausgestreckt auf einer Rattancouch unter der laubüberwachsenen Decke. Landwirtschaftszeitungen, Briefe, Rechnungen und aufgerissene Umschläge lagen verstreut um ihn herum. Ein mit Krümeln übersäter Porzellanteller mit einem braunen Apfelbutzen darauf stand neben einem halb vollen Teebecher auf dem Schieferboden. Die in grobwollene Socken gekleideten Füße waren an den Knöcheln übereinandergeschlagen, die braunen Arme über dem schlanken Bauch gefaltet. Auf dem Gesicht des Dösenden lag aufgeschlagen das Australian Farm Journal.
Toms Blick ruhte auf seinem stillen Bruder und Vater. Zwei vom gleichen Schlag. Seit Frankie nicht mehr da war, waren alle Küchenarbeiten Rebecca und Tom zugefallen. Mick schaffte es immer, sich um alles zu drücken, was nach Hausarbeit oder Arbeit mit den Tieren schmeckte. Allerdings störte das Bec und Tom nicht weiter. Sie spendeten einander Trost. Aber manchmal, in seinem dunklen Zimmer, zerrte Tom wütend an seinen Haaren. Er wollte seine Mutter wiederhaben. Er hatte Rebeccas wegen ein schlechtes Gewissen. Schließlich verließ er sich darauf, dass sie ihn bemutterte. In manchen Nächten weinte er nach seiner Mutter, in anderen tobte in ihm der Zorn auf sie. Stimmen in seinem Kopf. Wütende, heulende Stimmen.
In der sonnigen Küche grub Tom die Zähne in das weiße Fleisch eines Apfels und zog dann die Küchentür hinter sich zu. Er musste Rebecca finden.
Die Kühle der Betonstufe hinter dem Haus drang durch seine Jeans, als er sich darauf niederließ und seine Stiefel anzog. Die rotbraune Katze rieb sich an Toms Rücken.
»Es gibt zwei Stellen, wo sie sein könnte, wenn sie so ausrastet«, erklärte er der Katze.
»Komm schon, Ginge. Gehen wir sie suchen.« Er ging über den Pfad davon. Die Katze setzte sich und sah ihm nach, bis er durch das Gartentor und hinter der Böschung am Fluss verschwunden war.
Er rechnete damit, sie unten am Fluss zu finden, wo sie von ihren Hunden Stöcke apportieren ließ. Fast meinte er die zierliche Gestalt und die Kappe zu sehen, unter die sie ihre blonden, welligen Haare gestopft hatte. In seiner Fantasie stand sie leise lächelnd am Ufer und warf Stöcke in das träge dahinfließende Wasser. Aber an diesem Nachmittag war sie nicht unten am Fluss.
Er ging zum Haus zurück. An der Gebäudeseite überschattete eine Gruppe von Pfefferbäumen eine Reihe von ausgehöhlten Baumstämmen. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie Rebecca mit ihrem Vater um die Hundezwinger gestritten hatte. Sie wollte ihre Hunde nicht in den großen Auslaufzwinger zu Harrys Meute von kläffenden Mischlingen und durch Inzucht degenerierten Tieren stecken. Sie wollte die Hunde näher am Haus unterbringen, damit sie ihnen beibringen konnte, still zu sein. Ihr Vater hatte das abgelehnt und sie als Hundesnob bezeichnet, aber sie hatte ihre Hunde trotzdem hier untergebracht. Nachts konnte Tom bisweilen hören, wie sie die Schlafzimmertür öffnete und barfuß auf die Veranda trat, um leise auf ihre drei Hunde einzureden.
An diesem Nachmittag tänzelte keiner von Becs Kelpies am Ende seiner Kette in einem Zwinger, und kein Hund peitschte mit dem Schwanz den Staub auf. Die Ketten lagen im Dreck, während der auffrischende Wind in den dunklen Kronen flüsterte, die das Sonnenlicht abhielten. Tom blickte zu der Veranda im Obergeschoss auf und sah in Gedanken seine Schwester mit aufgestützten Ellbogen an dem weißen Holzgeländer lehnen, während ihre langen Haare sanft in der Brise wehten. Tom wusste, dass sie nicht mehr hier war, sonst wären ihre Hunde da gewesen. Er spürte, dass sie Waters Meeting verlassen hatte. Es war die gleiche Eiseskälte, die er gefühlt hatte, als seine Mutter sie verlassen hatte. Im Laufschritt kehrte er ins Haus zurück und riss die schwere Haustür auf, nicht ohne ein paar Spinnweben zu zerreißen, als der Türflügel aufschwang.
In der muffigen Düsternis des Arbeitszimmers wählte Tom hastig die Telefonnummer seiner Mutter. Während er auf Antwort wartete, sah er immer wieder zur Tür des Arbeitszimmers. Falls sein Dad ihn dabei erwischte, wie er am helllichten Tag das Telefon für ein Ferngespräch mit seiner Mutter benutzte, würde er an die Decke gehen. Endlich hörte er die neutrale, aber freundliche Stimme seiner Mutter auf dem Anrufbeantworter.
»Hallo, hier ist Dr. Frankie Saunders, bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer, dann rufe ich zurück. Falls es sich um einen Notfall handelt, wenden Sie sich bitte an unsere Tierklinik in der North Road. Die Nummer ist 87 34592 …«
Tom wartete auf das Piepen.
»Mum. Hier ist Tom. Ich glaube, Dad und Bec hatten wieder Streit. Diesmal hat sie ihre Hunde mitgenommen. Wahrscheinlich ist sie auf dem Weg zu dir, ruf mich bitte an, wenn sie heute Abend auftaucht. Danke, Mum. Bye.«
Tom legte auf und ging in die Küche zurück, um für das Abendessen ein paar Koteletts aus dem Gefrierfach zu nehmen. Mick und Harry befanden sich noch in derselben Position wie bei seinem Abgang. Sie sagten nichts und sahen auch nicht auf, als er ins Zimmer kam. Trotz des gleißend hellen Sonnenscheins draußen hatte Tom das Gefühl, dass ihn die Dunkelheit des Hauses erstickte. Sie legte sich über seine Schultern und saß ihm drückend im Genick. Leise schloss er die Küchentür und stieg die Treppe im Gang hinauf.
Auf seinem Bett rollte er sich zusammen und zog die Beine an die Brust. »Hör auf damit«, ermahnte er sich streng.
Kapitel 2
Die Hunde auf der Ladefläche rumpelten schwankend gegeneinander, als der Pick-up die Kurve nahm. Eine Sekunde lang kamen die Hinterräder auf dem Schotter ins Rutschen, dann griffen sie wieder. Rebecca packte das Lenkrad so fest, dass ihre Knöchel weiß leuchteten.
»Bastard!« Sie schlug auf das staubige Armaturenbrett. Winzige Staubflocken flogen auf und schwebten im Sonnenschein. Vor Zorn hatte sie Kopfweh. Die anfänglichen Tränen, Ängste und panischen Befürchtungen waren inzwischen zu Wut geronnen. Wut auf ihren Vater. Auf die Scheidung. Auf seine verfluchte Arroganz. Sie wischte sich mit dem Ärmel ihres alten Arbeitshemdes über Nase und Gesicht. Begriff er denn nicht, dass sie seit jeher immer nur auf Waters Meeting leben wollte?
Ihr Großvater hatte erkannt, dass sie sich nicht nur lebhaft für die Farm interessierte, sondern auch eine kluge Farmerin war. Gewitzt. Wenn sie an seiner Seite saß, während er die Bücher führte, konnte er ihren Geschäftssinn erkennen. Auf der Weide bewies sie ein unglaubliches Verständnis für alles, was mit der Natur zusammenhing. Jede Woche las sie die Landwirtschaftszeitungen, außerdem verschlang sie alle landwirtschaftlichen Zeitschriften oder Viehzuchtmagazine. Ständig ergoss sich ein Strom an Fragen über alles Mögliche aus ihrem Mund.
Zu alledem war da noch ihre »Gabe«. Ihr Großvater hatte den Begriff geprägt. Sie besaß ein natürliches Gespür für alle Tiere. Das Talent, ruhig und voller Selbstbewusstsein eine Schaf- oder Rinderherde zu führen. Hunde brauchten sie nur anzusehen und reagierten sofort auf jedes ihrer Kommandos. Pferde beruhigten sich unter ihrem Körpergewicht und strengten sich für sie an, wenn sie ihnen befahl, alles zu geben. Sie ging sanft mit ihren Rindern und Schafen um und erfasste wie von selbst die Rangordnung und die natürlichen Bewegungen innerhalb einer Herde. Sobald Rebecca reiten konnte, gab es für sie nur noch die Arbeit mit den Tieren. Im Alter von zehn Jahren konnte sie glückselig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Sattel sitzen. Sie liebte es, wenn ihr Großvater von jedem einzelnen Tier erzählte, sei es von den Vorzügen der pigmentierten Lider bei den Herefordrindern, den genetischen Merkmalen, die sich am ehesten vererbten, wie weißen Gesichtern, oder den Hörnern oder von sonst was.
Ihr Vater hingegen fand seine Erfüllung umgeben von Zahnrädern, Nieten, Kolben, Zylindern und Bolzen. Er mied die Arbeit mit den Tieren und erledigte freiwillig alles, was auf der Farm an Wartungsarbeiten anfiel. Er war ein »Maschinenmann«. Ein »Werkzeugmann«. Ein »Diesel-Dick«, wie die Männer im Pub es nannten. Doch es war nicht so, als hätte Harrys Vater seinen Sohn für diese Eigenschaften respektiert oder bewundert. Das wusste Rebecca nur zu gut. Und Mick war von Kindheit an ein Abziehbild seines Vaters gewesen. Als kleiner Junge hatte er endlos im Schuppen gewerkelt. Bec sah ihn noch mit dem Schraubenschlüssel in der kleinen Hand vor dem Rasenmäher stehen, dessen Innenleben über den ganzen Boden ausgebreitet war.
»Was wird Dad dazu sagen?«, hatte sie zu ihrem älteren Bruder gesagt und dabei gegen die Räder des Rasenmähers getreten.
»Halt die Klappe, Erbsenhirn«, hatte Mick geantwortet und ihr einen Streifen Öl auf die Wange geschmiert. Als sie noch Kinder waren, hatte Mick Bec manchmal so wütend gemacht, dass ihre Wangen rot aufleuchteten und sie ihn von hinten angesprungen hatte, um mit ihren kleinen Fäustchen auf ihn einzudreschen. Tom war Bec jedes Mal zu Hilfe gekommen und hatte versucht, sie zu beruhigen und von Mick wegzuziehen.
Aber eines teilten sie alle – ihre Liebe zum Fluss. Diese Liebe schien zeitweise die ganze Familie zu verbinden. Während der Hochwasserzeit. Während der Dürre. In den guten Zeiten. Während der langen Sommertage, in denen sie darin geschwommen hatten. Der Fluss hatte sie zusammengehalten. Ein langer, feuchter Strang, der sich durch ihre Seelen zog.
Auch jetzt sehnte sich Bec nach dem Fluss. Sie ging vom Gas und fuhr von der Schotterstraße ab auf das grasbewachsene Ufer. Mit einem Fußtritt stieß sie die quietschende Fahrertür ihres Pick-ups auf und stieg aus, um die Hunde loszumachen.
»Runter mit euch«, sagte sie, und alle drei Kelpies sprangen von der Ladefläche. Bec zwängte sich zwischen den rostbraunen Drähten des durchhängenden alten Zaunes hindurch. Auf dem steilen Uferhang rutschten ihre Blundstone-Lederstiefel über das trockene Eukalyptuslaub, bevor sie griffen. Die Hunde tollten voraus, schnüffelnd, markierend, niesend. Mossy blieb stehen und nahm mit hochgereckter Schnauze Witterung auf, während Dags und Stubby raschelnd durch das nahe Unterholz zogen. Rebecca ging geradewegs zum Fluss hinab. Ihrem Fluss. Dem Fluss, der ihren Namen trug und an Tagen wie diesen, fand sie, auch ihre Seele.
Der Rebecca River war für einen australischen Fluss in bemerkenswert guter Verfassung. Sein sauberes, frei fließendes Wasser strich über goldbraune Felsbrocken und an riesigen alten Eukalyptusbäumen vorbei. An den steileren Uferabschnitten tunkten junge, graublaue Akazien und staubgrüne Teebäume ihre Blätter ins kühle Wasser.
Die Homestead der Saunders stand mit Blick auf den Ursprung des Rebecca River, an dem sich zwei Oberläufe vereinten, die sich ihren Weg um eine massive, zerklüftete Bergkette gebahnt hatten. Von hier an öffnete sich der Rebecca River hin zu den üppigen Flussebenen von Waters Meeting. Vom Haupthaus aus konnte man zwischen dem offenen Buschland am Berghang die roten und weißen Rücken der Herefords aufleuchten sehen, und die schwarzerdigen Flusswiesen, auf denen fast das ganze Jahr über Grün spross, waren getupft mit Fleischlämmern und Merinos. Doch schon wenige Kilometer weiter schloss sich die Bergkette wieder. Die steilen Felsen zwangen das Flusswasser, düster durch steile Schluchten zu tosen. Oberhalb von Waters Meeting spendete der verlässliche Bergregen dem Fluss Leben und kontrollierte seine unzähligen Launen.
Eines, was ihr Vater beim Farmmanagement richtig machte, war der Wasserhaushalt. Er liebte den Fluss. Die Berge schieden ihr Land von anderen Farmen, weshalb das Unkraut am Flussufer leichter zu kontrollieren und auszumerzen war als weiter flussabwärts. Jedes Jahr wurden Bec, Tom und Mick mit Pestizidtornistern beladen und ausgeschickt, um Brombeeren aufzuspüren und zu vernichten.
Bec rief dabei regelmäßig in Richtung der Berge: »Who ya gonna call?« Worauf ihre Brüder, die Sprühdüse in der Hand, ihr zur Seite sprangen und im Chor antworteten: »Berry-Busters! « An den langen Sommertagen konnte Bec Harrys Motorsäge über die Hügel schallen hören, wenn er die Weiden ausschnitt, die einst die sandigen Ufer des Rebecca River erstickt hatten.
Jetzt hörte Rebecca durch die dicke Hitze des Busches hindurch den Fluss über die glatten Felsen sprudeln und schießen. Der Regen hatte den Fluss gerade erst aufgefüllt, sodass sie im Näherkommen das süße Wasser riechen konnte. Die Hunde rannten spritzend ins kühle Wasser und schwammen mit angelegten Ohren und zurückgezogenen Lefzen, als würden sie lächeln. Rebecca setzte sich auf einen Stein, legte den Kopf schief und lächelte wehmütig.
»Ihr kennt wirklich keine Sorgen …« Mossy schlug einmal mit dem nassen Schwanz, als er Becs Stimme hörte. Stubby, ein kleiner schwarzer Kelpie mit braunen Flecken über den Brauen und braunen Pfoten, der clownhafteste unter ihren Hunden, kam aus dem Wasser zu ihr gelaufen und schüttelte einen Sprühregen von silbrigen Tropfen aus dem kurzen Fell. Silberne Flussperlen landeten in Rebeccas Haar und befleckten ihr Hemd.
»Verzieh dich, Stubby!« Sie lächelte den Hund an und schickte ihn mit einer knappen Handbewegung fort. Der Hund sprang schwanzwedelnd ins Wasser.
Während die Hunde am Ufer spielten und sprangen, füllten sich Rebeccas Augen mit Tränen. Salzige Tropfen fielen in die frischen, flachen Pfützen, die an den Steinen leckten. Sie dachte an ihr Zuhause weiter flussaufwärts. Heute Morgen hatte sie Hass in den Augen ihres Vaters gesehen. Als sie an ihr Pferd Ink Jet dachte, begannen die Tränen zu fließen. Vielleicht hätte sie den Anhänger ankuppeln und sie mitnehmen sollen. Sie stieß mit der Stiefelspitze gegen die Flusskiesel. Ihre tränenverschmierten Wangen juckten so, dass sie ihr Gesicht mit beiden Händen massierte und danach die Strähnen zurückstrich, die aus ihrem Pferdeschwanz entkommen waren. Den Blick in das kühle, grüne Flusswasser gerichtet, schälte sie die papierdünne Borke von einem Stock.
Ihre Gedanken wanderten in die Zeit, als sie noch zu Hause gewohnt hatte. Bevor sie ins Internat geschickt worden war. Bevor ihre Mum weggegangen war.
Für Bec war Frankie eine Art Legende gewesen. Schon um halb sechs war sie aufgestanden und hatte in dem großen, alten Farmhaus herumgeklappert. Holz für den Ofen. Mittagessen für die Kinder und für Dad. Das Abendessen in der Gefriertruhe unter einer Klarsichtfolie mit der Aufschrift: »Abendessen – nur warm machen«. Um sieben Uhr dreißig hatte sie ihre drei Kinder zum Schulbus gefahren, dann war sie arbeiten gegangen. Hatte Kälber zur Welt gebracht, Schafen Blut abgenommen, um es auf Paratuberkulose zu testen, Katern die Eier abgeschnitten.
An manchen Abenden hatte ihre Mum bei Freunden in der Stadt übernachtet, damit sie am nächsten Morgen früh aufbrechen konnte, um die Kühe im Nachbartal auf Trächtigkeit zu prüfen. An anderen Tagen kam sie erst in der Dunkelheit heim, lange nachdem die Hennen auf ihre Stangen geklettert waren und sich die Hunde in die Wärme ihrer hohlen Baumstämme verkrochen hatten. Dann war Frankie in ihrem besprenkelten Kittel durch die Tür gestürmt, gefolgt von einem kalten Luftzug und einer leichten Kuhdungschwade. Die kastanienbraunen Haare standen in einem lockigen Heiligenschein um ihren Kopf, und ihre Wangen waren lieblich gerötet. Aber schon wenige Minuten nach ihrem beschwingten Auftritt hatten der stille Groll und die Ablehnung ihres Mannes das Rosa von ihren Wangen vertrieben, die Haare waren flach gekämmt, und sie stand am Spülbecken, um abzuwaschen. Inzwischen wusste Rebecca, dass der brodelnde Groll ihres Vaters auf eine Affäre zurückzuführen war, die es nie gegeben hatte.
Manchmal hörte Bec im hohen Hausflur das tiefe Brummen ihres Vaters, unterbrochen von dem leisen Flehen ihrer Mutter. Sie schnappte nur Bruchstücke auf, doch schon als Kind ahnte sie, was ihre Mutter empfinden musste. Er hatte sich eine Landfrau gewünscht und eine Tierärztin geheiratet. Er hatte die Farm groß aufziehen wollen, aber dann waren die Wollpreise gesunken, die Rindfleischpreise waren ins Bodenlose gefallen, und die Zäune und Gatter waren Jahr für Jahr tiefer im Dreck versunken. Sein stiller Groll, wenn Frankie arbeiten fuhr, verwandelte sich im Lauf der Zeit in brodelnden Zorn, den er an den Tieren ausließ, von denen er lebte. Harrys Adern wölbten sich wütend in seinem Hals, wenn eine Kuh im Fixierstand in die Knie ging; immer wieder drangsalierte er sie mit dem Elektroschocker, bis ihr tiefes Brüllen von den Hängen widerhallte. Schafe, die im Laufgatter stecken blieben, taumelten schließlich mit blutigen Nasen, wacklig und geprügelt durch das Sortiertor. Harrys dürre Hunde spürten die Knochen seiner Fäuste in ihren Flanken. Mit seinem Kontostand schmolz auch seine Liebe dahin. Nur in seinen Söhnen konnte er noch Hoffnung finden, während die Frauen in seiner Familie die ganze Schuld zu tragen hatten. Rebecca konnte es spüren. Sie spürte, wie sein Hass und seine Schuldzuweisungen wuchsen.
Sie erinnerte sich noch an den Tag, an dem er es ausgesprochen hatte. Damals hatte er mit hochgekrempelten Ärmeln am Ofen gestanden und eine Orange geschält. »Wir haben dich im Ladies’ College angemeldet.«
»Sehr witzig«, hatte sie geantwortet und im nächsten Moment gespürt, wie ihr Ohr nach dem Schlag seiner mächtigen Pranke zu glühen begann. Ein leichter Orangenduft blieb in ihren Haaren hängen.
Als sie dann ins Internat abfuhr, verabschiedeten sich ihre Brüder von ihr.
»Bis dann, Kurze«, hatte Mick, der ältere Bruder, sie geneckt. Dann hatte er seine riesige Faust geballt und ihr verspielt gegen die Schulter geschlagen. »Ich hoffe, du kommst als foine Lai-dy heim.«
Tom, der nur elf Monate älter als Rebecca war, ließ den Kopf hängen und hatte die Hände tief in den Taschen seiner ausgebeulten Jeans vergraben. Sie wuschelte ihm durchs sandfarbene Haar, bis er sie ansah. Seine Augen waren ernst und braun. Bec fand, dass sie aussahen wie Collie-Augen. Still und sanft. Er umarmte sie verlegen und sagte nur: »Bis dann, Schwester.«
Tom hatte sich gewünscht, dass Bec mit ihm auf die örtliche Highschool ginge. Er war schüchtern. Die Lehrer hatten ihn mit dem Etikett »künstlerisch begabt« bedacht, doch als die anderen Jungs Toms Andersartigkeit zu spüren begannen, hatte er schnell gelernt, seine Talente zu verbergen. In der Grundschule war Rebecca immer wieder für ihn in die Bresche gesprungen. Hatte ihn vor Micks Frotzeleien und den Schlägen der anderen Jungs beschützt.
»Mach dir keine Sorgen, Tommy«, hatte ihm die sommersprossige Rebecca versichert. »Ich hau ihnen in den Bauch. Die tun dir nichts.« Rebecca und Tom waren in der winzigen Landschule in dieselbe Klasse gegangen. Sie hatte neben ihm gesessen und die größeren Jungs mit finsteren Blicken eingeschüchtert.
Als Tom mit der Grundschule fertig war, hatte sein Vater verlangt, dass beide Jungs in der Nähe blieben, damit sie ihm auf der Farm helfen konnten, und so waren sie mit dem Bus in die örtliche Highschool gefahren.
Als Bec ins Internat geschickt wurde, trug sie im Herzen einen stillen Schmerz, weil sie von Tom getrennt wurde. In der Sandgrube, im Fluss oder abends auf dem dunklen Dachboden hatten sich die beiden ihre Träume anvertraut. Hatten sich flüsternd Geschichten über Waters Meeting erzählt. Träume von der Farm oder den Tieren, die sie eines Tages besitzen würden, wenn sie erst erwachsen waren. Dabei hatte immer Bec den Ton angegeben. Ohne sie versank Tom in Schweigen. Bec wusste, dass er nicht weniger leiden würde als sie, wenn sich das Schuljahr endlos hinzog.
Aus dem Auto heraus hatte Bec beobachtet, wie die Silhouetten ihrer winkend vor dem Haus stehenden Brüder mit zunehmender Entfernung immer kleiner wurden.
»Warum hast du dich nicht für mich eingesetzt, Mum? Warum hast du Dad nicht gesagt, dass ich nicht ins Internat soll? Warum?«
Ihre Mutter schüttelte schweigend den Kopf.
»Wir können uns das doch gar nicht leisten, Mum … Das weiß ich. Warum kannst du dich nicht für mich einsetzen, verflucht noch mal?«
»Das kann ich im Augenblick nicht, Rebecca. Ich kann es einfach nicht. Eines Tages wirst du das verstehen.« Ihre Mutter hatte stocksteif geradeaus gestarrt, so als könnte ein einziger Blick auf ihre Tochter ihre Seele zerspringen lassen.
Bec hätte am liebsten geschrien: »Warum hast du ihn überhaupt geheiratet? Warum?« Doch stattdessen hatte sie aus dem Autofenster geschaut und auf die rauschenden Eukalyptusbäume geblickt, während sie sich immer weiter von Waters Meeting entfernt hatten.
Jetzt kamen die drei Hunde angelaufen, um sich neben Bec auf den Grasflecken am Fluss niederzulassen. Flach ausgestreckt ließen sie sich von der Sonne den Pelz trocknen, Stubby sogar auf dem Rücken, die Pfoten in die Luft gereckt.
»Stubs, du alte Schlampe.« Bec kraulte den geschwollenen Schwangerschaftsbauch der Hündin.
»O Mann, was machen wir jetzt?«
Sie wusste, dass sie nach Süden in die Stadt fahren konnte, wo sie ins Internat gegangen war und wo ihre Mutter inzwischen lebte. Vierhundert Kilometer nach Süden, das war bis zum Abendessen zu schaffen. Vielleicht war ihre Mutter bis dahin schon aus der Tierklinik heimgekommen. Nach Parfüm und Desinfektionsmittel riechend, würde Frankie die Wohnungstür öffnen. Rebecca konnte das Begrüßungslächeln ihrer Mutter vor sich sehen und meinte gleichzeitig zu spüren, wie steif die Umarmung ausfallen würde. Rebecca wusste genau, dass Frankie denken würde: »Was hat sie jetzt wieder angestellt?«, und dass sie beim Umarmen die Augen verdrehen würde. Dann würde Frankie lang und breit darüber debattieren, was sie mit den Hunden anstellen sollten, weil, wie sie Rebecca schon früher erklärt hatte, die Zwinger in der Tierklinik für die Tiere der Kunden gebraucht wurden. Bec hätte das Gefühl, Frankies durchorganisiertes Stadtleben auf den Kopf zu stellen. Andererseits war sie schon früher unangemeldet vor Frankies Tür aufgetaucht, wenn sie es mit ihrem Vater nicht mehr ausgehalten hatte. Frankie hatte sie jedes Mal aufgenommen.
Am Ufer sitzend, blickte Rebecca in Mossys braune Augen und seufzte. Es wäre so einfach, nach Süden zu ihrer Mutter zu fahren.
»Scheiß drauf, Mossy, wir fahren nach Norden.«
Als Frankie Saunders ihre Einkäufe vor der Wohnungstür fallen ließ, dachte sie an Analdrüsen. Die Lebensmittel, die sie aus dem rund um die Uhr geöffneten Supermarkt mitgebracht hatte, sackten tiefer in die Einkaufstüten. Während Frankie in der Handtasche nach dem Schlüssel kramte, dachte sie an die Behandlung eines Border-Collie-Corgi-Mischlings vor zwei Wochen. Es hatte sich um einen der schlimmsten Fälle von verstopften Analdrüsen gehandelt, der ihr seit langer Zeit untergekommen war. Sie hatte es so eilig gehabt, den ekligen Job zu erledigen, dass sie den gut aussehenden Hundebesitzer erst registriert hatte, als er schon wieder gehen wollte.
Der Mann, Peter Maybury, hatte strahlend blaue Augen, die von kleinen Lachfältchen umringt waren. Er war ein bisschen pummelig, aber nett, auf eine große, weiche Weise.
»Wenn es möglich ist, sollten Sie ihn nächste Woche noch einmal bringen, Peter, dann drücken wir seine Drüsen wieder für Sie aus.« Als sie ihm in die Augen sah und ihm die Rechnung überreichte, berührten sich ihre Hände. Frankie spürte, wie ein Kribbeln durch ihren Körper lief, und erwiderte sein Lächeln.
Als Peter seinen Hund Henbury zum zweiten Mal brachte, hob er ihn behutsam von dem glatten Boden im Untersuchungsraum auf den Untersuchungstisch.
»Keine Angst, Henners, alles wird gut.« Er streichelte den Hund langsam und mit fester Hand, während Henbury auf seinen wackligen, lang behaarten Beinen auf dem Edelstahltisch stand. Frankie stellte die Standardfragen und begann dann vorsichtig, ein bisschen tiefer nachzubohren. Sie mochte diesen Mann.
»Er ist ein klein bisschen übergewichtig. Geht er oft spazieren? «
»Ich gehe jeden Abend mit ihm raus«, sagte Peter.
»Und es gibt niemanden, der ihn morgens ausführen könnte?«
»Nein! Nein. Geschieden.« Peter zuckte mit den Achseln.
»Ahhh«, sagte Frankie. »Dann müssen Sie seine Futterrationen kürzen.«
»Das wird nicht leicht. Ich koche für mein Leben gern, und er ist unwiderstehlich, wenn er mit diesen hungrigen Augen zu mir aufsieht. Sie kennen den Blick sicher.« Peter versuchte, sie möglichst hungrig anzusehen.
Frankie lächelte und streifte einen Handschuh über. »Schon gut, Junge. Das geht so schnell, das merkst du gar nicht.« Stirnrunzelnd führte sie den gekrümmten Zeigefinger ein. »Die linke Drüse ist okay, die rechte ist wieder ein bisschen zu voll … aber ich glaube, das Problem ist unter Kontrolle.«
Mit der nicht behandschuhten Hand gab Frankie dem Hund ein Stück getrocknete Leber und hob seine Schnauze an, damit er ihr in die Augen sah.
»Sag deinem Dad, von heute an keine Gourmetspeisen mehr, okay?«
Nachdem er Henbury auf den Boden gehoben hatte, griff Peter nach Frankies Hand und sagte: »Vielen, vielen Dank, Dr. Saunders. Er sieht aus, als ginge es ihm deutlich besser.«
»Oh!« Lächelnd zog sie den dünnen Latexhandschuh ab, bevor Peter ihre Hand nehmen konnte.
»Nennen Sie mich Frankie«, plapperte sie lächelnd und errötete sogleich. Die weiche, warme Haut seiner Hand fühlte sich so tröstlich an. Sie war rissige, spröde und schwielige Farmerhände gewohnt.
Am Empfang strich sie den in Bleistift vorgenommenen Eintrag »Henbury Maybury – Analdrüsen« im Terminkalender aus.
»Das macht dann sechsunddreißig Dollar, vielen Dank.«
Gerade als sie die Kasse öffnete, kam Charlotte von der Straße hereingelaufen und zog dabei die Strümpfe unter ihrer Schwesternuniform hoch.
»Tut mir leid, dass es ein bisschen später geworden ist, Frankie, in der Bank war so eine Schlange. Du kannst jetzt Mittag machen. Ich erledige das.«
»Mittagessen!«, sagte Peter. »Das nenne ich eine Idee! Sollen wir, ich meine, wir könnten doch, ähm, zusammen essen gehen.«
»Warum nicht?«, sagte Frankie, und Charlotte schmunzelte.
Draußen in der Sonne, wo der Verkehr vorbeizischte und -brummte, setzten sich die beiden praktisch Fremden gemeinsam an den Tisch eines Straßencafés nicht weit von der Tierklinik entfernt. Henbury wurde an einen nahen Laternenmast gehängt und ließ sich auf dem Pflaster des Gehwegs nieder. Er legte die weißen Pfoten ordentlich nebeneinander, als würde er seine Nägel betrachten, und drehte von Zeit zu Zeit den Kopf, um seinen langhaarigen Hintern abzulecken.
Peter kam von sich aus auf das Thema Scheidung zu sprechen und schnitt ironische Grimassen des Grauens, als er von der »Sorgerechtsschlacht« um Henbury erzählte.
»Das war schlimmer als bei den Kindern!« Seine Augen lachten sie an, dann tat er das Thema mit einer Handbewegung ab. »Die waren damals schon alle aus dem Haus und brauchten mich, den ums Überleben kämpfenden Lehrer, nicht mehr.«
Plötzlich merkte Frankie, dass sie ihm erzählte, wie sie Harry, Waters Meeting und ihre Kinder verlassen hatte.
»Ich mache mir so oft Sorgen um Tom. Er war immer so empfindsam. Eigentlich ist er das mittlere Kind, aber gefühlsmäßig ist er für mich das Nesthäkchen der Familie. Um ihn habe ich die größte Angst, seit wir uns getrennt haben.«
Peter lächelte sie mitfühlend an, sagte aber nichts, sondern drängte sie mit seinem Blick, mehr zu erzählen. Sie fühlte sich bei diesem Mann so geborgen, dass sie einen Schluck Kaffee nahm und weitersprach.
»Michael kommt bestimmt zurecht, er ist genau wie sein Vater«, meinte sie trocken. »Aber Rebecca, ach, Rebecca, um sie mache ich mir jeden Tag Gedanken. Sie ist so wild. Im Internat lief sie ständig Amok. Sie hat das Hirn, alles zu werden, was sie sich nur in den Kopf setzt, aber sie wollte auf gar keinen Fall bei mir in der Stadt bleiben, nachdem sie letztes Jahr mit der Schule fertig war. Sie musste zurück auf die Farm. Zu ihrem Fluss. Sie ist eine absolut Tier- und Hundenärrin. « Frankie spielte mit den dünnen, länglichen Zuckertütchen, die in einem Glas vor ihr standen, und Peter lächelte verständnisvoll.
»Sie sind nicht leicht zu ertragen, nicht wahr?«, fragte Peter. »Diese Schuldgefühle.«
»Ja«, bestätigte Frankie.
Sie hatten jeweils ihre Privatnummer auf die weichen Papierservietten geschrieben, die sofort einrissen, wenn man mit dem Stift zu fest draufdrückte. Beide hatten gelacht, als sie sich zum Abschied die Hand gegeben hatten. Frankie hatte beobachtet, wie Peter und Henbury die Straße hinabspaziert waren. In Peters Gang lag eine Leichtigkeit, die sich zuvor nicht gezeigt hatte.
Als sie jetzt in ihre Wohnung trat, fiel Frankies Blick als Erstes auf das rot blinkende Lämpchen am Anrufbeantworter.
Hatte Peter angerufen? Es war nach neun Uhr abends. Eine diabetische Katze, die um fünf gebracht worden war, hatte sie aufgehalten. Er hätte reichlich Zeit zum Anrufen gehabt. Frankie warf ihre Schlüssel auf die Bank und ging zur Tür zurück, um die Einkäufe hereinzuholen. Auf dem Weg zur Kochecke drückte sie den Wiedergabeknopf.
Gerade als sie sich bückte, um die Milch in den Minikühlschrank zu stellen, hörte sie Toms Stimme und hielt inne, um seiner Nachricht zu lauschen, bevor sie den Kühlschrank wieder schloss.
Sie sah zur Wanduhr auf. Seufzend trat sie ans Telefon, um ihren Sohn zurückzurufen und ihm zu berichten, dass Bec nicht bei ihr aufgetaucht war. Um sich selbst zu beruhigen, sprach sie laut in die schale Luft ihres kleinen Apartments: »Das hat Bec schon öfter gemacht.«
Rebecca war schon immer ein temperamentvolles Mädchen, aber nach der Trennung war sie nicht mehr zu bändigen gewesen. Mehr als einmal hatte Mrs Snell, die Internatsdirektorin, um sechs Uhr morgens angerufen, um sich in ihrem näselnden, super-britischen Tonfall zu beschweren.
»Saunders? Dr. Frankie Saunders? Ihre Tochter ist vergangene Nacht ernoit aus dem Internat entwichen. Inzwischen ist sie jedoch wieder bei uns. Wir können dieses Verhalten nicht dulden, wie Sie verstehen. Wir werden geeignete Disziplinarmaßnahmen ergreifen müssen. Schließlich besteht das Risiko einer Schwangerschaft oder Schlimmerem. Das würde den Ruf der Schule beflecken. Außerdem hat sie, nebenbei bemerkt, keinen guten Einfluss auf die anderen Mädchen. Natürlich berücksichtigen wir durchaus Rebeccas … ähem, familiäre Situation, dennoch muss etwas unternommen werden. Familiäre Trennungen wirken sich so verheerend auf die Kinder aus. Wären Sie so froindlich, hoiteMorgen auf dem Weg in die Klinik kurz in der Schule vorbeizuschauen? Sagen wir um acht Uhr? Punkt acht Uhr? Froit mich. Wir sehen uns dann.«
Doch nach einer weiteren kleinen Schulepisode, bei der Bec drei elfjährige Jungs in ihren Schlafsaal geschmuggelt hatte, hatte Mrs Snell schließlich befunden: »Nehmen Sie das Mädchen mit heim.« Sie durfte weiterhin als Externe den Unterricht besuchen, doch Bec hielt es nicht aus, mit ihrer Mutter in der voll gepfropften Wohnung eingesperrt zu sein. Am meisten vermisste sie ihre Hunde.
Hin und wieder musste Frankie, wenn sie von der Arbeit heimkehrte, feststellen, dass der Carport leer und der Wagen weg war. Dann hatte Rebecca wieder einmal die Schule geschwänzt und war drei Stunden gefahren, nur um bei ihren Hunden zu sein, selbst wenn das hieß, dass sie sich an ihrem Reiseziel den Zorn ihres Vaters zuzog.
Tom deckte sie oft. Er war ein Jahr zuvor von der örtlichen Schule abgegangen. Tom hatte Rebeccas Hunde gefüttert und ausgebildet, während sie in der Schule war. Tom versteckte auch den Wagen unten an der Zufahrt und schmuggelte Essen aus dem Haus, weil Bec in ihrem Schlafsack in einem Heuschober schlief, damit ihr Vater sie nicht in die Stadt zurückschickte.
Tom wird sich schreckliche Sorgen um sie machen, dachte Frankie, während sie die Nummer von Waters Meeting wählte. Ihre Tochter war heute eindeutig nicht hier in der Wohnung gewesen.
Sie hörte Harrys Stimme am anderen Ende der Leitung. Er hatte offenkundig geschlafen, sein »Hallo?« klang barsch.
»Harry, ich bin’s. Ich bin auf der Suche nach Bec. Tom scheint zu glauben, dass sie mit ihren Hunden losgezogen ist. Was hast du diesmal angestellt?«
Harrys Schweigen am anderen Ende der Leitung erfüllte Frankie mit Angst und Schrecken. Immer wenn Bec so ein
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Jillaroo« bei Penguin Books, Penguin Group (Australia), a division of Pearson Australia Group Pty Ltd.
1. Auflage Taschenbuchausgabe Januar 2010 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © by Rachael Treasure, 2002 Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
ES · Herstellung: RF Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Redaktion: Regine Kirtschig
eISBN 978-3-641-08116-4
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Leseprobe