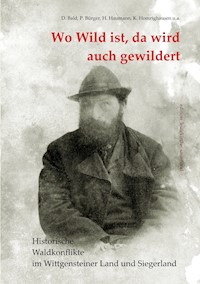
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bis ins 20. Jahrhundert hinein gehörten Wilderei und Holzfrevel zum Alltag. Dieser Sammelband erhellt den "Krieg im Wald" für das Gebiet des heutigen Kreises Siegen-Wittgenstein. Historische Dokumente, Zeitungsberichte, Forschungsarbeiten, heimatkundliche Texte und Hinweise auf noch unbearbeitete Quellen vermitteln den Rahmen für eine Gesamtdarstellung der Konflikte eines halben Jahrtausends. Die Landesherren beanspruchten für sich ein Monopol auf Waldbesitz und Jagdausübung. Doch die bäuerlichen Untertanen wollten mitnichten nur Frondienste für den adeligen Jagdkult leisten und erprobten lange vor der 1848er Revolution den Aufstand. Zuletzt erregten brutale Förstermorde die öffentliche Aufmerksamkeit. Verwundete oder getötete Wilderer aus der ärmeren Klasse handelte die Tagespresse anonym in Kurzmeldungen ab. Wie im "Absolutismus" plädierte man für Schüsse auch auf fliehende Frevler ... Die Dokumentation zu einem lange tabuisierten Schauplatz der Sozialgeschichte erschließt Beiträge von Adolf Bahne, Dieter Bald, Peter Bürger, Otto Busdorf, Karl Féaux de Lacroix, Heiko Haumann, Johann Georg Hinsberg, Klaus Homrighausen, Fürst Karl zu Leiningen, Fritz Krämer, Christian Saßmannshausen, Alfred Schärer, O. Troemper u.a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
E
INLEITUNG
zu diesem dokumentarischen Sammelband und Quellenüberblick
Peter Bürger
Aus Zeiten der Feudalherrschaft
Ab dem späten neunzehnten Jahrhundert
„Werkstatt der Heimaterzähler“
Literatur (mit Kurziteln)
Aus Zeiten der Feudalherrschaft
I.
W
ITTGENSTEINER
H
OLZORDNUNG VOM
18. A
UGUST
1579
Gegeben von Ludwig von Sayn (1558-1605), Graf zu Wittgenstein
II.
B
ESTALLUNGSBRIEF AUS DEM
J
AHR
1618
FÜR
R
ÖTGER
C
HUN
, S
CHULTHEIß UND
W
ALDFÖRSTERIM
A
MT
R
ICHSTEIN UND IN DER
V
OGTEI
E
LSOFF
Ausgestellt durch Graf Ludwig II. zu Sayn und Wittgenstein (1603-1634)
III.
E
IN
D
IEDENSHÄUSER
W
ILDERER DES
J
AHRES
1693
Johann Wilhelm Spies aus Schulze-Haus
Klaus Homrighausen
(2010)
IV.
B
ESTALLUNG DES
W
ITTGENSTEINER
F
ÖRSTERS
M
ATTHÄUS
K
ROH IM
J
AHR
1724
Durch Casimir (1687-1741), Graf zu Sayn und Wittgenstein
V.
A
US DER
B
ERLEBURGER
F
ORST
-
UND
W
ALDORDNUNG
1726
Gegeben von Casimir (1687-1741), Graf zu Sayn und Wittgenstein
VI.
V
ON
W
ILDDIEBEREI
, F
ALSCHMÜNZEREI UND GOTTLOSEN
A
NSCHLÄGEN WIDER DEN
L
ANDESHERRN
Ein dunkles Kapitel aus der Geschichte Elsoffs 1731-1734
Fritz Krämer
(1969)
Eine Audienz und ein vergessener Brief
Fischer und Horn sagen aus
Der Beschuldigte wird vernommen
Verhaftet und landesflüchtig
Aussagen unter Druck und Drohung?
Der Kreis der Beschuldigten wird größer
Die Nürnberger hängen keinen …
Alle Akten gehen nach Tübingen
Helft den Gefangenen!
Frauenbesuch im Gefängnis
Um freies Geleit
Das Tübinger Gutachten
Warum wird der Prozeß verschleppt?
Neue Bitten und Anträge
Johann Jakob Gelbach erhält freies Geleit
Ein Flüchtling wird verfolgt
Wieder bitten die betrübten Weiber
Um die Rechtmäßigkeit des gräflichen Vorgehens
Der Peinliche Prozeß wird eröffnet
Daniel Marburger beendet den Prozeß auf seine Weise
Daniels Weg zurück
VII.
„W
EIL AUCH DIE
W
ILD
-D
IEBEREY IN
U
NSEREN
W
ALDUNGEN ÜBERHAND GENOMMEN
“
Erneuerte Forst-, Jagd- und Fischereiordnung der Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 1737/1749
Zur Einordnung des Regelwerks
Inhaltliche Gesamtübersicht zur Ordnung von 1737/49
Textauszüge aus den Abteilungen zu Jagd & Fischerei
VIII.
U
EBER
W
ILDDIEBEREI
[Ein Plädoyer für rigorose Verfolgung mit Beispielen aus dem Wittgensteinischen, der Grafschaft Dagsburg, Wachenheim und dem Herzogtum Zweibrücken]
Annalen der Societät der Forst- und Jagdkunde
Karl, Fürst zu Leiningen
(1813)
IX.
J
AGDFREVEL IM GEMEINSCHAFTLICHEN
G
RUND
B
URBACH UND
S
ELBACH
1748-1804
Eine noch nicht ‚ausgewertete‘ Akte mit Bezug zum Fürstentum Nassau-Siegen
Findbuch Landesarchiv NRW: Abteilung Westfalen
Inhaltsangabe zur LAV-Akte E 601: A 168
‚Nassauische Rechtsbestimmungen‘ nach dem ‚Handbuch der Forst- und Jagdgesetzgebung‘ (1828)
X.
HOCHWILDSTAND UND WILDSCHADEN 1807-1811
Klagen der Einwohner des Fürstentums Wittgenstein
Karl Féaux de Lacroix
(1913)
XI.
„F
ORSTGESCHICHTE DER EHEMALIGEN
G
RAFSCHAFT
S
AYN
-W
ITTGENSTEIN
-H
OHENSTEIN BIS
1900“
Hinweise zu Jagdrecht, Wilderei und Holzfrevel in der Dissertation von Gerhard Naumann
Lesebericht von P. Bürger
Das Monopol des landesherrlichen Waldeigentums
Exkurs: Der „vierte Artikel“ der deutschen Bauern, 1525
„Das Jagdrecht stand im ganzen Lande allein dem Landesherrn zu“
Gräfliche Jagd-Apparatur im 18. Jahrhundert
Jagd-Obsessionen vor der „Mediatisierung“ 1806
Soziale Lage im 19. Jahrhundert
Aufruhr der Bevölkerung im Revolutionsjahr 1848
Ab dem späten neunzehnten Jahrhundert
XII.
„D
EUTSCHER
H
ANNES
“
Der Wilddieb Johannes Wagebach wurde 1892 zum Tode verurteilt
Otto Busdorf
(1928)
XIII.
A
UF DEN
S
PUREN EINES
F
ÖRSTERMORDES
Akteure und Lebenswelten rund um einen Fall im Wittgensteinischen 1891
Heiko Haumann
Wilderer in der Sozialgeschichte
Die Verhältnisse im Wittgensteinischen
Der Mord an Friedrich Kroh
Umbruchzeit in Dotzlar und Umgebung
Ermittlungen und Verhaftungen
Prozessordnung
Das Strafverfahren gegen Wagebach
Der Angeklagte
Der Untersuchungsrichter
Die Begegnung
Das Ende
Quellen- und Literaturverzeichnis
XIV.
V
ERSTREUTE
Z
EITUNGSFUNDE
1881
UND
1891-1894
Ermordung des Försters Trembour, Tragödie in der Familie eines Weidenauer Wilderers und Tötungsdelikt eines ‚Stiefsohnes des Johannes Wagebach‘
Zusammengestellt von Peter Bürger
Sauerländisches Volksblatt, 05.03.1881
Sauerländisches Volksblatt, 30.03.1881
Sauerländisches Volksblatt, 28.05.1881
Wittgensteiner Wochenblatt, 17.10.1891
Der Patriot, 05.04.1893
Sauerländisches Volksblatt, 05.04.1893
Sauerländisches Volksblatt, 08.04.1893
Sauerländisches Volksblatt, 12.04.1893
Sauerländisches Volksblatt, 19.04.1893
Sauerländisches Volksblatt, 19.04.1893
Der Patriot, 07.06.1894
XV.
S
CHLIMME
S
ILVESTERNACHT IM
L
INDENHÖFER
F
ORST
Berichte und Erinnerungen zum Tod eines Wilderers im Jahr 1901
Alfred Schärer
Der Bericht des ältesten Förstersohnes
Der Zusammenstoß mit dem Wilderer aus Förstersicht
Ein Standesbeamter bringt Licht in die Sache
XVI.
„W
ILDERER
-A
FFÄREN
“
Vier Berichte des ‚Sauerländischen Volksblattes‘ im Januar 1902
Zusammengestellt von Peter Bürger
Tod des Jagdhüters Thielen in der Nähe von Kevelaer
Tod des wittgensteinischen Wilderers Heinrich Stenger
Schussverletzung eines Wilderers bei Arnsberg
Erschießung des Arbeiters Kißmer durch den Mendener Hilfsförster Bock
XVII.
„A
UCH IST DAS
W
ILD NICHT ALLEIN FÜR WOHLHABENDE
H
ERREN GESCHAFFEN
“
Jagd und Wilderei während des ersten Weltkriegs und der Nachkriegsjahre – Zeitungsmeldungen und Chroniknachrichten
Zusammengestellt von Peter Bürger
„Jagdnachrichten“ 1914-1915
Quellen aus dem letzten Kriegsjahr
Meldungen im Revolutionsjahr 1919
Hilchenbacher Wilderer begeht Frauenmord?
Nachrichten zum Inflationsjahr 1923
XVIII.
M
ORD AM
B
ENFER
R
ÜCKEN
Der gewaltsame Tod eines mutmaßlichen Wilddiebes im Jahr 1923
Dieter Bald
Wer ist ein Wilderer?
Gefährliche Konflikte im Umfeld von Benfe
Der Fall Benfe im Jahre 1923
Was steht in den Quellen?
XIX.
W
O
W
ILD IST
,
DA WIRD AUCH GEWILDERT
Ein wittgensteinisch-sauerländischer Fall des Jahres 1959
Nach dem Bericht von F. W. Laue
‚Werkstatt der Heimaterzähler‘: Geschichte und Geschichten
XX.
„D
ER
W
ILDE
J
ÄGER
“
Anmerkungen zur siegerländischen und wittgensteinischen Sagenüberlieferung
Peter Bürger
XXI.
„B
ERTRAM DER
J
AEGER
“
Siegerländische Wilderer in einem historischen Roman von Friedrich Hué (1866-1941)
Lesebericht von Peter Bürger
XXII.
D
ES
W
ILDDIEBS
E
NDE
Eine wittgensteinische Karfreitags-Betrachtung
Pfarrer Johann Georg Hinsberg
(1912)
XXIII.
L
ICHT
-
UND
S
CHATTENBILDER
aus den Wittgensteiner und angrenzenden Forsten
Christian Saßmannshausen
(1920er Jahre)
Land und Leute
Hallih, halloh, ich bin ein Jägersmann
Hans, willst du wieder zur Jagd?
Aus der Jugendzeit
Förster Kroh’s letzter Gang
Und wieder fällt ein Schuß
Wer war der Täter?
Es werde Gerechtigkeit
[Exkurs:] Wilddiebstrafen im Mittelalter
Aug’ um Auge: Sylvester 1901
Ein Sauerländer Wilddiebsfall [1909]
Querschnitte durch die Wittgensteiner Jagdgeschichte
XXIV.
D
ER
S
CHNEIDERWILLEM
[Ein Westwälder Wilderer um 1888, aus der Sicht eines Wilddiebjägers]
O. Troemper
(1930)
XXV.
„W
ILDDIEBSGESCHICHTEN
“
[Ein Kapitel aus der Förster-Autobiographie „Im Wald und auf der Heide“, welches u.a. die Fahndung nach Wilderern als „Menschenjagd“ beschreibt]
Adolf Bahne
(1937)
Lehrjahre in Böddeken – Militärpflicht
Oberförsterei Glindfeld bei Medebach und Revier Oestrich bei Heeßen
In den Forstämtern Siegen und Hainchen
Kurzbiographie des Buchautors
XXVI.
W
ILDEREI IM MITTLEREN
E
DERTAL
Geschichtliches und Geschichten im Heimatbuch für Dotzlar, Arfeld, Richstein (1982)
Lesebericht von Peter Bürger
Winter 1806: Ein toter Hirsch im Breidenbach
Im Jahr 1865 fangen Richsteiner Bauernjungen einen Fischotter
Weihnachten 1890: Wilderer erlegen einen Hirsch
„Der O. aus Meckhausen war ein Wilddieb …“
*
Kleine Chronologie (mit Seitenverweisen)
Herausgeber & Autoren
Die Buchreihe über Wilderer und Waldkonflikte:
Peter Bürger (Hg.)
Krieg im Wald.
Forstfrevel, Wilddiebe und tödliche
Konflikte in Südwestfalen
ISBN: 978-3-7460-1911-6
Peter Bürger
Hermann Klostermann.
Der populärste Wilddieb Westfalens
ISBN: 978-3-7448-5055-1
Rudolf Gödde
Wildschütz Klostermann.
Ein westfälischer Wilddieb-Roman
ISBN: 978-3-7528-4262-3
Wo Wild ist, da wird auch gewildert.
Historische Waldkonflikte im
Wittgensteiner Land und Siegerland
ISBN: 978-3-7528-8090-8
P. Bürger, O. Höffer,
W. Scherer, M. Vormberg u.a.
Die heimliche Jagd
Historische Waldkonflikte
im Kreisgebiet Olpe
(in Vorbereitung zur Drucklegung)
Hans-Dieter Hibbeln, Peter Bürger (Hg.)
Es gab nicht nur den Klostermann.
Quellen und Berichte zur Wilderei in Westfalen
(in Vorbereitung)
edition leutekirche sauerland
Einleitung
zu diesem dokumentarischen Sammelband und Quellenüberblick
Peter Bürger
„Jene Herren begehen nicht eine gewöhnliche, sondern eine große Todsünde, die um eines Hasen oder anderen gefangenen Wildes halber die Leute töten oder mit Abhauung von Gliedmaßen am Leibe verstümmeln, insbesondere wenn sie dies tun aus Rachgier oder allzu großer Jagdlust.“
ANGELUS DE CLARA (geb. 1496), auch Angelus Astensis genannt1
In Westfalen finden wir, anders als z.B. in Süddeutschland, keine breite Tradition der ‚Wilderer-Folklore‘ und – abgesehen von Hermann Klostermann2 – auch keine wirklich herausragende ‚Heldengestalt‘ aus dem Kreis der illegal Jagenden. Forst- und Wildfrevel hat es gleichwohl über die Jahrhunderte hinweg immer gegeben, z.T. in erheblichem Ausmaß. Zur Tabuisierung des Themas haben verschiedene Gruppen beigetragen. Die Angehörigen bestrafter – oder gar getöteter – Wilderer oder Holzfrevler zogen das Schweigen vor, viele Förster nicht minder. (Steindenkmäler für Jagdbedienstete, die durch den ‚Krieg im Wild‘ den Tod fanden, reichen als Form der öffentlichamtlichen Gedächtniskultur weit zurück; daneben nimmt sich die Zahl von entsprechenden ‚Wilderer-Steinen‘ verschwindend gering aus.) Eine idealisierende Geschichtsschreibung für den nahen Raum konnte mit Kriminalität, landesherrlicher Repression oder tödlichen Konflikten um Ressourcen wenig anfangen.
Das aristokratische Jagdprivileg, Symbol der Macht über Territorien und Herrschaftskult zugleich, ließ die Ahndung der Wilderei oft zu einer hochpolitischen ‚(Klein-)Staatsangelegenheit‘ werden. Doch zum Märchen einer seit jeher wohlbehütenden Heimat gehören edle Herrschaftsgeschlechter und wirtschaftliche Bedingungen, die allen ein gutes Auskommen ermöglichen. Zeugnisse der sogenannten ‚kleinen Leute‘ oder gar der Ärmsten waren schon immer rar – und nicht von Interesse.3 Vom Hässlichen auf der ‚eigenen Seite‘ wollen eingefleischte Anhänger der Heimatraum-Religion ohnehin nur dann reden, wenn es sich in grauen Vorzeiten abgespielt hat.
Das Übergehen, Vergessen oder Tabuisieren bestimmter sozialgeschichtlicher Kapitel bleibt hingegen unannehmbar für alle, deren Suchen einer leibhaftigen Beheimatung von Menschen gilt.4 Mit dem Buch „Krieg im Wald“5 ist der Versuch unternommen worden, für Südwestfalen anhand höchst unterschiedlicher Quellensegmente einen ersten Überblick insbesondere zu Wilderei-Konflikten darzubieten. Dieses Werk, das als Einstieg in die Thematik hier noch einmal empfohlen sei, bezieht sich in einigen Teilen auch auf das Gebiet des heutigen Kreises Siegen-Wittgenstein.6 Mit dem vorliegenden dokumentarischen ‚Spezialband‘ zur Geschichte des waldreichen Territoriums erreichen wir nun eine weitere Stufe der Erkundungen.7 Zusammengetragen wurde zunächst, was nach Auskunft von Heimatforschern und Bibliographien für das Kreisgebiet bereits vorliegt. Diese Bestandsaufnahme findet Ergänzung durch die Dokumentation historischer Quellentexte, Hinweise auf (mutmaßlich) noch nicht ausgewertete, digital allgemein zugängliche Aktenstücke, exemplarische Zeitungsrecherchen, neu bearbeitete Fallbeschreibungen (Forschungsbeiträge) und einige eigens für diese Veröffentlichung erstellte ‚Literaturberichte‘. In chronologischer Folge werden so bedeutsame Stationen, Orientierungspunkte und Fragestellungen sichtbar, die eine wittgensteinisch-siegerländische Gesamtstudie zur jahrhundertelangen Geschichte der Waldkonflikte dereinst zu berücksichtigen hätte.8 Unter solchem Vorzeichen möge das hier Vorgelegte nicht zuletzt als nützliche Dienstleistung gelten. Die Zusammenschau soll uns ‚klüger‘ machen, gleichzeitig aber auch aufzeigen, warum das Thema bedeutsam ist, wie fragmentarisch unser Wissen ausfällt (bezeichnende Leerstellen) und wo weitere Forschungen ansetzen könnten.
1. AUS ZEITEN DER FEUDALHERRSCHAFT
In seinen „Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein“ schreibt Eitel Klein zur Entwicklung ab dem 16. Jahrhundert: „Den größten Teil des [Wittgensteiner] Landes nehmen die riesigen Waldungen ein, die sich sämtlich im Besitz der Grafen von Wittgenstein befinden und den Reichtum des Landes bilden. Die große Verbreitung ist naturbedingt und bildet die bestlohnende Anbauform in Wittgenstein. […] Der außerordentlich reiche Waldbestand des Landes bildet das Rückgrat des gesamten Wirtschaftslebens, ohne den ein Existieren in der Grafschaft überhaupt undenkbar ist.“9 Zur keineswegs „naturbedingten“ (oder gar „gottgewollten“) Sonderheit des Wittgensteiner Landes gehörte der bedrückende Umstand, dass nahezu der gesamte Wald im Besitz der Landesherrschaft stand (während sich anderswo in nennenswertem Umfang auch andere Eigentumsformen herausbilden konnten). Im Gegensatz etwa zum kurkölnischen Gebiet des heutigen Nachbarkreises Olpe10 war seit Festigung der Ansprüche auch von vornherein flächendeckend geklärt, dass nur dem Landesherrn die Jagdberechtigung zukam. Das eine bedingt das andere: Der sogenannte „Wildbann“ – die Jagdrechte in einem Territorium betreffend – hängt wie der „Forstbann“ eng mit dem historischen Ringen um Macht über den Raum zusammen.11 Der Zusammenhang spiegelt sich z.B. unter Graf Ludwig d. Jüngeren noch im Bestallungsbrief12 für Rötger Chun (Kuhn) aus dem Jahre 1618, da hier „Schultheiß und Waldförster“ (u.a. Grenzsicherungs- und Waldaufgaben) in einem kombinierten Amt vereinigt sind (→II). In der „Holzordnung vom 18. August 1579“13 wird bereits eingeschärft: Es soll niemand mit Büchsen oder Armbrust auf die Pirsch gehen; Waffen zum eigenen Schutz dürfen nur auf ordentlichen Straßen – nicht in potentiellen Jagdgefilden – getragen werden (→I). Die Strafandrohung bezogen auf das bloße Waffentragen ist jedoch noch nicht spezifiziert.
Klaus Homrighausen14 referiert eine Akte des Jahres 1693, in welcher es um die – grenzüberschreitende – Strafverfolgung des Johann Wilhelm Spies aus Diedenshausen (bei Berleburg) durch das Gericht in Laasphe geht (→III). Dies ist der früheste in unserem Band behandelte Wilderer-Kasus mit Namensnennung. Die um ein Gutachten gebetenen Marburger Juristen empfehlen ein Verhör unter Folter oder – im Falle eines gnädigen Vorgehens des Grafen – zumindest die Landesverweisung.
Im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts erfolgte eine Aufteilung des wittgensteinischen Territoriums. – Über den unmittelbaren Nachfolger des Begründers der Sayn-Wittgenstein-Berleburger Adelslinie wird mitgeteilt: „Ludwig Casimir, der älteste Sohn des Grafen Georg [1605-1631], hatte das Unglück, in den letzten Zeiten des dreißigjährigen Krieges von Straßenräubern und Wilddieben (den sogenannten Schnaphahnen) in der Nähe der Stadt Wetter am 6. Juni 1643 ermordet zu werden.“15 – Der pietistisch geprägte Casimir zu Sayn und Wittgenstein (1687-1741), Landesherr der waldreichen, aber dünn besiedelten Nordgrafschaft Wittgenstein-Berleburg, war der Jagd als Lustbarkeit seines Standes keineswegs abgeneigt, baute u.a. neue Jagdhäuser und hielt als nach innen gekehrter ‚Chronist‘ seine waidmännischen Aktivitäten trotz ihres weltlichen Charakters sorgfältig fest.16 Am 8. Februar 1724 notierte Graf Casimir in seinem Tagebuch: „Ich habe […] auch den schon 1 ½ Jahr allhier gefangen geseßenen Winterberger Wilddieb loßgelassen, nachdem er vorhero nicht alleine eydlich angelobet, sondern auch noch dazu eine gerichtliche Caution von sich gestellet hat, daß er sich nicht mehr hier im Lande auf Wilddieberey wollte betretten laßen.“17 Die von ihm ebenfalls 1724 ausgestellte Bestallungsurkunde für den Förster Matthäus Kroh (→IV) weist in mehreren Formulierungen auf die ernste Bedeutung der Wilderer-Verfolgung hin. Der Forstmann soll einen Jahres-‚Grundlohn‘ von nur vier Thalern erhalten, doch bei der Ergreifung eines Wilderers wartet auf ihn gleich eine Belohnungsprämie von 30 Thalern! Casimirs Forst- und Waldordnung aus dem Jahr 1726 (Auszüge →V) enthält u.a. Maßregelungen zum Halten von Hunden sowie das Verbot des Waffentragens abseits der ‚ordentlichen Landstraßen‘ (im Vergleich zur „Holzordnung vom 18. August 1579“ gibt es eine Präzisierung: wer das Waffenverbot nicht beachtet, wird per se als Wilddieb betrachtet und inhaftiert).
Am 28. September 1728 widerfährt abends einem von Casimirs Gerckhausener Förstern mit Namen „Hermannus Krähmer“ das Unglück, „daß ihme von einem Wilddiebe, den er fangen wollen, der lincke Arm oben an der Schulter […] ist entzwey geschoßen worden, so sehr gefährlich ist. Der Förster ist hierher in das Schloß gebracht worden, um beßerer Verpflegung willen, gestalten es eine mißliche Cur ist. Gott stehe dem armen Geschoßenen, der viele Schmertzen ausstehen muß, gnädiglich bei und laß alle wohl gerathen, zu seines Nahmens Ehre und des Patientens Seelen besten! Amen!“18. Solch innigliche Anteilnahme eines Grafen am Los eines Forstbedienten war wohl kaum selbstverständlich.
Ob dieser fromme Landesherrscher sich auch gegenüber illegal Jagenden milder verhielt als andere jagdliebende Standesgenossen, darüber kann anhand der für diesen Band gesichteten Quellen nichts Zuverlässiges ausgesagt werden.19 (Zum Vergleich: Kurkölnisch-sauerländische Holzfrevler aus dem Raum Olpe hatten 1727 bei Grenzüberschreitungen in Gebiete des Fürstentums Nassau-Siegen keine Gnade zu erwarten. Dort waren die Hochfürstlichen Heckenknechte und Jäger angewiesen, „diejenigen, welche etwa nach verübten Holtzschaden der pfändung entfliehen mögten und keinen stand halten wollten, ohne Ansehen zu erschießen“20.) Ende des 18. Jahrhunderts zeichnete sich dann die ‚Nordgrafschaft‘ jedenfalls nicht durch besondere Milde aus. Die Berleburger Regierung klagte 1797 beim Landdrosten und bei den Räten in Arnsberg über häufige Wilddiebereien durch Einwohner des Amtes Bilstein21: Man habe „die kräftigsten Gegenanstalten getroffen“, so „dass die betroffenen wilddiebe sich sogar des verlustes ihres Lebens dabei bloß stellen“. Pfarrer Johann Georg Arens aus Heinsberg warnte seine Schäfchen: „Stehlt kein Wild! – die Berleburger schießen euch todt!“
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Gesamtprojekts zur Erforschung der Wilderei in der Grafschaft Wittgenstein-Berleburg bestünde vermutlich kein Mangel an Quellen. Aus dem Fürstlichen Archiv Berleburg sind für alle Interessierten über Internet z.B. frei zugänglich eine äußerst umfangreiche Akte über „Wildpret und Fischdiebe“ aus den Jahren 1675 bis nach 172622 sowie eine Fallakte „Wilddieberei, ./. Schultheis Fischer zu Wingeshausen“23 (1748/49).
Zur Wilderei-Bekämpfung der Südgrafschaft (Sayn-Wittgenstein-Hohenstein) im 18. Jahrhundert vermerkt Eitel Klein (mit einer Ausnahme leider ohne genauere Zeitangaben zu den Maßnahmen): „Der Wilddieberei rückte man energisch zu Leibe. Auf jeden Wilddieb wurden dreißig Reichstaler ausgesetzt. Diese Prämie wirkte besser als alle Strafanordnungen; denn jeder Dieb hatte sich jetzt vor seinen Dorfgenossen mehr zu fürchten als vor dem Förster. Ein auf frischer Tat ertappter Wilddieb wurde 1726 des Landes verwiesen. Setzte er sich gar zur Wehr, so hatte jeder Untertan das Recht, ihn niederzuschießen. Später wurde ein Jägerkommando von zehn Mann angestellt, das dem Wilddiebunwesen den Garaus machen sollte und sich bald hier bald dort aufhielt und seine Streifzüge machte.“24 Die Jagdordnung aus dem Jahr 1622 „galt weiter und bekam eine Neuauflage unter Graf August. In der Forstordnung von 1737 nehmen die Jagd und Fischerei betreffenden Paragraphen einen breiteren Raum ein als die den Forstangelegenheiten gewidmeten Bestimmungen.“25
Unter dem vom gottesfürchtigen Nachbarregenten Casimir als „Weltmenschen“ betrachteten Graf August David (1663-1735) eskalierten jene Konflikte in der Grafschaft, die von Werner Troßbach als ‚Bauernunruhen 1696-1806‘ dargestellt worden sind und nicht zuletzt deutlich machen, dass die ‚Untertanen‘ den alleinigen Waldbesitz und den exklusiven Jagdberechtigungs-Anspruch des Landesherrn mitnichten als unantastbare Angelegenheiten betrachteten: Die Bauern gingen bei ihrem Widerstand in Fragen des Forstes, der verschärften Leibeigenschaft und der Frondienste (bzw. Dienstgelder) ab 1722 von sehr grundsätzlichen Überlegungen aus, wozu eben auch die Eigentumsfrage gehörte.26 Sie setzten „sich nicht allein gegen die Neuerungen des Grafen August zur Wehr, sondern forderten das Gemeineigentum am Wald; reaktiver Widerstand wurde also in proaktive Forderungen transformiert […]. Der naturrechtliche Kern dieser Vorstellungen war allerdings mit einer altrechtlichen Schale umgeben, da die Untertanen die mit einem Mal auftretende Prätension des Waldeigentums auf Dokumentenabschriften stützten, die ihre Deputierten aus Hallenberg im kurkölnischen Herzogtum Westfalen mitgebracht hatten. Es waren Abschriften der Hallenberger Chronik des Johann Adam Bange von 1602, eines Vertrags, den Graf Ludwig d.Ä. mit der Stadt Hallenberg 1596 geschlossen hatte, und eines kurkölnischen Dokuments von 1611. Auf diesen drei Stücken bauten die Bauern und ihre Sachwalter eine Geschichtslegende auf […]. Was die Bauern damit beweisen wollten, war nichts weniger als ‚Recht und Gerechtigkeit in Holtz, Huede, Maste, Weide, Berg und Thal‘.“27 Neben den Urkunden zum „Hallenberger Streit“ zwischen Wittgenstein und Kurköln sind Konstruktionen der Bange-Chronik (1602) entscheidend für die Argumentation der Bauern, wobei der angenommene Geltungskreis der wittgensteinischen Orten unversehens enorm ausgeweitet wurde. Die vormals in alten Zeiten zur Grafschaft Züschen gehörenden Untertanen der Wittgensteiner hätten „alle ihre von Alters hergebrachte Berechtsamkeiten in obgedachtem Recess vorbehalten. Als da ist die Freyheit, freye Holtzung zu Berg und Thai, Huden, Maste, und alles, was sie mit Recht hergebracht haben, keinesweges genommen, sondern solche Berechtsamkeiten auch vom Churfürsten von Cölln und Wittgenstein ratificirt worden; zu diesen obig specificirten Orthen ist alles Volck ein freyes Volck, keiner Leibeigenschafft unterworffen. Geben nur 4 Schatzungen. Ein jedes Hauß thut und hat seine wenige gemessene Dienste, Hude, Maste, so viel als nöthig, frey, die Fischerey und kleine Jagd.“28 1722 widersetzen sich die Oberndörfer nach Beratungen mit Bauern aus dem ganzen Land den Förstern und erklären, „sie wären der Herrschafft keine Forstfrevel schuldig und ließen sich darauf nicht pfänden“29. Die Radikalität der unfolgsamen Bewohner wird deutlich in einer Verhöraussage des Johann Adam Weber aus Banfe aus dem Jahr 1723: „Sie könten Herrn Graffen Augustum vor keinen Herrn annehmen, noch sich mit ihm vergleichen, weilen er ihnen die Punkten wegen der kleinen Jagd und ihnen der Fischerey, so ao 1611 zugestanden wäre, und dann H. Graff Henrich die gedachte Fischerey ihnen abgetrungen haette, nicht concediren würde.“30 Die Elsoffer vertreiben dann im September 1724 die „herrschaftliche Holzhauer aus ihrem ‚eigentümlichen‘ Wald […] mit der Begründung, ‚man fiele ihnen gewaltthätiger Weiß in ihren [!] Wald und hauete ihr Holtz ab‘.“ Der Forstverwalter will daraufhin wissen, wer ihnen „denn den Berg und ihre vermeynte Gerechtigkeiten gegeben hätte“, und die Bauern erwidern, „sie hätten solche von Ewigkeit her gehabt, und unser Herr Gott hätte ihnen solche gegeben.“31 – Zu den Schikanen unter Graf August zählten 1730 auch Ärgernisse wie die vom Schloss eingeforderten „Abgaben an Schlehen, Haselnüssen und Heidelbeeren, die im Wald von den Frauen gesammelt“ wurden; die Bauern klagten rückblickend, „500 Haushalte hätten von 1724 bis 1730 50.000 Rtlr. Dienststrafen bezahlen müssen“32. Die Frauen waren vor allem aufgrund strategischer Überlegungen am Widerstand beteiligt. – Zur Wirkungsgeschichte des beeindruckenden Emanzipationskampfes der Wittgensteiner Bauern gehören später unter anderem noch 1776 ein Protest gegen amtliche Haus-Blechnummern (diese stünden für „ewige Leibeigenschafft und Sclaverey“), ziviler Ungehorsam 1790 in Banfe, Laaspher Sympathien für die Mainzer Jakobiner im Jahr 1792 und Dienstverweigerungen im ganzen Kleinterritorium um 1800; die Wittgensteinische ‚Forstfrage‘ wird 1848, 1919 und 1945 wieder auf der Tagesordnung stehen.33
Ein spannendes ‚Nebenkapitel‘ der Unruhen unter Graf August „aus der Geschichte Elsoffs 1731-1734“34 hat Fritz Krämer auf Aktenbasis – gut lesbar für ein breites Publikum – dargestellt; der exzellente Aufsatz, in dem es allerdings nur in vergleichsweise wenigen Abschnitten um ‚Wilddieberei‘ und ‚Fischfrevel‘ geht, wird in diesem Sammelband dokumentiert (→VI): Der ehemalige wittgensteinische Förster Daniel Marburger (angeblich aber auch Förster Christ Fischer), der Hallenberger Richter Honekamp und Feldscherer Stefan Bürger aus Winterberg stehen in Verbindung mit der Wilderei; aus der kurkölnischen – katholischen – Nachbarschaft erhofft man sich Hilfe beim Werk der Falschmünzerei und ebenso bei der Beschaffung einer magischen Frei- bzw. Blutkugel35, die bei einem Anschlag auf den Landesherrn ihr Ziel nicht verfehlen kann. Mehrere Vertreter der Elsoffer Bauern, die doch mit juristischem Beistand gegen bedrückende Abgaben, Verbote von ‚Waldnebennutzungen‘ und Frondienste Widerstand leisten, geraten in langwierige Haft. Wie konnte sich das Anliegen der Bauern so sehr mit der ‚Causa Marburger‘ vermischen? (Ein Vertreter der Untertanen, Dr. Spoenla, mutmaßt gemäß der zu allen Zeiten beliebtesten Verschwörungstheorie, es sei u.a. auch ein Einfluss von Juden unter den hohen Bediensteten des Landesherrn mit im Spiel!) Nebenbei erfahren wir, dass prinzipiell nicht nur Hochverrat, sondern auch Wilderei mit Folterverhör untersucht und noch immer mit dem Tode bestraft werden kann.
Nachfolger des Machtstrategen und Willkürherrschers August, der mitunter über Leichen ging, wurde dessen Sohn Graf Friedrich, Landesherr zwischen 1735 und 1756. Friedrichs feudale Jagdlust findet anschauliche Darstellung in einem neueren Beitrag für die Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins.36 Zu ihm wird in unterschiedlicher Weise folgende Geschichte in einem Aufsatz des Fürsten zu Leiningen37 (→VIII) aus dem Jahr 1813 und viel später in einer ‚Karfreitags-Betrachtung‘ von Pfarrer Johann Georg Hinsberg38 (→XXII) mitgeteilt: Um 1750 habe sich Graf Friedrich während einer Jagd unter einem Baum (Buche, oder Eiche) niedergelassen, in dem sich ein Wilderer versteckt hielt. Nachdem der Wilderer mit seinem Gewehr von oben herab die Suppenterrine des Landesherrn getroffen habe, sei er vom „gräflichen Forstmeister“ (bzw. „Leibjäger Müller“) im Baum entdeckt und zur Abwehr erschossen worden. Fürst Karl zu Leiningen kommentiert den Vorfall aus der Mitte des 18. Jahrhunderts sechs Jahrzehnte später so: „Erst nach vielen Jahren, als alle Anschreiben und Bitten des Grafen, den öffentlichen Wilddiebereyen Einhalt zu thun, bey den Grenz-Behörden und der benachbarten Regierung ohne Wirkung geblieben, und nachdem zwey Revierförster des Grafen meuchelmörderisch erschossen worden waren, griff man in Verbindung mit dem Grafen von Wittgenstein zu strengeren Maaßregeln, und es wurde nun Ruhe.“39 Ob es im Wittgensteinischen Schloßarchiv Laasphe zuverlässige Chroniknachrichten zur legendenhaft klingenden Wilderer-Tötung um 1750, zu den beiden mutmaßlichen Förstermorden und zur Umsetzung „strengerer Maßregeln“ (s.u.) gibt, bleibt zu erkunden.
Keineswegs zimperlich fielen freilich schon die Bestimmungen in Graf Friedrichs 1737 unterzeichneter und 1749 gedruckter „Forst-[,] Jagd- und Fischerey-Ordnung“ aus.40 Die entsprechenden Paragraphen werden vollständig in unserem Band dokumentiert (→VII.3): „Forst- und andere Bedienten und Unterthanen“ sind verpflichtet zur Einfangung der Wilderer, sollen bei eigener Gefährdung „durch deren Niederschiessung, sich vor solcher Gefahr wahren, wie Wir denn demjenigen, welcher dergleichen Wild-Dieb einbringet, zur Ergötzlichkeit 30 Rthlr. aus Unserer Forst-Cassa auszahlen lassen wollen.“ (§ 77) Die Übeltäter werden dann „an Leib und Leben gestraffet“! Bei der Verfolgung von Fischdieben soll man aber möglichst nur mit „leichter Ladung“ und auf die Füße schießen (§ 154).
Als 1796 Graf Johann Ludwig (Regent 1756-1796) starb, folgte ihm als neuer Landesherr sein Sohn Graf Friedrich Karl zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1766-1837; ab 1804 „Fürst“). Dieser übertraf hinsichtlich der Jagdleidenschaft den Vater und beschäftigte „sich eingehend mit den an den Grenzen überhandnehmenden Wilddiebereien. Die Forstleute sollten jeden Verdächtigen totschießen und selbst straffrei ausgehen, auch wenn sie dabei einen Unschuldigen töten sollten. 1806 wurden zur besseren Kontrolle der Waldfrevel wieder nur zwei Holztage in der Woche eingeführt. Wer sich außerhalb dieser Zeit im Walde aufhielt, riskierte, erschossen zu werden.“41 Das von diesem Landesherrn unterhaltene „zehnköpfige ‚Jägerkommando‘ […] zur Bekämpfung der Wilderei […], das sich aber als wirkungslos erwiesen hatte, wurde 1811 von Hessen entlassen.“42
Was nun sollte im Wittgensteiner Land (und anderswo) gelten: frommer Sinn und menschenfreundliche ‚Aufklärung‘ oder Jagdaristokratie und ‚Absolutismus‘? Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts scheinen sich Vertreter des Adels wie Graf Friedrich Karl noch einmal darin zu gefallen, ein rigoroses Vorgehen gegen Wilderer ohne Rücksicht auf Menschenleben zu propagieren. Diese Tendenz zeigt sich auch in dem schon erwähnten, 1813 veröffentlichten Plädoyer des Fürsten Karl zu Leiningen (→VIII), welches über die Familie des Verfassers und die angeführten Beispiele Bezüge zum Wittgensteinischen aufweist.43
Für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ist ebenfalls eine umfangreiche Akte mit Bezügen zum Fürstentum Nassau-Siegen über „Jagdfrevel im gemeinschaftlichen Grund Burbach und Selbach 1748-1804“ im Internet frei abrufbar (Übersicht →IX.1). Transkription und Auswertung dieser Quelle, die bislang offenbar noch nicht vorliegen, könnten uns u.a. auch zu mehr Einblicken in die siegerländische ‚Regionalgeschichte der Wilderei‘ verhelfen.44 – Der Vorstellung von Akte „E 601: A 168“ aus dem Landesarchiv NRW (Abt. Westfalen) gebe ich umfangreiche Auszüge aus einem 1828 gedruckten ‚Handbuch der Forst- und Jagdgesetzgebung‘ bei, in dem die Rechtslage in ‚nassauischen Territorien‘ vermittelt wird (→IX.2). Die Bestimmungen zum Schießbefehl bei der Verfolgung von Wilderern klingen wiederum ganz und gar ‚absolutistisch‘: „Die Jäger sollen die Uebertreter gefänglich einbringen, und wenn sie sich zur Wehre setzen, in so fern es bekannte und verrufene Diebe sind, sie niederschießen. […] Wenn Jagdbediente […] unbekannte Wilddiebe antreffen, welche geschwärzt oder auf eine andere Art maskirt sind und nach dreimaligem Anrufen nicht stehen bleiben, sondern fortlaufen oder sich wohl gar zur Wehre stellen, so dürfen sie auf dieselben scharf Feuer geben und wenn ein solcher Frevler hart verwundet oder wohl gar getödtet worden, soll sich der Entleiber hieran nicht verwirkt haben“45.
Die wittgensteinischen Exkurse, die Karl Féaux de Lacroix gemäß einem Wunsch von Auftraggebern 1913 in seinem Werk zur Jagdgeschichte des Sauerlandes anbietet, enthalten kaum mehr als Fragmente. (In einem Abschnitt zur ‚Hessenzeit‘46 wird übrigens suggeriert, dass in der wittgensteinischen Südgrafschaft hauptsächlich auswärtige Wilderer die Jagdobsessionen des hohen Fürsten gestört haben [→X]). Gerhard Naumann hat indessen 1970 im Rahmen seiner wissenschaftlichen „Forstgeschichte der ehemaligen Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein“47 gründliche Abschnitte auch zur regionalen Jagdgeschichte vorgelegt, die es zu erschließen gilt (→XI).
Nicht sachgerecht erscheint es mir, wenn in manchen Regionalstudien zur 1848er Revolution der Eindruck erweckt wird, das Ringen der Bevölkerung um Weiderechte, Brennholz oder Jagdmöglichkeiten bzw. Abschaffung der adligen Jagdprivilegien sei – gemessen an den hehren Idealen des bürgerlichen Aufbegehrens – etwas ‚Minderwertiges‘ bzw. gar ‚unpolitisch‘.48 Im Wittgensteinischen verbietet sich eine solche Betrachtungsweise vor dem Hintergrund der erstaunlichen „Bauernunruhen 1696-1806“49 eigentlich von selbst. Speziell bei Fragen der Jagd ist zudem stets mit zu bedenken, welche historische Symbolträchtigkeit diesem Feld bezogen auf Herrschaftssicherung (Kontrolle über Territorien), Machtkult und Selbstinszenierung der feudalen Herren-Kaste zukommt. Der Adel beschäftigte sich kaum zufällig seit den Umwälzungen durch die Französische Revolution weiterhin intensiv mit dem von ihm dominierten Waidwerk und blieb in den Jagdszenen stets überaus präsent.
2. AB DEM SPÄTEN NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT
In seiner schon genannten Dissertation merkt Gerhard Naumann über die Folgen der 1848er Revolution im Wittgensteinischen an: „Da die Bewohner des ehemaligen Fürstentums [Südgrafschaft] nunmehr ihr Holz selbst hauen durften und täglich Laubstreu abfahren konnten, überschwemmten sie die Wälder, fuhren das Holz ohne Bezahlung ab, frevelten und jagten unbekümmert. Die Forstbeamten, vor denen die Bevölkerung jeden Respekt verloren hatte, waren gegen das Ausmaß der Frevel machtlos. Die Wilddieberei wurde zur Selbstverständlichkeit, seitdem die Jagd jedem Grundstückseigentümer auf dessen Grund gesetzlich erlaubt worden war. […] Die Folge war eine fast völlige Ausrottung des Wildes.“50 In Spannung zu dieser dramatischen Einschätzung steht der Umstand, dass die für den vorliegenden Sammelband gesichteten Quellen auch für das weitere 19. Jahrhundert nur relativ wenige konkrete Fallbeispiele für Wilderei im heutigen Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein enthalten.
Tödliche Anschläge auf die beiden wittgensteinischen Förster Nickel und Söder (Soeder) in den 1870er Jahren werden – jedoch ohne genaue Angaben, eingehende Darstellung oder Quellenhinweise – in Texten aus der ‚Werkstatt der Heimaterzähler‘ genannt (→XXIII.10; XXV.3).51 Sie sollen sich nicht weit entfernt von dem Ort bei Burgholdinghausen ereignet haben, an dem später im Jahr 1881 Förster Trembour (→XIV.1-3) ermordet aufgefunden worden ist.
Ein mehr als abenteuerlicher, schier unglaublicher Fall aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts (evtl. 1879?) ist mir im November 2019 nur mündlich mitgeteilt worden: In einem bislang unveröffentlichten Manuskript werde vorgetragen, ein namentlich bekannter Vertreter des wittgensteinischen ‚Hochadels‘ in der ehemaligen Südgrafschaft habe als Wilderer (!) einen zufällig vorbeikommenden Tatzeugen erschossen und dies erst auf dem ‚Sterbebett‘ gebeichtet; der Kasus sei zumindest durch einen Forst-Chronisten postum auch schriftlich in Form eines kurzen Eintrags festgehalten worden. (Bereits als mündlicher Überlieferungsstoff ist diese ‚Geschichte‘ eines Freiherrn – unabhängig von der Frage nach einem belegbaren Wirklichkeitsgehalt – von Interesse. Wir können hierzu jedoch im vorliegenden Sammelband keinen Beitrag darbieten.)
Nachhaltig ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist eigentlich nur jener Komplex, der mit dem Namen des 1893 hingerichteten Johannes Wagebach zusammenhängt. Der Kriminalist Otto Busdorf52 hat diesen Fall Ende der 1920er Jahre in seinem populären dreibändigen Werk über Förstermorde berücksichtigt (Textdokumentation: →XII); etwa zeitgleich legte Christian Saßmannshausen53 in einer selbstverlegten Broschüre sein heimatgeschichtliches „Schattenbild“ zu diesem Wilderer-Kapitel vor (→XXIII.3-8). Ein großer Glücksfall ist es, dass Heiko Haumann jetzt in diesem Buch seine Forschungen54 über den berühmten ‚Förstermörder Wagebach‘ in einer stark überarbeiteten und erweiterten Form vorlegt (→XIII). Haumanns Beitrag setzt einen neuen Maßstab für die Darstellung von Wilderer-Kriminalfällen, korrigiert unhaltbare Angaben in älteren Arbeiten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erhellt regionale ‚Vernetzungszusammenhänge‘ und vermittelt den Lesern dieses Bandes auch eine gute Einführung in sozialgeschichtliche Fragestellungen, die bei der Erforschung des illegalen Jagens zu berücksichtigen sind. – Angestrebt ist es, in allen Beiträgen dieses Bandes die richtige Schreibweise55 („Wagebach“, nicht „Wagenbach“) kenntlich zu machen.
Dokumentiert werden in einer nachfolgenden Abteilung (→XIV) noch einige eher ‚zufällige Zeitungsfunde‘ aus den Jahren 1881 und 1891-1894, die nur zum Teil einen Bezug zum ‚Wagebach-Komplex‘ aufweisen (u.a. die Siegener Meldung über einen Schusswechsel am 2.6.1894 zwischen Förster und Wilderer: →XIV.11). Um für das 19. Jahrhundert (und ebenso für die nachfolgenden Jahrzehnte) einen aussagekräftigen Überblick zur Wilderei im Gebiet des heutigen Kreises Siegen-Wittgenstein zu gewinnen, wäre es in einem ersten Schritt unumgänglich, alle Jahrgänge der einschlägigen Regionalpresse56 für diesen Raum auszuwerten! Daran war im Rahmen unseres Publikationsprojekts freilich nicht zu denken. Ergiebig kann auch die Auswertung lokaler ‚Heimatbücher‘ sein (→XXVI).
Zur Jahrhundertwende bleibt das illegale Jagen ein öffentliches Thema. Das Königliche Amtsgericht Berleburg bietet am 24. Oktober 1901 eine Belohnung57 von 100 Mark für Hinweise, die zur Ergreifung von zwei – möglicherweise verwundeten – Gesetzesbrechern führen (→S. →). Zur Silvesternacht 1901 begibt sich der aus dem ‚Wagebach‘-Komplex schon bekannte Heinrich Stenger aus Langenzaun bei Berleburg – mutmaßlich zum Wildern – in den Wald und erhält vom Königlichen Förster Carl Klinkert eine tödliche Schussverletzung (→XVI.2). Aus der Familie des Getöteten gibt es vermutlich – wie bei fast allen ähnlichen Fällen – kein öffentliches Zeugnis. Die Sichtweise des Försters hat jedoch Eingang gefunden in einen längeren Aufsatz58 (→XV).
1908 stirbt der Bergmann Johannes Honig aus Steinbach (‚Spatzenhannes‘), einer der Hauptbelastungszeugen im Verfahren gegen Wagebach (1892), und die ‚Siegener Zeitung‘ verkündet über diesen ehemaligen Wilderer in einem Nachruf59: „Sein Name wird jedenfalls noch viel im Wittgensteinschen genannt werden und in späteren Jahren werden Großmütter ihren erstaunt aufhorchenden Enkeln erzählen von den Taten des Wittgensteiner Wilddiebes ‚Spatzenhannes‘.“ (→S. →) Ist dies der hilflose – ja aberwitzige – Versuch, der ‚Sünderlegende Wagebach‘ nun doch noch eine eher positive ‚Wildschützlegende‘ (mit Reuezeugnis) gegenüberzustellen? Was sollen die Großmütter denn dereinst den Kleinen von Johannes Honig erzählen, da schon der Nachruf so inhaltsarm ausfällt?
Eine Abteilung mit Meldungen u. a. aus dem ‚Wittgensteiner Kreisblatt‘ und dem in Olpe erscheinenden ‚Sauerländischen Volksblatt‘ vermittelt Wilderei-Ereignisse zur Zeit des Ersten Weltkrieges und aus den Nachkriegsjahren60 (→XVII: Q1-Q26), wobei zunächst eine sehr abstoßende, u. a. explizit rassistische Verbindung von Krieg und Jagd ins Auge sticht (→XVII: Q3). Ostern 1919 werden Wilhelm Daus und Friedrich Bergmann aus Dotzlar-Laubroth als Wilderer ergriffen (→XVII: Q11; Q12). Hernach veröffentlicht das ‚Wittgensteiner Kreisblatt‘ eine fast spektakulär zu nennende Solidaritätserklärung mit 47 (!), allerdings nicht einzeln abgedruckten Unterzeichnernamen: „Nach unserer Ansicht ist das Wild von höherer Hand in die Welt gesetzt worden61 […] Auch ist das Wild nicht allein für bessere, wohlhabende Herrn […]. Aus Wohllust haben sicherlich unsere armen zwei namhaft gemachten Kollegen nicht gewildert“ (→XVII: Q13). – In einer lapidar wirkenden Kurzmeldung wird der Tod eines nicht namentlich genannten Mannes aus Girkhausen im Zuge einer ‚Wilddiebsaffäre‘ abgehandelt (→XVII: Q14). Aus der ‚Gegenseite‘ meldet man die schwere Verwundung des Forstgehilfen Emil Dickel im Revier Wundthausen durch wildernde Männer mit geschwärztem Gesicht (→XVII: Q17). Das Referat des Beitrags einer juristischen Zeitschrift zu einer Entscheidung des Reichsgerichts vermittelt 1919 noch, präventive Schüsse der Forstbeamten auf fliehende bewaffnete Wilderer seien rechtens (→XVII: Q18).
Im Inflationsjahr 1923 wird der erst 20jährige ‚Wilderergehilfe‘ Heinrich Kuhn aus Langewiese durch einen Schuss in den Rücken von einem Förster im Dienst des Fürsten zu Sayn-Wittgenstein getötet (→XVII: Q25).62 Im gleichen Jahr kommt ebenfalls ein mutmaßlicher Wilderer am Benfer Rücken ums Leben, vielleicht erschossen durch einen Wilderer-Gefährten. Die Darstellung von Dieter Bald63 hierzu sollte ‚Schule machen‘ bei der Erarbeitung von Ortschroniken, denn nachweisbare Quellen werden belegt, im Wortlaut zitiert und nicht mit bloßen Spekulationen vermischt (→XVIII).
Keine Nachrichten liegen in unserer Sammlung vor für den Zeitraum zwischen Weltwirtschaftskrise und Niederwerfung des deutschen Faschismus.64 Ein konkreter sauerländisch-wittgensteinischer Wilderer-Kasus wird zuletzt berichtet für das Jahr 195965 (→XIX). Für die nachfolgenden Jahrzehnte lesen wir in einem Heimatbuch für das mittlere Edertal: „In der modernen Zeit wird das Wilderer-Unwesen durch den Kraftwagenverkehr und die Öffnung fast aller Wege in Wald und Flur begünstigt. Mit wachsendem Erfolg bemüht sich aber die Jägerschaft und die Polizei, diesem Treiben, welches vorwiegend nicht aus Jagdleidenschaft, sondern aus Geldgier verursacht wird, ein Ende zu setzen.“66
3. „WERKSTATT DER HEIMATERZÄHLER“
Leider war es kaum möglich, für die letzte Abteilung unserer Sammlung auch solche „Geschichten“ aus der Werkstatt der ‚Heimaterzähler‘ heranzuziehen, die so etwas wie eine „Sichtweise von unten“ enthalten. Am ehesten spiegeln noch einige Texte aus der regionalen „Sagenüberlieferung“67 einen antifeudalistischen Standort von ‚Untertanen‘ (→XX). Hingegen führt der vermutlich erstmals 1936 veröffentlichte historische Heimatroman „Bertram der Jäger“68 streckenweise geradezu lustvoll eine blutige Verfolgung von Wilderern der Jahre 1663-1666 im Siegerland vor (→XXI). Die schon oben genannte „Karfreitagsbetrachtung“69 von Johann Georg Hinsberg zum Tod eines wittgensteinischen Wilderers in der Mitte des 18. Jahrhunderts vermittelt die obrigkeitstreue Haltung eines Theologen im späten Kaiserreich und zeugt ansonsten von Ignoranz hinsichtlich der sozialgeschichtlichen Dimension des illegalen Jagens (→XXII).
Die ‚Wagebach-Berichterstattung‘ ließ auch 1892 die Landschaft für Zeitungsleser als ein finsteres Territorium erscheinen. Udo Bürger referiert: „Der Prozess, dessen ‚romantisch-düsterer Hintergrund‘ (Hagener Zeitung) der Hochwald in der Wittgensteiner Gegend bildete, in dem sich ‚von jeher eine aus allen möglichen Elementen zusammengesetzte Wildererbande tummelte‘, gewährte einen Einblick in die Rücksichtslosigkeit und Brutalität ‚des zu allen Schandthaten bereiten‘ Verurteilten. In jener Gegend standen Förster und Wilddiebe beständig ‚auf dem Quivive‘ (waren auf der Hut), und nur zu oft, so die Hagener Zeitung, war es ‚Glücksache, wenn anstatt des Försters der Wilddieb am Boden‘ liegen blieb.“70
Aus der Perspektive von erprobten Wilddieb-Fahndern erzählen O. Troemper71 und Adolf Bahne 1930/1937 ihre ‚Wilderergeschichten‘ mit Bezügen zur Region (→XXIV und XXV). Der militäraffine Adolf Bahne72 betrachtet illegal Jagende als Menschen, die „zur Strecke gebracht“ (!) werden müssen. Aus seinen autobiographischen Niederschriften wissen wir auch, dass er sich bereits als Forstlehrling gerne an „Zigeunerjagden“ beteiligt hat.73 Hier kommen menschenverachtende Traditionen zum Vorschein, die weit in vergangene Jahrhunderte zurückreichen und mit der Niederschlagung des deutschen Faschismus mitnichten aufhörten. Noch zu früher bundesrepublikanischer Zeit liest man in einem ‚forstkriminalistischen Fachbuch‘: „Es läßt sich beweisen, daß gerade der gerissene Forstfrevler zu jeder anderen Straftat, vor allem zu anderen Eigentumsdelikten, bereit ist, wenn sich ihm dazu Gelegenheit bietet. Diese Erscheinung verstärkt sich noch in den Gegenden, in denen sich eine bunte Bevölkerungsmischung [sic!] in ihrer Herkunft bis auf Wannenmacher, Kesselflicker oder gar auf entlassene Sträflinge zurückverfolgen läßt. Diebstähle, Feldfrevel, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzungen, Verstrickungsbruch, Wilderei, Vogelstellerei u. ä. Delikte sind in den Strafregisterauszügen dieses Personenkreises verzeichnet. Es läßt sich als Grundregel sagen, daß der Forstfrevler schon wegen eines möglichen Hanges zu Begehung anderer Straftaten unsere Aufmerksamkeit verdient.“74
Manche Leser werden sich vielleicht fragen, warum auch die umfangreiche, zur Zeit der Weimarer Republik vorgelegte Pionierdarstellung „Licht- und Schattenbilder aus den Wittgensteiner und angrenzenden Forsten“75 von Christian Saßmannshausen der Abteilung ‚Heimaterzähler‘ zugeordnet wird (→XXIII). Der ca. 1882 geborene Verfasser dieser Publikation zur Wilderei wäre – statt fern der Heimat an Maschinen zu arbeiten – gerne selbst Förster des von ihm pathetisch verehrten Wittgensteinischen „Fürsten“ geworden, kennt aus seiner Jugend noch eigene Konflikte mit dem Forst- und Jagdrecht (Laubstreu sammeln, Fischen) und betont, dass er im Zusammenhang mit der prominenten ‚Causa Wagebach‘ nicht die eigenen Kindheitserinnerungen, sondern Siegener Zeitungsberichte zugrunde legt. Die – mutmaßlich in ausführlichen Zitaten eingebauten – „Quellen“ werden jedoch zumeist nicht abgehoben im Textfluß und mit wenigen Ausnahmen auch nicht vermerkt. (Gleiches gilt z.B. bei der Darbietung der Bestallungsurkunde für den Förster Matthäus Kroh aus dem Jahr 1724, die vermutlich dem 1913 erschienenen Werk „Geschichte der hohen Jagd im Sauerlande“ entnommen worden ist.76 Der Autor der ‚Licht- und Schattenbilder‘ kennt offenbar einschlägige Literatur zur regionalen Jagdgeschichte, die ihm Dr. Albert Kleffmann zugänglich gemacht hat; wir wissen jedoch nicht, um welche Werke es sich hierbei handelt.) Zu den berücksichtigten Wilderer-Fällen gehört u.a. die Erschießung des – bei Saßmannshausen nicht namentlich genannten – Oberhundemer Waldarbeiters Anton Dörrenbach im Jahr 1909 durch den Förster Jagemann. In dem wiederum ohne jeglichen Quellennachweis erstellten Abschnitt dazu (→XXIII.11) tauchen nun Behauptungen zu diesem traurigen Geschehen auf, die man sonst in der ‚Literatur‘ nicht findet. Die Sachlage erscheint klar, die manichäische Sichtweise (durchtriebener Wilderer, guter Forstmann) wird wieder einmal bestätigt: Licht und Schatten, säuberlich geschieden. Aus Oberhundemer Chroniknachrichten und der Berichterstattung des ‚Sauerländischen Volksblattes‘ ergibt sich jedoch bei weiterer Recherche heute ein anderes Bild, das zu ergänzenden Archivarbeiten und zu einer mehrschichtigen, insbesondere auch sozialkritischen Darstellung anregen kann.77
Hier und an anderen Stellen führt Saßmannshausen leider eine Arbeitsweise vor, die ich „Werkstatt der Heimaterzähler“ nenne: Nachrichten aus ganz unterschiedlichen Quellensegmenten (z. B. amtliches Dokument, Zeitungsausschnitt, Buchkapitel, eigene Wahrnehmung, Zeitzeugen-Meinungen, mündliche Überlieferungen, Gerüchte, Legendenstoffe, Spekulationen …) werden auf eine Ebene gehoben und zu einem vermeintlich schlüssigen Text verarbeitet, in dem es weder Anführungszeichen (Quellenangaben) noch Fragezeichen gibt. Alles klingt objektiv, widerspruchsfrei, zuverlässig … Doch solche Erzählungen haben für die historische Forschung am Ende nicht sehr viel mehr Wert als Kalendergeschichten, die man als Spiegel von kollektiven Mentalitäten und subjektiven Befindlichkeiten eines Autors heranzieht. Problematisch ist nicht etwa das breite Spektrum der herangezogenen Quellengattungen, sondern die Nivellierung der Quellenunterschiede (und Widersprüche). Es gibt nun allerdings einfache Abhilfe: Jeder ‚Heimaterzähler‘, der seinen Lesern ausdrücklich keine Fiktionen anbieten will, kann heute auch ohne akademische Ausbildung wörtlich zitieren und die Herkunft seiner Quellen dann jeweils vermerken. In einem Seminarangebot für lokale Geschichtswerkstätten wäre ein als Rollenspiel dargestellter Wilderei-Gerichtsprozeß vermutlich besonders gut geeignet, die Bedeutsamkeit der Herausarbeitung unterschiedlicher, geradezu widersprüchlicher Sichtweisen zu einem bestimmten Ereignis zu vermitteln.
In einer exemplarischen Sichtung des 1982 erschienenen „Heimatbuches für Dotzlar, Arfeld, Richstein“ kommen Beiträge zur Wilderei von Erwin Seiffert (Berleburg) und Heinz Becher zum Vorschein, die uns mit sonst unbekannten Fällen des 19. Jahrhunderts – und neuen ‚Überlieferungsformen‘ – vertraut machen78 (→XXVI). Zum guten Schluss wird gegen die hochfürstliche Betrachtungsweise doch noch so etwas wie eine ‚Leute-Perspektive‘ ins Spiel gebracht.
*
Zwei weitere, z.T. nahezu abgeschlossene Dokumentationsbände zu „Waldkonflikten“ in Westfalen sollen noch in der ‚edition leutekirche sauerland‘ erscheinen. Als Bearbeiter der Reihe beabsichtige ich jedoch, danach dieses Forschungsfeld ganz zu verlassen.79 Vielleicht kann das Vorgelegte – durchaus mehr als ein erster Anfang – andere Autorinnen und Autoren dazu verführen, durch Veröffentlichung noch ungedruckter Manuskripte, systematische Erschließung von „Wilderer-Kapiteln“ in Ortschroniken, Dorfzeitungen etc., Übertragung und Edierung der in dieser Einleitung aufgeführten Digitalisate zu handschriftlichen Dokumenten, Archivbesuche in der Nähe, Auswertungen zu allen Zeitungsjahrgängen ab Mitte des 19. Jahrhunderts (oder früher) und neue ‚heimatkundliche Darstellungen‘ das Wissen über diese so bedeutsame sozialgeschichtliche Thematik zu vertiefen (oder gar zu revolutionieren). Falls die Spuren in unserer Sammlung nicht trügen, wäre von einem vernetzten Projekt der siegen-wittgensteinischen Regionalforschung zur Wilderei noch Erstaunliches zu erwarten.
Der hier vorgelegte dokumentarische Band hätte ohne mannigfachen Beistand anderer Menschen, die Großzügigkeit von Autoren und Schriftleitungen, die Zusendung von Texten und weiterführende Hinweise von Forschenden aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein nicht verwirklicht werden können. Bedankt seien insbesondere:
Dieter Bald, Bodo Bischof, Wolf-Dieter Grün, Prof. em. Dr. Heiko Haumann, der Heimat- und Verkehrsverein Diedenshausen e.V., Klaus Homrighausen, Heinrich Imhof, Melina Jabir, Dr. Ulf Lückel, der Verlag J. Neumann-Neudamm, Dr. Ulrich Opfermann, Dr. Bernd D. Plaum (GeschichtsAtelier Siegen), Rikarde Riedesel, Andreas Saßmannshausen, Hans Wied, die Schriftleitung der Jagdzeitschrift „Wild und Hund“ (Verlag Paul Parey) und der Wittgensteiner Heimatverein e.V.
Januar 2020
4. LITERATUR
(mit Kurztiteln)
Kurztitel zu Internetressourcen
sind mit einem Sternchen* gekennzeichnet.
Berücksichtigt sind mit entsprechendem Zusatz z.T. auch
nicht eingesehene Beiträge zur regionalen Jagdgeschichte
LANDESARCHIV NRW* Abteilung Westfalen, E 601 (Fürstentum Siegen: „Freier Grund Sel- und Burbach“), A 168. (124 Digitalisate zu Jagdfrevel, frei abrufbar über https://www.archive.nrw.de)
1 Zit. GENDRICH 2000, S. 174 (Sprache des Zitats hier frei modernisiert, PB). – Die Bibliographie zu den Kurztiteln folgt am Ende dieser Einleitung.
2 Vgl. zu Hermann Klostermann: BÜRGER 2018b. – Bereits in dieser Arbeit wird deutlich, dass der literarisch herausgestellte (bzw. konstruierte) „Held“ auch in diesem Fall sachgerecht nur im Kontext von sozialen Vernetzungen und größeren Wilderer-Szenen betrachtet werden kann. Dies soll demnächst mit einer Dokumentation „Es gab nicht nur den Klostermann“ (edition leutekirche sauerland) auf der Basis u.a. der Archivsammlung von Hans-Dieter Hibbeln noch weitgehender gezeigt werden.
3 Vgl. aber zum mittleren Edertal PÖPPEL 1982, S. 206: „,Wir treffen uns in früher Stunde bei der bewußten Eiche dort …‘, so sangen und singen die jungen Burschen im Bergland noch heute das berühmt-berüchtigte Wilddiebslied. Und wenn einmal bei irgendwelchen Festlichkeiten Forstbeamte in ihren schmucken Uniformen besonders schneidig auftraten, dann schmetterten die übermütigen Burschen in ihrer durch Bier und Schnaps beschwingten Stimmung den Schlußrefrain hinaus: ,O hoher, stolzer Förster, geh’ er in Ruh und Fried’ nach Haus. Vielleicht schmeckt auch der weiße Käse und uns der schönste Rehbockschmaus …‘. Obwohl auf Wilderei seit eh und je harte Strafen ruhten, sieht der Großteil der Bevölkerung auch heute noch das dunkle Treiben der Wildschützen kaum als ein Verbrechen an.“
4 Nicht zuletzt ergibt sich aus der Geschichte die Frage, ob wir es dulden, dass die ehedem auch nach innen geübte Praxis „Töten statt teilen“ im 3. Jahrtausend noch immer im globalen Maßstab – nach außen – zur Anwendung kommt (wozu die nationalen Militärdoktrinen der reichen und hochgerüsteten Länder – nur wenig verschleiert – ermutigen). Eine Zukunftsfähigkeit der Gattung homo sapiens ist mit diesem ‚Programm Krieg‘ ganz sicher nicht vorstellbar.
5 BÜRGER 2018a.
6 Vgl. als sachgerechte Rezension zu Nutzen und Grenzen dieser vor allem auf das kurkölnische Südwestfalen konzentrierten Einführung: PLAUM 2019.
7 Möglicherweise gab es schon einmal einen Anlauf für ein entsprechendes Projekt. Andreas Saßmannshausen (Hilchenbach) hat mir im Dezember 2019 mitgeteilt, der inzwischen verstorbene Karl Zoll habe vor Jahren auf einer Jahreshauptversammlung des Wittgensteiner Heimatvereins erwähnt, dass er für ein Buch über Wilderer in Wittgenstein recherchiert. Ein jetzt von ihm befragter Sohn Karl Zolls konnte im Nachlass des Vaters jedoch keine entsprechenden Unterlagen finden. – Im Archiv von A. Saßmannshausen befinden sich übrigens noch nicht ausgewertete Digitalisate zu Forstakten mit mutmaßlichen Wilderei-Bezügen.
8 Auf der Basis unterschiedlichster Quellengattungen liegt z.B. für den Solling (Mittelgebirge des Weserberglandes, Niedersachsen) eine Gesamtschau zur Wilderei in mehreren Jahrhunderten vor: CREYDT 2010. Die dort im Anhang aufgeführte ‚Opferbilanz‘ (S. 233-234) weist aus für Anschläge von Wilderern auf Förster / Amtspersonen: 13 Tote, 6 Verletzte (1779-1909); für den Schusswaffengebrauch von Förstern / Amtspersonen gegen Wilderer: 48 Tote, 11 Verletzte (1669-1946). Vermutet wird zudem eine sehr hohe ‚Dunkelziffer‘.
9 KLEIN 1935, S. 31-32. Das gräfliche Waldbesitz-Monopol wird hier nicht kritisch bewertet; stattdessen fasst Klein direkt im Anschluss an diese Passage äußerst wohlklingend die Nebennutzungsrechte der ‚Untertanen‘ zusammen: „Die einzelnen Gemeinden haben weitgehende Nutzungsrechte an den landesherrlichen Forsten. Aus ihnen holen die Bewohner Streu für ihr Vieh. Da es bei dem geringen Umfang der Feldgemarkungen an dem nötigen Weideland fehlt, treiben sie ihre Rinder- und Schafherden hinein. Weiterhin stehen ihnen in den gräflichen Waldungen noch ausgedehnte Berechtigungen zum Bezuge von Brenn- und Bauholz zu.“ – Nicht eingesehen: WREDE 1927 (Abriss zur Territorialgeschichte). – Vgl. KRÄMER 1965, S. 307-311; sowie TROßBACH 1985*, S. 29: „Weit über die Hälfte des Bodens in der Grafschaft war […] mit Wald bedeckt, den das Grafenhaus eigentümlich besaß, Gemeindewald ist im Gegensatz zu hessischen Nachbargebieten nicht festzustellen. Die geringe Ausstattung der Dörfer mit Land und der hohe Stellenwert der Viehzucht in der bäuerlichen Wirtschaft wies den bäuerlichen Nutzungsrechten im herrschaftlichen Wald erhöhte Bedeutung zu.“
10 Vgl. SCHERER 1996; VORMBERG 1996; VORMBERG 2000; WIEMERS 1928; diese Texte demnächst auch im Sammelband „Heimliche Jagd“ für das Olper Kreisgebiet.
11 Vgl. RÖSENER 2004, S. 215-232 (dieses Buch sei als Überblick zur Jagdgeschichte nachdrücklich empfohlen); HELDT 2009, S. 40, 222-228, 307, 359, 376-378, 399, 404.
12 WIED 1964b.
13 NAUMANN 1970, Anhang 4.
14 HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN DIEDENSHAUSEN 1997 (noch ohne Aktenbasis); HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN DIEDENSHAUSEN 2010.
15 WINCKEL 1842*, S. 29.
16 WINCKEL 1842*, S. 86; WIED 1964a; REIMANN 2019 (vgl. auf S. 700 im Register das Stichwort „Jagd“). Am 19. Oktober 1728 kommt bei einer Treibjagd aufgrund eines Waffenunfalls ein Mädchen ums Leben – die Technologie der Flinte des Försters von Wingeshausen war offenbar der Zeit entsprechend noch sehr unsicher; Casimir fasst den Vorsatz, nie wieder an solchen ‚Klepper-Jagden‘ teilzunehmen und stattdessen seine Zeit ‚nützlicher anzuwenden‘ (REIMANN 2019, S. 157, 517).
17 Zit. REIMANN 2019, S. 404.
18 Tagebucheintrag Casimirs; zit. REIMANN 2019, S. 516.
19





























