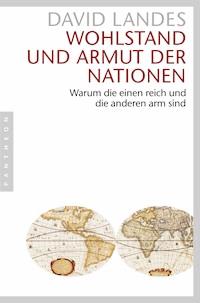
SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk zur Wirtschaftsgeschichte
Kaum eine Frage ist umstrittener und stärker mit Ideologie befrachtet als die, warum manche Länder wirtschaftlich äußerst erfolgreich sind, während andere unfähig scheinen, aus ihrer Armut herauszufinden. Liegt es am Klima? An der Kultur? An der Politik? In seiner umfassenden Geschichte über die Weltwirtschaft der letzten sechshundert Jahre entwickelt David Landes Antworten auf diese Fragen und bietet zugleich ein Standardwerk zur Geschichte der Weltwirtschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1415
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,8 (20 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Vorwort
Einleitung
Kapitel 1 - Die Ungleichheiten der Natur
Kapitel 2 - Antworten auf die Geographie: Europa und China
Copyright
Für meine Kinder und Enkel, in Liebe
… the causes of the wealth and poverty of nations - the grand object of all enquiries in Political Economy.
Malthus an Ricardo in einem Brief vom 26. Januar 18171
Vorwort und Dank
Mit diesem Buch lege ich eine Weltgeschichte vor. Allerdings nicht in der multikulturellen, anthropologischen Bedeutung prinzipieller Gleichbehandlung, nach dem Motto: Alle Völker sind gleich, und der Historiker versucht, ihnen allen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Vielmehr war meine Absicht, den Hauptstrom ökonomischer Fortschritte und Neuerungen zu verfolgen und zu verstehen: Wie sind wir dahin gekommen, wo wir uns befinden, und zu dem geworden, was wir sind - und zwar unter dem Gesichtspunkt der Produktion, der Distribution, der Konsumtion. Diese Fragestellung gestattet eine stärkere Zentrierung und begrenzt entsprechend die Darstellung. Dennoch bleibt die Aufgabe gewaltig, und so langwierig die Vorarbeiten auch waren, auf die das Buch zurückblickt, kann es doch nicht mehr als eine erste Annäherung sein. Eine solche Aufgabe läßt sich unmöglich in Angriff nehmen ohne die Beiträge und Ratschläge anderer - das heißt, ohne die Mitwirkung von Kollegen, Freunden, Studenten, Journalisten, historischen Zeugen, toten und lebenden.
Bekennen muß ich mich zuerst zu meiner Dankesschuld gegenüber Studenten und Kollegen aus Seminaren an der Columbia University, der University of California in Berkeley, der Harvard University sowie an anderen akademischen Orten, an denen ich mich weniger lange aufhielt. Viel gelernt habe ich vor allem durch die Arbeit und die Lehrtätigkeit im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Grundstudienprogramme und des Basislehrplans in Harvard. In beiden Einrichtungen kommen die Lehrenden in Kontakt mit Studenten und Assistenten aus dem ganzen Fächerspektrum und aus anderen Fakultäten und müssen sich der Herausforderung durch aufgeweckte, streitbare, unabhängige Menschen stellen, die sich von Unterschieden in Alter, Rang und Erfahrung nicht einschüchtern lassen.
Zweitens erhielt, hauptsächlich dank des anteilnehmenden Verständnisses von Dr. Alberta Arthurs, das vorliegende Werk schon früh Unterstützung von seiten der Rockefeller Foundation, die Geldmittel für Forschungen und für die Niederschrift zur Verfügung stellte und die zwecks Anregung und intellektuellem Austausch eine Reihe von Wissenschaftlern in der stiftungseigenen schönen Villa Serbelloni im italienischen Bellagio an den Ufern des Comer Sees zusammenführte - dort, wo Plinius der Jüngere einst Schönheit, Arbeit und Müßiggang miteinander versöhnt hatte. Das Treffen mündete in die Veröffentlichung von Favorites and Fortunes (hrsg. von Patrice Higonnet, Henry Rosovsky und mir selbst) und gab mir Gelegenheit, einen ersten Essay über neuere mathematisch-statistisch fundierte wirtschaftsgeschichtliche Forschungen zum Thema europäisches Wachstum zu schreiben. Zu den Personen, die mir damals und bei anderer Gelegenheit halfen, zählen die beiden Mitherausgeber, Higonnet und Rosovsky, außerdem Robert Fogel, Paul David, Rudolf Braun, Wolfram Fischer, Paul Bairoch, Joel Mokyr, Robert Allen, François Crouzet, William Lazonick, Jonathan Hughes, François Jequier, Peter Temin, Jeff Williamson, Walt Rostow, Al Chandler, Anne Krueger, Irma Adelman und Claudia Goldin.
Die Rockefeller Foundation unterstützte auch zwei thematisch bestimmte Kongresse - im Jahre 1988 einen über Lateinamerika und im darauffolgenden Jahr einen über die Rolle der Geschlechter im Wirtschaftsleben und in der ökonomischen Entwicklung. Von den Beitragenden zu diesen anregenden Gesprächen, die regelrechte Blitzschulungen waren, nenne ich David Rock, Jack Womack, John Coatsworth, David Felix, Steve Haber, Wilson Suzigan, Juan Dominguez, Werner Baer, Claudia Goldin, Alberta Arthurs und Judith Vichniac.
Dank schulde ich auch Armand Clesse und dem Luxemburg-Institut für Europäische und Internationale Studien. Herr Clesse spielt mittlerweile eine Schlüsselrolle beim Bemühen, Wissenschaftler und Intellektuelle zur Diskussion und Analyse zeitgenössischer politischer, sozialer und ökonomischer Probleme anzuregen. Sein Hauptthema ist die »Lebenskraft von Nationen«, womit im weitesten Sinne praktisch alles gemeint ist, was Nationen leistungsfähig macht. Das Ergebnis dieser Bemühungen war eine Reihe von Kongressen, die ihren Niederschlag nicht nur in Sammelbänden gefunden haben, sondern auch in einem wachsenden und in seinem Wert unschätzbaren Netz von persönlichen Kontakten zwischen Wissenschaftlern und Spezialisten. Ein von Herrn Clesse veranstalteter Kongreß ist eine wundervolle Mischung aus Diskussion und Geselligkeit - eine normalerweise freundschaftliche Übung in der Kunst, übereinzustimmen und unterschiedlicher Meinung zu ein. Im Jahre 1996 organisierte Herr Clesse genau solch ein Treffen, das der Auseinandersetzung mit dem noch unfertigen Manuskript des vorliegenden Buches diente. Zu den Anwesenden zählten William McNeill, Universalhistoriker und hinsichtlich seines enzyklopädischen Wissens würdiger Nachfolger des früheren Byzantinisten Arnold Toynbee, Stanley Engerman, der als Auswerter und Rezensent wirtschaftshistorischer Literatur im Amerika eine Sonderstellung einnimmt, Walt Rostow, vielleicht der einzige Gelehrte, der nach seiner Beschäftigung in der Staatsverwaltung zu echter akademischer Tätigkeit zurückgefunden hat, Rondo Cameron, der Einzelkämpfer gegen Idee und Begriff einer Industriellen Revolution, Paul Bairoch und Angus Maddison, die Sammler und kalkulatorischen Bearbeiter des Zahlenmaterials zu Wachstum und Produktivität.
Ein ähnliches Treffen, dessen Thema die »Einzigartigkeit der europäischen Zivilisation« war, wurde im Juni 1996 in Israel unter der Schirmherrschaft der Yad-Ha-Nadiv Rothschild Foundation (Koordinator Guy Stroumsa) abgehalten und führte einige Personen der genannten Gruppe mit einem weiteren Team zusammen, dem Mittelalterforscher und andere angehörten, darunter Patricia Crone, Ron Bartlett, Emanuel Sivan, Esther Cohen, Yaacov Metzer, Miriam Eliav-Feldon, Richard Landes, Gadi Algazi.
Weitere Gelegenheiten, Teile des vorliegenden Materials zur Diskussion zu stellen, boten mir Tagungen in Ferrara und Mailand (Bocconi-Universität) im Jahre 1991, der III. Curso de Historia de la Técnica in der Universität Salamanca im Jahre 1992 (organisiert von Julio Sánchez Gómez und Guillermo Mira), ein Convegno der Società Italiana degli Storici dell’Economia (Sekretärin Vera Zamagni) zum Thema »Innovazione e Sviluppo« im Jahre 1993, mehrere Sitzungen des Wirtschaftshistorischen Workshops in Harvard, die »Jornadas Bancarias« der Asociación de Bancos de la República Argentina zum Thema »La Estrategias del Desarrollo«, die 1993 in Buenos Aires stattfanden, ein Kongreß im englischen Hull 1993 (Gesellschaft für Wirtschaftsgeschichte, Tawney Lecture), eine Tagung an der Universität Cambridge über »Technischer Wandel und ökonomisches Wachstum« (organisiert von Emma Rothschild) im Jahre 1993, das Colloquium von Jacques Marseille und Maurice Lévy-Leboyer (Institut d’Histoire économique, Paris, 1993) über »Les performances des entreprises françaises au XXe siècle«, eine Konferenz zum Thema »Konvergenz oder Niedergang in der britischen und amerikanischen Wirtschaftsgeschichte« an der Notre Dame University im Jahre 1994 (organisiert von Edward Lorenz und Philip Mirowski, gefördert von Donald McCloskey), eine Sitzung zum Thema Industrielle Revolution (organisiert von John Komlos) auf dem Elften Internationalen Wirtschaftshistorischen Kongreß in Mailand im Jahre 1994 und eine Sitzung der Sozialwissenschaftsgeschichtlichen Vereinigung 1994 in Atlanta.
Außerdem Vorträge an den Universitäten von Oslo und Bergen im Jahre 1995 (organisiert von Kristine Bruland und Fritz Hodne), ein Symposion 1995 in Paris zum Werk von Alain Peyrefitte (»Valeurs, Comportements, Développement, Modernité«, organisiert von Raymond Boudon), das sich unter anderem mit regionalen Unterschieden in der ökonomischen Entwicklung Europas beschäftigte, dazu Symposien im Jahre 1995 über »Reichtum und Armut von Nationen«, die in Reggio Emilia und an der Bocconi-Universität in Mailand (organisiert von Franco Amatori) stattfanden.
Desgleichen im Jahre 1996 eine Tagung an der Universität Oslo über »Technische Revolutionen in Europa, 1760-1860« unter der Leitung von Kristine Bruland und Maxine Berg und ebenfalls 1996 eine Tagung an der Fondazione Eni Enrico Mattei in Mailand über »Technik, Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft« (organisiert von Michele Salvati und Domenico Siniscalco). Und im Jahre 1997 ein Planungstreffen in Madrid für den bevorstehenden Zwölften Internationalen Wirtschaftsgeschichtlichen Kongreß zum Thema »Ökonomische Folgen der Kolonialreiche 1492-1989« (organisiert von Leandro Prados de la Escosura und Patrick K. O’Brien).
Unnötig zu bemerken, daß sich jede dieser Begegnungen auf Punkte konzentrierte, die für die Beteiligten von besonderem Interesse waren, und daß ich daraus Gewinn sowohl für mein Gesamtthema als auch für seine besonderen Aspekte zog.
Angesichts der Vielzahl von Treffen, zu denen noch eine große Menge persönlicher Unterhaltungen und Beratungen hinzukommt, ist es nicht leicht, eine vollständige Liste der Personen zu erstellen, die mir bei diesen und anderen Gelegenheiten behilflich waren. Zuerst meine Lehrer, die mir durch das, was sie mir beibrachten, und durch ihr Vorbild unvergeßlich sind: A. P. Usher, M. M. Postan, Donald C. McKay, Arthur H. Cole. Desgleichen meine Kollegen in den wirtschafts- und geschichtswissenschaftlichen Abteilungen der Columbia University (vor allem Carter Goodrich, Fritz Stern, Albert Hart und George Stigler), der University of California in Berkeley (vor allem Kenneth Stampp, Hans Rosenberg, Richard Herr, Carlo Cipolla, Henry Rosovsky und Albert Fishlow) und von Harvard (Simon Kuznets, C. Crane Brinton, Alexander Gerschenkron, Richard Pipes, David und Aida Donald, Benjamin Schwartz, Harvey Leibenstein, Robert Fogel, Zvi Griliches, Dale Jorgensen, Amartya Sen, Ray Vernon, Robert Barro, Jeff Sachs, Jess Williamson, Claudia Goldin, Daniel Bell, Nathan Glazer, Talcott Parsons, Brad DeLong, Patrice Higonnet, Martin Peretz, Judith Vichniac, Stephen Marglin, Winnie Rothenberg).
Und vergessen seien auch nicht die außerordentlichen Anregungen, die ich 1987/88 empfing, als ich ein Jahr am Zentrum für Wissenschaftliche Forschung in den Verhaltenswissenschaften in Palo Alto verbrachte. Ich war der Nutznießer einer erlesenen Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern: Kenneth Arrow, Milton Friedman, George Stigler, Robert Solow (vier spätere Nobelpreisträger!). Konnte man mit einem Referat vor ihnen bestehen, brauchte man kein Publikum mehr zu fürchten.
Und zu den oben erwähnten Kollegen kommen andere im In- und Ausland hinzu. In den USA: William Parker, Roberto Lopez, Charles Kindleberger, Liah Greenfield, Bernard Lewis, Leila Fawaz, Alfred Chandler, Peter Temin, Mancur Olson, William Lazonick, Richard Sylla, Ivan Berend, D. N. McCloskey, Robert Brenner, Patricia See, Margaret Jacob, William H. McNeill, Andrew Kamarck, Tibor Scitovsky, Bob Summers, Morton und Phyllis Keller, John Kautsky, Richard Landes, Tosun Aricanli. In Großbritannien: M. M. Postan, Lance Beales, Hrothgar John Habakkuk, Peter Mathias, Barry Supple, Berrick Saul, Charles Feinstein, Maxine Berg, Patrick K. O’Brien, P. C. Barker, Partha Dasguppa, Emma Rothschild, Andrew Shonfield. In Frankreich: François Crouzet, Maurice Lévy-Leboyer, Claude Fohlen, Bertrand Gille, Emmanuel Leroy-Ladurie, François Furet, Jacques LeGoff, Joseph Goy, Rémy Leveau, François Caron, Albert Broder, Pierre Nora, Pierre Chaunu, Rémy Prudhomme, Riva Kastoryano, Jean-Pierre Dormois. In Deutschland: Wolfram Fischer, Hans Ulrich Wehler, Jürgen Kocka, John Komlos. In der Schweiz: Paul Bairoch, Rudolf Braun, J.-F. Bergier, Jean Batou, François Jecquier. In Italien: Franco Amatori, Aldo de Madalena, Ester Fano, Roby Davico, Vera Zamagni, Stefano Fenoaltea, Carlo Poni, Gianni Toniolo, Peter Hertner. In Japan: Akira Hayami, Akio Ishizaka, Heita Kawakatsu, Isao Suto, Eisuke Daito. In Israel: Shmuel Eisenstadt, Don Patinkin, Yehoshua Arieli, Eytan Shishinsky, Jacob Metzer, Nahum Gross, Elise Brezis. Und anderswo: Herman van der Wee, Francis Sejersted, Erik Reinert, H. Floris Cohen, Dharma Kumar, Gabriel Tortella, Leandro Prados de la Escosura, Kristof Glamann. Ihnen allen und anderen schulde ich Dank für Anregungen, Kritik, Informationen, Einsichten. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber so soll es ja auch sein.
Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Lektor, Edwin Barber, der den Text nicht nur kritisch durchging und verbesserte, sondern mir auch etliches übers Schreiben beibrachte. Man lernt nie aus.
Schließlich möchte ich meiner Frau Sonia danken, die mit Engelsgeduld Jahre voll mit Bücherstößen, Sonderdrucken, Referaten, Briefen und sonstigem Schrott ertragen hat. Selbst mehrere Arbeitszimmer reichten nicht aus; nur der Computer hat mich gerettet. Und jetzt wird aufgeräumt.
Einleitung
»Keine neue Erhellung hat die Frage erfahren, warum arme Länder arm sind und reiche Länder reich.«
Paul Samuelson, 19761
Im Juni des Jahres 1836 fuhr Nathan Rothschild von London nach Frankfurt, um an der Hochzeit seines Sohnes Lionel mit seiner Nichte (Lionels Kusine Charlotte) teilzunehmen und mit seinen Brüdern über den Eintritt seiner Kinder in das Familienunternehmen zu reden. Nathan war vermutlich der reichste Mann der Welt, jedenfalls was flüssige Mittel anging. Unnötig anzumerken, daß er sich alles leisten konnte, wonach ihm der Sinn stand.
Der damals neunundfünfzigjährige Nathan war im allgemeinen bei guter Gesundheit - wenn auch ein bißchen beleibt -, ein Energiebündel von unermüdlichem Arbeitseifer und unbezähmbarem Temperament. Als er London verließ, litt er indes an einer Entzündung am unteren Rücken, nahe dem Ende der Wirbelsäule. (Ein deutscher Arzt diagnostizierte ein Furunkel, aber es könnte sich auch um einen Abszeß gehandelt haben.)2 Trotz medizinischer Behandlung eiterte das Geschwür und wurde schmerzhaft, was Nathan jedoch nicht hinderte, von seinem Krankenbett aufzustehen und an der Hochzeit teilzunehmen. Wäre er im Bett geblieben, hätte man die Hochzeit im Hotel gefeiert. Auch seinen Geschäften widmete er sich weiterhin, wobei er seiner Frau diktierte. Mittlerweile hatte man den großen Dr. Travers von London herbeizitiert, und als dieser das Problem nicht lösen konnte, zog man einen führenden deutschen Chirurgen hinzu, vermutlich um die Wunde zu öffnen und zu säubern. Nichts half; das Gift breitete sich aus, und am 28. Juli 1836 starb Nathan. Es wird erzählt, daß die Taubenpost der Rothschilds die Nachricht nach London brachte: Il est mort.
Nathan Rothschild starb wahrscheinlich an einer durch Staphylokokken oder Streptokokken verursachten Sepsis - früher sprach man von Blutvergiftung. Mangels näherer Informationen können wir nicht sagen, ob das Furunkel (Abszeß) ihn umbrachte oder eine sekundäre Infektion durch die Skalpelle der Chirurgen. Die Keimtheorie gab es damals noch nicht und dementsprechend auch keine Vorstellung davon, wie wichtig Sauberkeit ist. Antibakterielle Mittel waren ebenfalls unbekannt, ganz zu schweigen von Antibiotika. Und so starb der Mann, der sich alles kaufen konnte, an einer Allerweltsinfektion, die sich heutzutage ohne Mühe heilen läßt, sofern man sich nicht scheut, einen Arzt, ein Krankenhaus oder auch nur eine Apotheke aufzusuchen.
Die Medizin hat seit den Zeiten von Nathan Rothschild enorme Fortschritte gemacht. Aber eine bessere, wirksamere medizinische Versorgung - die Behandlung von Krankheiten und die Heilung von Verletzungen - erklärt die Veränderungen nur zum Teil. In einem beträchtlichen Maße hat die höhere Lebenserwartung unserer Tage in einer verstärkten Vorbeugung ihren Grund und verdankt sich eher unserem reinlicheren Leben als der verbesserten Medizin. Sauberes Wasser und rasche Abfallbeseitigung, außerdem Fortschritte in der persönlichen Hygiene - darauf kommt es entscheidend an. Lange Zeit waren Magen-Darm-Infektionen der große Todbringer; die Keime gelangten von Abfällen auf die Hände und von dort über Nahrungsmittel in den Verdauungstrakt. Und dieser unsichtbare, aber tödliche Feind, der stets gegenwärtig war, wurde von Zeit zu Zeit noch unterstützt durch epidemisch auftretende Mikroben wie den Vibrio-Bazillus der Cholera. Die beste Gelegenheit zur Übertragung bot der gemeinsame Abort, wo der Kontakt mit Unrat dadurch begünstigt wurde, daß es kein Toilettenpapier und keine waschbare Unterkleidung gab. Wer in ungewaschenem Wollzeug lebt - und Wollzeug wäscht sich nicht gut -, leidet an Juckreiz und kratzt sich. Die Hände waren also verschmutzt, und das große Versäumnis bestand darin, daß man sie vor dem Essen nicht wusch. Aus diesem Grund lagen die Krankheits- und Todesraten bei religiösen Gruppen wie den Juden oder den Muslimen, die Waschungen vorschrieben, niedriger. Dies gereichte ihnen allerdings nicht immer zum Vorteil, da die Menschen sich leicht einreden ließen, daß die Juden weniger zahlreich starben, weil sie die Brunnen der Christen vergifteten.
Die Lösung für das Problem lieferten nicht veränderte Glaubensvorstellungen oder religiöse Lehren, sondern der industrielle Fortschritt. Das Hauptprodukt der neuen technischen Entwicklung, die wir als Industrielle Revolution bezeichnen, war billige, leicht waschbare Baumwolle - und zusammen mit ihr Seife, die in Massenproduktion aus pflanzlichen Ölen hergestellt wurde. Zum ersten Mal konnten sich die einfachen Leute Unterkleidung leisten, Leibwäsche, wie man damals sagte, weil dies der waschbare Textilstoff war, den die Wohlhabenden direkt auf der Haut trugen. Jedermann (und jede Frau) konnte sich mit Seife waschen und sogar baden, auch wenn man sich durch zu häufiges Baden dem Verdacht aussetzte, schmutzig zu sein. Ein sauberer Mensch hatte es schließlich nicht nötig, sich so oft zu waschen! Aber das nur nebenbei. Die Hygiene des einzelnen wandelte sich nachdrücklich, so daß im ausgehenden neunzehnten und im beginnenden zwanzigsten Jahrhundert gewöhnliche Menschen oft reinlicher lebten als ein Jahrhundert früher Könige und Königinnen.
Das dritte Element, das beim Rückgang von Krankheit und frühem Tod eine Rolle spielte, war eine bessere Ernährung. Die war in großem Maße einer reichlicheren Versorgung mit Lebensmitteln zu verdanken und mehr noch verbesserten, beschleunigten Transportmöglichkeiten. Hungersnöte, oft das Ergebnis lokaler Engpässe, wurden seltener; die Nahrung gewann an Vielfalt und wurde reicher an tierischen Proteinen. Die Veränderungen schlugen sich unter anderem in einem größeren und robusteren Körperbau nieder. Da sie jedoch in erster Linie eine Frage der Gewohnheit und des Geschmacks wie auch des Einkommens waren, vollzogen sie sich weit langsamer als die genannten medizinischen und hygienischen Neuerungen, die sich von Staats wegen durchsetzen ließen. Noch im Ersten Weltkrieg staunten die Türken, die gegen das britische Expeditionskorps bei Gallipoli kämpften, über den Größenunterschied zwischen den mit Steaks und Lammfleisch großgezogenen Soldaten aus Neuseeland und Australien und den verkümmerten Jugendlichen aus britischen Industriestädten. Und wer sich Gruppen anschaut, die aus armen Ländern in reiche eingewandert sind, wird feststellen, daß die Kinder größer und besser gewachsen sind als ihre Eltern.
Dank dieser Fortschritte hat sich die Lebenserwartung drastisch erhöht, während die Kluft zwischen Arm und Reich schmaler geworden ist. Die Haupttodesursachen bei Erwachsenen sind nicht mehr Infektionen, und hier besonders Infektionen des Magen-Darm-Trakts, sondern die Verfallserscheinungen hohen Alters. In den reichen Industrienationen mit ihrer medizinischen Versorgung für jedermann sind die Fortschritte am größten, aber selbst einige ärmere Länder haben eindrucksvolle Erfolge vorzuweisen.
Die Entwicklungen in Medizin und Hygiene stehen für ein umfassenderes Phänomen - für den Gewinn, den es bringt, wenn Wissen und wissenschaftliche Einsichten Anwendung in der Technik finden. Daraus schöpfen wir Hoffnung, was die Bewältigung der Probleme betrifft, die unsere Gegenwart und Zukunft überschatten. Wir fühlen uns dadurch sogar zu Phantasien von einem ewigen Leben oder, besser noch, von ewiger Jugend ermutigt.
Diese Phantasien sind allerdings, soweit sie wissenschaftlich fundiert sind, das heißt, eine wirkliche Basis haben, die Träume der Reichen und vom Glück Begünstigten. An den Fortschritten im Wissenserwerb haben nicht alle gleichmäßig teil, nicht einmal innerhalb der reichen Nationen. Wir leben in einer Welt der Ungleichheit und der Unterschiede. Grob gesagt, zerfällt unsere Welt in drei Gruppen von Nationen: In der ersten Gruppe geben die Menschen viel Geld aus, um nicht zuzunehmen, in der zweiten haben sie genug zum Leben, und in der dritten wissen sie nicht, wo sie ihre nächste Mahlzeit hernehmen sollen. Mit diesen unterschiedlichen Situationen gehen schroffe Diskrepanzen in den Sterbeziffern und in der Lebenserwartung einher. Die Menschen in den reichen Ländern sorgen sich darum, daß sie ein möglichst hohes Alter erreichen und werden auch immer älter. Sie trainieren, um fit zu bleiben, kontrollieren und bekämpfen das Cholesterin, vertreiben sich die Zeit mit Fernsehen, Telefonieren und Spielen, trösten sich mit Euphemismen wie »die goldenen Jahre« oder »die zweite Jugend«. »Jung sein« ist gut, »alt sein« etwas Minderwertiges und Problematisches. Die Menschen in den armen Ländern kämpfen währenddessen darum, am Leben zu bleiben. Sie müssen sich um Cholesterin und verfettete Arterien keine Sorgen machen, teils wegen ihrer schmalen Kost, teils weil sie früh sterben. Ihr Alter, falls ihnen eines beschieden sein sollte, suchen sie durch zahlreiche Kinder zu sichern, die ein angemessenes Gespür für Verpflichtung gegenüber den Eltern anerzogen bekommen.
Die alte Aufteilung der Welt in zwei Machtblöcke, Ost und West, hat sich erledigt. Heute bildet die Kluft im Hinblick auf Reichtum und Gesundheit, die arme und reiche Nationen trennt, die große Herausforderung und Bedrohung. Das wird oft als Gegensatz zwischen Nord und Süd gefaßt, weil sich die Aufteilung geographisch darstellt; passender wäre aber, von einem Gegensatz zwischen dem Westen und der restlichen Welt zu sprechen, weil die Aufteilung auch eine historische Dimension hat. Hier liegt die, für sich genommen, größte Schwierigkeit und Gefahr, mit der sich die Welt des dritten Jahrtausends konfrontiert sieht. Die einzige andere Sorge, die an dieses Problem heranreicht, ist die Umweltzerstörung, und beide hängen eng miteinander zusammen, sind in der Tat eins. Die Verschwendung von Ressourcen und die Naturzerstörung, die mit der steigenden Produktion und den wachsenden Einkommen enorm zugenommen haben - sie sind es, die den Raum bedrohen, in dem wir leben und uns bewegen.
Wie groß ist die Kluft zwischen Arm und Reich, und wie entwickelt sie sich? Ganz grob und in aller Kürze: Der Unterschied zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen in der reichsten Industrienation, sagen wir der Schweiz, und der ärmsten nicht-industrialisierten Nation, Mosambik, beläuft sich auf ungefähr 400 zu 1. Vor zweihundertfünfzig Jahren betrug das Verhältnis zwischen reichsten und ärmsten Nationen vielleicht 5 zu 1, und der Unterschied zwischen Europa und beispielsweise Ost- oder Südasien (China oder Indien) lag bei etwa 1,5 oder 2 zu 1.3
Wächst die Kluft auch gegenwärtig noch? Hinsichtlich der Extreme ist das eindeutig der Fall. Einige Länder machen nicht nur keine Fortschritte, sondern werden ärmer, relativ und manchmal sogar absolut gesehen. Wieder andere halten mit Müh und Not ihre Position. Andere holen auf. Unsere Aufgabe (die Aufgabe der reichen Nationen) ist es, den armen Ländern dabei zu helfen, gesünder und wohlhabender zu werden - im eigenen Interesse nicht weniger als in ihrem. Tun wir das nicht, werden sie sich nehmen, was sie nicht selbst erzeugen können; und wenn sie keine Verdienstmöglichkeiten durch den Export von Waren haben, werden sie Menschen exportieren. Kurz gesagt, Reichtum übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, während Armut hochgradig ansteckend ist: Sie läßt sich nicht isolieren, weshalb auf lange Sicht unsere Ruhe und unser Wohlstand davon abhängen, daß es den anderen gutgeht.
Wie werden die anderen das erreichen? Wie helfen wir ihnen? Dieses Buch wird sich bemühen, zu einer Antwort beizutragen. Ich betone »beizutragen«. Niemand verfügt über eine simple Antwort, und alle Patentrezepte haben den Charakter von Heilsbotschaften.
Ich schlage vor, die Probleme historisch anzugehen. Ich tue das, weil ich nach Ausbildung und Veranlagung Historiker bin und weil man bei schwierigen Fragen dieser Art am besten so vorgeht, wie man es am besten kann und versteht. Ich tue es aber auch, weil man sich von dem Problem am ehesten einen Begriff machen kann, wenn man fragt: Wie und warum sind wir an den Punkt gelangt, an dem wir stehen? Auf welche Weise wurden die reichen Länder so reich? Warum sind die armen Länder so arm? Warum übernahm Europa (»der Westen«) in der sich wandelnden Welt eine führende Rolle?
Ein historischer Ansatz garantiert noch keine Antwort. Andere haben ebenfalls über diese Dinge nachgedacht und verschiedenartige Erklärungen gefunden. Die meisten davon lassen sich zwei Richtungen zuordnen. Manche sehen im Reichtum und in der Vorherrschaft des Westens einen Triumph der Tüchtigkeit. Die Europäer, so meinen sie, waren klüger, besser organisiert, arbeitsamer; die anderen waren unwissend, überheblich, faul, rückständig, abergläubisch. Andere kehren die kategorialen Zuordnungen um: Die Europäer seien aggressiv, rücksichtslos, gierig, skrupellos, verlogen gewesen; ihre Opfer dagegen lebensfroh, unschuldig, schwach - geborene Opfer, die entsprechend gründlich von ihrem Schicksal ereilt wurden. Wir werden sehen, daß diese einander diametral entgegengesetzten Vorstellungen zwar Elemente von Wahrheit enthalten, aber auch ideologischen Hirngespinsten entspringen. Die Dinge sind immer komplizierter, als uns das lieb ist.
Einer dritten Richtung zufolge ist es schlicht falsch, den Westen in einen Gegensatz zur restlichen Welt zu bringen. Im Gesamtstrom der Weltgeschichte sei Europa ein Nachzügler, der auf der Woge der früheren Errungenschaften anderer schwimme. Diese Sicht ist augenscheinlich unrichtig. Wie die historischen Quellen beweisen, war Europa (der Westen) während der letzten tausend Jahre die treibende Kraft der Entwicklung und Modernisierung.
Bleibt noch das moralische Problem. Etliche meinen, der Eurozentrismus sei schlecht nicht nur für uns, sondern für die Welt insgesamt; man müsse sich deshalb vor ihm hüten. Sollen sie doch! Was mich betrifft, so ziehe ich die Wahrheit dem Rechtdenken vor. Auf diesem Boden fühle ich mich sicherer.
1
Die Ungleichheiten der Natur
Die Geographie hat heutzutage nichts zu lachen. Als Schüler in der Grundschule mußte ich Landkarten lesen und durchpausen, ja sogar welche aus dem Gedächtnis zeichnen. Wir erfuhren von fremdländischen Orten, Völkern und Sitten - und das lange Zeit bevor das Wort »multikulturell« erfunden war. Gleichzeitig gediehen auf höherer, akademischer Ebene Schulen, die Wirtschaftsgeographie und Kulturgeographie betrieben. In Frankreich wäre es niemandem in den Sinn gekommen, eine regionalgeschichtliche Studie anzufertigen, ohne zuerst die materiellen Bedingungen des individuellen und gesellschaftlichen Lebens darzulegen.1 Und in den USA untersuchten Ellsworth Huntington und seine Schüler die Einflüsse der Geographie, und besonders des Klimas, auf die menschliche Entwicklung.
Trotz vieler nützlicher und aufschlußreicher Forschungen aber brachte Huntington die Geographie in Verruf.2 Er ging zu weit. Er war so beeindruckt vom Zusammenhang zwischen natürlicher Umgebung und menschlicher Aktivität, daß er immer mehr auf die Geographie zurückführte, wobei er mit materiellen Einflüssen begann und zu kulturellen überging. Zuletzt brachte er die Zivilisationen in eine Rangordnung und schrieb die besten - oder was er für die besten hielt - günstigen klimatischen Bedingungen zu. Huntington lehrte an der Universität Yale und gelangte nicht von ungefähr zu der Ansicht, der Standort der Universität, New Haven in Connecticut, verfüge über das förderlichste Klima in der ganzen Welt. Der Glückspilz. Die übrige Welt schloß sich in absteigender Linie an, wobei die Gebiete mit farbigen Bevölkerungen weiter hinten kamen oder das Schlußlicht bildeten.
Aber mit solchen Thesen stand Huntington einfach nur in der Tradition der philosophischen Geographie. Die Philosophen verknüpften gern Milieu und Gemütsart miteinander (man denke an die althergebrachte Gegenüberstellung von kalten und warmen Klimaten mit den dazugehörigen Temperamenten nüchterner Nachdenklichkeit und überschäumender Lustsuche), während die noch in den Kinderschuhen steckende Disziplin der Anthropologie im neunzehnten Jahrhundert zu zeigen beanspruchte, welche Auswirkungen die Geographie auf die Verteilung von Vorzügen und geistigen Fähigkeiten hatte, wobei beides unfehlbar in der Gruppe des Autors am reichlichsten vertreten war.3 Heute wird der Spieß gelegentlich umgedreht, wenn afroamerikanische Mythologen das heitere, schöpferische »Sonnenvolk« dem frostigen, unmenschlichen »Eisvolk« gegenüberstellen.
Diese Art von Selbstbeweihräucherung mittels Analyse mag in einer geistigen Welt akzeptabel erschienen sein, in der man Verhalten und Charakter gern in Begriffen rassischer Zugehörigkeit bestimmte; aber sie verlor ihre Glaubwürdigkeit und Annehmbarkeit in dem Maße, in dem die Menschen anfingen, auf übelmeinende Vergleiche zwischen den Gruppen empfindlich und ablehnend zu reagieren. Und die Geographie befand sich auf der Verliererseite. Als Harvard nach dem Zweiten Weltkrieg das Geographische Institut kurzerhand abschaffte, erhob kaum jemand die Stimme zum Protest - außer der kleinen Gruppe der Entlassenen.4 Eine Reihe führender Universitäten - Michigan, Northwestern, Chicago, Columbia - folgte dem Beispiel, und auch jetzt gab es keinen ernsthaften Widerstand.
Diese Institutsauflösungen sind in der Geschichte des höheren Bildungswesens der USA ein einmaliger Vorgang und spiegeln ohne Frage die intellektuellen Schwächen des Faches, seinen Mangel an theoretischer Grundlage, seine Hansdampf-in-allen-Gassen-Mentalität (beschönigend gesagt, seine katholische Offenheit), die spezielle »Leichtfertigkeit« der Anthropogeographie. Aber hinter diesen Kritikpunkten versteckte sich Unzufriedenheit mit einigen der Befunde. Die Geographie war durch eine rassistische Färbung verunziert, und niemand wollte sich an ihr schmutzig machen.
Wenn jedoch mit »Rassismus« eine wie auch immer beschaffene Bindung individuellen Handelns und Verhaltens an die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, insbesondere einer biologisch definierten Gruppe, gemeint ist, dann gibt es keine Thematik oder Disziplin, die weniger rassistisch wäre als die Geographie. Hier haben wir ein Fach, das sich in seiner Beschränkung auf Einflüsse des natürlichen Milieus für nichts weniger interessiert als für gruppenbedingte Eigenschaften. Für die Lufttemperatur oder die Menge und den Zeitpunkt von Niederschlägen oder die Beschaffenheit des Landes ist niemand verantwortlich zu machen.
Trotzdem umgibt die Geographie der Schwefelgeruch des Häretischen. Warum? Andere wissenschaftliche Disziplinen haben ebenfalls Unsinn verzapft oder sich zu etwas verstiegen, und doch wurde keine andere so sehr herabgesetzt und so geringschätzig behandelt - und sei es auch nur durch die Mißachtung, mit der man sie strafte. Meinem Gefühl nach ist es das Wesen der Geographie selbst, das sie zu Recht oder zu Unrecht in Verruf bringt. Sie verkündet eine unliebsame Wahrheit, daß nämlich die Natur ebenso wie das Leben ungerecht ist und ihre Wohltaten ungleich verteilt und daß sich außerdem diese Ungerechtigkeit der Natur nur schwer wiedergutmachen läßt. Eine Zivilisation wie die unsere mit ihrem ausgeprägten Hang, alles meistern zu wollen, läßt sich nicht gern einen Strich durch die Rechnung machen. Sie schätzt keine Entmutigungen, und mit denen warten geographische vergleichende Betrachtungen reichlich auf.5
Kurz: Die Geographie überbringt schlechte Kunde, und jedermann weiß, was mit Boten geschieht, die das tun. Um es mit den Worten eines Vertreters des Faches zu sagen: »Anders als in anderen historischen Disziplinen... wird hier der Forscher unter Umständen für die Ergebnisse verantwortlich gemacht, ganz ähnlich wie dem Meteorologen die Schuld daran gegeben wird, wenn man an den Strand will und die Sonne sich nicht blicken läßt.«6
Aber Verleugnung hilft uns nicht weiter. Auf einer Weltkarte, die das Produkt oder das Einkommen pro Kopf der jeweiligen Bevölkerung zeigt, liegen die reichen Länder in den gemäßigten Zonen, insbesondere auf der nördlichen Erdhälfte; die armen Länder liegen in den Tropen und Subtropen. Kenneth Galbraith beschrieb in seiner Zeit als Agrarökonom den Sachverhalt mit folgenden Worten: »[Wenn] man entlang dem Äquator einen dreitausend Kilometer breiten Streifen rund um die Erde absteckt, stellt man fest, daß sich kein einziges entwickeltes Land darauf befindet.... Überall ist der Lebensstandard niedrig und die Lebensspanne kurz.«7 Und Paul Streeten, der beiläufig auch auf den instinktiven Widerstand der Menschen gegen unangenehme Wahrheiten hinweist, erklärt:
»Vielleicht am auffälligsten ist, daß die meisten unterentwickelten Länder in den tropischen und subtropischen Zonen liegen, zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem des Steinbocks. Neuere Autoren setzen sich über diesen Umstand allzu leichtfertig hinweg und betrachten ihn als weitgehend zufällig. Das zeigt, wie tief bei uns der Hang sitzt, optimistisch an die Probleme heranzugehen, und wie schwer wir uns damit tun, zur Kenntnis zu nehmen, wie sehr sich die Ausgangsbedingungen der heutigen armen Länder von denen unterscheiden, mit denen sich die fortgeschritteneren Länder in der Zeit vor ihrer Industrialisierung konfrontiert sahen.«8
Sicher, die Geographie ist nur einer der Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Manche Forscher geben der Technik und den reichen Ländern, von denen sie entwickelt wurde, die Schuld: Ihnen wird vorgeworfen, Verfahren entwickelt zu haben, die auf gemäßigte Zonen abgestellt seien, so daß potentiell fruchtbarer tropischer Boden brachliegen bleibe. Andere werfen den Kolonialmächten vor, sie hätten in die äquatorialen Gesellschaften störend eingegriffen, so daß diese die Herrschaft über ihre natürliche Umwelt verloren hätten. So wird geltend gemacht, der Sklavenhandel habe durch Entvölkerung großer Gebiete deren Rückverwandlung in Wildnis ermöglicht, was wiederum der Tsetsefliege und der Ausbreitung von Trypanosomiasis (Schlafkrankheit) Vorschub geleistet habe. Die meisten Autoren ziehen es vor, sich zu dem Thema gar nicht erst zu äußern.
So leicht darf man es sich nicht machen. Der Historiker darf die Vergangenheit nicht ausradieren oder umschreiben, um sie angenehmer zu machen; und der Ökonom mit seiner bequemen Annahme, daß jedes Land dazu bestimmt sei, sich früher oder später zu entwickeln, muß bereit sein, genau hinzusehen, wenn das nicht eintritt.9 Man mag heute, in einer Zeit der Tropenmedizin und der Hochtechnologie, noch soviel von einer Abschwächung geographischer Beeinträchtigungen reden, verschwunden sind diese Beschränkungen nach wie vor nicht, und früher fielen sie eindeutig stärker ins Gewicht. Die Welt war nie eine planierte Spielwiese, und alles hat seinen Preis.
Wir beginnen mit den einfachen, unmittelbaren Auswirkungen des natürlichen Milieus und gehen weiter zu den komplexeren, stärker vermittelten Zusammenhängen.
Zuerst zum Klima. Die Welt weist eine breite Palette von Temperaturen und Temperaturmustern auf, je nach Standort, Höhenlage und Neigungswinkel der Sonneneinstrahlung. Die Unterschiede wirken sich unmittelbar auf den Aktivitätsrhythmus sämtlicher Arten aus: In kalten, nördlichen Wintern rollen sich einige Tiere einfach zusammen und halten Winterschlaf; in heißen, schattenlosen Wüsten suchen Eidechsen und Schlangen kühle Plätze unter Felsen oder sogar unter der Erdoberfläche. (Das ist der Grund, warum Schlangen einen so großen Teil der Wüstenfauna stellen; Reptilien sind Kriechtiere.) Der Mensch geht den Extremen normalerweise aus dem Weg. Die Menschen ziehen durch die Wüste, lassen sich aber nicht dort nieder; daher Namen wie Rub’al-Chali (»Leeres Viertel«) in der Arabischen Wüste. Nur Gier - die Entdeckung von Gold oder Erdöl - oder das Pflichtbewußtsein wissenschaftlichen Forschens kann die vernünftige Abneigung gegen so harte Lebensbedingungen überwinden und rechtfertigen, daß man sich ihnen unterwirft.
Aufs Ganze gesehen, übertrifft die Beschwerlichkeit der Hitze die der Kälte.10 Wir alle kennen die Fabel von der Sonne und dem Wind. Gegen die Kälte schützt man sich, indem man Kleider anzieht, ein Obdach baut oder findet und Feuer macht. Diese Techniken reichen Zehntausende von Jahren zurück und sind der Grund dafür, daß sich die Menschheit von ihrer ursprünglichen Heimat Afrika schon früh in kältere Landstriche ausbreiten konnte. Hitze ist ein anderes Kapitel. Dreiviertel der Energie, die durch Muskeltätigkeit freigesetzt wird, nimmt die Form von Wärme an; wie jeder maschinelle Apparat oder Motor muß auch der Körper diese Wärme abstrahlen oder wegschaffen, um eine angemessene Temperatur aufrechtzuerhalten. Leider besitzt das menschliche Tier für diesen Zweck nur wenige Vorrichtungen. Die wichtigste ist das Schwitzen, besonders wenn es durch eine rasche Verdunstung unterstützt wird. Feuchte, schwüle Landstriche verringern den Abkühleffekt des Schwitzens - es sei denn, man hat einen Diener oder Sklaven, der einem Luft zufächelt und die Verflüchtigung der Ausdünstung beschleunigt. Sich selbst Luft zuzufächeln mag zwar psychologisch hilfreich sein, aber der eigentliche Kühleffekt wird dabei durch die Wärme zunichte gemacht, die durch die eigene motorische Aktivität entsteht. Das ist ein Naturgesetz: Nichts geschieht umsonst; in der Wissenschaft nennt man dies das Gesetz der Erhaltung von Energie und Masse.
Der einfachste Weg, dieses Problem der Energieverschwendung zu lösen, besteht darin, keine Wärme zu erzeugen, mit anderen Worten, sich ruhig zu verhalten und nicht zu arbeiten. Daraus erklären sich solche sozialen Anpassungen wie die Siesta, die den Sinn hat, die Menschen in der Mittagshitze von Aktivität abzuhalten. Als Indien noch unter britischer Kolonialherrschaft stand, pflegte man dort zu sagen, nur tollwütige Hunde und Engländer liefen in der Mittagssonne herum. Die Einheimischen waren schlauer.
Sklaverei dient dazu, andere Menschen die schwere Arbeit machen zu lassen. Es ist kein Zufall, daß in der Vergangenheit Sklavenarbeit mit tropischen und subtropischen Klimaten verknüpft war.11 Dasselbe gilt für die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern: Besonders in warmen Landstrichen leisten die Frauen schwere Feldarbeit und kümmern sich um den Haushalt, während die Männer sich auf den Krieg und die Jagd spezialisieren - beziehungsweise in der modernen Gesellschaft auf Kaffee, Kartenspiel und Motorfahrzeuge. Ziel ist, die Arbeit und Fron auf diejenigen abzuwälzen, die sich nicht wehren können.
Als Lösung für das Hitzeproblem hat sich die Klimatisierung erwiesen. Sie kam allerdings sehr spät in Gebrauch - eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl man sie in den USA zuvor schon aus Kinos, den Praxisräumen von Ärzten und Zahnärzten und den Büros wichtiger Leute wie etwa der Mitarbeiter im Pentagon kannte. In Amerika ermöglichte die Klimaanlage den ökonomischen Aufschwung des Neuen Süden. Ohne sie wären Großstädte wie Atlanta, Houston und New Orleans auch heute noch verschlafene Landstädte.
Aber die Klimatisierung ist eine kostspielige Technik und für die meisten der Armen in der Welt unerschwinglich. Hinzu kommt, daß sie die Hitze einfach nur von den Glücklicheren auf die weniger Glücklichen umverteilt. Sie benötigt und verbraucht Energie, die sowohl bei ihrer Erzeugung als auch bei ihrer Verwendung Wärme produziert (nichts geschieht umsonst) und dadurch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der nicht gekühlten Umgebung erhöht - wie jeder weiß, der schon einmal an dem Entlüftungsschacht einer Klimaanlage vorbeigegangen ist. Und natürlich gab es sie den größten Teil der Geschichte hindurch auch gar nicht. Die Produktivität der Arbeit in tropischen Ländern war entsprechend gering.12
Soviel zu den unmittelbaren Auswirkungen. Hitze, zumal wenn sie das ganze Jahr über anhält, hat noch schwerwiegendere Konsequenzen: Sie begünstigt die Ausbreitung von Lebensformen, die für den Menschen schädlich sind. Mit steigender Temperatur nehmen die Insektenschwärme zu, und die Parasiten, die sie mit sich führen, reifen und vermehren sich in kürzerer Zeit. Das hat zur Folge, daß Krankheiten sich schneller ausbreiten und die Immunität gegen Abwehrmaßnahmen sich rascher entwickelt. Das Vermehrungstempo ist das kritische Maß für die Gefahr von Seuchen: Eine Wachstumsquote von 1 bedeutet, daß die Krankheit stabil ist - ein neuer Krankheitsfall an Stelle eines alten. Bei ansteckenden Krankheiten wie Mumps und Diphtherie liegt die höchste Wachstumsquote etwa bei 8. Für die Malaria beträgt sie 90. Durch Insekten übertragene Seuchen in warmen Klimaten können verheerend sein.13 Der Winter ist demnach, was immer die Dichter über ihn sagen mögen, der große Freund der Menschheit: ein stiller weißer Killer, der Insekten und Parasiten vernichtet und mit Seuchen aufräumt.
Außer in höher gelegenen Regionen kennen die tropischen Länder keinen Frost; die Durchschnittstemperatur im kältesten Monat bleibt über 18 Grad Celsius. Infolgedessen wimmelt es dort von biologischen Aktivitäten, die vielfach zerstörerische Auswirkungen auf den Menschen haben. Das südlich der Sahara gelegene Afrika bedroht alle, die dort leben oder dorthin gehen. Durch das Auftauchen neuer Nationen, die Armeen aufstellen und die Rekruten untersuchen lassen, fangen wir gerade an, das Ausmaß des gesundheitlichen Problems zu ermessen. Wir wissen zum Beispiel, daß viele Menschen nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe von Parasiten beherbergen und deshalb zu krank zum Arbeiten und in einem fortlaufenden Verfallsprozeß begriffen sind.
Ein oder zwei Beispiele mögen die grausige Situation veranschaulichen.
In den warmen Gewässern Asiens und Afrikas, egal ob Kanäle oder Tümpel oder Bäche, lebt eine Schnecke, die einem Wurm (Schistosoma) als Wirtstier dient, der zur Fortpflanzung Tausende von winzigen geschwänzten Larven (Cercariae) ins Wasser ausschüttet, die sich dann einen Säugetierwirt suchen und durch Bißwunden oder Kratzer oder andere verletzte Hautstellen in dessen Körper eintreten. Sobald sie es sich in einer Vene bequem gemacht haben, wachsen die Larven zu kleinen Würmern heran und paaren sich. Die Weibchen legen Tausende von stachligen Eiern - die Stacheln sollen das Wirtstier daran hindern, sich der Eier zu entledigen. Diese wandern nun in die Leber oder die Eingeweide, wobei sie unterwegs Gewebe zerreißen. Die Auswirkungen auf die Organe kann man sich vorstellen: Es kommt zu Zerstörungen der Leber, zu Darmblutungen, zu karzinogenen Verletzungen, zu Beeinträchtigungen der Verdauung und Ausscheidung. Das Opfer wird von Schüttelfrost und Fieber befallen, leidet an allen möglichen Schmerzen, kann nicht mehr arbeiten und ist anfällig für andere Krankheiten und Parasiten, so daß es oft schwerfällt zu sagen, was am Ende den Tod verursacht.
Wir kennen diese Geißel der Menschheit unter dem Namen Schneckenfieber, Leberegelkrankheit oder, in medizinischer Fachsprache, als Schistosomiasis beziehungsweise als Bilharziose, nach Theodor Bilharz, der 1852 als erster die Verbindung zwischen Wurm und Krankheit herstellte. Im tropischen Afrika ist sie besonders weit verbreitet, aber auch in den übrigen Gebieten des Kontinents findet sie sich außerdem in den subtropischen Regionen Asiens und in Südamerika, wo sie in einer verwandten Form auftritt. Ein spezielles Problem ist sie überall da, wo Menschen im Wasser arbeiten - beim Anbau von Sumpfreis zum Beispiel.14
In den letzten Jahrzehnten hat die Medizin eine Reihe von partiellen Heilmitteln entwickelt, wenngleich durch die Zerstörungskraft dieser Wurmmittel das Heilverfahren fast ebenso schlimm ist wie die Krankheit. Das gleiche gilt für die chemische Bekämpfung der Wirtsschnecke: Das Mittel tötet nicht nur die Schnecken, sondern auch die Fische. Die Gewinne eines Jahres werden durch die Verluste im nächsten zunichte gemacht: Die Bilharziose ist nach wie vor unbezwungen. In der Vergangenheit war sie sogar noch verheerender.
Bekannter ist die Trypanosomiasis - eine Gruppe von Krankheiten, zu denen die Tierkrankheit Nagana, die Schlafkrankheit und in Südamerika die Chagas-Krankheit zählen. Die Quelle dieser Krankheiten sind Trypanosomen, parasitische Protozoen, die zu den Geißeltierchen gehören und ihren Namen ihrer bohrerförmigen Gestalt verdanken. Das Trypanosoma brucei ist außerdem »ein raffiniertes Biest mit einer einzigartigen Fähigkeit, seine Antigene zu verändern«15. Wir kennen mittlerweile Hunderte davon; möglicherweise gibt es Tausende. Mal entdeckt man es, mal wieder nicht. Das Immunsystem des Körpers ist machtlos, weil es das Trypanosoma nicht findet. Die einzige Hoffnung auf Abwehr des Erregers besteht demnach in Medikamenten - die sich noch im Versuchsstadium befinden - und in der Bekämpfung der Überträger.
Im Falle der afrikanischen Trypanosomiasis ist der Überträger die Tsetsefliege, ein gemeines kleines Insekt, das vertrocknet und stirbt, wenn es nicht immer wieder Säugetierblut bekommt. Selbst heute, da wir über wirkungsvolle Gegenmittel verfügen, sind in weiten Gebieten des tropischen Afrika diese Insekten so zahlreich, daß Vieh dort nicht existieren kann und die Lebensbedingungen für Menschen schädlich sind. Früher, vor dem Aufkommen der Tropenmedizin und der Pharmazie, hatte diese Seuche schwerwiegende Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftsleben: Tierzucht und Transport mit Tieren waren unmöglich; nur Güter von hohem Wert und geringem Umfang ließen sich bewegen, und dann auch nur von menschlichen Trägern. Unnötig zu bemerken, daß niemand freiwillig zu dieser Arbeit bereit war. Die Lösung fand man in der Sklaverei, einer gewohnheitsbildenden Pestilenz eigener Art, die einen Großteil des Kontinents unablässigen Raubzügen und Gefährdungen unterwarf. All diese Faktoren wirkten abschreckend auf den Handel und den Verkehr zwischen den Stämmen und ließen städtisches Leben, das abhängig ist von Lebensmittelzufuhren von außerhalb, praktisch nicht aufkommen. Das wiederum hatte die Verlangsamung jener Austauschprozesse zur Folge, die den kulturellen und technischen Fortschritt vorantreiben.16
Tabelle 1.1. Reichweite und Umfang tropischer Krankheiten, 1990
Quelle: Weltgesundheitsorganisation (WHO), Sonderprogramm für Forschung und Schulung im Bereich tropischer Erkrankungen, 1990, zit. in: Omar Sattaur, »WHO to Speed Up Work on Drugs for Tropical Diseases«, S. 17.
Sicher, die Medizin hat bei der Bekämpfung dieser Leiden große Fortschritte gemacht. Ihre Bemühungen reichen fast bis zum Beginn des europäischen Vordringens in diese Gegenden zurück. Körperlich unangepaßt an die besonderen Härten und Gefahren warmer Klimazonen, brachten die Europäer Ärzte mit. Natürlich stifteten in jenen frühen Tagen ahnungslose, wenn auch von guten Absichten beseelte Ärzte unter Umständen mehr Schaden als Nutzen; dennoch brachten die Behandlungen den Menschen letztlich Linderung. Erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts legte die Keimtheorie den Grund für eine gezielte Forschung und für wirksame Vorbeugungs- und Behandlungsmaßnahmen. Davor war man auf empirisch gestützte Vermutungen und Eingebungen angewiesen. Das bedeutete glücklicherweise nicht, daß man aufs Geratewohl handelte. Das Gewicht, das auf empirische Beobachtung gelegt wurde, und das Realitätsprinzip - nach dem Motto »solange du siehst, was ich sehe, kannst du dem, was du siehst, vertrauen!« - machten sich bezahlt, auch wenn es am Verständnis der Phänomene fehlte.
Nehmen wir den weltweit größten Killer: die Malaria. Vor der Entdeckung der bakteriellen Krankheitserreger schrieben die Ärzte »Fieberanfälle« sumpfigen Ausdünstungen zu - was zwar, kausal gesehen, falsch, aber doch mit Blick auf die empirischen Zusammenhänge kein unsinniger Schluß war. Die Franzosen in Algerien, die über ihre krankheitsbedingten Verluste entsetzt waren, nahmen daraufhin eine systematische Trockenlegung von Sumpfgebieten in Angriff, um die schlechte Luft (mal-aria) loszuwerden. Ob diese Unternehmungen die Luft sauberer werden ließen, bleibe dahingestellt; aber sie vertrieben jedenfalls die Stechmücken. Im Zeitraum zwischen 1846-1848 und 1862-1866 sank die Zahl der durch Malaria verursachten Todesfälle im Militär um 61 Prozent, während die Krankheitsrate zwischen den dreißiger und den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts sogar noch stärker zurückging.17 Maßnahmen dieser Art brachten außerdem segensreiche Nebeneffekte mit sich. Für die Zivilbevölkerung verfügen wir über keine Zahlen, aber auch für sie muß sich die gesundheitliche Situation verbessert haben, und zwar gleichermaßen für Einheimische wie für französische Kolonisten. Über die Politik und Vorgehensweise der Franzosen in Algerien mag man sagen, was man will: Sie ermöglichten jedenfalls Millionen von Algeriern ein längeres und gesünderes Leben. (Ein algerischer Nationalist würde darauf vielleicht antworten, daß die Trockenlegung auch die Landflächen vergrößerte, auf denen sich die französischen Kolonisten ansiedeln konnten.)
Das Beispiel Algerien verdeutlicht, welchen Vorteil Verbesserungen des natürlichen Milieus haben: Die Leute vor dem Krankwerden zu bewahren ist besser, als sie erkranken zu lassen und dann zu heilen. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts haben Medizin und öffentliche Hygiene die Lebenserwartung enorm gesteigert - die Zahlen für in den Tropen lebende und arme Bevölkerungen haben sich denen aus den bekömmlicheren, reicheren Klimazonen angenähert. So konnte etwa im Jahre 1992 ein Säugling, der in einer einkommensschwachen Volkswirtschaft zur Welt kam (klammert man China und Indien aus, trifft das auf über eine Milliarde Menschen zu), mit einer Lebenszeit von sechsundfünfzig Jahren rechnen, wohingegen Menschen in den reichen Ländern (828 Millionen) durchschnittlich siebenundsiebzig Jahre vor sich hatten. Diese Differenz (37,5 Prozent längere Lebenserwartung), die nicht klein ist, aber kleiner als früher, wird in dem Maße weiter abnehmen, in dem arme Länder reicher werden und die Langlebigkeit in den reichen Gesellschaften an biologische Grenzen und die Schranken der mit Überflußmilieus verknüpften Erkrankungen stößt.18 Zu den entscheidendsten Verbesserungen kam es in der Säuglingspflege (Kleinkinder unter einem Jahr): In den ärmsten Ländern sank die Sterblichkeit von 146 pro 1000 Lebendgeburten im Jahre 1965 (114 in China und Indien) auf 91 im Jahre 1992 (79 in Indien, 31 in China). Dennoch bleibt der Unterschied zu den reichen Ländern bestehen: Deren ohnehin niedrige Raten bei der Säuglingssterblichkeit sanken im gleichen Zeitraum sogar noch schneller, von 25 auf 7.19 Viel niedriger geht es nicht mehr.
All das ist kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Die heutige Medizin kann Säuglinge retten und Menschen länger am Leben erhalten, aber das bedeutet nicht unbedingt, daß sie gesund sind. Tatsächlich bilden Sterblichkeits- und Krankheitsrate, statistisch gesehen, einen Gegensatz. Tote Menschen zählen nicht als Kranke, wie der wissenschaftliche Vertreter der Tabakindustrie zu verstehen gab, als er unverfroren geltend machte, die Schätzungen der hohen gesundheitlichen Kosten des Rauchens müßten nach Maßgabe der geringeren Lebenserwartung der Raucher reduziert werden. Umgekehrt in den Tropen: Antibiotika, Immunisierungen und Schutzimpfungen retten zwar Menschen, aber häufig nur auf Kosten lebenslanger Kränklichkeit. Schon die bloße Tatsache, daß es eine Spezialdisziplin namens Tropenmedizin gibt, macht das Problem deutlich. Soviel diese Disziplin auch erreicht hat, die forschenden Wissenschaftler haben ebenso wie die Opfer unter den Einheimischen und den Imperialisten aller Couleur einen hohen Preis dafür zahlen müssen.20
Die Vorbeugung ist heutzutage kostspielig, und die Behandlung umfaßt häufig derart ausgedehnte Therapiemaßnahmen, daß die Gesundheitseinrichtungen sie nicht bereitstellen können und die Patienten Schwierigkeiten haben, sie in die Tat umzusetzen. Nach den Zahlen von 1990 lebten die meisten Menschen mit tropischen Krankheiten in Ländern, in denen das durchschnittliche Jahreseinkommen bei 400 Dollar lag. Die Regierungen dieser Länder brachten weniger als 4 Dollar pro Kopf für die Gesundheitspflege auf. Kein Wunder also, daß sich die Arzneimittelfirmen, nach deren Angaben die Entwicklung und Vermarktung eines Medikaments oder Impfstoffes ungefähr 100 Millionen Dollar kosten, mit der Versorgung dieser Art von Kunden schwertun.21 Selbst in den reichen Ländern übersteigen die Kosten für Medikamente unter Umständen die finanziellen Mittel der Patienten und die Zahlungswilligkeit der Krankenkassen. Die neuesten Behandlungsmethoden gegen AIDS zum Beispiel kosten ein Leben lang 10 000 bis 15 000 Dollar pro Jahr - für Opfer in der Dritten Welt ein unvorstellbares Vermögen. 22
Schließlich können Gewohnheiten und Einrichtungen Krankheiten begünstigen und medizinische Lösungen hintertreiben. Krankheiten sind fast unfehlbar durch menschliche Verhaltensweisen geprägt, und die Heilmethoden schließen nicht nur Medikamentierungen, sondern auch Veränderungen im Verhalten ein. Hier liegt der Hase im Pfeffer: Sich eine Spritze geben zu lassen ist leichter, als seine Lebensweise zu ändern. Schauen wir uns AIDS in Afrika an. Anders als sonstwo sucht die Krankheit Frauen nicht weniger als Männer heim und entspringt in überwiegendem Maße dem heterosexuellen Verkehr. Die Epidemiologen suchen noch nach Erklärungen für diesen Sachverhalt, aber unter anderem wurden als Ursachen in Betracht gezogen: eine bei den Männern verbreitete und von ihnen erwartete Promiskuität, die Praxis des Analverkehrs zur Verhinderung von Schwangerschaften und die nach wie vor praktizierte Beschneidung von Frauen (Klitorektomie), die sexuelle Lust und Begierde unterbinden soll. Keiner dieser Übertragungswege ist ein eigentlich medizinisches Problem, so daß die Ärzte hier keine andere Möglichkeit haben, als die Leiden der Opfer zu lindern und den vollen Ausbruch der Krankheit hinauszuschieben. Angesichts der Armut dieser Gesellschaften ist das herzlich wenig.
Von den materiellen Beschränkungen abgesehen, findet sich die heutige Medizin auch mit ideologischen und religiösen Hemmnissen konfrontiert - überall zwar, aber in stärkerem Maße in den ärmeren, technisch rückständigen Gesellschaften. Überlieferten Geheimmitteln und Zaubersprüchen gibt man unter Umständen den Vorzug vor den ausländischen, gottlosen Heilmethoden. Wissenschaftsgläubige Menschen aus dem Westen tun solche Praktiken als Ausdruck von Aberglauben und Unwissenheit ab. Dennoch wird mit ihnen möglicherweise eine psychosomatische Linderung der Leiden erreicht, und die Heiltränke erzielen trotz aller chemischen Unreinheit und geringen Konzentration manchmal eine Wirkung. Das ist der Grund, warum Wissenschaftler und Arzneimittelfirmen heute Geld für die Erforschung der Heilkräfte exotischer Arzneistoffe ausgeben.
Diese gelegentlichen Erfolge der traditionellen Heilkunst haben im Verein mit antikolonialistischen Stimmungen und der gefühlsbedingten Anhänglichkeit an die einheimische Kultur (ganz zu schweigen vom Interesse der etablierten Heilkundigen an einer Wahrung ihres Besitzstandes) bei Politikern und Ethnologen Kritik an der Tropenmedizin (beziehungsweise der modernen Medizin überhaupt) laut werden lassen und eine, wie vorsichtige auch immer, Parteinahme für »alternative« Praktiken in Mode gebracht.23 Im Hinblick auf Afrika macht die in diesem Zusammenhang entstandene Literatur geltend, daß die Tropenmedizin in ihrer Überheblichkeit und ihrer Verachtung für einheimische Heilverfahren weniger geleistet habe, als ihr möglich gewesen wäre, ferner, daß die von Europa gezogenen Grenzen und der kommerziell ausgerichtete Ackerbau europäischen Stils traditionelle Schranken für Krankheitsüberträger (Käfer, Parasiten usw.) niedergerissen hätten. Selbst »absolut vernünftige« staatliche Gesundheitsmaßnahmen verletzten unter Umständen Gefühle der einheimischen Bevölkerung, während Untersuchungen und Vorkehrungen vielleicht als erniedrigend und ausbeuterisch erschienen.24
Ein weiteres Problem ist das Wasser. Tropische Gebiete weisen normalerweise genug Niederschlagsmengen auf, aber der Zeitpunkt der Regengüsse ist oft unregelmäßig und unberechenbar, und es geht dabei alles andere als sanft zu. Die Tropfen sind riesig; es gießt wie aus Eimern. Die Durchschnittswerte sind nichtssagend, wenn man sich die Extreme anschaut, ein Jahr mit dem anderen, eine Jahreszeit mit der folgenden, einen Tag mit dem nächsten vergleicht.25 In Nordnigeria fallen 90 Prozent aller Niederschläge in Form von Regenstürmen mit einer Wassermenge von 25 Millimetern pro Stunde; das entspricht der halben monatlichen Niederschlagsmenge in Kew Gardens am Rande Londons. Java kennt noch heftigere Regengüsse: Ein Viertel der jährlichen Niederschläge stürzt mit einer Menge von 60 Millimetern pro Stunde herab.
In solchen Klimaten hat es der Ackerbau schwer, mit Dschungel und Regenwald zu konkurrieren: Diese Schatzkammern der Artenvielfalt sind allen Spezies förderlich, nur nicht dem Menschen und seiner beschränkten Palette von Feldfrüchten. Das Ergebnis ist eine Art Krieg, aus dem sowohl die Natur als auch der Mensch als Verlierer hervorgehen. Die Bemühungen, Wald zu roden, nehmen die Form einer verschwenderischen Zerstörung und Abholzung wertvoller Pflanzen und Bäume an. Und das üppige Wachstum des Dschungels sagt auch nichts über die landwirtschaftlichen Möglichkeiten aus. Rodet man den Wald und legt Pflanzungen an, knallt die Sonne auf die schattenlosen Flächen herunter; heftige Regen prasseln auf die Erde, ohne durch Blätter und Zweige gebremst zu werden, waschen die Nährstoffe aus dem Boden und sorgen für eine neue Form von Vergeudung. Ist der Boden lehmig und besteht zu großen Teilen aus Eisen- und Aluminiumoxiden, wird er durch Sonne und Regen zu einem steinharten Panzer verbacken. Auf zwei oder drei Erntejahre folgt eine unabsehbare Brache. Der neugerodete Boden wird rasch wieder aufgegeben, und bald schon ersticken die aufwendigen Behausungen und Tempel unter wuchernden Ranken und Lianen. Weil sie auf Nahrungsüberschüsse aus der Umgebung angewiesen sind, können Städte hier nicht gedeihen. Die oft chaotisch verlaufende Verstädterung im heutigen Afrika ist in hohem Maße abhängig von überseeischen Lebensmittelzufuhren.
Am anderen Extrem verwandeln sich Trockengebiete in Wüste; der Wüstensand breitet sich unerbittlich aus und begräbt angrenzende, einst fruchtbare Gebiete unter sich. Um 1970 schob sich die Sahara mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Stunde in die Sahelzone vor - geologisch gesehen, im Galopp.26 Diese Ausbreitung von Ödland stellt in allen semiariden Klimazonen ein Problem dar: in den Präriegebieten der USA (man denke an die »Okies«, die Farmarbeiter aus Oklahoma, in Steinbecks Früchte des Zorns), in der israelischen Negev und den Gegenden unmittelbar östlich des Jordanflusses ebenso wie in Westsibirien. Ein Rückgang der Regenfälle genügt, um die Feldfrüchte verdursten und den Wind die trockene Humusschicht abtragen zu lassen. Während in gemäßigten Breiten der wiederkehrende Regen neuen Feldanbau ermöglicht, sind die tropischen und subtropischen Wüsten weniger nachsichtig.
Eine mögliche Antwort auf unregelmäßige Befeuchtung liegt in der Wasserspeicherung und künstlichen Bewässerung; aber dem steht in den betreffenden Gegenden der unvorstellbar hohe Verdunstungsgrad entgegen. In der Region um die indische Stadt Agra zum Beispiel übersteigen die Niederschläge den Wasserbedarf der heutigen Landwirtschaft nur während zweier Monate im Jahr; der Feuchtigkeitsüberschuß, den die Erdkrume in diesen nassen Monaten aufnimmt, trocknet innerhalb von nur drei Wochen weg.
Es ist deshalb kein Zufall, daß sich die Besiedlung und Kultivierung des Landes entlang der Flüsse vollzog, die aus ihren Einzugsgebieten Wasser und zusammen mit dem Wasser jährliche Ablagerungen fruchtbarer Erde herabführen: etwa Nil, Indus, Tigris und Euphrat. Die dort entstandenen alten Kulturzentren waren zuallererst Nahrungszentren - auch wenn uns die Bibel daran erinnert, daß sogar den Ägyptern Hungersnöte das Leben schwermachten. Nicht alle Ströme sind so großzügig wie die genannten. Der westafrikanische Fluß Volta bezieht sein Wasser aus einem Gebiet von über 100 000 Quadratkilometern - die Hälfte der Fläche Großbritanniens -, weist aber an seiner Mündung bei Niedrigwasser nur einen kärglichen Durchfluß von 28 Kubikmetern pro Sekunde auf, gegenüber 3500 bis 9800 Kubikmetern beim Höchststand. Der Wassermangel im Stromgebiet des Volta tritt in der heißesten und windigsten Zeit des Jahres ein; der Wasserverlust durch Verdunstung ist dann hoffnungslos hoch.27
Außerdem gibt es die Katastrophen - die sogenannten Jahrhundertüberschwemmungen, -stürme und -dürren, die sich ein- oder zweimal in jedem Jahrzehnt ereignen. In den Jahren von 1961 bis 1970 erlitten an die zweiundzwanzig Länder in »klimatisch benachteiligten Gegenden« (das heißt in Gegenden, die Überschwemmungen und Dürren ausgesetzt sind oder Wüstengebiete einschließen) durch Orkane, Taifune, Wassermangel und ähnliche Katastrophen Schäden in Höhe von nahezu 10 Milliarden Dollar - fast genausoviel, wie sie von der Weltbank an Darlehen erhielten, so daß ihnen so gut wie nichts für Entwicklungsaufgaben verblieb. In Bangladesch, das sich auf Höhe des Meeresspiegels befindet und rasch unter Wasser gesetzt ist, forderte der Wirbelsturm von 1970 etwa eine halbe Million Tote und vertrieb doppelt so viele Menschen aus ihren Häusern. In Indien, das sich um eine jährliche Wachstumsrate von 2 bis 3 Prozent in der Produktion von Futterpflanzen bemüht, reicht eine schlechte Wachstumsperiode aus, um den Ernteertrag um 15 Prozent sinken zu lassen.28 Die Folgen solcher gar nicht so seltenen Ausnahmesituationen können sogar für reiche Gesellschaften extrem kostspielig sein, wie die Verluste beweisen, die in den USA auf das Konto des Wirbelsturms Andrew im Jahre 1992 und der großen Überschwemmungen gingen, von denen der mittlere Westen in den Jahren 1993 und 1997 heimgesucht wurde. Für arme Bevölkerungen, die ihr Dasein am Rande des Existenzminimums fristen, sind die Auswirkungen mörderisch. Falls Fernsehkameras zugegen sind, erfahren wir etwas davon; falls nicht, hören und sehen wir nichts von den Millionen, die ertrinken und verhungern. Und wenn wir von ihnen nichts hören und sehen, kümmert es uns auch nicht!
Das Leben in schlechten Klimaten ist mithin gefährlich, bedrängt und grausam. Menschliche Fehler, mögen sie auch besten Absichten entspringen, verstärken noch die von der Natur verursachten Leiden. Selbst gute Einfälle bleiben nicht ungestraft. Kein Wunder, daß diese Regionen in Armut verharren, daß viele von ihnen nur immer ärmer werden, daß zahlreiche, vielbejubelte Entwicklungsprojekte entsetzlich gescheitert sind (von ihnen hörte man vorher mehr als danach), daß sich gesundheitliche Verbesserungen in neuen Krankheitsformen verlaufen und den Gegenangriffen der alten Übel erliegen.
Insbesondere Afrika hat hart mit diesen Handikaps zu kämpfen; obwohl viele Fortschritte erzielt worden sind, wie die Sterblichkeitsziffern und die Daten zur Lebenserwartung zeigen, bleiben die Krankheitsziffern hoch, die Ernährungssituation unbefriedigend, Hungersnöte eine regelmäßig wiederkehrende Erscheinung und die Produktivität niedrig. Während der Kontinent einst imstande war, seine Bevölkerungen zu ernähren, kann er das heute nicht mehr. Hilfe aus Übersee ist primär Lebensmittelhilfe. Die Menschen dort nutzen nur einen Bruchteil ihres Potentials. Die Regierungen kommen mit ihren Aufgaben nicht zu Rande. Angesichts der hartnäckigen natürlichen Belastungen, denen die Afrikaner ausgesetzt sind, kann man sich nur darüber wundern, wie relativ gut sie bislang noch zurechtgekommen sind.
Und doch wäre es falsch, die Geographie als etwas Schicksalhaftes zu betrachten. Ihr Einfluß läßt sich vermindern oder umgehen, wenngleich das stets seinen Preis kostet. Wissenschaft und Technik spielen hier die Schlüsselrolle: Je mehr wir wissen, desto mehr können wir tun, um Krankheiten zu verhüten und für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu sorgen. Heute verfügen wir eindeutig über mehr Handlungsmöglichkeiten als in der Vergangenheit, und die Aussichten für die tropischen Gebiete sind besser, als sie es vormals waren. Fortschritte in diesen Regionen setzen ein waches Bewußtsein und aufmerksame Beobachtung voraus. Die rosarote Brille müssen wir ablegen. Dadurch, daß wir das Problem wegerklären oder ignorieren, schaffen wir es nicht aus der Welt und tragen auch nichts zu seiner Lösung bei.
»Ich habe immer das Gefühl gehabt, daß mich das gemäßigte Klima kräftigt und belebt«
Persönliche Eindrücke können in die Irre führen, und sei’s auch nur, weil Individuen verschieden reagieren. Was dem einen behagt, ist dem anderen zuwider. Dennoch trifft das Gesetz der hitzebedingten Erschöpfung für alle zu; nur wenige bringen ihre volle Arbeitsleistung, wenn es heiß und feucht ist. Hören wir einen Diplomaten aus Bangladesch, der sich daran erinnert, wie er und seine Landsleute den Aufenthalt in gemäßigten Zonen erlebten:
»In Ländern wie Indien, Pakistan, Indonesien, Nigeria und Ghana habe ich mich immer durch die geringste körperliche oder geistige Anstrengung strapaziert gefühlt, wohingegen ich in Großbritannien, Frankreich, Deutschland oder den USA immer das Gefühl hatte, daß mich das gemäßigte Klima kräftigt und belebt, nicht nur während langer Aufenthalte, sondern auch bei kurzen Reisen. Und ich weiß, daß Leute aller tropischen Völker beim Besuch gemäßigter Klimazonen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich habe auch Hunderte von Menschen aus den gemäßigten Zonen beobachtet, wie sie sich strapaziert und erschöpft fühlten, sobald sie sich außerhalb klimatisierter Räume aufhielten.
In Indien und anderen tropischen Ländern ist mir aufgefallen, daß die Bauern, die Industriearbeiter und überhaupt alle körperlich oder am Schreibtisch Tätigen in einem langsamen Rhythmus arbeiten und lange und häufige Pausen machen. In den gemäßigten Zonen dagegen habe ich bemerkt, daß die Leute mit viel Einsatz und großer Energie in raschem Tempo arbeiten und sehr wenige Ruhepausen einlegen. Ich weiß aus eigener Anschauung und aus der Erfahrung, die andere tropische Völker in den gemäßigten Zonen gemacht haben, daß dieser auffällige Unterschied in der Arbeitsenergie und Arbeitsleistung nicht völlig und nicht einmal wesentlich auf unterschiedliche Ernährungsniveaus zurückzuführen ist.«29
2
Antworten auf die Geographie: Europa und China
Wie ungleichmäßig die Naturbedingungen sind, zeigt der Gegensatz zwischen dieser unseligen Situation und den weit günstigeren Verhältnissen in den gemäßigten Zonen, und dort insbesondere in Europa und innerhalb Europas zuerst und vor allem im westlichen Teil.
Nehmen wir das Klima. In Europa gibt es Winter, die kalt genug sind, um Krankheitserreger und Seuchen zu unterdrücken. Die Strenge des Winters nimmt zu, je weiter man nach Osten in kontinentale Klimazonen vordringt, aber selbst in seinen milderen Formen taugt er zur Abwehr um sich greifender Krankheiten. Es finden sich auch hier endemische Erkrankungen, aber die sind nichts im Vergleich mit den Verkrüpplern und Killern, die man in heißen Zonen antrifft. Parasiten bleiben die Ausnahme. Man hat geltend gemacht, diese relative Freiheit von Parasitenbefall sei schuld daran, daß Europäer so anfällig für Epidemien sind: Sie seien den Krankheitserregern nicht hinlänglich ausgesetzt gewesen, um Abwehrmechanismen aufbauen zu können.
Selbst im Winter sind die Temperaturen in Westeuropa noch freundlich. Verbindet man rund um den Globus die Orte mit gleichen Temperaturen durch Linien (Isothermen), so buchten diese nirgends so weit nach Norden aus wie an der europäischen Atlantikküste. Die mittlere Wintertemperatur im Küstenbereich Norwegens, der sich zwischen dem 58. und dem 71. Grad nördlicher Breite befindet, übersteigt den Mittelwert von Vermont oder Ohio, die rund zwanzig Grad näher zum Äquator liegen. Dank dieses Umstandes konnten die Europäer rund um das Jahr Ackerbau betreiben.
Zustatten kamen ihnen dabei auch die vergleichsweise regelmäßigen Niederschläge, die das ganze Jahr hindurch fallen und selten in Wolkenbrüchen ausarten: Der Regen »tropfet als ein sanftes Himmelsnaß«. Das ist ein Muster, dem man sonst nur ausnahmsweise auf dem Erdball begegnet. Über der ganzen eurasischen Kontinentalmasse regnet es im Sommer reichlich, im Winter dagegen nicht. Die Niederschläge vom Atlantik haben sich im Winter erschöpft, ehe sie die weiten Ebenen des mittleren und östlichen Europas erreichen. Die landumschlossenen Steppen Asiens dürsten nach Wasser; das Ergebnis sind Orte wie die Wüste Gobi. Dem südlichen und östlichen China bringen die Wolken Rettung, die von den Seegebieten vor Südostasien nach Norden ziehen; das gleiche gilt für den Südosten der USA, der von den Ausdunstungen des Golfs von Mexiko profitiert.
Diese zuverlässige und gleichmäßige Versorgung mit Wasser begünstigte eine soziale und politische Organisationsstruktur, die sich von der in den flußtalgebundenen Zivilisationen unterschied. An den Flüssen fiel die Kontrolle über die Nahrung unvermeidlich denen zu, die über den Fluß und die von ihm gespeisten Kanäle verfügten. Schon früh trat eine zentralisierte Herrschaft in Erscheinung, weil der Herr über die Nahrung auch Herr über die Menschen war. (Die biblische Erzählung von Joseph und Pharao gibt diesen Vorgang in allegorischer Form wieder. Um an Brot zu kommen, liefern die hungernden Ägypter dem Pharao zuerst ihr Geld, dann ihr Vieh, dann ihr Land und schließlich sich selbst aus [1. Buch Mose 47,13-22].) Nichts derartiges war in Europa möglich.





























