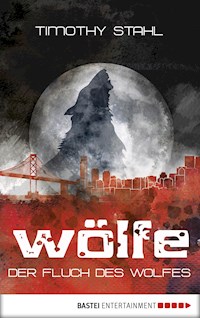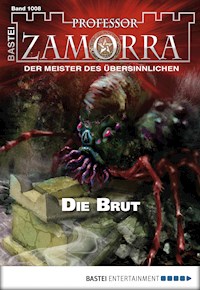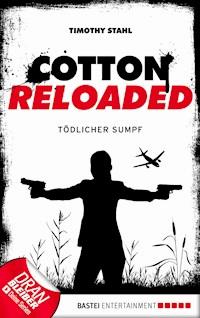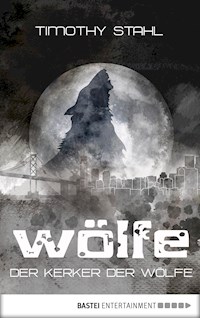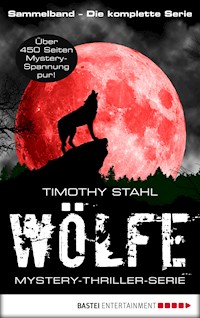
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die komplette Serie zum Sparpreis in einem Band!
Lass dich packen von der Kult-Serie von Timothy Stahl und erlebe blutige Mystery-Spannung der Extraklasse.
"Wölfe" - Einmal angefangen, und du wirst nicht mehr aufhören können!
Ein einziger Augenblick hatte Leon Talbots Leben auf den Kopf gestellt, mehr noch, es zerstört.
Was daraus geworden ist, ließ sich nicht mehr Leben nennen. Es ist ein unseliges Dasein, ein Fluch.
Wenn er hungrig wird oder Lust bekommt zu töten, wächst das Böse in ihm unaufhaltsam. Er muss diesem Leben ein Ende bereiten - nachdem er unter Einfluss dieses Fluches dem Leben so vieler anderer ein Ende bereitet hatte ...
Ein Serienkiller, der San Francisco in Angst und Schrecken versetzt, entpuppt sich als Werwolf. Er verletzt den jungen Police Detective Brandon Hunt, der daraufhin ebenfalls zum Ungeheuer mutiert ...
Jetzt herunterladen und sofort losgruseln!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln Covergestaltung: Tanja Østlyngen Covermotive von © shutterstock: Denis Andricic ISBN 978-3-7325-7426-1Timothy Stahl
Wölfe - Mystery-Thriller-Serie Sammelband
Inhalt
Inhalt
Cover
Über die Serie
Über diesen Band
Über den Autor
Impressum
Der Fluch des Wolfes
Vorschau
Wölfe – Die Serie
»Gewöhn dich lieber dran, dass das Leben oft schlimmer ist als jeder Film, Junge«, hatte ihm sein Freund und Kollege Detective Dave Allred gesagt, bevor sie das Hotel betraten. Wie recht der Alte damit haben sollte, konnte sich Brandon Hunt nicht einmal in seinen schlimmsten Träumen vorstellen ...
Seitdem ein brutaler Serienmord die Bevölkerung rund um San Francisco in Angst und Schrecken versetzt, ist Detective Brandon Hunt dem Killer auf den Versen. »Das Tier« betiteln die Tageszeitungen die Bestie, die Ihre Opfer auf grausame Weise tötet und nur einzelne Körperteile zurücklässt. Wer oder was ist im Stande so etwas zu tun? Brandon Hunt verfolgt das Ungeheuer und weiß noch nicht, welche tragende Rolle er selbst spielen soll – in der Geschichte, die eine ganze Spezies in eine neue Zeit bringen wird ...
Erlebe die Wiedergeburt von »Wölfe« – eine hochspannende Mysterythriller-Serie von Timothy Stahl, in dem Brandon Hunt seiner Bestimmung folgt, die sein Leben völlig auf den Kopf stellen wird.
Band 1: Der Fluch des Wolfes
Band 2: Der Bund der Wölfe
Band 3: Die Jagd des Wolfes
Band 4: Der Kerker der Wölfe
Band 5: Der Friedhof der Wölfe
Band 6: Der Herr der Wölfe
Über diesen Band
Band 1: Der Fluch des Wolfes
Ein einziger Augenblick hatte Leon Talbots Leben auf den Kopf gestellt, mehr noch, es zerstört.
Was daraus geworden ist, ließ sich nicht mehr Leben nennen. Es ist ein unseliges Dasein, ein Fluch.
Wenn er hungrig wird oder Lust bekommt zu töten, wächst das Böse in ihm unaufhaltsam. Er muss diesem Leben ein Ende bereiten – nachdem er unter Einfluss dieses Fluches dem Leben so vieler anderer ein Ende bereitet hatte …
Ein Serienkiller, der San Francisco in Angst und Schrecken versetzt, entpuppt sich als Werwolf. Er verletzt den jungen Police Detective Brandon Hunt, der daraufhin ebenfalls zum Ungeheuer mutiert. Sein erstes Opfer: seine Freundin Rowena McGee, von der anschließend nur die rechte Hand gefunden wird …
Über den Autor
Timothy Stahl, geboren 1964 in den USA, wuchs in Deutschland auf, wo er unter anderem als Chefredakteur eines Wochenmagazins und einer Jugendzeitschrift tätig war. 1999 kehrte er nach Amerika zurück. Seitdem ist das Schreiben von Spannungsromanen sein Hauptberuf. Mit seiner Horrorserie WÖLFE gehörte er zu den Gewinnern im crossmedialen Autorenwettbewerb des Bastei-Verlags. Außerdem ist er in vielen Bereichen ein gefragter Übersetzer. Er lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Las Vegas, Nevada.
Timothy Stahl
Der Fluch des Wolfes
Mysterythriller
Durch das schmutzige Fenster sah Leon Talbot über die Oakland Bay Bridge hinüber zu den Lichtern des Financial Districts. Verloren und schemenhaft zeichneten sie sich im Abendnebel ab, der aus der Bucht aufstieg. Unwirklich und unerreichbar fern schien der Ort, an dem er gearbeitet und gelebt hatte. Als sei San Francisco nicht mehr seine Stadt, als hätte sie ihn ausgestoßen.
Talbot trat vom Fenster weg, während Nacht und Nebel draußen den letzten Rest Tageslicht schluckten. Er ließ sich auf dem Rand des Bettes nieder, das so muffig roch wie der Rest des Zimmers. Das Lied war vorbei, und ehe die Stimme eines Moderators oder ein Werbespot den Nachklang des Songs aus Talbots Kopf vertreiben konnte, schaltete er das Radio aus.
What a difference a day makes …
Rau summte er leise die Melodie mit, die noch hinter seiner Stirn umhergeisterte. Sein Blick fiel in den Spiegel, der neben der Zimmertür hing.
Die Veränderung, die er auf dem fleckigen Glas sah, hatte etwas länger gedauert als ›24 little hours‹. Sie war im Laufe der vergangenen Wochen schleichend erfolgt, und heute erkannte Talbot sich kaum noch wieder. Sein Gesicht war abgezehrt, blass und unrasiert. Unter den Augen lagen dunkle Ringe, wie mit schmutzigem Finger aufgemalt. Mit hängenden Schultern hockte er da, niedergeschlagen und kraftlos.
Nein, es war nichts mehr übrig von dem energiegeladenen jungen Aufsteiger, der vor drei Jahren aus einem Nest an der Ostküste nach San Francisco gekommen war, um bei einem der Hightech-Unternehmen Karriere zu machen, die mehr und mehr mit dieser Stadt gleichgesetzt wurden.
Was er auch geschafft hatte.
Er hatte stets gewusst, wo er hinwollte, und war bereit gewesen, hart dafür zu arbeiten. Zwar stand er noch nicht ganz oben auf der Erfolgsleiter, aber er konnte nach der verhältnismäßig kurzen Zeit doch sehr zufrieden sein mit dem, was er erreicht hatte.
Leon Talbot nickte seinem Spiegelbild zu, das ihn wie das Gesicht eines Fremden anstarrte. Ja, er war mit seinem ganzen Leben zufrieden gewesen. Immer hatte alles perfekt geklappt …
Aber vielleicht war alles ein bisschen zu perfekt gewesen.
Vielleicht, dachte Leon Talbot jetzt, da er auf dem Bett des Hotelzimmers saß und den kurzläufigen Revolver aus dem Hosenbund zog, vielleicht hatte ich bisher zu viel Glück – zu viel Glück auf einmal. Vielleicht habe ich mein ganzes Lebensglück zu schnell aufgebraucht …
Er wog die Waffe in der zitternden Hand und betrachtete sie, als könne sie ihm einen anderen Ausweg verraten.
Aber er wusste, dass es keinen anderen Weg gab. In den vergangenen Tagen und Wochen war ihm klar geworden, was mit ihm geschah. Er hatte alle nur denkbaren Möglichkeiten in Erwägung gezogen und dann doch wieder verworfen.
Er hatte keine Chance.
Wäre er doch vor fünf Wochen bloß nicht nach Kanada gereist, um sich seinen Yuppie-Traum vom grandiosen Abenteuerurlaub zu erfüllen – eine Woche lang allein durch die Wildnis, nur mit dem Nötigsten bepackt. Er hatte wissen wollen, ob er das Zeug dazu hatte, ob es in ihm steckte, auch abseits des beruflichen Parketts seinen Mann zu stehen.
Und fast hätte er es geschafft.
Aber dann hatte ihn dieses … Ding angegriffen. Dieses Tier, von dem er heute wusste, dass es ein Wolf gewesen war. Und nicht irgendeiner, kein normaler Wolf, sondern …
Er unterdrückte ein schmerzhaftes Schluchzen, das ihm in der Kehle hochstieg, und schüttelte den Kopf. Heiße Tränen brannten ihm an den entzündeten Augenlidern.
Nein, nicht einmal jetzt, da er alles wusste, da alles offensichtlich war, ging ihm das verfluchte Wort von den Lippen. Nicht einmal in Gedanken konnte er es formulieren. Nicht einmal jetzt – da er selbst einer war!
Etwas wie ein Fieberschauer packte Leon Talbot, schüttelte ihn durch, und der Revolver drohte, ihm aus den Fingern zu rutschen. Er umklammerte ihn wie einen Anker, als könnte die Waffe ihm Halt in der Wirklichkeit bieten, körperlichen wenigstens. Denn seine Gedanken kehrten erneut zurück nach Kanada, in jene Nacht, in der ihn irgendetwas geweckt hatte.
Es war ein Geräusch, womöglich auch Instinkt, der ihn vor einer Gefahr warnen wollte. Andernfalls wäre der Wolf im Schlaf über ihn hergefallen und hätte ihn vermutlich auf der Stelle getötet.
Rückblickend schien dies ihm die bessere Alternative …
Aber so war es nun mal nicht gelaufen.
Er war aufgewacht, hatte den angreifenden monströsen Wolf gesehen, hatte sich zur Wehr gesetzt und es geschafft, das Untier in die Flucht zu schlagen.
Die Verletzungen, die er bei der kurzen, aber heftigen Auseinandersetzung davongetragen hatte, waren nicht allzu schlimm gewesen.
Herrgott, er hatte sich nach dem Kampf mit dem Wolf sogar wie ein Held gefühlt!
Fast hatte er es ein wenig bedauert, dass seine Wunden so schnell verheilten. Er hatte sie eigentlich im Fitness-Center seinen Kollegen zeigen wollen, wenn er ihnen die Story von seinem Kampf mit dem Wolf erzählte. Doch als er wieder in San Francisco eintraf, waren die Verletzungen kaum noch zu sehen gewesen.
Und so hatte es begonnen …
An die ersten beiden Morde konnte er sich nicht erinnern. Sein erstes Opfer, eine Praktikantin aus dem Büro, hatte er in der Tiefgarage der Firma getötet. Das zweite Opfer war ebenfalls eine junge Frau gewesen, die er auf dem Heimweg von der Kneipe, wo sie als Bedienung gearbeitet hatte, erwischt hatte.
Seit diesem zweiten Mord nannten die Medien den unbekannten Täter nur noch »das Tier«, weil er tödliche Wunden riss wie ein Raubtier und vom Fleisch seiner Opfer fraß. Von offizieller Seite schloss man nicht aus, dass tatsächlich ein mordendes Tier in San Francisco sein Unwesen trieb. Auf ein bestimmtes hatte man sich dabei allerdings nicht festgelegt. Die Polizei hielt sich mit Auskünften über die Mordfälle überhaupt sehr bedeckt. Es hieß, man ermittle in alle Richtungen und wolle die Arbeiten nicht gefährden, indem man zu viele Details bekannt gab.
Natürlich war auch der Begriff »Werwolf« gefallen, vor allem in den weniger seriösen Zeitungen des Landes und den Nachrichten der lokalen TV-Sender, die jeder Mücke hinterherhechelten, aus der sie einen Elefanten machen konnten. Durchgesetzt hatte sich diese Theorie natürlich nicht, und mittlerweile war sie auch wieder ad acta gelegt worden. Wer glaubte denn schon ernsthaft an Werwölfe?
Bis vor etwa vier Wochen war auch Leon Talbot in dieser Hinsicht ein ungläubiger Thomas gewesen. Bis er auf sehr schmerzhafte Weise eines »Besseren« belehrt worden war.
Heute fragte er sich, warum man nicht viel öfter vom Treiben von Werwölfen hörte und las. Er konnte doch unmöglich der Einzige sein, der von diesem Fluch befallen war …
Mittlerweile gingen sechs Morde auf sein Konto. Und an die letzten vier Opfer konnte er sich erinnern. Mehr noch, er musste sich fortwährend an sie erinnern. Er versuchte, die schrecklichen Bilder zu unterdrücken, sie zu verdrängen. Aber sie kehrten immer wieder zurück und suchten ihn ständig heim wie ein Albtraum, für den die Grenze zwischen Schlaf und Wachsein keine Gültigkeit hatte.
Es war, als wachse der Wolf in ihm. Fast wie ein Tumor. Als würde sich das Ungeheuer, das in ihm hauste, seiner selbst in immer stärkerem Maße bewusst. Und dieses andere, neue Bewusstsein schien auf Talbots eigenes abzufärben, als begännen beide miteinander zu verschmelzen – ohne jedoch wirklich ganz eins zu werden.
Zwei Seelen wohnten in seiner Brust. Und die eine, seine, litt Höllenqualen unter der Präsenz des Parasiten und konnte sich nicht wehren.
Deshalb hatte er diesen Entschluss gefasst. Er musste seine Seele befreien, sie erlösen. Und es gab nur einen Weg. Er musste ihn gehen, um ihr noch größeres Leid zu ersparen. Und um zu verhindern, dass er noch größere Schuld auf sich lud, indem er den Wolf in sich tatenlos gewähren ließ.
Aber das war nicht der einzige Grund, weshalb Leon Talbot diese verzweifelte Flucht gewählt hatte.
Er wollte auch nicht der Polizei in die Hände fallen. Er wusste nicht, ob sie ihm schon auf den Fersen waren. Dennoch hatte er vorsichtshalber seine Wohnung vor einigen Tagen verlassen. Seither zog er in den weniger feinen Gegenden der Bay Area von einem schäbigen Hotel oder Motel ins nächste.
Er wollte auch nicht, dass seine Familie herausfand, was mit ihm los war. Die Schmach, dass er ein Serienmörder war und die Medien über sie herfielen wie Aasgeier, musste er ihnen ersparen.
Vor allem aber wollte Leon unter keinen Umständen warten, bis der Wolf ihn am Ende dermaßen vereinnahmte, dass ihm das Töten nichts mehr ausmachte oder er gar Gefallen daran fand.
Denn er konnte spüren, dass seine Entwicklung in diese Richtung ging, unaufhaltsam. Wie eine Vision, an deren Richtigkeit es keinen Zweifel gab, sah er vor sich, was aus ihm werden würde: ein Monster, in dem nichts Menschliches, nichts Gutes mehr steckte.
Und damit einher würde der Wahnsinn gehen. Auch den konnte Leon bereits spüren. Schleichend, als sei er selbst ein Tier auf Beutefang, näherte sich ihm der Irrsinn, umkreiste ihn, berührte ihn, machte ihn sich gefügig …
Leon Talbot fröstelte abermals. Er riss sich zusammen – so gut er eben konnte.
Nein, es war nicht zu spät. Es musste nicht so enden. Noch konnte er sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Er hielt es ja schon in den Händen.
Er senkte den Blick und sah wieder auf den Revolver hinab.
Es war an der Zeit, es zu tun. Jetzt oder nie. Er musste einen Schlussstrich ziehen unter dieses irrsinnige, blutige und letzte Kapitel seines Lebens.
Er durfte nicht länger zögern. Die Zeit mochte ihm schon davonlaufen. Denn der Wolf, das Tier in ihm, konnte jede Minute erwachen und ihn zum siebten Mord zwingen.
Er wusste nie im Voraus, wann der Wolf aus ihm hervorbrechen würde. Es geschah ohne Ankündigung, so überraschend, schnell und brutal, dass er nichts dagegen tun konnte.
Aber immerhin wusste er jetzt, dass die Verwandlung nichts mit dem Vollmond oder den Mondphasen generell zu tun hatte. Zumindest diese landläufige Meinung entstammte lediglich Romanen und Filmen.
Die Transformation folgte scheinbar überhaupt keinem bestimmten Zeitplan oder sonst einem Muster. Vielleicht kam der Wolf immer dann, wenn er Hunger hatte – womit er nicht nur das natürliche Hungergefühl meinte, sondern auch die schiere Lust am Töten. Denn das genoss der Wolf ebenso sehr wie das Fressen selbst.
Talbot wusste das, weil er das Empfinden des Ungeheuers teilte, wenn es sich erst einmal seines Körpers bemächtigt hatte. Nur mit der Schuld, dem schlechten Gewissen, den grauenvollen Erinnerungen ließ ihn der Wolf danach allein.
Allein war er auch jetzt.
Noch, denn der Wolf schlief.
Und diese Gelegenheit musste und wollte Leon nutzen.
Mit beiden Händen fasste er den Revolver. Seine Armmuskeln schmerzten. Das war weniger eine Folge seiner jüngsten Verwandlung in einen Wolf vor vier oder fünf Tagen, sondern weil es einen wahren Kraftakt bedeutete, die Waffe zu heben. Es war, als hinge ihm jemand mit ganzem Gewicht und aller Macht an den Armen, um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten.
Endlich, nach einer halben Ewigkeit, wie ihm schien, befand sich der Revolver auf Höhe seines Gesichts. Er drehte ihn, legte den Daumen um den Abzug, und die kleine Mündung berührte seine bebenden Lippen, kalt wie der Kuss einer Toten.
Er öffnete den Mund und schob den kurzen Lauf hinein, schmeckte Pulverschmauch, Öl, Metall.
Talbot schloss die Augen, presste die Lider so fest aufeinander, dass es wehtat.
Ihm kam in den Sinn, dass Werwölfe angeblich nur mit Silberkugeln zu töten waren. Ob auch das nur eine Erfindung von Schriftstellern und Filmemachern war?
Gleich würde er es wissen …
Sein Daumen am Abzug krümmte sich, zuckte und – verharrte.
Leon Talbot schlug die Augen auf.
Jemand kam!
Er hatte zwar nichts gehört und natürlich auch nichts gesehen. Aber er spürte es. Mit Sinnen, die nicht die seinen, nicht die eines Menschen waren.
Der Wolf war erwacht. Geweckt von dem oder denen, die sich da näherten und zu ihm wollten. Sie waren zu diesem Zimmer unterwegs.
In diesem Augenblick übernahm der Wolf vollends die Kontrolle!
Es war wie immer.
Talbot hatte das Gefühl, als explodierte ihm das Herz in der Brust und als raste mit einem Mal die doppelte Menge Blut durch seine Adern. Dann war ihm, als zerreiße sein Fleisch und als breche jeder Knochen in seinem Leib. Ein Gefühl, als würde ihn von innen her ein wildes Tier anfallen und mit Zähnen und Klauen zerfetzen.
Starr richtete er den Blick auf den Revolver in seinen Händen, auf den Daumen am Abzug. Verzweifelt bemühte er sich, in dem Chaos, das in ihm tobte, den einen Gedankenbefehl herauszufiltern, der den Schuss abfeuern, der ihn erlösen und den Wolf dieses Körpers berauben sollte.
Aber es war zu spät. Das Tier war schneller, raubte ihm den Körper und tat damit, was es wollte, formte ihn neu.
Talbot litt Schmerzen, die so gewaltig, so alles verzehrend waren, dass sie ihm nicht einmal Kraft zum Schreien ließen.
Er sah, wie sich seine Hände verwandelten, wie sie zu ungelenken Pfoten wurden, die den Revolver nicht länger halten konnten. Die Waffe entglitt ihnen und fiel mit einem dumpfen Laut zu Boden.
Und Leon Talbot fiel hinterher und krümmte sich unter Qualen, die denen seiner Opfer um nichts nachstanden.
Nicht weit entfernt …
… schlüpfte jemand beinahe so mühelos in seine zweite Haut, wie andere sich neue Kleider überzogen.
Die Schmerzen, die mit der Verwandlung einhergingen, wenn Fleisch und Knochen mürbe wurden und sich mit feuchtem Knirschen verformten, hatte Morgan im Laufe vieler Jahre zu verdrängen gelernt.
Ebenso hatte er gelernt, den Prozess, der einst scheinbar endlos gedauert hatte, zu beschleunigen. Anders als damals wurde er heute binnen weniger Herzschläge vom Menschen zum Wolf – und nur dann, wenn er es wollte.
Auch das hatte sich im Vergleich zu früher geändert. Das und vieles mehr.
Was sich nicht änderte, war der moralische Konflikt, in den er jedes Mal stürzte, wenn er ausgeschickt wurde – wenn es, wie es im Jargon des Rudels hieß, einen Renegaten auszuschalten galt, ehe dieser die ganze Rasse in Gefahr brachte.
Morgan selbst nannte es anders.
Er nannte es Brudermord.
Trotzdem hatte er sich nie geweigert, seine Pflicht zu erfüllen. Aus Loyalität dem Last One ebenso wie aus Verantwortungsgefühl seinem Volk gegenüber.
Morgan war berufen, und die Kraft oder auch nur der Wunsch oder Wille, diesem Ruf zuwiderzuhandeln, lagen nicht in seiner Natur – weder in seiner menschlichen noch in seiner wölfischen.
So machte er sich, ohne zu zögern, auch heute Nacht auf, um jenen Einen, der zwar von derselben Art, aber doch aus der Art geschlagen war, zu töten, bevor er zum Verräter am Volk der Wölfe werden konnte.
Detective Dave Allred stoppte den zivilen Dienstwagen, einen dunkelroten Ford Crown Victoria, neben dem Eingang des Hotels, das laut der schmutz- und smogverklebten Leuchtreklame über der Tür schlicht »The Inn« hieß.
Allred war sich sicher, dass sie an der richtigen Adresse waren. Er tat seit über 25 Jahren Dienst beim San Francisco Police Department und kannte nicht nur jeden Winkel der Bay Area, sondern auch jede Absteige. Das Inn war kein Etablissement von der ganz üblen Sorte, aber auch kein Ort, an dem er Bekannte einquartiert hätte.
Er gab seinem Partner ein Zeichen, schon mal auszusteigen. Der junge Detective, ein tüchtiger Bursche namens Brandon Hunt, verließ den Ford auf der Beifahrerseite, während Allred der Zentrale per Funk meldete, dass sie ihr Ziel erreicht hatten. Das abermalige Angebot der Zentrale, einen Streifenwagen zur Verstärkung zu schicken, lehnte er ab.
»Du glaubst immer noch nicht, dass diese Spur heiß ist, was?«, fragte Hunt übers Wagendach herüber, als Allred ausgestiegen war.
»No, Sir.« Der Ältere schüttelte den Kopf. »Darum will ich ja auch nicht, dass die Zentrale noch mehr Manpower verschwendet.«
Hunt sagte nichts, aber die Miene, mit der er an der schmuddeligen Fassade des Hotels emporsah, sprach Bände.
Allred erlaubte sich ein schiefes Grinsen. »Du denkst, wir sind auf der richtigen Fährte, habe ich recht?«
Hunt hob die Schultern. »Bin mir nicht sicher. Ist nur so ein Gefühl, verstehst du?« Er tippte sich mit dem Finger gegen die Nase. »Mein Riecher sagt mir, dass an diesem Hinweis was dran sein könnte.«
Dave Allred wollte etwas darauf erwidern, ließ es dann aber bleiben. Immerhin musste er sich eingestehen, dass der Junge tatsächlich einen guten Riecher hatte. Er konnte sich nicht erinnern, dass Hunt sich in den zwei Jahren, die sie als Team zusammenarbeiteten, auch nur einmal getäuscht hatte.
»Gehen wir«, sagte Allred lediglich und setzte sich in Bewegung, wobei er den Blick über die Front des Hotels wandern ließ.
Dass San Francisco unter anderem seiner architektonischen Schönheiten wegen gerühmt wurde, hatte den Erbauer dieses Gebäudes offensichtlich nicht beeinflusst. Nicht einmal die Nacht konnte verbergen, dass es ein selten hässlicher, schmuckloser Kasten war, kaum besser als ein etwas zu groß geratener, ramponierter Schuhkarton. Allerdings, das konnte man nicht abstreiten, passte er in diese Gegend von Oakland. Hier schien im Umkreis von drei oder vier Blocks ein- und derselbe Architekt am Werk gewesen zu sein.
Die beiden Detectives betraten das winzige Foyer des Hotels. Hinter einer zerschrammten Theke saß ein Mann undefinierbaren Alters, der, seinem Äußeren nach zu schließen, noch nicht mitbekommen hatte, dass die Flowerpower-Bewegung Schnee von vorgestern war. Die welken Blümchen in seinem verfilzten Haar verliehen ihm etwas beinahe Trauriges.
Allred zeigte dem Mann seine Dienstmarke, Hunt ein Foto des Mannes, wegen dem sie hier waren. Um drei oder vier Ecken herum war ihnen zu Ohren gekommen, dass er hier abgestiegen sein sollte.
Der Hippie schob die Sonnenbrille mit den winzigen Gläsern zur Stirn hoch und blinzelte das Foto an.
»Hm«, brummte er dann. »Was soll mit dem sein?«
»Wohnt er hier?«, fragte Allred.
»Zimmer zwohundertacht. Sieht allerdings ’n bisschen anders aus als auf dem Bild.«
»Anders?«, hakte Hunt nach.
Der Hippie zuckte die Achseln. »Älter oder so. Abgerissen.«
»Wir sehen ihn uns mal an«, sagte Allred zu Hunt.
»Der Fahrstuhl ist Schrott«, warnte der Langhaarige. »Ihr müsst die Treppe nehmen.«
Auf dem Weg in die erste Etage fragte Allred seinen Partner: »Wieso glaubst du, Talbot könnte unser Mann sein?«
»In der Garage der Transamerica Pyramid hat sich das Tier sein erstes Opfer geholt. Und Leon Talbot arbeitet in der Pyramid«, antwortete Hunt.
»Wie ungefähr fünfzehnhundert andere Leute auch«, gab Allred zu bedenken. »Deiner Logik zufolge wären die alle genauso verdächtig wie Talbot.«
»Nein, weil der Tipp, den wir bekommen haben, sich nur auf Talbot bezieht. Auf niemanden sonst, der bei einer der Firmen in der Pyramid angestellt ist. Aber«, Hunt hob einhaltend die Hand, ehe Allred etwas darauf sagen konnte, »ich gebe zu, dass meine Überlegung auf tönernen Füßen steht. Ich hab’s ja schon gesagt, es ist nur so ein Gefühl.«
Der Junge – zumindest für Allreds Begriffe, der nächstes Jahr seinen fünfundfünfzigsten Geburtstag feiern konnte, war Brandon Hunt mit seinen 30 Jahren noch ein Junge – lächelte fast entschuldigend.
Allred lächelte zurück. Hunt war ein netter Bursche. Hoffentlich nicht zu nett für den Job als Polizist. Es wäre schade drum, denn er war ein guter Cop.
Seine erste wirklich harte Feuerprobe hatte der Junge auch schon hinter sich – und bestanden.
In seinem ersten Dienstjahr hatte man Hunt mit Martin Fallick zusammengespannt. Fallick war ein Cop von der Sorte gewesen, die den ganzen Polizeiapparat in Verruf brachten. Er hatte sich schmieren lassen, konfiszierte Drogen unterschlagen und wieder verkauft und noch ein paar andere Dinger dieser Art gedreht.
Hunt war noch keine sechs Monate Fallicks Partner gewesen, als dessen schmutziges Spiel endlich aufflog. Und der Junge war in den Strudel, der danach folgte, natürlich mit hineingezogen worden. Davor hatte ihn auch sein gutes Verhältnis zu Captain Edward McGee, ihrem direkten Vorgesetzten, nicht bewahren können.
Aber darauf hatte Hunt auch gar nicht gebaut. Er hatte sich als ein Mann erwiesen, der seinen Weg aus eigener Kraft ging, der sich nicht protegieren ließ. Und er war heil und sauber aus dieser Sache hervorgegangen, vielleicht sogar gestärkt.
Allred nickte innerlich. Ja, verdammt, ein guter Junge, der ihn nicht nur wegen der Geschichte mit Martin Fallick ein bisschen an diesen jungen Schauspieler in dem Film »Training Day« erinnerte, in dem Denzel Washington das schwarze Schaf in den Reihen der Cops gespielt hatte. Hunt sah ihm auch ähnlich, diesem … na, wie hieß er noch gleich? Der Name des Schauspielers wollte ihm nicht einfallen. Hawke. Evan … oder Ethan …?
Brandon Hunt hatte das Zeug, in der Hierarchie des Polizeiapparats weit nach oben zu kommen. Er musste nur auf eines aufpassen: dass er nicht zu einem dieser typischen Bullen wurde, zu einem jener Cops, für die es nichts anderes gab als ihren Job und die darüber alles andere, das Leben selbst nämlich, vergaßen. Die Voraussetzungen dazu brachte Hunt durchaus mit.
Er war ein Einzelgänger, ein einsamer Wolf. Soziale Bindungen schien er kaum zu haben. Seine Eltern waren tot, er war nicht verheiratet. Ab und zu ging er sicherlich mit einem Mädchen aus, aber Allred hatte nie davon gehört, dass Hunt je eine längere, wirklich ernsthafte Beziehung gehabt hätte.
Wenn Hunt, was selten vorkam, einmal über ein in die Brüche gegangenes Verhältnis redete, dann stellte sich oft heraus, dass seine Freundin nicht damit klargekommen war, mit einem Polizisten liiert zu sein, der mitunter 24 Stunden am Stück und länger im Einsatz war. Manchmal lag es aber auch daran, dass Hunt die Beziehung gelöst hatte, weil er der Meinung war, das Mädchen habe etwas Besseres verdient. Womit er seine Person allerdings nicht herabsetzen wollte. Vielmehr meinte er damit, dass er dem Glück nicht im Weg stehen wolle, das sie mit einem anderen Mann sicherlich eher finden würde als an seiner Seite. Das war, wie Allred fand, eine durchaus ehrenwerte, wenn auch etwas selbstzerstörerische, masochistische Einstellung.
Ganz bestimmt hatte es jedenfalls nichts mit seinem Äußeren zu tun, dass Hunt noch Junggeselle war. Im Gegenteil, der Bursche sah gut aus: einsachtzig groß, brünettes Haar, durchtrainiert, und seinem Gesicht und bisweilen auch seinem Gebaren hafteten etwas Jungenhaftes an, wie es viele junge Frauen mochten.
Vielleicht hatte er die Richtige ganz einfach noch nicht gefunden. Davon zumindest ging Allred aus, und daran war ja nichts Verkehrtes.
Ab und zu traf man Hunt in »Moose’s Saloon« an, der Stammkneipe der Kollegen ihres Departments. Aber dort ging es ja auch nicht ums wahre Leben. In erster Linie unterhielt man sich auch dort nur über die Arbeit. Und wenn die Gespräche mal ins Private abdrifteten, hielt Hunt sich sehr bedeckt. Ob aus Scheu oder weil es über sein Privatleben nichts zu erzählen gab, wusste Allred nicht.
Fakt war allerdings, dass Hunt auch ihm gegenüber, seinem Partner, mit dem er den Großteil seiner Arbeitszeit verbrachte, kaum einmal erzählte, was er etwa am Abend vorher so getrieben hatte. Hier und da mal ein paar Worte übers Fernsehprogramm oder Sportergebnisse und dergleichen, aber mehr ließ er sich so gut wie nie entlocken.
Allred war allerdings auch nicht der Typ, der einem Kollegen auf den Zahn fühlte, wenn der von Natur aus nicht redselig war.
Trotzdem, in Brandon Hunts Fall konnte er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Junge ein Geheimnis mit sich herumtrug – und dass er womöglich selbst nicht recht wusste, was es damit auf sich hatte.
»Zweihundertacht ist da hinten«, mischte sich Brandon Hunts Stimme in Allreds Gedanken.
Hinter dem Treppenabsatz erstreckte sich der Korridor, an dem die Zimmer lagen, nach links und rechts. Ein kaum noch leserliches Schild an der Wand verriet, welche Zimmernummern wo zu finden waren.
Sie wandten sich nach links. Im Gehen zogen sie beide ihre Dienstpistolen.
»Irgendwie hoffe ich ja, dass Talbot der Richtige ist«, sagte Dave Allred leise. »Damit diese Scheißgeschichte endlich vorbei ist.«
Hunt schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ich kann’s immer noch nicht fassen, dass ein Mensch zu solchen Morden imstande sein soll. In Filmen oder Romanen – ja, das ist was anderes. Aber im richtigen Leben? Man, das pack ich einfach nicht.«
»Gewöhn dich lieber dran, dass das Leben oft schlimmer ist als jeder Film, Junge.«
»So langsam komm ich dahinter, fürchte ich.«
»Da ist es.« Allred wies auf die Tür, die noch drei Schritte von ihnen entfernt war. Auf dem Holz klebten fleckige Messingziffern, die das Zimmer als Nummer 208 auswiesen.
Wenn Hunts Riecher ihn nicht trog, befand sich hinter dieser Tür der Serienmörder, den man »das Tier« nannte und auf den das San Francisco Police Department eine Heerschar von Cops angesetzt hatte.
Buchstäblich Tausende von Hinweisen waren im Laufe der vier Wochen, die der Killer nun schon sein Unwesen trieb, aus der Bevölkerung eingegangen. Hunderte waren ausgewertet und an die Einsatzteams zur Überprüfung weitergeleitet worden. Aber noch hatte keine der Spuren zu einem nennenswerten Erfolg geführt.
Der Tipp, der auf Leon Talbot hindeutete, war von einem seiner Nachbarn gekommen. Der fand Talbot aus mehreren Gründen verdächtig, unter anderem auch deshalb, weil er seit ein paar Tagen verschwunden war. Einer Nachfrage bei Talbots Brötchengeber zufolge war er einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen. Außerdem hatte man dort gesagt, dass er in letzter Zeit sehr schlecht ausgesehen habe. Was ihn natürlich noch lange nicht zum Mordverdächtigen abstempelte.
Merkwürdiger war da schon, dass niemand wusste, wo Talbot steckte. Nahe liegend war der Gedanke, dass er seine Familie an der Ostküste besuchte. Aber dort hatte man seit Längerem nichts von ihm gehört.
Aber auch das machte Leon Talbot noch nicht zum Täter, noch nicht einmal wirklich verdächtig. Eher der Form halber als aus Überzeugung hatte man ihn trotzdem auf die Fahndungsliste gesetzt. Und tatsächlich war heute ein Hinweis auf seinen Aufenthaltsort eingegangen.
Mit einer Geste gab Allred seinem Partner zu verstehen, sich rechts neben der Tür von Zimmer 208 zu postieren. Er selbst nahm links davon Aufstellung. Er streckte die rechte Hand mit der Waffe zur Seite, um mit deren Knauf gegen die Tür zu klopfen, verharrte jedoch, als dahinter etwas polterte.
Gleich darauf folgte ein ähnliches Geräusch, nur lauter, massiger. Wie von einem Körper, der zu Boden fiel.
Und noch etwas war zu hören, dumpf nur, aber unverkennbar.
»Da stöhnt jemand«, fasste es Hunt in Worte.
»Mister Talbot!«, rief Allred alarmiert. »San Francisco Police Department! Öffnen Sie die Tür!«
Keine Antwort, keine Reaktion. Nur das Stöhnen hielt unvermindert an. Es klang, als leide jemand furchtbare Schmerzen.
Mit einem raschen Blick bedeutete Allred seinem Partner, ihm den Vortritt zu lassen. Er selbst griff nach dem Türknauf, der sich allerdings nicht drehen ließ.
»Mister Talbot!«, wiederholte Allred. »Aufmachen! Sofort!«
Aber die Tür blieb zu und abgeschlossen.
Allred trat zwei Schritte zurück und warf sich mit der Schulter gegen das Türblatt.
Das Holz knirschte und knackte. Die 2 und die 8 lösten sich und klimperten zu Boden.
Unter Allreds zweitem Ansturm flog die Tür nach innen und krachte dort gegen die Wand. Mit dem Fuß verhinderte Allred, dass sie zurück und ihm ins Gesicht schlug.
Er richtete die Pistole im Beidhandanschlag ins Zimmer – und erstarrte.
Mehr sah Brandon Hunt von seiner Position aus nicht.
Und dann geschah so viel auf einmal, dass sein Verstand in den Zeitlupenmodus zu schalten schien, damit er alles erfassen konnte …
Dave Allred wollte offenbar etwas sagen, aber was ihm über die Lippen kam, ergab keinen Sinn. Es waren unzusammenhängende Laute, sonst nichts.
Jenseits der Türschwelle bewegte sich etwas. Ein Schatten, groß und rasend schnell, verdunkelte den Lichtschein, der durch den Türrahmen in den Flur fiel.
Ein heiseres, grollendes Knurren war zu vernehmen.
Allred schoss. Verfehlte sein Ziel, was es auch gewesen war. Das Klirren von Glas verriet, dass seine Kugel das Fenster des Zimmers durchschlug.
Er schrie auf. Ganz kurz nur. Der Schrei erstickte in einem Gurgeln und feuchten Reißen.
Brandon Hunt schrie auf.
Warme Nässe spritzte ihm ins Gesicht – und etwas flog aus dem Zimmer und prallte auf den verschlissenen Teppichboden des Flurs, sich einmal drehte und dann liegen blieb.
Dave Allreds Kopf!
Glasigen Blickes schien Dave Allred direkt in Brandon Hunts Augen zu starren. In das Gesicht des Toten hatte sich ein Ausdruck geprägt, der nicht nur Schrecken widerspiegelte, sondern vor allem völlige Fassungslosigkeit. Als hätte Dave im Angesicht des Todes etwas gesehen, das ihn zwar entsetzt hatte, das er aber zugleich absolut nicht glauben konnte.
Hunt war sicher, dass sein Gesichtsausdruck dem des Toten in diesem Augenblick ähnelte.
Er glaubte, der Boden würde ihm unter den Füßen weggerissen. Seine Umgebung geriet mit ins Wanken. Er musste sich mit der Hand an der Wand abstützen, um nicht umzukippen.
Es war nicht zu fassen.
Dave – tot.
Gerade eben hatte er noch mit ihm gesprochen – und jetzt …
Jetzt lag Daves Kopf vor ihm auf dem Boden eines billigen Hotels.
Allred war mehr als nur sein Partner gewesen, er war ein Freund gewesen. Hunt hatte zu ihm aufgesehen. Dave war ein guter Cop gewesen, der sich in seiner Laufbahn nichts hatte zuschulden kommen lassen.
Hunt wurde übel, vor Grauen wie vor Entsetzen und Wut gleichermaßen. Er hatte das Gefühl, um seinen Hals ziehe sich eine Drahtschlinge unaufhaltsam zu, so schmerzhaft eng wurde ihm die Kehle. Seine Augen begannen zu brennen. Mühsam kämpfte er die Tränen zurück.
Nein, er durfte seiner Trauer jetzt nicht nachgeben, musste aufpassen, dass ihm nicht dasselbe widerfuhr wie Dave, dafür Sorge tragen, dass ihm nicht auch der Kopf …
Mein Gott!
Er gelangte gerade noch rechtzeitig zurück in die Wirklichkeit.
Aus dem Augenwinkel sah er einen Schatten auf sich zukommen.
Sein erster Gedanke war, dass derjenige, der Dave Allred getötet hatte, sich nun auf ihn werfen wollte.
Ein Irrtum.
Es war Daves kopfloser Körper, der ihm aus der offenen Tür entgegenkippte, steif und schwer wie ein gefällter Baum. Reflexhaft streckte Hunt die Hände aus, um den Leichnam abzufangen.
Dave Allred war ein hoch gewachsener, kräftiger Mann und brachte locker 200 Pfund auf die Waage. Der Anprall seines toten Leibes ließ Hunt einen Schritt nach hinten taumeln und etwas in die Knie gehen.
Das war sein Glück.
Denn im selben Moment fegte etwas dicht an seinem Gesicht vorbei, das ihn andernfalls getroffen hätte. Ein wütendes Knurren war zu vernehmen.
Im nächste Augenblick sah Hunt, wie das Etwas gegen den Türrahmen hieb und nicht nur ein gut faustgroßes Stück Holz herausfetzte, sondern auch Putz und Gips aus der Wand.
Für eine Sekunde trübte aufwölkender Staub Hunts Sicht auf die Türöffnung, sodass er nur einen unförmigen, massigen Schemen heraustreten sah.
Dann hatte sich der Staub so weit gesenkt, dass er wieder klar sehen konnte.
Und er sah … einen Wolf?
Das jedenfalls war es, was ihm als Erstes in den Sinn kam und womit sein Gegenüber noch am ehesten Ähnlichkeit hatte.
Irgendwo in ihm jedoch brüllte eine Stimme, dass es kein Wolf war, keiner sein konnte. Es war nicht einmal ein Tier im natürlichen Sinne, sondern … ja, was eigentlich?
Ein Ungeheuer, ein Monstrum.
Etwas Unmögliches!
Dieses Unding durfte es einfach nicht geben.
Brandon Hunt konnte sich beglückwünschen – sein Riecher hatte ihn nicht getrogen. Es konnte kaum noch Zweifel daran bestehen, dass ihm hier der Serienkiller gegenüberstand, den die Medien mit Fug und Recht »das Tier« nannten.
Aber das machte die Sache keineswegs besser, nicht begreifbarer. Hunt musste an sich halten, um nicht einfach loszubrüllen vor schierem Grauen, das ihn um den Verstand zu bringen drohte.
Er hatte sich zwar nicht vorstellen können, dass ein Mensch hinter den brutalen, kannibalischen Morden steckte.
Das allerdings hatte er sich ebenso wenig vorgestellt!
Eher schon hatte er insgeheim darauf getippt, es mit einem Freddy-Krueger-Verschnitt zu tun zu haben, einem Verrückten, der irgendeinem filmischen Vorbild nacheiferte.
Aber wie hatte Dave Allred vor ein paar Minuten erst zu ihm gesagt? »Gewöhn dich lieber dran, dass das Leben oft schlimmer ist als jeder Film, Junge.«
Wie wahr …
Und jetzt hatte etwas, das schlimmer war als jede Filmfantasie, Dave umgebracht – und damit war es noch nicht zufrieden!
Geifernd, das blutverschmierte Maul halb offen, näherte sich das bepelzte Untier. Funkelte Hunt an aus Augen, die wie Bernstein und vor einer Lust glänzten, wie sie kein Mensch empfinden konnte. Es machte einen Schritt, setzte zu einem zweiten an.
Hunt erkannte, dass sich der Wolf – das Wolfsding! – zum Sprung spannte.
Und er reagierte keinen Sekundenbruchteil zu früh.
Vor Anstrengung aufstöhnend stemmte Hunt Allreds enthaupteten Leichnam von sich und stieß ihn dem Untier entgegen.
Der Tote und die Kreatur, die gerade zum Sprung angesetzt hatte, prallten zusammen. Der Wolf wurde zurückgeworfen, stürzte, und die Leiche begrub ihn halb unter sich.
Hunt wusste natürlich, dass ihm diese Aktion höchstenfalls ein paar Sekunden Aufschub verschaffte, aber noch nicht den Sieg bedeutete.
Ebenso wusste er, dass Flucht keine Option und vermutlich auch sinnlos war. Es würde hier ein Ende finden – auf die eine oder andere Weise …
Brandon Hunt schoss. Dreimal zog er den Stecher seiner Pistole durch.
Die erste Kugel traf das Biest in den Schulterbereich. Die Wucht des Treffers warf den Wolf mitsamt des Leichnams, in den er sich verkrallt hatte, am Boden liegend herum.
Dadurch ging die zweite Kugel fehl.
Das dritte Geschoss hieb in den Boden, wo das Ungeheuer eben noch gelegen hatte. Denn in dem Moment war es mit einem mächtigen Satz schon wieder auf den Beinen – stand auf zwei Beinen wie ein Mensch! – und hielt die Leiche wie einen Schutzschild vor sich.
Aber nur für eine halbe Sekunde. Dann schleuderte es den Toten mit urgewaltiger Macht in Hunts Richtung und setzte gleichzeitig selbst hinterher.
Hunt wich dem grausigen Wurfgeschoss aus, indem er sich gegen die Flurwand drückte. Als er aber die Waffenhand wieder herumreißen und auf den Wolf richten wollte, war es bereits zu spät.
Ein furchtbarer Hieb traf seine Hand und prellte ihm die Pistole aus den Fingern. Er schrie auf, vor Schmerz und Überraschung gleichermaßen.
Der Wolf, offenbar unbeeinträchtigt von der Schussverletzung, flog förmlich auf ihn zu und prallte gegen ihn. Er schlang die vorderen Gliedmaßen um den Oberkörper des Polizisten. Die Krallen bohrten sich durch den Jackenstoff in Hunts Rücken.
Gemeinsam gingen sie zu Boden.
Hunt versuchte noch, die Beine anzuziehen, um den Schwung des Sturzes auszunutzen und den Wolf über sich hinweg zu katapultieren – aber es blieb beim Versuch.
Der Aufprall und das Gewicht des auf ihm landenden Monstrums pressten dem Cop die Luft aus der Lunge.
Der Bestie hilflos ausgeliefert lag er unter ihr. Heißer Atem peitschte ihm ins Gesicht, das Maul fuhr auf ihn zu, so weit aufgerissen, dass es ihm den Kopf mühelos vom Hals beißen würde!
Mit einer verzweifelten Anstrengung und unter Aufbietung aller Kraft vollführte Hunt eine Drehbewegung – und schrie noch in der Sekunde so laut auf, dass es ihm selbst in den Ohren wehtat, als sich der Schmerz durch seine linke Schulter fraß.
Seine Bewegung hatte ihm das Leben gerettet, für den Moment zumindest. Das Wolfsmaul hatte sich nur um seine Schulter geschlossen, nicht um seinen Kopf oder seine Kehle.
Jetzt riss das Tier seinen Schädel wieder zurück. Ohne jedoch das Maul ganz zu öffnen. Die Zähne wurden förmlich aus Hunts Schulter herausgefetzt. Der Schmerz drohte Hunt die Besinnung zu rauben.
Nur Todesangst verhinderte, dass sich Hunt von der Dunkelheit umfangen ließ. Selbst knurrend wie ein Tier brachte er irgendwie seine rechte Hand in die Höhe und stemmte sie unter das Maul des Wolfs, der schon zum zweiten Biss ansetzte.
Aber die Bestie war stark. Stärker als Brandon Hunt, stärker als jeder Mensch.
Sein hochgestreckter Arm zitterte unter der Kraft des Wolfs, der sich zusätzlich noch auf sein Gewicht verlassen konnte, das auf Hunt niederdrückte.
Hunts Ellbogen knickte langsam ein, der Bizeps schien platzen zu wollen unter der schier übermenschlichen Anstrengung.
Das Maul senkte sich weiter auf ihn herab. Wieder spürte und roch er den heißen Atem. Er konnte direkt in den Rachen des Ungeheuers hineinsehen, hörte das grollende Knurren daraus aufsteigen. Riesengroß schwebten die mörderischen Reißzähne über seinem Gesicht, nur noch wenige Finger breit entfernt.
Dann füllte das Maul Hunts ganzes Blickfeld aus. Die Welt bestand für ihn nur noch aus diesem blutroten Schlund, den die Zähne säumten wie Felsnadeln eine Schlucht.
Schließlich berührten die Spitzen der Zähne seine Gesichtshaut, seinen Hals …
Und Brandon Hunts Kräfte versagten endgültig.
Aus!, dachte er.
Dann verschlang das Wolfsmaul das allerletzte bisschen Licht und hüllte ihn in Finsternis …
Es war wie ein Sturm, der aus dem Nichts heranfegte.
Brandon Hunt merkte, dass der Druck und das Ungeheuer nicht einfach nur von ihm wichen, sondern regelrecht von ihm heruntergerissen wurden. Plötzlich war es wieder hell, der heiße Raubtieratem füllte ihm nicht mehr Mund und Nase, er konnte sich wieder bewegen.
Und das tat er – weniger bewusst, als vielmehr automatisch, von Instinkt und Reflexen getrieben. Im Aufstehen tastete er nach seiner Pistole, fand und ergriff sie. Der Schmerz in der verletzten Schulter ließ ihn die Zähne zusammenbeißen und gepresst aufstöhnen.
Dann sah er, was geschah.
Was allerdings nicht hieß, dass er es auch verstand …
Eine zweite Wolfskreatur war erschienen!
Und sie hatte ihn, Hunt, gerettet. Vorerst jedenfalls.
Das zweite Untier unterschied sich kaum von dem ersten, was Größe und Gestalt anging. Nur sein Fell war dunkler, fast schwarz, während das von Dave Allreds Mörder eine graubraune Färbung zeigte.
Die beiden Ungeheuer kämpften. Nein, ein Kampf war es im Grunde gar nicht, was sich da vor Hunts fassungslosen Blicken zutrug.
Es war eine Hinrichtung.
Der erste Wolf schien zu verwirrt aufgrund der neuen Lage, um sich wirklich effektiv zur Wehr setzen zu können.
Zwei, drei, höchstens vier Sekunden mochten vergangen sein, bis der Schwarze den Graubraunen mit den Zähnen zu packen bekam. Seine Kiefer schlossen sich um den Nacken seines Kontrahenten – und bissen zu.
Mit einem Knirschen, das Hunt erschauern ließ, brach das Rückgrat des Killers. Sein Leib erschlaffte.
Da ließ der schwarze Wolf sein Opfer los und wandte den Kopf in Hunts Richtung. Und noch in derselben Bewegung setzte er mit einem Sprung auf ihn zu.
Hunt schoss. Zu spät.
Wieder traf ein Hieb seine Schusshand und lenkte die Kugel ab. Der Schwarze prallte gegen ihn, stand auf den Hinterläufen und presste ihn gegen die Wand.
Eine krallenbewehrte Pranke legte sich um Hunts Kehle.
Der Wolf, der ihn vor Sekunden gerettet hatte, würde jetzt zu seinem Mörder werden.
Aber warum? Was ging hier vor? Hatte der Schwarze lediglich sein Revier gegen den Grauen verteidigt?
Hunt konnte spüren, wie er am Rand des Wahnsinns dahinbalancierte – und wie er gefährlich ins Schwanken geriet.
Und was als Nächstes geschah, machte es nicht besser. Im Gegenteil …
Das schwarze Wolfsgesicht befand sich nicht mehr als zwei Hand breit von seinem entfernt. Tatsächlich sah es dem eines echten Wolfs sehr ähnlich.
Umso unfassbarer war das Mienenspiel in diesem Gesicht.
Hunt glaubte nicht nur, er war überzeugt davon, Regungen in diesem pelzigen Gesicht und den Wolfsaugen zu lesen. Da waren Empfindungen, die menschlichen so sehr ähnelten, dass sie als solche erkennbar waren.
Und im Gesicht dieses Wolfs erkannte er etwas wie Verwunderung. Verblüffung.
Der Wolf musterte ihn aus zu schmalen Schlitzen zusammengekniffenen Augen. Hörbar sog er schnüffelnd die Luft in die feuchte Schnauze.
Der Wolf witterte.
Und vor allem zögerte er, Hunt etwas zuleide zu tun.
Bis er schließlich ganz von ihm abließ.
Das Tier ließ sich auf alle viere nieder und wirkte mit einem Mal sehr viel mehr wie ein richtiger Wolf und weniger wie ein Monster, als sei unbemerkt eine Verwandlung mit ihm vorgegangen. Es zog sich zwei, drei Schritte zurück, ohne Hunt jedoch aus den Augen zu lassen.
Mehr noch, es sah ihn so durchdringend an, als präge es sich sein Gesicht ganz genau ein, damit es ihn nur niemals vergaß.
Dieser Gedanke ließ Hunt schaudern.
Endlich wandte sich der Wolf um, packte seinen toten Artgenossen und verschwand mit dem Kadaver in Zimmer 208.
Hunt bewunderte die Mühelosigkeit, mit der das Tier diesen Kraftakt bewerkstelligte.
Es dauerte ein paar Sekunden, bis er sich so weit gefasst hatte, dass er ihm folgen konnte. Er hob die Pistole und betete dabei inständig, dass er sie nicht benötigen würde. Sie hatte ihm bislang nicht viel genutzt.
Als er das Zimmer betrat, sah er niemanden mehr, auch Leon Talbot nicht, weder tot noch lebendig.
Den Gedanken, der sich Hunt im Fahrwasser dieser Feststellung aufdrängte, unterdrückte er halbwegs erfolgreich und zumindest für den Augenblick …
Der Wolf war mitsamt des toten Ungeheuers verschwunden. Wahrscheinlich hatte er durch das zerschossene Fenster in der rückwärtigen Wand des Zimmers das Hotel verlassen. Von dort aus war, wovon Hunt sich mit einem Blick hinaus überzeugte, die Feuertreppe als Fluchtweg zu erreichen.
Warum habe ich nicht auf ihn geschossen?, fragte er sich im Stillen, während er die Pistole wegsteckte.
Eine Frage, auf die er keine Antwort fand. Obwohl es eine gab – das konnte er förmlich spüren. Aber noch war er zu durcheinander, zu entsetzt, um sie auch nur suchen zu wollen …
Einen Moment lang schaute er noch zum Fenster hinaus, seine rechte Hand auf die blutende, vor Schmerz pochende linke Schulter gepresst. Schließlich hörte er draußen auf dem Gang näher kommende Schritte und fast gleichzeitig einen kaum unterdrückten Aufschrei. Jemand kämpfte würgend und wie es klang erfolglos dagegen an, sich zu übergeben.
Brandon Hunt drehte sich um und ging zur Tür.
Ihm war, als kehre er erst mit dieser Bewegung in seine angestammte Wirklichkeit zurück.
Eine Wirklichkeit allerdings, der er gern ferngeblieben wäre …
Zwei Stunden später, 70 Meilen nördlich von San Francisco
Der Lexus GX mochte zwar wie ein Geländewagen wirken, wirklich geeignet allerdings war er fürs Gelände nicht. Oder vielleicht waren es auch nur die typischen Besitzer dieses Schickimicki-SUVs, die für Fahrten durch unwegsames Terrain nicht taugten.
Morgan beobachtete jedenfalls mit einiger Genugtuung, wie sich Richard Jacobsons schmales, fast hageres Gesicht bei jeder Bodenunebenheit, über die er seinen Lexus in dieser menschenleeren Gegend manövrieren musste, schmerzhaft verzog. Und dazu bekam Jacobson reichlich Gelegenheit. Morgan gab die Fahrtrichtung an und ließ Jacobson den Wagen buchstäblich über Stock und Stein knüppeln.
»Verdammt, muss das wirklich sein?«, fluchte Jacobson am Steuer des Lexus zum x-ten Mal, seit sie den Highway 1 kurz vor Bodega Bay in nördlicher Richtung verlassen hatten. Seither fuhren sie mehr oder weniger querfeldein. Die Straßen sprachen dieser Bezeichnung Hohn und waren allenfalls auf Spezialkarten verzeichnet.
»Ich verstehe nicht, warum dieser Hokuspokus unbedingt hier, am Arsch der Welt, abgezogen werden muss«, setzte Jacobson noch dazu, und auch diese Bemerkung machte er – so oder in ähnlichem Wortlaut – nicht zum ersten Mal.
Hokuspokus …
Ignorantes Arschloch, dachte Morgan, schwieg aber.
So wie er auch den Rest seiner Gedanken für sich behielt.
Er hatte kaum zwei Dutzend Worte gesprochen, seit sie San Francisco verlassen hatten, und damit war er beinahe so stumm wie ihr Fahrgast im Heckraum des Lexus.
Von Leon Talbot war mittlerweile kaum noch etwas zu hören. Natürlich hatte er kein Wort gesprochen – schließlich war er tot –, dafür aber hatte er andere Geräusche von sich gegeben. Es waren feuchte, knirschende Laute, und die Macht, die ihn im Tode in seine menschliche Gestalt zurückverwandelte, hatte den Leichnam wie in Krämpfen hin und her bewegt, als leide er selbst tot noch Schmerzen.
Morgan mochte Jacobson nicht. Dass dieser, wie er freimütig zugab, nicht verstand, warum nötig war, was sie taten, war nur ein Grund dafür. Oder vielleicht war das auch nur eine Folge des wahren Grundes, weshalb er Jacobson im Besonderen und Wölfische von Jacobsons Schlag im Allgemeinen nicht mochte.
Eine knorrige, mehr als armstarke Luftwurzel hob den Lexus förmlich aus und ließ das Fahrzeug mit einem dumpfen Krachen wieder zu Boden fallen. Jacobson, über einen Kopf größer als Morgan, stieß hart gegen die Wagendecke und fluchte von Neuem, auch weil ihm sein Handy aus den Fingern rutschte und im Fußraum verschwand. Er hatte gerade – wie schon ein paar Mal während der Fahrt – jemandem per Telefon Anweisungen erteilt und gesagt, er werde morgen früh wieder persönlich erreichbar sein und sich weiter »um diese ganze Scheiße kümmern«.
Diesmal hatte der Ruck auch Morgan überrascht, weil er in Gedanken woanders gewesen war. Reflexhaft suchte er Halt, um nicht aus dem Beifahrersitz geworfen zu werden.
Er reckte den Hals ein wenig, um besser hinausschauen zu können, wo allerdings nicht viel zu sehen war. Die Scheinwerfer des Lexus entrissen der Nacht nur Ausschnitte der Wirklichkeit, und dank des holprigen Bodens wechselten diese Ausschnitte beständig und verwirrten eher, als dass sie der Orientierung dienten.
Doch Morgan brauchte sich auch in menschlicher Form nicht allein auf sein Augenlicht zu verlassen.
»Dort vorne«, sagte er, den Finger ausgestreckt. »Nach links.«
Das war für seine Begriffe – und vor allem Jacobson gegenüber – schon fast eine Volksrede gewesen.
Linker und rechter Hand bildeten die mächtigen Stämme und das Unterholz des Redwood-Waldes, durch den sie seit gut einer halben Stunde kreuzten, eine Wand, die im Dunkeln undurchdringlich wie ein Festungswall wirkte.
Morgan lehnte sich wieder zurück und dachte an die sonderbar vertraute Witterung, die er an dem Fremden im Hotel wahrgenommen hatte und dessen Leben er daraufhin verschont hatte. Er war gespannt, ob der Last One eine Erklärung dafür wusste.
Durch das halb offene Fenster auf seiner Seite drang der würzige Duft des Waldes ins Wageninnere und trieb ihm die Erinnerung an jene höchst eigenartige Witterung für den Moment aus der Nase.
Tief sog er den frischen Geruch ein. Herrlich. Er schloss die Augen und ließ seine Gedanken wieder auf Wanderschaft gehen. Sie kehrten wieder zurück zu dem, worüber er vorhin nachzudenken begonnen hatte.
Richard Jacobson.
Ein typischer Vertreter seiner, dieser Generation von Wölfischen. Und genau deshalb mochte Morgan ihn nicht.
Wie viele ihrer Artgenossen war Jacobson im Innersten ein Wolf und im so genannten richtigen Leben ein hohes Tier. Er wusste, seine animalischen Triebe zu unterdrücken, zu kontrollieren. Er nutzte seine Instinkte und alle anderen Eigenschaften des Wolfs im Umgang mit Menschen, sodass sie ihn anderen überlegen machten. Was sich in einer steilen Berufskarriere und dergleichen auszahlte.
Dem Rudel gehörte Jacobson allerdings nicht an, um dem wölfischen Volk zu dienen und es zu schützen, auch wenn er sich diesen Anschein gab. In Wirklichkeit tat er es aus purem Eigennutz – und aus Feigheit, die eines Wölfischen unwürdig war. Würde die Existenz ihrer Rasse nämlich bekannt unter den Menschen, wäre eine Neuauflage der Hexenverfolgung nicht mehr weit. Nur würden dann nicht Hexen beziehungsweise Menschen, die man der Zauberei bezichtigte, auf dem Scheiterhaufen brennen, sondern Wölfe – oder eben Männer und Frauen, die man für sogenannte Werwölfe hielt. Die Menschheit war immer noch barbarisch genug, um so etwas zu tun – oder wenigstens zuzulassen.
Morgan knurrte verhalten und warf Jacobson aus dem Augenwinkel einen finsteren Blick zu, den der allerdings nicht bemerkte. Er konzentrierte sich völlig auf den kaum wahrnehmbaren Weg durch den nachtdunklen Wald.
Das Volk der Wölfe als Ganzes lag Morgan durchaus am Herzen, sonst hätte er auch nicht getan, was er als seine geradezu heilige Pflicht ansah.
Aber die Einzelnen … Nein, davon waren ihm viele zuwider. Die meisten von ihnen, genau wie Jacobson, verstanden nicht mehr. Sie hatten mit den wölfischen Werten von einst, dem ursprünglichen Wesen ihrer Rasse, der wahren Macht der Wölfe nichts mehr im Sinn. Dieses Verständnis war ihnen abhandengekommen, und niemand schien wirklich daran interessiert zu sein, es wiederzufinden, um es über die Zeiten zu retten. Stattdessen ließ man es dem Vergessen anheimfallen.
Andererseits … Konnte man ihnen das wirklich zum Vorwurf machen?
Eigentlich nicht. Die alte Ordnung ruhte heute – und seit Langem schon – nur noch auf einer einzigen Stütze. Und das war zu wenig, um sie auf Dauer aufrechtzuerhalten. Da half es auch nicht, dass er, Morgan, dieser buchstäblich letzten Säule – dem Last One, wie er nur genannt wurde – beistand. Es war, als versuchte man, zu zweit eine Naturgewalt mit bloßen Händen aufzuhalten. Und genau genommen war es tatsächlich ein bisschen so.
Erschwerend hinzu kam noch, dass Morgan selbst nicht wirklich vertraut war mit der alten Macht. Er wusste nicht viel darüber, und das Meiste von diesem Wenigen kannte er nur vom Hörensagen.
Der Last One, der Letzte der Old Ones, hatte ihn nicht in die alten Mysterien eingeweiht. Er schien sich nicht mit dem Gedanken zu tragen, Morgan zu seinem Nachfolger heranzuziehen, obschon er ihn anderweitig durchaus wie einen Sohn behandelte.
Geheimniskrämerei allerdings konnte Morgan dem Last One auch nicht vorwerfen. Er ließ sich von ihm jederzeit über die Schulter schauen und verbarg nichts vor ihm. Aber es war, als fehle Morgan schlicht das Begriffsvermögen für vieles von dem, was der Last One tat – und für das, was er wirklich war …
»Wie weit ist es noch?«
Jacobsons Stimme riss Morgan aus den Gedanken. Er richtete sich ein wenig auf. Seiner Statur wegen hatte er etwas Mühe, über die Motorhaube hinwegzuschauen; eine »kompakte Bauweise« hatte das mal jemand genannt.
»Nicht mehr weit«, sagte Morgan nur, nachdem er sich orientiert hatte.
Der Weg führte seit einiger Zeit bergab, die Redwoods standen mittlerweile weniger dicht. Schließlich öffnete sich vor ihnen in der Talsenke eine fast kreisrunde Lichtung, auf der nicht nur keine Bäume, sondern gar nichts wuchs. Kein Strauch, kein Halm, absolut nichts. Das Rund zwischen den monströs hohen Bäumen ringsum bestand einzig aus karger Erde. Das konnte natürlich am Boden selbst liegen. Wahrscheinlicher aber war, dass hier Kräfte am Wirken waren – oder irgendwann einmal gewirkt hatten –, die kein pflanzliches Wachstum zuließen. Es war ganz sicher keine willkürliche Entscheidung des Last Ones gewesen, ausgerechnet dieses winzige Fleckchen Erde für das Ritual auszusuchen. Der Ort musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit überhaupt möglich war, was sie den alten Regeln nach zu tun hatten. Aber auch über die Beschaffenheit und Geheimnisse dieser Orte wusste Morgan kaum etwas.
Was er indes wusste, war, was sie erwartete. Immerhin reiste er seit seiner Jugend, seit der Wolf in ihm erwacht war, an der Seite des Last Ones. Morgan wusste gar nicht mehr, das Wievielte das bevorstehende Ritual in einer langen, langen Reihe war. So wie Leon Talbot ein Renegat in einer langen, langen Reihe ebensolcher gewesen war, die er hatte töten müssen. Zum Wohl ihres Volkes …
Für Jacobson war es das erste Mal, dass er einer Seelenrettung beiwohnte, dem erlösenden Ritual. Dementsprechend wusste er nicht, was sie erwartete. Und dementsprechend enttäuscht war er. Das war ihm nicht nur anzumerken, er tat es auch mit Worten kund.
»Das ist alles?«, entfuhr es ihm, als das Scheinwerferlicht des Lexus die Lichtung fast zur Gänze ausleuchtete.
Er mochte irgendetwas Spektakuläres erwartet haben. Einen beeindruckenden Aufbau, der zur Durchführung des Rituals nötig war, eine regelrechte Show vielleicht.
Aber ganz bestimmt nicht einen steinalten Pick-up-Truck mit einem nicht minder alten Wohnwagen im Schlepp, die beide aussahen, als würden sie nur noch von etwas Farbe, viel gutem Willen und gelegentlichen Gebeten zusammengehalten.
Nicht nur das Ambiente enttäuschte Richard Jacobson. Auch der Last One entsprach kaum seinen Erwartungen …
Jacobson war dem Letzten der Old Ones in den vielen Jahren, die er nun schon zum Rudel gehörte, noch nie persönlich begegnet. Es war in der Bay Area in all der Zeit nie zu einem Vorfall gekommen, der ein Erscheinen und Eingreifen des Last Ones erfordert hatte. Trotzdem hatte Jacobson natürlich ein Bild des Last Ones vor Augen, basierend auf all dem, was er im Laufe der Jahre über ihn gehört hatte.
Jetzt aber, als der Last One aus der schmalen Tür des schäbigen Wohnwagens auf die Lichtung heraustrat, musste Jacobson feststellen, dass es zwischen seiner Vorstellung von diesem Mann und der Wirklichkeit nur eine einzige Übereinstimmung gab: Der Last One war indianischer Abstammung, sein uramerikanisches Erbgut stand ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Aber das war auch schon alles.
Jacobson wusste, dass man den Last One nicht nur den Letzten der Alten nannte