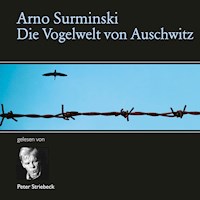14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erzählungen dieses Bandes haben allesamt die historischen Ereignisse und Brüche zum Thema, die Ostpreußen und seinen Menschen durch die Jahrhunderte seiner Geschichte widerfahren sind. Arno Surminski schildert darin, wie die Pest einst nach Preußisch-Litauen kam (Der Pestreiter), wie sich die Verhandlungen zur Konvention von Tauroggen 1812 zugetragen haben mögen (In der Poscherunschen Mühle), wie sich die Menschen zu helfen wussten, als die Tataren vor mehr als 350 Jahren Ostpreußen heimsuchten (Der Tatarensee) oder was den ostpreußischen Dorfbewohnern widerfuhr, wenn aus dem Osten die Kosaken einfielen und auf der Durchreise durch ihre Dörfer zogen (Als die Kosaken kamen).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Arno Surminski
Wolfsland
oder
Geschichten aus dem
alten Ostpreußen
LangenMüller
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook:
2016 LangenMüller in der
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: akg-images, Berlin
Satz und eBook-Produktion:
Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
www.Buch-Werkstatt.de
ISBN 978-3-7844-3462-9
Inhalt
Vorwort
Aus aller Herren Länder
Der Pestreiter
In der Poscherun’schen Mühle
Der Tatarensee
Als die Kosaken kamen
Ephas Düne
Die masurische Frömmigkeit
Auf der Krutinna
Lange Kerle
Dichtertreffen
Der Eisfischer
Der Domherr zu Frauenburg
Exulanten
Ostpreußische Feuersbrünste
Das achte Weltwunder
Der masurische König
Der Tote im Wald
Der Teufelsberg
Auf der Durchreise
Das Treffen in Tilsit
Der feine Herr Murat
Gestohlene Ehre
Über die Grenze
Die vielen Schlachten
Tannenberge
Erntekrieg
Mutter mit Kind
Die große Schlittenfahrt
Kalter Winter
Unter Tage
Wolfsland
Schweigen ist Gold
De oole Fretz
Verspätete Sedanfeier
Zu Gast in Masuren
Die Vergangenheit saß auf der Treppe
Die Fische im Beldahnsee
Ein Bote für Dobre Miasto
Der Engel von Mensguth
Geschichte eines Steins
Ein Mythos
Vorwort
Touristisch findet die Landschaft, die einmal Ostpreußen war, genug Beachtung. Die Dünenwelt der Kurischen Nehrung, die Bernsteinküste, das »Land der dunklen Wälder« und die tausend Seen Masurens fehlen in keinem Reiseprospekt. Bis zur nächsten Eiszeit wird die Landschaft, wie Millionen sie kennengelernt haben, erhalten bleiben.
Anders steht es um Kultur und Geschichte. Hier hat der Zweite Weltkrieg eine Wüstenlandschaft hinterlassen. Das Wort »Ostpreußen« auszusprechen, galt lange Zeit als revanchistisch. Es kam im Mainstream der deutschen Kultur nicht vor und wenn doch, dann als Etikett für die Ewiggestrigen. Ebenso das Wort Heimat, das dem Vorgestern zugeordnet wurde. Zu dieser Verlorenheit hat beigetragen, dass ein Teil Ostpreußens, das Königsberger Gebiet, aus der Weltgeschichte herausgefallen war und fast ein halbes Jahrhundert nicht gesehen und betreten werden durfte.
Die Zeit hat diesen Konflikt geheilt. Diejenigen, die an ihrem Land im Osten hingen und es wiederhaben wollten, sind nicht mehr. Eine neue Generation wächst heran, der das Nationale wenig bedeutet, dafür das Europäische umso mehr. Die Menschen, die jetzt in diesem Land heimisch sind, werden als gute Nachbarn und europäische Freunde gesehen, ein Verständnis, das von der anderen Seite erwidert wird. Bevor die ferne Provinz im Schattenreich der Geschichte versinkt, sollte aufgehoben werden, was bewahrenswert ist. Es geht darum, das geistige Ostpreußen am Leben zu erhalten. Die preußische (ostpreußische) Weltsicht wird in den immer unsichereren Zeiten als stabilisierendes Element gebraucht. In Ostpreußen hatten wir es mit einer einzigartigen Vermischung von Völkern, Sprachen und Religionen zu tun, einer europäischen Gemeinschaft im Kleinen, die in ihrer Toleranz jeden nach seiner Fasson selig werden ließ. Kant, Herder, Kopernikus, Corinth sind einige der Leuchttürme, die in die Welt strahlten, bevor die Schatten des 20. Jahrhunderts sie verdunkelten.
In diesem Buch werden, eingebettet von zwei Essays zu Beginn und am Ende, Geschichten aus dem alten Ostpreußen erzählt. Sie sollen dazu beitragen, dass uns dieses Land nicht geistig verloren geht.
Arno Surminski, 4.10.2017
Aus aller Herren Länder
Menschenleer war es dort nie. In uralten Zeiten lebten die Pruzzen im Land zwischen Weichsel, Memel und Narew. Sie streiften durch die Wälder, versammelten sich zur Sonnenwende in heiligen Hainen, um ihre Lieder zu singen. Eine Schrift hinterließen sie nicht, ihre Sprache ging unter vor vierhundert Jahren, nur einzelne Namen und Redewendungen überdauerten die Zeit, ein Staat wurde nach ihnen benannt. Als die Sieger des Zweiten Weltkrieges Preußen auflösten, glaubten sie, die Wurzel allen Übels beseitigt zu haben. In Wahrheit hatten sie einen Staat exekutiert, den es schon lange nicht mehr gab. Dieser Akt der Leichenschändung stürzte Preußen nicht in Vergessenheit, sondern wertete seine historische Bedeutung auf.
Spät nahm sich das Christentum des spärlich besiedelten Pruzzenlandes an. Kreuzritter wurden ausgesandt, um Heiden zu bekehren. Da die sich nicht fügten, musste Blut vergossen werden. Die Pruzzen zogen sich ins Litauische zurück, blieben aber eine ständige Bedrohung des Grenzlandes. Die Zahl der Einfälle und Raubzüge ist Legion, ebenso die Strafexpeditionen der Ritter. Danach blieb die Region geteilt zwischen Heiden und Christen, so wie sie nach dem Schicksalsjahr 1945 wieder geteilt wurde unter Heiden und Christen.
Der Ritterorden löste die erste Einwanderungswelle aus. Er rief Bauern und Adelsleute aus ganz Europa ins Land. Um sie vor pruzzischen Überfällen zu schützen, ließ er zahlreiche Burgen bauen; am Nogatfluss entstand die Burg aller Burgen: Marienburg.
Zu den Einwanderern gehörten adlige Familien aus Franken, Hessen und Bayern, die vom Orden mit landwirtschaftlichen Gütern belehnt wurden, den sogenannten Rittergütern. Viele kamen auch als Söldner, um dem Orden bei seinen kriegerischen Unternehmen zu dienen. Als Lohn erhielten sie Ländereien. Bis ins 20. Jahrhundert prägten ihre Namen das Preußenland; in den Parks neben den Herrenhäusern liegen noch heute die Gedenksteine der ersten Siedlerfamilien.
Die Einwanderung unterschiedlichster Volksgruppen wurde über Jahrhunderte hinweg zur Regel. So entstand ein Schmelztiegel, in dem sich vieles vermischte, ein Kleinamerika im östlichen Preußen. Aus dem Süden kamen Masowier und polnische Adelige, sie brachten und bewahrten ihre polnische Sprache, der masurische Dialekt hat sich bis heute erhalten. Luthers Lehre kam früh ins Preußenland, ein Sohn Luthers studierte in Königsberg, ein Schwager war Burggraf von Memel und eine Tochter mit einem Rat des Herzogs Albrecht verheiratet. Preußen war der erste protestantische Staat und wurde zur Schutzmacht verfolgter Protestanten. Der südwestliche Teil Ostpreußens, das Ermland, war polnisch und katholisch. Auch als es bei der polnischen Teilung an Preußen fiel, blieb es katholisch. Es spricht für Toleranz und Weltoffenheit der Menschen, dass »Katholische« und »Evangelische« gut zusammenlebten und auch die anderen Glaubensrichtungen wie Mennoniten und Reformierte toleriert wurden. Im Nordosten der Provinz gab es Ortschaften, die von réfugies, Glaubensflüchtlingen aus Frankreich, bewohnt wurden. Über 7000 schottische Reformierte wanderten seit 1607 nach Ostpreußen ein. Auch Reformierte aus Nassau wurden zur Auswanderung gezwungen und siedelten in Ostpreußen. Die Königsberger Universität wurde zum Anziehungspunkt für Studierende aus ganz Deutschland, aber auch aus Polen und den baltischen Ländern. Für die Litauer war sie so etwas wie geistige Heimat.
Was trieb die Schotten ins Preußenland? Konflikte zwischen Schottland und England führten immer wieder zu Auswanderungswellen. Reformierte Schotten wurden aus dem Land gedrängt. Viele Schotten gingen nach Amerika, einige auch nach Europa. Preußen, nicht zuletzt das liberale Ostpreußen, war häufig das Ziel schottischer Emigranten. Mit dem Schiff reisten sie von Schottland nach Hamburg, zu Lande weiter bis Lübeck und von dort über die Ostsee. Ein schottischer Feldmarschall namens Keith diente in der Armee Friedrichs II. Barclay, ein Preuße mit schottischen Wurzeln, führte die Zarenarmee gegen Napoleon. In Schillers Kriegsdrama »Wallenstein« kommen ein Schotte Lesly und ein irischer General Butler vor.
Als die große Pest zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Norden des Landes entvölkerte, rief der preußische König Siedler ins Land. Sie kamen aus Polen und Litauen, dazu Glaubensflüchtlinge aus dem Westen und Süden Europas. 1731 zogen die Salzburger in einer monatelangen Odyssee quer durch Deutschland nach Ostpreußen. Dort bauten sie ihre Kirchen und gründeten ihre Städte (Gumbinnen). Salzburger Namen (Lechleitner, Tiefentaler) waren bis 1945 verbreitet. Auch Hugenotten, die die religiösen Verfolgungen in Frankreich überlebt hatten, zogen auf ihrer Flucht nach Osten ins Preußenland. In Berlin und Ostpreußen wurden sie eine bedeutende Volksgruppe. General L’Estocj, der 1807 für Preußen bei Preußisch-Eylau kämpfte, kam aus einer Hugenottenfamilie. Zuvor hatten sich die holländischen Mennoniten im Mündungsgebiet der Weichsel und im Norden Ostpreußens niedergelassen, weil sie hier ihren Glauben frei leben durften. Reformierte aus der Schweiz und Süddeutschland siedelten vor allem in der Gegend von Insterburg.
Religionsflüchtlinge waren auch die Philipponen, die in Russland verfolgt wurden und 1823 in Ostpreußen Aufnahme fanden. In der »masurischen Wildnis« bauten sie ihre Dörfer und Kirchen und blieben, bis der letzte Krieg sie weiter nach Westen vertrieb. Calvinisten, Täufer, Hugenotten, Salzburger und Philipponen bildeten einen großen Teil der Bevölkerung Ostpreußens.
Die Aufnahme von Glaubensflüchtlingen war nicht nur eine humane Geste der Obrigkeit, sie entsprang auch praktischen Erwägungen der preußischen Könige. Hatte die Pest das Land entvölkert oder ein Tatareneinfall Dörfer und Städte verwüstet, mussten neue Siedler gewonnen werden. »Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Fiskal nur das Auge darauf halten, das keine der anderen Abbruch tue, daher muss ein jeder nach seiner Fasson selig werden«. Dieser berühmte Ausspruch Friedrichs des Großen begleitete die Geschichte Ostpreußens. Ein weiterer Ausspruch: »… und wenn Türken und Heiden kämen und wollten das Land peuplieren, so wollen wir sie Mosqueen und Kirchen bauen« ist allerdings nicht verwirklicht worden. Die Zuneigung der Ostpreußen zu ihren Königen wurde von diesen nicht immer erwidert. Friedrich II. sprach schon mal von den »Halbwilden« im Osten. »In Königsberg herrschen Müßiggang und Langeweile«, stellte er nach einem Besuch in Ostpreußen fest. Schon sein Vorgänger Friedrich Wilhelm I. »erachtete Menschen für den größten Reichtum« und bot ihnen gern Asyl an. Die religiöse Toleranz Preußens, die zu einem ständigen Zustrom von Flüchtlingen führte, war auch deshalb möglich, weil Preußen nicht zum Römischen Reich gehörte und ein Kurfürst sich 1701 in Königsberg zum »König in Preußen« krönen konnte.
Holländer wurden nach Ostpreußen gerufen, weil sie sich auf die Regulierung von Flüssen und Sümpfen und den Bau von Windmühlen verstanden. Eine ganze Stadt erhielt ihren Namen: Preußisch-Holland. Viele kamen, weil im Nordosten eine freiere Luft wehte ohne die Zwänge der Religionen und Zünfte. Es brachen hauptsächlich die auf, die mit den Zuständen in ihren Heimatländern nicht zufrieden waren und die glaubten, in der Fremde eine Existenz aufbauen zu können. Auch Abenteuerlust spielte eine Rolle. Das ferne Preußen bestand aus Seen, Sümpfen und waldiger Wildnis, in der Bären, Wölfe und Elche hausten. Die Menschen wanderten in den »Wilden Osten« aus wie später in den amerikanischen »Wilden Westen«. Im Kaiserreich gab es allerdings auch eine Wanderungsbewegung in die andere Richtung. Zweite und dritte Söhne der masurischen Bauern gingen in die Kohlengruben des Ruhrgebiets. Für sie kamen polnische Wanderarbeiter auf die Güter und Felder Ostpreußens.
Große Menschenbewegungen brachten die Kriege. Im Nordischen Krieg lagerten die Schweden mehrere Jahre in Ostpreußen. Die Tataren brachten bei ihren Einfällen nicht nur Feuer und Totschlag in die Provinz, sondern auch ihr asiatisches Blut. Im Siebenjährigen Krieg hielt die Zarenarmee Ostpreußen mehrere Jahre besetzt. Friedrich II. trug es seinen Ostpreußen nach, dass sie der Zarin den Huldigungseid geleistet, russische Offiziere Königsberger Kaufmannstöchter geheiratet und mit ihren Kinder gezeugt hatten. Vielfältig waren die Verbindungen zu Russland. Im sogenannten Befreiungskrieg gegen Napoleon gab es eine preußisch-russische Waffenbrüderschaft. 1914 besetzte die Zarenarmee die Hälfte Ostpreußens, 1941 erfolgte von Ostpreußen aus der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, 1945 fiel die Rote Armee in Ostpreußen ein. Nicht nur russisches Blut kam in die preußische Provinz, es gingen auch Preußen ins Reich des Zaren. Zahlreiche Generäle des Zaren waren preußischer Abstammung. Als nach den Schlachten von Jena und Auerstedt auf Anordnung Napoleons die preußische Armee reduziert werden musste, traten zahlreiche Offiziere in russische Dienste. Nach den französischen Hugenotten waren es später französische Soldaten, die in Ostpreußen blieben. Zum Sommeranfang des Jahres 1812 brach die Große Armee von Ostpreußen auf nach Moskau. 129 Jahre später, fast am gleichen Junitag, versuchte es ein neuer Imperator noch einmal. Und die Rückkehr immer im tiefsten Winter. Als die Große Armee aus Russland zurückflutete, hat es den einen oder anderen Soldaten wohl verlangt, in einer warmen Bauernstube zu nächtigen und das Ende des furchtbaren Ringens in einem warmen Bett abzuwarten. Franzosenkinder wurden geboren. Niemand sah ihnen an, woher die Väter kamen.
Was zog die Schweizer aus ihren Bergen ins nordöstliche Flachland? Nicht nur reformierte Glaubensflüchtlinge aus der Schweiz siedelten im Norden Ostpreußens. Schweizer wurden auch gerufen, um dort die Milchwirtschaft aufzubauen. Sie erfanden den Tilsiter Käse. Ihretwegen wurden alle Melker auf den Gütern bis 1945 »Schweizer« genannt.
Während und nach dem Ersten Weltkrieg kamen die Wolhyniendeutschen nach Ostpreußen. Sie hatten in der russischen Provinz Wolhynien gesiedelt und wurden wegen der Kriegsereignisse vertrieben.
Bis zur Judenemanzipation 1812 durch Hardenberg lebten nur wenige Juden in Ostpreußen. Jüdische Händler kamen allerdings öfter aus Polen und dem Litauischen mit ihren Wägelchen über die Grenze, um Handel zu treiben. Als die Juden in Deutschland gleichberechtigte Bürger wurden, die sich überall niederlassen konnten, entstand in Königsberg ein jüdisches Zentrum. Eine Statistik aus dem Jahre 1848 über die Bewohner des Regierungsbezirks Königsberg nannte 5124 Personen, die der mosaischen Religion angehörten. Als 1896 eine neue Synagoge in Königsberg eingeweiht wurde, hielt der Königsberger Oberbürgermeister Brinkmann eine Festrede, in der er sagte:
Hier in Königsberg leben die Bekenner aller Religionen und aller Konfessionen in Frieden und Eintracht neben- und miteinander.
Das ging gut bis zu den Unheiljahren des Dritten Reiches. Viele Königsberger Juden wanderten in den Dreißigerjahren nach England aus, darunter ein Mädchen namens Lea, das später die Frau des israelischen Premierministers Rabin wurde.
Die Provinz Ostpreußen ist von den unterschiedlichsten Völkern besiedelt worden, was zu einer einzigartigen Vermischung geführt hat. Es entstand eine geistige Besonderheit, eine europäische Gemeinschaft im Kleinen, die in ihrer Toleranz auch eine bemerkenswerte Vielsprachigkeit duldete. Die letzte Völkerwanderung kam 1944/45 über das Land, nun von Ost nach West. Die durch Krieg, Flucht und Vertreibung menschenleere Provinz wurde von Osten her neu besiedelt. Was die russischen Neusiedler empfanden, die 1946 in Königsberg ankamen, sagt folgender Text:
Man entlud den Zug an zwei Holzbaracken, dort war auch der Wartesaal. Ich ging auf die Straße. Rechts und links war Sumpf, vor mir lagen Trümmer. Ich ging zu einer Brücke und schaute mich um. Ringsum Stille und Ruinen … Über der Stadt kein einziges Rauchwölkchen, kein Auto, kein Mensch, nur Ruinen. Eine solche Einöde.
Die Innenstadt Königsbergs zählte 1940 5000 Gebäude. Als die Neusiedler in Königsberg aus dem Zug stiegen, fanden sie 161 bewohnbare Häuser im Zentrum der Stadt.
Der Pestreiter
Als die Dunkelheit von Osten heraufzog, watete er, das Pferd am Zügel führend, durch den Grenzfluss, verweilte kurze Zeit im hohen Gras, bis er sich auf den Rücken des Tieres schwang und zum nächsten Dorf preschte. Es kostete ihn Mühe, das Pferd auf dem Dorfplatz zum Stehen zu bringen. Kinder liefen aus den Häusern und musterten den sonderbaren Besucher. Niemand kannte den Fremden. Er war von kleiner Statur, hatte ein rundes Gesicht, das von schwarzen Flecken entstellt war. Am Gürtel hing ein krummer Säbel, den Kopf bedeckte eine Lederkappe.
Sie erwarteten, dass er sich erklären werde, aber bevor er ein Wort hervorbringen konnte, fiel der Reiter vom Pferd. Als sie sich über ihn beugten, sahen sie, dass er tot war. Das Tier stand noch eine Weile mit gesenktem Kopf neben seinem Herrn, dann fiel es auch zu Boden. Darüber waren die Leute so erschrocken, dass sie schreiend in ihre Hütten rannten und die Türen verriegelten. Den toten Reiter und sein Pferd ließen sie auf dem Dorfplatz zurück in der stillen Hoffnung, über Nacht werde der Spuk verschwinden.
Kaum ging die Sonne auf, eilten sie zum Dorfplatz, fanden dort die Leichen des Mannes und des Pferdes, über die sich die Ratten hergemacht und Löcher in die Leiber gefressen hatten. Sie wussten sich keinen besseren Rat, als trockenes Reisig zu holen, es über die Kadaver zu werfen und sie anzuzünden. Das Feuer brannte den ganzen Tag, Pestgestank zog die Straße entlang, und am Abend kratzten einige Männer die Asche zusammen, fuhren sie in den Wald, um sie in einem Erdloch zu verscharren. Noch tagelang redeten sie über den sonderbaren Reiter. Welche Botschaft hatte er ihnen bringen wollen? War er der Bote eines Unheils, das von Osten heraufzog?
Nach ein paar Tagen erkrankte ein Kind; an Gesicht, Armen und Beinen zeigten sich schwarze Flecken. Noch vor Michaelis starb es. Kaum lag es unter der Erde, kam weiteres Unglück ins Dorf. Hier erkrankte eine Frau, dort ein alter Mann. Auch als der Pfarrer von Haus zu Haus ging, die Bewohner segnete und die Türen mit Weihwasser besprengte, nahm das Sterben kein Ende. Einige Frauen rannten mit ihren Kindern zu Verwandten in die Nachbardörfer, verbreiteten dort die Kunde von dem Unheil, das von Osten über den Grenzstrom gekommen war. Bald zeigte sich auch dort die sonderbare Krankheit; den Pfarrer streckte es zu Martini nieder.
Wer konnte, floh aus den Grenzdörfern zum Meer hin, wo die Krankheit – so wusste es ein Gerücht – sich im Wasser totlaufen würde. Einige setzten auch mit Kähnen über das Haff, hoffend, im weißen Sand der Dünen gäbe es die Krankheit nicht. Aber auch dort kroch der Schwarze Tod aus dem Wasser und wanderte in die Fischerdörfer. Nidden wurde menschenleer und sein Friedhof zum größten Pestfriedhof der Gegend. Bald verbreiteten sich sonderbare Gerüchte. Ein wandernder Tuchhändler wollte riesige Rattenscharen gesehen haben, die aus menschenleeren Ortschaften aufbrachen und den fliehenden Menschen folgten. Nach den Ratten werden die Tataren kommen und die umbringen, die die Krankheit überlebt haben, hieß es. Einer wollte gesehen haben, wie ein Jude, der mit einem Bauchladen über Land gekommen war, giftiges Pulver in die Brunnen schüttete. Ein anderer spielte so lustig auf seiner Flöte, dass die Rattenschwärme ihm folgten.
Als das Sterben kein Ende nehmen wollte, läuteten sie Tag und Nacht die Kirchenglocken, unternahmen Prozessionen zu den Stätten der Heiligen, doch der Schwarze Tod war schon vor ihnen da. Die Hälfte der Bewohner Preußisch-Litauens brachte er unter die Erde, die Überlebenden wagten sich nicht mehr auf die Felder aus Furcht, sie könnten ihm begegnen. Erst zwei Jahre später verzog sich die Pest in andere Gegenden.
Nach diesem Unglück schickte die Obrigkeit Boten in fremde Länder, die um Menschen warben. Sie sollten kommen, um die fruchtbaren Gegenden zwischen Memel und Pregel wieder zum Blühen zu bringen. Die heraufkamen, besaßen ein großes Gottvertrauen und wurden mit reichen Ernten belohnt. Sie erweckten die Memelniederung zu neuem Leben, doch blieb die ständige Furcht vor dem Unheil, das aus dem Osten gekommen war, und vor denen, die die Brunnen vergiften.
In der Poscherun’schen Mühle
Am vorletzten Tag des Jahres – gerechnet nach preußischer Zeit – ging Perkun zum Fluss, um das Eis zu prüfen. Der strenge Frost, der seit Wochen herrschte, hatte die Räder seiner Wassermühle zum Stillstand gebracht, dem Müller Perkun war die Arbeit ausgegangen. Vom Ufer aus erblickte er zwei Dragoner, die den Eingang seiner Mühle bewachten. Ihre Pferde hatten sie ans Holz gebunden, die Pistolen steckten im Halfter, die Lanzen im Schnee. Was hatten diese Krieger mit seiner Mühle zu schaffen?
Perkun rechnete die Reiter dem 10. Preußischen Korps zu, das mit den Franzosen gegen den Zaren gekämpft und nach dem Rückzug der Großen Armee im nahen Tauroggen Quartier gefunden hatte. Preußische und russische Vorposten standen sich auf den Feldern vor der Stadt gegenüber, mochten aber nicht mehr gegeneinander kämpfen. Perkun hoffte, das werde so bleiben, denn unter kriegerischen Umständen leiden vor allem die Mühlen.
Das ist meine Mühle, sprach er die Dragoner an.
Es ist besser, in deine Hütte zu gehen und den Tag zu verschlafen, rieten sie ihm.
Ich muss aber Schrot mahlen, antwortete er.
Das Schrot kann warten! In deiner Mühle wird heute Geschichte geschrieben. Dazu braucht es kein Schrot.
Da Perkun der Weltgeschichte nicht im Wege stehen wollte, verfügte er sich wie befohlen zurück über das Eis. Doch bevor er sein Haus erreichte, riefen sie ihn.
Es werden hohe Generäle eintreffen! Da es gar zu kalt ist, solltest du in der Mühle ein Feuer machen, damit es den Herren angenehm ist.
Perkun kehrte um, kniete vor der Feuerstelle, gab Reisig und festes Holz hinein, auch ein paar Tropfen Petroleum. Dann zündete er die Lunte. Rauch stieg auf, entwich durch die Luke im Dach und zeigte aller Welt, dass in der Poscherun’schen Mühle Leben herrschte.
Wir brauchen noch einen Tisch und Stühle, denn die Herren müssen lesen und schreiben und bei ihren Geschäften bequem sitzen, erklärte einer der Dragoner.
Zu dritt gingen sie in Perkuns Hütte, um die gewünschten Möbelstücke über das Eis zu tragen. Sie verlangten auch nach einer Petroleumlampe, weil die Herren für ihre schriftlichen Arbeiten Licht brauchten.
Während Perkun Holzscheite ins Feuer gab und Schrotsäcke zum Mühlentrichter schleppte, ging über Tauroggen die Sonne auf, wie immer um diese Jahreszeit verspätet. Mit dem Sonnenlicht erschien, hoch zu Pferde, einer der angekündigten Generäle, begleitet von zwei Offizieren. Die Offiziere besprachen sich mit den Dragonern, der General verharrte auf einer Anhöhe, blickte übers verschneite Land zu jenem Fluss, der von Russland kommend dem Kurischen Haff zuströmte, nun aber tot unter dem Eis lag. Danach spazierte er, den Kopf gebeugt von schweren Gedanken, im Schnee auf und ab, umrundete die Mühle und forderte Perkun auf, seinem Pferd Schrot zu geben.
Unser König wird es dir danken, sagte der General.
Perkun fragte, ob noch weitere Dienste gefällig seien. Seine Frau könne, wenn die Herren es wünschten, ein kräftiges Essen zubereiten. Auch wollte er einen Wasserkessel über das Feuer hängen, um Tee aufzugießen oder einen Grog zu rühren. Wenn hier große Geschichte geschrieben wird, ist es angebracht, diese mit einem kräftigen Schluck zu begießen, dachte er.
Sie schickten ihn fort. Wenn er gebraucht werde, wolle man ihn rufen, sagten die Herren.
Gehört ihr zu Napoleon oder zum Zaren?, fragte Perkun im Weggehen.
Wir sind Preußen, antwortete einer der Dragoner. Dabei soll es auch bleiben.
Von seiner Hütte aus erblickte Perkun drei Reiter in russischen Uniformen, die sich in leichtem Trab der Mühle näherten. Ihr Oberster, ein junger General, wurde von den Dragonern begrüßt. Obwohl sie Feinde waren, taten sie freundlich miteinander. Die Gruppe stand eine Weile auf der Anhöhe und betrachtete die schneebedeckte Landschaft. Danach begaben sich sechs Herren ins Innere der Mühle, die beiden Dragoner bewachten weiter den Eingang und die Pferde.