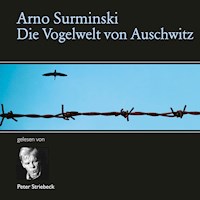18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ostpreußen im Jahr 1812. Martin Millbacher, Sohn eines Bauern an der Memel, lässt sich vom Glanz der Armee der "Zwanzigsprachigen" verführen und zieht mit westfälischen Kanonieren für Napoleon in den Krieg. Er hofft auf Abenteuer und reiche Beute, doch sein Weg nach Moskau und zurück hält anderes für ihn bereit. Er gerät in die Schlachten von Smolensk und Borodino, erlebt die Feuersbrunst von Moskau und schließlich das massenhafte Sterben an der Beresina wie im litauischen Wilna. Sprachgewaltig erzählt Arno Surminski vom Schicksal des jungen Ostpreußen in den Wirren des napoleonischen Russlandfeldzugs. Sein Roman ist lebendige Geschichte, nicht aus der Sicht von Generälen und Monarchen, sondern aus der Perspektive der einfachen Soldaten. Kein Ruhmesblatt für die Herrscher, die für die Kriege verantwortlich sind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Arno Surminski
Der lange Weg
Von der Memel zur Moskwa
Roman
© für die Originalausgabe und das E-Book: 2019 LangenMüller in der
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Studio LZ, Stuttgart
Umschlagmotiv: akg-images, Berlin
Lektorat: Tanja Frei, München
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-3508-4
www.langen-mueller-verlag.de
Nur das Geschriebene geht in die Geschichte ein.
Zu Hause am Memelbogen
Im Dorfe Jorate, am Ufer des großen Stromes gelegen, der als Njemen von Osten daherkommt und als Memel dem Kurischen Haff zustrebt, lebte vor mehr als zweihundert Jahren ein Mann namens Anton Millbacher, dessen Vorfahren aus den Salzburger Bergen, einem Ruf des Königs folgend, nach Preußisch-Litauen gekommen waren. Millbachers Vater hatte in der Insterburger Gegend eine Windmühle betrieben. Als diese in einer Gewitternacht abbrannte, lud er die Familie auf einen Leiterwagen und zog weiter zum Memelstrom, wo er in einem anderen Gewerbe sein Glück versuchen wollte. Er kaufte mit geborgtem Geld eine Bauernkate, dazu Wiesen im Memelbogen und Ackerland, auf dem Kartoffeln und Korn wachsen sollten. Als er seine Schulden beglichen hatte, starb er an einem Neujahrsmorgen und hinterließ seinem Sohn Anton den Hof, der weit entfernt lag von den Salzburger Bergen, auch von dem Hügel, auf dem Millbachers Mühle gestanden hatte. Bis zum Ende seiner Tage hatte er jenes Deutsch gesprochen, das ihm aus den Bergen gefolgt war, was aber nicht sonderlich auffiel, denn in jener Gegend hörten sie viele Sprachen. Sie nannten ihn Soltbörger und fragten zum Spaß, wo er sein Salz vergraben habe.
Agnes Millbacher gebar ihrem Mann Anton zwei Söhne, Gregor und Martin, die Geburt des Jüngsten überlebte sie nicht. Nach ihrem Tode versorgte die Magd Berta Haus und Garten, während Anton Millbacher seinen bäuerlichen Arbeiten nachging, des Sommers mit den Söhnen, die er schon früh zur Arbeit anhielt, auf den Memelwiesen schaffte und wintertags in den Wäldern Holz schlug, das er über den gefrorenen Strom nach Hause fuhr. Für eine Schule war Jorate nicht groß genug, deshalb gingen die Söhne in das eine halbe Stunde Fußweg entfernte Paskalwen zum Lehrer Jablonski, der viel vom Alten Fritz erzählte, an dessen Schlacht von Kunersdorf er teilgenommen hatte. Sie lernten in deutscher Sprache; ein paar litauische Wörter fielen ihnen beim Spielen mit Kindern zu, die von der anderen Seite des Stromes kamen.
Der Landmann Anton Millbacher diente dem König, der seine Vorfahren nach Preußisch-Litauen gerufen hatte, mehr aber noch Jesus Christus, um dessentwillen sein Vater aus dem Salzburgischen geflohen war. In dieser Zweieinigkeit eines himmlischen und eines irdischen Königs fühlte er sich geborgen und hielt darauf, seine Söhne im gleichen Geist zu erziehen. Oft erzählte er ihnen von seinem Vater, der vor Jahren, als russische Truppen in Ostpreußen einzogen, den Treueeid auf die Zarin verweigerte und dafür mit zehn Stockhieben traktiert worden war. Diese Prügel erfüllten ihn bis zum Lebensende mit Stolz. Während der preußische Adler auf allen amtlichen Gebäuden durch den russischen Doppeladler ersetzt wurde, die Pfarrer für die Zarin beten mussten und auf den Friedhöfen russische Grabkreuze erschienen, hielt Millbacher zum preußischen König. Er hoffte, der Alte Fritz werde nach dem Abzug der Russen zu seinen treuen Untertanen nach Preußisch-Litauen kommen. Aber der König kam nicht. Er nahm es ihnen übel, dass sie seiner Feindin gehuldigt und die Königsberger Damen zaristische Offiziere geheiratet hatten. So blieb die Königstreue des alten Millbacher unbelohnt, und Anton Millbacher erzählte die Geschichte immer wieder seinen Söhnen, trug ihnen auch auf, sobald sie schreiben konnten, die Sache mit dem Alten Fritzen und seinem Vater zu Papier zu bringen, denn nur das Geschriebene geht in die Geschichte ein.
Auch in Dürrezeiten litten sie an der Memel keine Not, der Fluss spendete reichlich Wasser. Seine Wiesen schnitt Millbacher dreimal in jedem Sommer. Wenn er gar zu viel erntete, schickte er Heukähne den Strom abwärts bis zur Kurischen Nehrung, wo es an Heu mangelte, aber Sand reichlich gab. Die Milch, die ihm seine Kühe gaben, brachte ein Milchkutscher jeden Tag nach Paskalwen. Anton Millbacher fuhr sonnabends zweispännig zum Turgus nach Tilsit, um Butter und Käse auf den Markt zu bringen, Tabak für seine Pfeife und Petroleum für die Lampen zu erstehen. An großen Feiertagen klapperte sein Wagen auch in die andere Richtung auf Ragnit zu, begleitet von Gregor und Martin, die am Fährufer auf die Pferde achtgeben mussten, während der Vater seinen Geschäften nachging. Gern hielten sich die Jungs am Wasser auf und sahen zu, wie Fuhrwerke, Fußgänger, Schafe und Rinder den Strom überquerten. An warmen Sommertagen badeten sie unweit des Fähranlegers und ritten auf Baumstämmen, die aus Russland flussabwärts gekommen waren. Anton Millbacher verbot ihnen, zum gegenüberliegenden Ufer zu schwimmen. Das Reich des Zaren, obwohl christlich regiert, kam ihm düster und furchterregend vor, von Wölfen, Bären und wilden Reitervölkern bewohnt. Gelegentlich trieben Wasserleichen stromabwärts und erschreckten die Kinder, die am Ufer spielten.
Bei seinen Fahrten nach Tilsit kaufte Millbacher regelmäßig eine Gazette und ließ sich von seinen Söhnen vorlesen. So erfuhr er von den Unglücksfällen und Feuersbrünsten, die sich in der Welt ereignet hatten, von schweren Stürmen und Schiffsuntergängen, denn die Gazetten legten es darauf an, nur das Unheil zu beschreiben. Sie verschwiegen alles Gute und Schöne, das Gott geschehen ließ. Immerhin meldeten sie eines Tages, der preußische König sei mit der Königin Luise ins Memelland gekommen, um Zar Alexander zu treffen, und zwar hoch zu Ross auf halbem Wege zwischen Polangen und Memel. Anton Millbacher wäre bei dem Treffen gern dabei gewesen, doch als er davon erfuhr, waren die Herrschaften schon abgereist.
Der Sohn Gregor war in dem Jahr auf die Welt gekommen, als sie in der fernen Stadt Paris ein Gerät erfanden, das den Kopf eines Menschen schnell und schmerzlos vom Körper trennen konnte. Martin wurde vier Jahre später geboren, als jenes Gerät schon viel Blut vergossen hatte. Gewisse Neuigkeiten brachten auch die Postkutscher mit, die von St. Petersburg kamen und vor der Weiterfahrt nach Königsberg und Berlin an der Memel Station machten. Sie berichteten von einem Menschen namens Bonaparte, der großen Ruhm in Italien und Ägypten erworben hatte und wohl bald auch nach Osten aufbrechen würde. In Preußisch-Litauen kümmerten sie sich wenig um die fernen Siege, sondern verweilten bei den Schlachten des Alten Fritzen. Jablonski erzählte immer wieder, wie er bei Kunersdorf einen Arm verloren hatte. Der fehlende Arm hinderte ihn daran, seinen Schulmeisterpflichten mit dem Rohrstock nachzukommen. Wenn es doch geschehen musste, bestellte er zwei große Jungs ein, die den Delinquenten festhielten, während er mit der Hand, die noch da war, dreinschlug. Bei Jablonski lernten sie das Rechnen bis hundert, das Schreiben ihres Namens und das Lesen so gut, dass es für die Heilige Schrift und die Tilsiter Gazetten reichte. Sie lernten es in deutscher Sprache, obwohl in ihrer Gegend viele lebten, die sich Litauisch unterhielten und jenseits des Stromes das Litauische die gebräuchlichste Sprache war. Aber der Jablonski kannte diese Sprache nicht, deshalb mussten auch die Kinder, die zu Hause litauisch sprachen, bei ihm Deutsch lernen.
Von der anderen Seite der Memel blickte die einzige Erhebung weit und breit herüber, der heilige Berg Rombinus, an dessen Opferstein die Menschen, als sie noch Heiden waren, ihr Blut gegeben hatten. Auch als die Litauer sich zum Christentum bekehrten, hielten sie heimlich an den alten Bräuchen fest und feierten Christi Himmelfahrt am Opferstein des Rombinus. In der Pestzeit zogen sie, als alles Beten und Singen nicht helfen wollte, zu den heidnischen Göttern am Berg. Danach verzog sich die Pest zu anderen Gegenden.
Ihre Jugendjahre verlebten die beiden Söhne in stiller Abgeschiedenheit. Abwechslung brachten die Moritatensänger und Lumpensammler, die mit dem Einspänner durchs Dorf klapperten, ferner die natürlichen Sonderbarkeiten, so der Brand einer Scheune nach einem Blitzschlag oder die jährlichen Überflutungen der Memelwiesen nach der Schneeschmelze. Anton Millbacher, dessen Vorfahren die Salzburger Berge bestiegen hatten, wunderte sich bis zum Ende seiner Tage, warum Gott dieses sonderbare Land so flach gehalten und dem Schmelzwasser keinen raschen Abfluss ermöglicht hatte. Nach dem Krachen des Eises auf der Memel, das stromauf und stromab zu hören war, und dem morgendlichen Ruf »Das Eis geht!«, füllten sich die Wiesen und Gärten mit Wasser. Wochenlang stand die Memel vor den Haustüren, überflutete Wege und Stege, verschonte nur die Wohnhäuser und Stallungen, die zum Schutz vor dem Wasser auf leichten Erhebungen errichtet worden waren. Für die Kinder war es die Zeit des Kahnchenfahrens, wenn sie mit langen Stangen durch die Gärten stakten. Jablonskis Schule umzingelte das Hochwasser, sie war für die Kinder wochenlang nicht zu erreichen.
An Sommertagen ritten die beiden Jungs sonntags nach dem Gottesdienst oft unter den alten Weiden am Memeldeich so weit nach Osten, bis sie hinter Ragnit auf der anderen Seite des Stromes Kosaken erblickten, die ihnen mit ihren Säbeln zuwinkten und Uräh schrien. Sie fürchteten sich nicht vor den fremden Kriegern, von denen jeder wusste, dass sie wilde Reiter waren, die dem Zaren dienten. Vor allem Martin, der Jüngere, hielt sich gern bei den Kosakenpferden auf, die klein und zottelig aussahen, aber eine wilde Natur hatten. Einmal ritt er in den Strom, der drei Steinwürfe breit war, und wurde auf der anderen Seite von Kosaken eingefangen. Sie wollten ihn gehörig verprügeln, aber als sie sahen, dass er noch ein Kind war, gaben sie ihm scharfes Zeug zu trinken und schickten ihn samt Pferd zurück zum preußischen Ufer.
Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
Heraklit
Wie der Krieg an die Memel kam
Eine Kanonenkugel, im Herbst des Jahres 1806 abgefeuert, schreckte Jorate auf. Sie explodierte auf den Feldern vor Jena und traf dort den Landmann Friedrich Lukat aus Jorate, der als Grenadier dem preußischen König diente. Es verstörte die Leute sehr, dass nichts von Friedrich Lukat übrig geblieben war, das in heimischer Erde begraben werden konnte. Der Pfarrer sprach bewegende Worte und machte einen gewissen Napoleon für den Tod des Mannes aus Jorate verantwortlich. Martin, der hinter der Friedhofshecke kauerte, hörte diesen sonderbaren Namen, der ihm schon einmal in einer Gazette begegnet war. Sein Vater sagte, Napoleon sei der Antichrist, der die Welt mit Krieg überziehen wolle. Die Trauergemeinde für Friedrich Lukat betete, der Antichrist möge nie bis zur Memel gelangen.
Doch das Kriegsgeschrei rumorte nun einmal in der Welt, es wurde lauter und lauter. Es kam von Süden herauf, selbst der beginnende Winter konnte es nicht aufhalten, bald rumorte es in Polen und am Weichselstrom. Kurz vor Weihnachten zog der Antichrist unter dem Jubel vieler Menschen in Warschau ein und ließ nicht weit entfernt zum Christfest eine blutige Schlacht gegen die Zarenarmee schlagen. Die verschlammten Wege, die Kälte, die Erkrankungen vieler Soldaten hielten ihn nicht davon ab, weiter nordwärts zu marschieren, um den preußischen König heimzusuchen. Der hatte die Söhne Preußens zu den Waffen gerufen und war mit seiner Königin auf dem Wege in seine zweite Hauptstadt Königsberg. Dort wollte er residieren, bis die französischen Eindringlinge vertrieben waren. Bevor er Königsberg erreichte, fand er Herberge in einer ärmlichen Hütte in Ortelsburg, wo er eine Schrift verfasste, die als Ortelsburger Erklärung in die Geschichte eingehen sollte. In ihr beschuldigte er seine Offiziere, die preußischen Festungen kampflos den Franzosen überlassen zu haben, und kündigte standrechtliche Erschießungen an, sobald er dazu in der Lage sei. Tief war das stolze Preußen gesunken. Besonders schmerzte den König, dass er auf Befehl Napoleons seine Armee arg verkleinern musste. Daraufhin traten viele seiner Offiziere in die Dienste des russischen Zaren, weil sie einem König von Napoleons Gnaden nicht dienen mochten. Nachdem er seinen Ärger in der »Ortelsburger Erklärung« kundgetan hatte, reiste der König weiter nach Rastenburg, verbrachte dort eine Nacht in einem Bürgerhaus und begab sich auf den Weg nach Königsberg.
Auch in Jorate spürten sie die Unruhe. Russische Truppen kamen über die Memel, um dem preußischen König gegen Napoleon beizustehen. Martin saß mit anderen Schuljungen auf dem Deich und sah zu, wie sie den Fluss überquerten. Besonders die Kosaken mit den struppigen Pferden hatten es ihm angetan. Anton Millbacher sprach mit den Offizieren, die sich in gutem Deutsch verständigen konnten. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Russen auch Christenmenschen waren, schloss er seinen Frieden mit den Besuchern.
Martin, der von klein auf eine Zuneigung zu Pferden hatte, sah zu, wie Hunderte edler Tiere von Insterburg heraufkamen, schwimmend die Memel durchquerten und weiter ins Russische getrieben wurden. Von den Begleitern hörte er, dass sie von dem preußischen Gestüt Trakehnen kämen und den Auftrag hätten, die Pferde vor den anrückenden Franzosen in Sicherheit zu bringen.
Wenn schon die Pferde fliehen, wird dieser Bonaparte nicht mehr weit sein, sagte Anton Millbacher.
Das Weihnachtsfest verlebten sie noch in Frieden. Als Martin den Wunsch äußerte, eine Schlacht aus der Nähe anzuschauen, bekam er von seinem Vater zwei Ohrfeigen. Das sei nichts für kleine Jungs.
Von der Schlacht, die am zweiten Weihnachtstag nahe Warschau geschlagen worden war, erfuhren sie in Jorate erst im neuen Jahr. Da die Russen zurückgingen und die Franzosen näher kamen, konnte sich jeder denken, wie das Treffen ausgegangen war. Kurische Fischer, die gelegentlich die Memel heraufkamen, erzählten von der Königin, die mit ihren Kindern vor den Franzosen aus Königsberg über die Nehrung und das Haff nach Memel geflohen sei. Übers Eis sei der Schlitten gejagt, und die Königin habe arg gefroren. Der Scherenschleifer Rudies, der viel über die Dörfer ging, traf einen Trupp französischer Reiter. Sie waren freundlich zu ihm und ließen ihn seine Pfeife aus ihrem Tabaksbeutel stopfen.
Mit den Schlachten nahm es kein Ende. Im Februar, als die Erde noch unter Schnee lag, das Memeleis Pferdefuhrwerke trug und die Zugvögel noch nicht an die Heimkehr dachten, kam es zur Schlacht bei Eylau. Der Kirchendiener von Paskalwen behauptete, er habe vom Turm seines Gotteshauses den Kanonendonner gehört, auch etliche Brände gesehen, was die meisten bezweifelten, weil der Ort der Schlacht an die hundert Kilometer entfernt lag. Der alte Millbacher wunderte sich nur, dass die Franzosen, denen ein Leben in Sonnenschein und warmer Luft nachgesagt wird, im kalten Nordosten Preußens Winterschlachten schlagen konnten. Er tröstete sich mit dem Spruch: Dieser Napoleon wird sich noch wundern, was für ein Held der General Winter ist.
In den Tagen nach Eylau verließ Gregor, der Älteste, die Schule, sagte Gebote und Glaubensbekenntnis auf und wurde am Osterheiligabend zur Konfirmation zugelassen. Ihm stand, so schrieben es die Gesetze vor, der Hof zu, sollte der Vater sterben oder sich auf der Ofenbank niederlassen. Da der alte Millbacher fürchtete, seine Söhne könnten Gefallen am Soldatenleben finden, das sich nun auch im Memelland ausbreitete, ermahnte er sie, sich von Krieg und Kriegsgeschrei fernzuhalten. Gregor gehöre als Bauer auf den Hof und nicht ins Schlachtgetümmel, und der kleine Martin sei für Kriegsspiele noch viel zu jung.
Hoch zu Ross
Während der Heuernte hörten sie von Süden her Kanonendonner. Als Tage später russische Soldaten zurückfluteten, war die Schlacht von Friedland entschieden. Und wieder hatte Napoleon gesiegt. Bei Ragnit setzten die russischen Truppen über die Memel. Die Geschlagenen waren längst nicht mehr so freundlich zu den Kindern wie zuvor und ließen sich nur mit Mühe davon abhalten, Ragnit in Brand zu setzen. Armeen auf dem Rückzug neigen zum Vandalismus, erklärte Schulmeister Jablonski, der es wissen musste von den Schlachten des Alten Fritzen. Die Schulkinder lagerten am Straßenrand und sahen dem Abzug der Russen zu, bis Jablonski ihnen dieses Maulaffenfeilhalten verbot. Die Kosaken nehmen kleine Jungs und Mädchen mit in ihre Steppe, sagte er. Und das auf Nimmerwiedersehen.
Die Russen überquerten mit Kähnen oder schwimmend die Memel, einige ließen sich auch von ihren Pferden durchs Wasser tragen. Kanonen und Proviantwagen wurden mit der Fähre über den Fluss befördert. Auf der anderen Seite, unweit des heiligen Rombinus, errichteten sie ihr Lager. Dort brannten die Feuer Tag und Nacht, und der Gesang tiefer Männerstimmen wehte über den Strom. Weil sie verloren hatten, sangen sie nur traurige Lieder. Es wird ein Unglück geben, sagten die Alten. Die Geister des Rombinus werden so lange rumoren, bis Felsbrocken in den Fluss stürzen, Flutwellen das russische Lager überschwemmen und sich auf den Memelwiesen ausbreiten.
Der Krieg ist zu Ende, verkündeten die Kirchenglocken, und alle erwarteten den Einzug des Siegers. Gescheite Leute wussten es längst: Napoleon und Zar Alexander wollten sich am Memelstrom treffen, um den ewigen Frieden zu beschließen. So geschah es, jedenfalls das Treffen; mit dem ewigen Frieden zog es sich noch etwas hin. Mit Trommeln, Pauken und Trompeten hielt die Weltgeschichte Einzug ins Memelland. Napoleons Armee marschierte vom Pregelfluss auf Tilsit zu und war, wie es Siegern geziemt, heiter und guter Dinge. Die Reiter grüßten vom Pferd herab, das Fußvolk machte den Kindern am Straßenrand Grimassen, den Frauen warfen die Soldaten Kusshände zu. Martin war tief beeindruckt von dem Aufzug dieser Armee.
Die Kinder erwarteten, Napoleon werde auf dem Weg nach Tilsit Paskalwen passieren, also an ihrer Schule vorbeikommen. Lehrer Jablonski hielt es nicht für gut, wegen eines Kaisers – dazu noch eines welschen – den Kindern schulfrei zu geben. Also ließ er rechnen, während draußen die Trommeln den Aufzug der Franzosen ankündigten. Nach der Schule liefen die Kinder nicht nach Hause, sondern setzten sich an die Straße, auf der der Herrscher kommen sollte. Einige kletterten in die Bäume. Welch ein herrliches Heer! Farbenfroh geschmückt mit rot leuchtenden, grünen, schwarzen und weißen Röcken. Lanzen und Standarten glänzten im Sonnenlicht, Kanonenrohre zeigten drohend in den Himmel. Kürassiere ritten auf schwarzen Rössern, die noch nie einen Pflug gezogen hatten, hinter ihnen wirbelte Staub auf. Hatte die Schlacht bei Friedland überhaupt keine Opfer gekostet? War sie in herrlichen Kostümen wie auf einer Theaterbühne geschehen? Wenn die Kriege und Schlachten so herrlich ausgestattet sind, können sie dem Zuschauer wohl gefallen.
Martin saß in einem Lindenbaum, während unter ihm die Kanonen, von sechs Pferden gezogen, vorbeirasselten. Trommlerjungen gaben mit ihren Trommelschlägen den Marschierenden den Takt vor. Sie schienen kaum älter zu sein als er und verrichteten ihren Dienst mit großem Ernst, ohne nach rechts oder links zu schauen. Konnte es etwas Schöneres geben, als mit einer solchen Armee trommelschlagend durch die Welt zu ziehen?
Schließlich kam Napoleon. Auf einem Schimmel sitzend, einen dreigezackten Hut auf dem Kopf, einen Degen an seiner Seite, so ritt er durch Paskalwen auf Tilsit zu. Er grüßte nach links und rechts. Die Männer am Weg zogen ihre Hüte und riefen Vivat, die Frauen verneigten sich tief. Wenn sie ihn auch als Antichrist verabscheuten, er war nun einmal der Sieger, und sie mussten sich gut mit ihm stellen. Wer weiß, wozu es dienen konnte? Nur der alte Millbacher schaute nicht hin. Es ist alles eitel, sagte er, griff zu seinem Krückstock und sprach mit den Kühen. Als der Kirchendiener während des Durchzuges von Napoleon die Glocken läuten ließ, eilte Millbacher nach Paskalwen und stellte ihn zur Rede wegen dieses gottlosen Unfugs. Es half nichts, die Glocken läuteten und läuteten.
Seinem Sohn Martin befahl der alte Millbacher, vom Baum zu klettern. Unten angekommen, erhielt er eine Maulschelle und wurde vom Vater bis Sonnenuntergang in die Knechtskammer gesperrt. Vorher hörte Martin noch die Epistel von der Verführung der Jugend durch Pomp und Tand der Mächtigen. Nur dem Herrn Christus und dem preußischen König komme Bewunderung zu, nicht aber diesem hergelaufenen Wengtiner. Und was das weiße Pferd betraf, hielt Millbacher ihm das letzte Buch der Heiligen Schrift vor. Da erschien auch ein Reiter auf weißem Pferd, er hieß aber nicht Napoleon, sondern »Treu und Wahrhaftig«.
Aber er ist doch arg klein, wunderte sich Martin.
Davon kommt alles Unglück, brummte Anton Millbacher. Die Kleinen müssen sich auf hohe Rösser setzen, große Hüte tragen und immer nur siegen. So können sie wettmachen, was die Natur ihnen verweigert hat, Größe nämlich.
Zum ewigen Frieden
Als die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte, kehrte Napoleon in Tilsit ein. Ein Bote Zar Alexanders kam über die Memel, um ein Treffen der beiden Herrscher zu verabreden. Es sollten alle Streitigkeiten beigelegt und ein ewiger Frieden beschlossen werden.
Hätten sie sich vor einem halben Jahr getroffen, könnten die Gefallenen von Eylau und Friedland noch leben, grummelte Anton Millbacher. Für sie kommt der ewige Frieden zu spät.
Das Kaisertreffen in Tilsit interessierte Millbacher nicht sonderlich, aber als er hörte, auch das preußische Königspaar werde dem Friedensfest beiwohnen, machte er sich auf den Weg. Drei irdische Herrscher in der Stadt an der Memel! Wann hatte es das schon mal gegeben? Millbacher hatte seinen König noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen; hier bot sich die Gelegenheit, ihm nahe zu sein.
Mit dem Zweispänner fuhr er in die Stadt, nicht um dem Zaren oder dem Korsen zu huldigen, er fuhr zu seinem König, und seine Söhne durften ihn begleiten. Es wurde eine beschwerliche Reise, denn auf den Straßen tummelten sich Reiter und Soldaten, auch strömte viel Volks in die Stadt, das bei diesem denkwürdigen Ereignis dabei sein wollte. Oft scheuten die Pferde, und Gregor, der Älteste, musste sie vorn am Zügel halten, um sie zu beruhigen. In Tilsit standen die Leute vor den Türen oder hingen aus den Fenstern. Auf dem Platz vor dem Rathaus spielten russische und französische Militärkapellen, Gardesoldaten paradierten, Reiter trabten durch die Straßen. Martin wunderte sich, dass die Soldaten, die vor zwei Wochen bei Friedland aufeinander geschossen hatten, hier so fröhlich vereint umherziehen konnten. Und wie herrlich sie aussahen in ihren bunten Uniformen!
Es kostete den alten Millbacher einige Mühe, mit seinem Fuhrwerk an das Ufer des Flusses zu kommen. Auf den Memelwiesen und neben den in den Strom ragenden Buhnen lagerte viel Volks, das auf den Auftritt der Herrscher wartete. Nachdem er seinen Wagen bei einem befreundeten Schmied untergestellt hatte, ging er mit den Söhnen zum Wasser. Ein Floß im Strom, von beiden Seiten durch kräftige Taue gehalten, rührte sich nicht vom Fleck. Auf dem Floß sahen sie ein Zelt mit Sesseln, Tischen und Bediensteten, die auf die hohen Gäste warteten. An jedem Ufer lag ein Kahn mit kräftigen Ruderknechten, die die Herrscher über den Strom rudern sollten. Endlich traten sie aus ihren Zelten. Der Zar bestieg den Kahn am russischen Ufer, Napoleon sprang ohne Hilfe seiner Diener in den ihm zugedachten Kahn am preußischen Ufer. Er setzte sich nicht auf weiche Kissen wie der Zar, sondern verbrachte die Überfahrt aufrecht stehend.
Er ist ja man klein geraten, sagte der alte Millbacher. Wenn er sich hinsetzt, sieht ihn keiner, darum muss der Korse im Kahn stehen.
Die Menge schrie Vivat, Napoleon lüftete den Hut und winkte, der Zar blickte abwesend ins fließende Wasser. Ob die Jubelrufe auch ihm galten?
Martin und Gregor drängten sich zum Wasser, um dem kleinen, großen Mann nahe zu sein. Sie sahen sein Gesicht, erkannten die scharfen Augen, die schmucke Uniform, den Degen an seiner Seite. Napoleons Kahn erreichte als erster das Floß. Leichtfüßig sprang er aufs Holz, eilte zur anderen Seite, um dem Zaren beim Verlassen seines Kahns behilflich zu sein. Bevor die Herrscher im Zelt verschwanden, standen sie nebeneinander wie ein Bruderpaar und grüßten die Menge am Ufer. Der Jubel kannte kein Ende.
Wo blieb der preußische König? So sehr Anton Millbacher Ausschau hielt, er konnte ihn nicht entdecken. Hatten Kaiser und Zar ihn nicht für würdig befunden, mit am gleichen Tisch zu sitzen? Später entdeckte er am russischen Ufer einen einsamen Reiter, der auf und ab trabte, auch Anstalten machte, sein Pferd in den Strom zu lenken, um schwimmend das Floß zu erreichen; schließlich war es ein preußischer Strom mit einem preußischen Ufer, an dem sich die Herren trafen. Wie konnten sie den preußischen König von ihren Gesprächen ausschließen? Der alte Millbacher packte seine Söhne am Arm und eilte zu Pferd und Wagen. Martin und Gregor wären noch gern am Fluss geblieben, um die Rückkehr Napoleons abzuwarten, aber ihr Vater duldete keinen weiteren Aufenthalt an diesem unwürdigen Ort. So klapperten sie, während hinter ihnen die Musik spielte und die Menge jubelte, schweigend zurück nach Jorate. Millbacher brummelte unverständliche Worte, mit denen er Franzosen und Russen gleichermaßen verfluchte. Sein Zorn legte sich erst, als er vom Scherenschleifer Rudies erfuhr, der Korse habe den König auf dringlichen Wunsch des Zaren doch noch empfangen, sogar der Königin Luise eine viertelstündige Audienz gewährt. Mehr konnte ein König, der alle Schlachten gegen Napoleon verloren hatte, nicht erwarten. So tief war Preußen gesunken.
Das Böse ist in aller Munde, das Gute bleibt stumm.
Unruhige Zeiten
Drei Wochen feierten sie den Frieden, hielten Paraden ab und vergnügten sich bei großen Festen. Zar und Kaiser unternahmen gemeinsame Ausritte am Memeldeich, dabei besprachen sie die Angelegenheiten der Welt. Sie unterhielten sich auf Französisch, der Sprache jener Zeit. Botschafter und Gesandte aus fernen Ländern kamen an die Memel, um den Herren ihre Aufwartung zu machen und zu erfahren, wie er denn beschaffen sei, der ewige Frieden. Nie zuvor sahen die Tilsiter so viele feine Damen in der Stadt spazieren, und die herrlichsten Kutschen klapperten vierelang durch die Straßen. Martin wäre gern nach Tilsit gelaufen, um dem bunten Treiben zuzuschauen, aber sein Vater verbot ihm jedes Maulaffenfeilhalten. Die Umtriebe in Tilsit waren ihm gar zu sündhaft.
Wo aber blieb der preußische König? Hielt er sich in Memel auf oder in Königsberg, oder war er nach Potsdam zurückgekehrt, um den Niedergang Preußens zu betrauern? Ein Gerücht wollte wissen, der wilde Korse habe König und Königin in Festungshaft genommen und werde sie auf eine nordische Insel verbannen. Ach, die liebliche Luise konnte das kalte Wetter des Nordens nur schwer ertragen, für sie wäre eine südliche Insel besser gewesen.
Im hohen Sommer zogen sie ab. Die französischen Soldaten marschierten in Richtung Königsberg, der Zar ging mit seinen Truppen nach Wilna. Der Landstrich zwischen Pregel und Memel blieb so friedlich zurück, als hätten die Herrscher tatsächlich einen ewigen Frieden beschlossen. Die Zugvögel machten sich auf den Weg nach Süden, ebenso die Störche, der Altweibersommer hing in den Sträuchern, und abends kroch von der Memel her Nebel über die Wiesen.
Anton Millbacher war es zufrieden.
Es ist wieder so in unserem Land, wie Gott es geschaffen hat, sagte er.
Martin dachte oft an die aufregenden Tage in Tilsit, das größte Erlebnis seiner Kinderzeit. Wenn er auf dem Pferd saß, spielte er Napoleon, wenn er durch die Wiesen trabte, gehörte er zu den Muratschen Reitern, wenn ein Gewitter aufzog, donnerten die französischen Kanonen. Als es auf den Winter zuging, schreckte er nachts manchmal auf, weil er meinte, die Trommlerjungen zu hören. Doch es war nur das Eis, das auf dem Memelstrom in Stücke barst. Er hoffte, der Kaiser werde zurückkehren, vielleicht schon im nächsten Sommer, und noch größer und herrlicher seines Weges ziehen.
Auch nach seinem Abzug blieb der Korse in aller Munde. Die Leute fragten, was er nun wohl anstellen werde. Seine Große Armee musste beschäftigt werden. Wozu wäre sie nütze? Anton Millbacher ärgerte sich, weil dem Korsen mehr Aufmerksamkeit zuteilwurde als dem preußischen Königspaar. Das Böse ist in aller Munde, das Gute bleibt stumm, schimpfte er.
Als Martin ihn fragte, ob mit dem baldigen Erscheinen Napoleons zu rechnen sei, hob Millbacher abwehrend die Arme.
Gott bewahre!, rief er. Wo der auftaucht, folgt das Unglück auf dem Fuß. Soll er nur bleiben in seinem Frankenreich!
Die Feuersbrunst von Ragnit, die sich im ersten Jahr des ewigen Friedens ereignete, war Aufregung genug. Vielen galt sie als böses Zeichen künftigen Unglücks. So kündigen sich noch größere Feuer an, hieß es. Martin lief mit anderen Jungs zum Paskalwusberg, um das Flammenmeer aus der Höhe anzusehen. Sie sahen Rösser durchs Feuer jagen, hörten Brandglocken läuten und Balken bersten. Der alte Millbacher nahm die Gelegenheit wahr, seinen Söhnen die Geschichte von Sodom und Gomorrha zu erzählen. Er rechnete jede Feuersbrunst dem bösen Tun der Menschen zu und erwartete den Brand von Paris und anderer sündiger Städte noch zu seinen Lebzeiten. Feuer war immer eine Strafe.
Äußerlich war das Land friedlich, aber inwendig rumorte es. Wenn die Kirchgänger nach dem sonntäglichen Gottesdienst zusammenstanden, sprachen sie über den kleinen, großen Mann. Was mochte er anstellen mit seinem Heer? Dass er den in Tilsit geschlossenen ewigen Frieden in seinen Schlössern und Parks lustwandelnd genießen konnte, glaubte niemand. Müßiggang gehörte nicht zu seiner Natur, dieser Mensch musste immer etwas unternehmen. Da sein Handwerk der Krieg war, würde er auf weitere Schlachten sinnen, immer mit dem Versprechen, es sei der letzte Kampf, danach komme der ewige Frieden.
Martin war traurig, weil Napoleon nicht zurück an die Memel kam. Die Gazetten schrieben von seinen Schlachten in Spanien und anderen Gegenden. Einige meinten, er werde Konstantinopel erobern und von dort aus mit einem kühnen Handstreich Moskau einnehmen, auf dem Rückweg zum Memelfluss kommen, um sich von den Bewohnern Tilsits noch einmal huldigen zu lassen. Andere sahen Napoleon auf einem Elefanten nach Indien reiten, um ein neues Reich zu gründen. Von dort war es nicht weit bis zum Kaiser von China. Ach, Martin wäre gern dabei gewesen, aber er musste in Jablonskis Schule die Schlachten des Alten Fritzen aufsagen.
Auch der Pfarrer sprach weniger vom ewigen Frieden als von dem Rumor, der übers Erdreich gekommen war und sogar das Heilige Land, Ägypten und Iberia erfasst hatte. Er dankte Gott, dass Preußisch-Litauen davon verschont geblieben war. Ein Wanderprediger verkündete auf dem Dorfplatz vor Frauen und Kindern die Ankunft des Jüngsten Gerichts. Er nannte keinen Namen, aber jeder wusste, dass der Vollstrecker des heraufziehenden Unheils nur der Antichrist Napoleon sein konnte. Der Wanderprediger trieb es so arg, dass die Frauen sich zu Tode ängstigten, die Knechte ihre Peitschen holten und ihn aus dem Dorf jagten.
Lehrer Jablonski nahm das Wort Napoleon nicht in den Mund. Als Martin fragte, ob nicht bald wieder ein schmuckes Heer mit Trommeln und Trompeten nach Jorate käme, zeigte Jablonski auf seinen fehlenden Arm und sagte, er habe von solchen Darbietungen genug. Martin wäre gern als Trommlerjunge mit Napoleons Armee durch die Welt gezogen, um all die herrlichen Gegenden kennenzulernen. Doch behielt er diesen Wunsch für sich, weil er den Spott der anderen und die Ohrfeigen seines Vaters fürchtete.
Zwei Menschen am Strom
Im letzten Schuljahr begegnete Martin einem Mädchen, das auch zu Jablonski in die Schule ging. Es war schon vorher da gewesen, aber sie hatten sich nicht wahrgenommen. Das Mädchen hieß Mareike und war die Tochter des Scherenschleifers Rudies, der im letzten Haus des Dorfes wohnte und auch als Mausefallenmacher sein Brot verdiente. Anfangs lief Martin auf dem Schulweg immer einen Steinwurf voraus, doch von Tag zu Tag kamen sie sich näher und sprachen über dieses und jenes. Kurz vor dem Schulhaus trennten sich ihre Wege, weil Martin von den anderen Jungs nicht ausgelacht werden wollte. Auf dem Heimweg kletterten sie bei schönem Wetter die Uferböschung hinauf, setzten sich ins Gras und sahen dem Strom zu, zählten Enten und Schwäne und ließen kleine Steine über das Wasser hüpfen. Kamen Kähne vorbei, winkten sie dem Fährmann zu und lachten, wenn er ihnen antwortete. Mareike sprach Deutsch und Litauisch. Das Litauische hatte sie von ihrer Mutter gelernt, die auf der anderen Seite des Stromes in Bittehnen zu Hause gewesen war, bevor sie den Scherenschleifer heiratete. Es war eine Trauung von der Art, über die die Leute auf dem Lande sagten: Er hat eine Frau. Sie hat einen Mann. Und unser Herrgott hat zwei arme Leute. Auch Mareikes Vater kannte sich in beiden Sprachen aus, weil er die Scheren auf Deutsch und auf Litauisch schleifen musste. Er verstand sogar etwas Polnisch, denn seine Wanderungen führten ihn bis Masuren. Oft ging er über den Fluss, um in Bardehnen und Bittehnen seine Schleifkunst auf Litauisch anzubieten. Manchmal lebte er wochenlang in fremden Dörfern und brachte von seiner Wanderschaft Neuigkeiten mit, die sich in Litauen, Polen oder Russland zugetragen hatten. So erzählte er von einem komischen Kauz, der nur mit einer brennenden Zigarre im Mund schwimmen konnte. Er legte sich auf den Rücken, steckte die Zigarre an und schwamm, eine kräftige Rauchfahne auspustend, über den Fluss. Auf der anderen Seite angekommen, warf er den Zigarrenstummel ins Wasser und ließ sich von einem Fährmann zurückrudern, denn er konnte ohne brennende Zigarre nicht schwimmen.
Gesungen wurde in Mareikes Familie auf Litauisch, weil es so schön tief und traurig klang. Als Lehrer Jablonski einen Helfer bekam, der die litauische Sprache in Wort und Schrift beherrschte, teilten sie die Schulkinder in eine deutsche und eine litauische Klasse. Mareike, die schon bei Mutter und Vater genug Litauisch gelernt hatte, ging in die deutsche Abteilung, was sich als Glücksfall erwies, denn dort saß sie mit Martin Millbacher in einer Bank. Die Aufteilung der Schüler in Deutsch und Litauisch galt nur für die Schulstunden. Davor, danach und in den Pausen tobten alle Kinder durcheinander und spielten auf Deutsch, Plattdeutsch, Litauisch oder Polnisch.
Eines Tages erzählte Mareikes Vater von dem korsischen Kaiser, der, so sprachen sie in Kowno, wieder nach Preußisch-Litauen kommen wollte. Er habe mit einer polnischen Gräfin einen Sohn gezeugt und werde von Paris herüberkommen, um das Kind zu besehen.
Wenn es nur die Frau und das Kind sind, mag es gut sein, meinte der alte Millbacher. Aber er wird wohl auch mit Soldaten kommen.
Martin schwärmte von den Trommlerjungen, zu denen er gehen wollte, wenn Napoleons Armee wieder an die Memel käme.
Mareike lachte ihn aus. Bleib lieber hier und trommle den Kühen auf der Wiese vor, sagte sie.
Da Jorate ein kleines Dorf war, in dem jeder jeden kannte und sich wenigstens einmal am Tag begegnete, trafen sich Mareike und Martin auch nach der Schule oft wie zufällig am Memeldeich. Dort spazierten sie auf und ab, sahen den springenden Fischen zu, bis die Dunkelheit überhandnahm und der Anstand es gebot, dass Mareike in ihr Elternhaus zurückkehrte. An einem schwülen Abend sprangen sie, weil es vor Hitze nicht auszuhalten war, in die Memel, schwammen über den Fluss und wieder zurück, und das ohne brennende Zigarre. Sie fanden sich nackt im hohen Ufergras wieder, wo sie eine Weile nebeneinander lagen, um sich zu wärmen und zu trocknen. Zum ersten Mal spürten sie, wie warm es sein kann, wenn die Körper sich berühren. Das Trocknen hielt nicht lange vor, denn sie gerieten in einen Gewitterschauer. Mareikes Mutter sprach von der Gefährlichkeit, bei Gewitter am Deich zu liegen oder gar in der Memel zu baden, weil die Blitze nicht nur von Kühen und Kälbern, sondern auch von Menschen angezogen werden. Martin ging, nachdem es abgeregnet hatte, mit der Angel zum Fluss, denn in Jorate wussten sie, dass nach einem Gewitter die Fische gut beißen.
Am Sonntag Palmarum wurden beide konfirmiert. Anton Millbacher fuhr seinen Sohn per Kutsche zur Kirche nach Paskalwen. Als sie auf halber Strecke den Scherenschleifer, seine Frau und Mareike trafen, die den gleichen Weg, aber kein Fuhrwerk hatten, ließ Millbacher sie aufsteigen. So fuhren die beiden Konfirmanden, hoch auf dem Bock nebeneinander sitzend, bei der Kirche vor, und Martin wunderte sich, wie hübsch Mareike in ihrem Konfirmationskleid aussah.
In der Kirche standen Jungs und Mädchen getrennt vor dem Altar. Martin sah ein langes schwarzes Kleid, einen weißen Halskragen und die Haube auf Mareikes Kopf, darunter die zu einem Kranz geflochtenen blonden Haare. Sie gefiel ihm.
Nach der Konfirmation trennten sich ihre Wege. Mareike nahm eine Stellung im Haus eines jüdischen Schuhhändlers in Ragnit an. Ach, wäre sie doch zum Domänenvorwerk Paskalwen gegangen, das nahe lag und mit einem einstündigen Spaziergang zu erreichen gewesen wäre. Ragnit aber lag so fern, er konnte unmöglich an einem Abend hinüber und zurück spazieren. So sahen sie sich nur an Sonntagen, wenn Mareike von Ragnit aus am Fluss stromabwärts wanderte, um ihr Elternhaus zu besuchen. Meistens ritt er ihr entgegen. Sie ließen das Pferd am Ufer grasen, lagen im Gras und sprachen über dieses und jenes, bis alles Sprechen verstummte.
An einem Sonntag nach dem Kirchgang nahm Anton Millbacher seinen Jüngsten beiseite und fragte, was er mit seinem Leben anzufangen gedenke. Der Hof sei an den älteren Bruder vergeben, so schrieben es die Gesetze im Preußenland vor.
Ein paar Jahre kannst du noch bei uns leben und arbeiten, aber dann wirst du auf Wanderschaft gehen müssen. Unser Preußen ist groß, es reicht bis zum Rhein und bietet Schusters Rappen viele Wege.
Martin wäre lieber nicht auf Schusters Rappen, sondern hoch zu Ross durch die Welt geritten, aber nie und nimmer würde sein Vater ihm eines der zum Hof gehörenden Pferde mit auf den Weg geben. Über seinen Wunsch, als Trommlerjunge in Napoleons Dienste zu treten, verlor er kein Wort, weil das nur wieder Mutzköppe gegeben hätte.
Wenn du alt genug bist, kannst du auf einen Bauernhof einheiraten, sagte der alte Millbacher. In unserer Gegend gibt es genug Bauern, die nur weibliche Nachkommenschaft haben und auf einen tüchtigen Schwiegersohn warten.
Ja, in einen Bauernhof einheiraten, das wäre etwas, dachte Martin. Aber die Tochter des Bauern müsste Mareike heißen.
Im Zeichen des Kometen
Es begann 1811, ein merkwürdiges Jahr. Der Lärm der hundert Böllerschüsse, die am 20. März in Paris die Geburt eines Kindes anzeigten, erreichte das Memelland nicht. Als die polnische Gräfin in Warschau Napoleons Kind auf die Welt brachte, waren die Kanonen stumm geblieben, aber in Paris tönten sie umso lauter. Nicht einmal die Königsberger Gazetten erwähnten den Jubel in den Pariser Straßen, doch es sprach sich herum: Dem kleinen Kaiser war ein kleiner Sohn geboren worden. Hatte die Revolution die Könige geköpft, zog Napoleon einen König nach dem anderen aus dem Hut. Einen König Lustig ließ er in Westfalen regieren, seinen Reitergeneral Murat machte er zum König von Neapel und den neugeborenen Sohn zum König von Rom, damit er einst wie Cäsar Herrscher des Abendlandes werden konnte. Um das zu erreichen, musste Napoleon noch einige Länder des Abendlandes unter sich bringen, so Russland und England. Leider kränkelte der König von Rom ein wenig.
Das Jahr brachte auch diese Merkwürdigkeit: Ein Komet zeigte sich am Himmel und zog Abend für Abend seine leuchtende Bahn, wanderte von Süden nach Nordosten, wo er jenseits von Moskau in der Finsternis verschwand. Die Sterndeuter erkannten in dem mächtigen Kometenschweif ein großes N und brachten die Erscheinung mit der Geburt des kleinen Königs in Verbindung. Nach altem Aberglauben verkündeten solche Sterne aber heraufziehendes Unglück, eine Hungersnot, eine Feuersbrunst oder Krieg und Blutvergießen. Auch die große Dürre des Sommers 1811 wurde dem Kometen zugerechnet. Im immer feuchten Memelland spürten sie die Trockenheit weniger, während in anderen Gegenden Preußens das Getreide auf dem Halm verdorrte. Aus Russland kam die Kunde von zahlreichen Feuersbrünsten, die vom Kometen entzündet worden waren und die sich in der herrschenden Trockenheit ausgebreitet hatten. Auch in Moskau brannten einige Holzhäuser, doch verhinderten die Feuerwehr und ein kräftiger Gewitterschauer größeres Unglück in der aus Holz erbauten Stadt.
In Bardehnen jenseits der Memel verursachte der Komet dieses Unglück: Einem reichen Mann war es in den Sinn gekommen, zwei Mühlen zu bauen. Den Opferstein auf dem Berg Rombinus, an dem in grauer Vorzeit die Heiden ihrem Gott Perkun geopfert hatten, fand er gut genug als Mühlstein. Er schickte kräftige Männer aus, den Stein zu behauen und zu bergen. Der eine schlug sich ins Bein, den anderen traf ein Splitter im Auge und ließ ihn erblinden, der Dritte starb an einer rätselhaften Krankheit. Der Opferstein blieb auf dem Rombinus, die Mühlen wurden nicht gebaut, weil es auch den reichen Mann noch im Jahre 1811 dahinraffte. Im Berg aber rumorten die alten Götter, warfen so große Felsen in den Strom, dass eine Flutwelle die Memel aufwärts spülte.
Schließlich begann 1812. Der Komet war erloschen, irgendwo im Meer verglüht. Der Winter meinte es gnädig und sparte seine eisigen Kräfte für kommende Ereignisse. Als die Aussaat beginnen sollte, mangelte es an Saatgut, weil wegen der Dürre des Kometenjahres wenig geerntet worden war, dieses Wenige auch Menschen und Tiere im Winter verzehrt hatten.
Martin wurde achtzehn Jahre alt und mannbar, wie sie in Jorate sagten. An den Abenden ging er oft auf Nachbarschaft zum Scherenschleifer Rudies, der viel zu erzählen wusste: Wie es auf der Kartoffelhochzeit in Lasdehnen zugegangen war, wo Rudies mit der Ziehharmonika auf dem Kartoffelwagen gespielt hatte, neben ihm der Dorfschneider mit der Fiedel und der Totengräber mit der Klarinette. Nach Mareike wagte Martin nicht zu fragen, aber ihre Mutter erzählte ihm ungefragt von den schönen Schuhen, die der Jude in Ragnit ihrer Tochter zum Osterfest geschenkt hatte.
Anton Millbacher verschrieb seinem Ältesten den Hof. An Martins Geburtstag nahm er ihn beiseite und erklärte, die Zeit sei gekommen, auf Wanderschaft zu gehen. Den Sommer über könne er noch auf dem Hof bleiben und seinem Bruder bei der Ernte helfen, dann aber solle er sich auf den Weg machen, erst zu Fuß nach Königsberg, dann per Schiff nach Stettin, um von dort durchs preußische Reich zu wandern.
Melde dich nicht zu den Soldaten, ermahnte ihn der Vater. Die preußische Armee ist auf Geheiß Napoleons arg verkleinert worden und braucht keine Soldaten mehr. Und die Armee Napoleons ist es nicht wert, ihr zu dienen, denn es ist die Armee des Antichristen, mit der du dich nicht gemein machen solltest.
Die Magd Berta backte ihm Mohnstriezel. Weiter geschah nichts am achtzehnten Geburtstag, als dass er nach Ragnit wanderte, dort mit Mareike in einen Kahn stieg und sich flussabwärts auf Tilsit zu treiben ließ. Als er ihr von der Wanderschaft erzählte, die sein Vater ihm verordnet hatte, wurde Mareike traurig. Sie versprach, auf ihn zu warten, und er erzählte von schönen Kleidern und goldenen Armreifen, die er heimbringen wollte.
Ein großer Frühling brach an. Die Wiesen zum Strom hin, auf denen er als Kind gespielt hatte, standen in Blüte, die Vögel, die ihm vorgesungen hatten, waren immer noch die gleichen Vögel, die er als kleiner Junge gehört hatte. Die Störche kamen früh und klapperten hinter ihm her, wenn er über den Hof ging.
Mach es wie die Störche, sagte Anton Millbacher. Im Herbst ziehst du davon und schaust dich in der Welt um. Im Frühling kommst du wieder und erzählst uns, was du erlebt hast.
Das Wort unmöglich kommt in meinem Wörterbuch nicht vor.
Napoleon
Aufmarsch im Osten
Bevor Martin in die Welt aufbrechen konnte, kam die Welt zu ihm. Reisende, die von Berlin nach St. Petersburg unterwegs waren, berichteten von Soldaten, die in langen Marschsäulen durchs Preußenland marschierten. Sie kannten nur eine Richtung: Osten. Von Krieg wollte keiner etwas wissen, es gab auch keinen Anlass. Der französische Kaiser wollte ein Königreich Polen errichten, hieß es. Seine polnische Gräfin sollte Königin werden. Dem russischen Zaren wollte er zeigen, wer Herr in Europa ist. Darum die vielen Soldaten. Die Rede war von einem erneuten Treffen in Tilsit, von Festmählern und Paraden am Memelstrom, diesmal auch mit dem preußischen König, denn Preußen war mit dem Korsen verbündet. Letzteres wussten alle, nur Anton Millbacher konnte es nicht glauben, dass sein König mit dem Antichristen im Bunde stand.
Während sie in Jorate rätselten, was die neue Unruhe bedeuten sollte, zog der, der alles bewegte, mit großem Prunk im sächsischen Dresden ein. Er hatte die deutschen Fürsten einbestellt, damit sie ihm ihre Aufwartung machten. Die einen kamen mit Freuden, die anderen eher widerwillig. Zu den Letzteren gehörte der preußische König, der dem Korsen die Demütigung von Tilsit, als er den Preußenkönig nicht auf das Floß gelassen hatte, nicht verzeihen konnte. Sie verlebten festliche Tage mit Bällen und Empfängen, die Dresdner waren davon so angetan, dass sie auf der Stelle zu großen Bewunderern des französischen Kaisers wurden. Gern hätte Napoleon seinen Sohn von Paris nach Dresden kommen lassen, um den Fürsten den künftigen Caesar des Römischen Reiches vorzustellen. Doch der König von Rom kränkelte immer noch.
Nachdem er den deutschen Fürsten erklärt hatte, er wolle keinen Krieg gegen Russland, sondern nur mit dem Zaren ein ernstes Wort reden, bestieg Napoleon seine von sechs Pferden gezogene gelbe Reisekutsche und folgte seinen Soldaten auf dem Weg zum Memelstrom. In der Kutsche, so sagten die Kammerdiener, gebe es ein Bett und ein Studierzimmer, das dem Herrscher erlaube, bedeutende Pläne zu entwerfen. Er reiste über Glogau nach Posen, wo man ihm einen Triumphbogen errichtet hatte. In Danzig inspizierte er Munitionsdepots und Verpflegungslager, sah den Übungen der Pioniere zu, die die Überquerung von Flüssen mit Pontonbooten probierten. Dieses Russland, so sagten es die Landkarten, besaß zahlreiche Ströme, die es zu überwinden galt, wenn die Große Armee nach Moskau oder St. Petersburg gelangen wollte. Rein vorsorglich übten sie die Flussüberquerungen, denn Napoleon wünschte keinen Krieg. In der Marienburg traf er Vorkehrungen, ein großes Lazarett einzurichten, falls es denn nötig werden sollte. Gedacht war an Krankheitsfälle, die beim Aufzug großer Menschenmassen immer mal vorkommen, weniger an Verwundete eines kriegerischen Feldzuges.
Von Marienburg reiste Napoleon nach Königsberg, umjubelt von den Menschen in Dörfern und Städten. Das Heer, das mit ihm zog, war in guter Stimmung, es erwartete Großes. Seine Armee sprach mit vielen Stimmen. Alle Fürsten des Kontinents hatten dem französischen Kaiser ihre Landeskinder zum Zug nach Osten überlassen. Das Heer der Zwanzigsprachigen marschierte in den farbenprächtigen Uniformen ihres jeweiligen Landes zum Memelstrom. Ihm folgten Diener, Köche, Marketenderinnen, Straßenhändler, Huren und die Pferdeknechte der Offiziere. Ein buntes Völkchen zog heiter und beschwingt in den Sommer.
Der Kaiser selbst erschien mit großem Hofstaat. Vierhundert Pferde sowie vierzig Maulesel zogen und trugen, was das kaiserliche Hauptquartier benötigte. Einhundertdreißig Reitpferde standen dem Kaiser und seinen Adjutanten zur Verfügung. Die Marschälle und Generäle führten ebenfalls ihre Dienerschaften mit sich, viele Offiziere hatten ihre Frauen oder Mätressen mitgenommen, damit sie sich zu Hause nicht langweilten, sondern an dem Unerhörten, das im Osten geschehen sollte, teilnehmen konnten. Vor allem italienische Offiziere kamen in weiblicher Begleitung. Sollte es winterlich kalt werden, woran im Sommer niemand denken mochte, wollten sie die Frauen über die Alpen ins sonnige Italien zurückschicken, wenn der Feldzug bis dahin nicht längst beendet wäre.
Es war nicht einfach, das Riesenheer zu ernähren. Wenn sich hier und da Mängel einstellten, ritten die Soldaten zu Bauernhöfen, requirierten Hühner, Gänse und Schweine, ohne zu zahlen und ohne ein Wort des Dankes. Wenn die Bauern sich bei ihren Amtsleuten beschwerten, erhielten sie zur Antwort, König und Kaiser seien Verbündete, das Fouragieren ein Freundschaftsdienst des preußischen Herrschers. Sie sollten nur alles aufschreiben, was die Soldaten genommen hatten. Bei der Rückkehr der Großen Armee würden sie aus den erbeuteten Schätzen großzügig entschädigt werden.
In Jorate spazierten die Störche ungestört auf den Wiesen, den Strom herab treidelten die Flößer das Holz aus den russischen Wäldern, die Tage wurden länger und länger, alles steuerte auf einen schönen Memelsommer hin.
Eines Tages erschien ein Trupp zu Pferde, der sich am Memeldeich zu schaffen machte. Die Chevaliers sprachen französisch, ritten am Ufer auf und ab, fertigten Zeichnungen an, maßen die Geschwindigkeit der Strömung, markierten Untiefen und Sände. Schließlich bezogen sie in Ragnit Quartier. Was hatten sie vor? Der Scherenschleifer Rudies erzählte von einer Brücke, die bei Ragnit über den Strom gebaut werden sollte. In Insterburg ließ Napoleon ein Hospital einrichten, in dem er kranke und verwundete Soldaten versorgen wollte.
Die Gerüchte wurden immer wunderlicher. Der französische Kaiser sei das Siegen gewohnt und könne Müßiggang schwer ertragen, hieß es. Das Gleiche gelte für die Soldaten. Ein so großer Haufen könne nicht tatenlos in den Wäldern herumliegen, sondern müsse beschäftigt werden. Napoleon wolle den russischen Zaren, den letzten Rivalen auf dem Kontinent, niederringen, wenn nicht friedlich, dann mit Gewalt. Danach werde er den Kaiser von China heimsuchen, in Indien ein großes Fest mit bengalischem Feuer geben und schließlich zum Herrn der Welt aufsteigen. Das alles hoch zu Ross.
In den Junitagen näherte sich die Große Armee dem Memelfluss. Als die Kunde eintraf, Napoleon habe in Insterburg eine Parade abhalten lassen, spuckte der alte Millbacher ins Herdfeuer und ließ seinen Sohn die Stelle aus der Schrift vorlesen, die von der Anbetung des Goldenen Kalbes handelt. Es kann nicht gut gehen, beteuerte er.
Auf Wiesen und in Wäldern kampierten Tausende. Wer sie fragte: Wohin des Weges?, bekam zur Antwort: Heute zur Memel, morgen nach Moskau und übermorgen zur ganzen Welt.
Die russischen Husaren auf der anderen Seite des Flusses nahmen das Treiben wohl wahr, blieben aber unbesorgt. Sie glaubten, Kaiser und Zar wollten sich wie vor fünf Jahren erneut am Memelstrom treffen, um den beschlossenen Frieden zu bestätigen. An Krieg dachte niemand.
Und wieder gingen Pferde über den Fluss. Die Trakehner, die schon 1806 ins Russische geflüchtet waren, begaben sich erneut auf die Flucht und gelangten per Schiff ins schwedische Pommern. Die edlen Tiere sollten nicht als Kanonenfutter in die Hände der französischen Pferdeeintreiber fallen.
Wie wird es erreicht, dass eine große Menge Dinge tut, zu denen der Einzelne sich nie verstehen würde?
Nietzsche
Zu den Schätzen des Orients
Martin verbrachte viele Stunden an der belebten Straße, auf der rassige Pferde, Kutschen und Kanonen vorüberzogen, Grenadiere in bunten Uniformen marschierten, Chasseurs und Lanzenreiter daherritten. Über ihnen schwebten Standarten und die kaiserlichen Adler. Immer wieder kündigten Trommelwirbel und Spielmannszüge die Ankunft neuer Regimenter an, und alle hatten nur ein Ziel: den großen Memelstrom. Die Menge staute sich wie das Wasser vor einem Wehr. Der Stau reichte zurück zu den Dörfern des Memellandes, ja bis nach Gumbinnen und Insterburg. Überall herrschte ein aufgeregtes Treiben, und laut war es plötzlich geworden in dem stillen Land. Erschien ein General oder Marschall, ertönten Posaunen. Der Herr grüßte huldvoll vom Pferd herab. Fuhr er per Kutsche, winkte er aus dem Fenster. Alles an dieser Armee war sauber und adrett, nirgends floss Blut.
Für Martin waren es bewegende Bilder, die ihn bis in den Schlaf verfolgten. Er lauschte den Gesängen von den Lagerplätzen, hörte das Gelächter auf der Straße, das Trappeln der Pferde. Der große Fluss war illuminiert von Biwakfeuern, die bis zum Morgen loderten. Bald ist Mitsommer, dann werden sich die Johannisfeuer und die Feuer am Rombinus mit den Biwakfeuern der Großen Armee vereinigen. So viel Feuer war noch nie.
Sein heimlicher Wunsch, als Trommlerjunge den Regimentern vorauszuziehen, würde wohl nicht in Erfüllung gehen. Dafür nahmen sie nur Halbwüchsige, Martin war für diesen Dienst schon zu alt und zu groß gewachsen. Aber vielleicht gab es eine andere Verwendung für ihn. Er sah sich auf dem Bock einer weißen Kutsche sitzen oder hoch zu Ross als Lanzenreiter seines Weges ziehen.
Zwischen Paskalwen und Jorate lagerte auf den Memelwiesen ein Regiment des 10. Korps des Marschalls Macdonald. Die dazu gehörende Reiterstaffel besuchte er jeden Abend, half beim Füttern der Pferde und Reinigen der Hufe. Viele Kavalleristen sprachen Deutsch. Sie kamen aus Westfalen, Bayern, Sachsen, Württemberg und dem Schweizer Land. Auch Polen, die sich vom französischen Kaiser die Befreiung von russischer Herrschaft erhofften und ein eigenes Königreich errichten wollten, gehörten zu ihnen.
Da die Deutschen ohne Vaterland sind, folgen wir dem welschen Kaiser, der uns von Sieg zu Sieg führt, sagte einer, der von der Stadt Kassel bis zum Memelstrom geritten war.
Martin fragte ihn nach Napoleon. Nein, er wird nicht nach Tilsit kommen, sagte der aus Kassel. Er ist in einem Gasthaus nahe Wilkowischken eingekehrt, dort wartet er auf eine Friedensbotschaft des Zaren. Unser Kaiser will keinen Krieg, sondern nur am Memelfluss seine Stärke zeigen und den vor fünf Jahren beschlossenen Frieden bestätigen. Nur wenn der Zar keine Einsicht zeigt, wird die Armee die Memel überschreiten. So redete der Westfälinger, und es klang ein wenig traurig. Er wäre gern über die Memel gezogen, um das Reich des Zaren zu besichtigen.
Ein Botschafter des Zaren kam nicht. Hatte der russische Herrscher von dem Unheil, das sich am Memelfluss zusammenbraute, noch nichts erfahren, weil in seinem weitläufigen Land alles seine Zeit dauerte und die Post lange Wege gehen musste?
In Ragnit griffen die Franzosen einen Juden auf, der von Kowno herübergekommen war, um in Preußisch-Litauen Handel zu treiben. Sie führten ihm die Große Armee vor Augen, zeigten ihm ihre Macht und Herrlichkeit und schickten ihn, gut mit Verpflegung versorgt, nach Wilna, wo der Zar sich aufhielt und seine Sommerfeste feierte. Er sollte dem russischen Herrscher von der gewaltigen Streitmacht erzählen, die sich an der Grenze seines Reiches versammelt hatte: 600000 Soldaten, 160000 Pferde und mehr als 800 Kanonen stünden bereit, um in Russland einzumarschieren.
Der Mann erfüllte seinen Auftrag gewissenhaft, aber der Zar schickte keinen Botschafter.
Die Westfälinger, mit denen Martin sprach, schienen unbesorgt. Wenn der Zar keinen Frieden will, marschieren wir nach Moskau!, riefen sie. Unser Kaiser hat alle seine Schlachten gewonnen, er wird auch den Zaren besiegen!