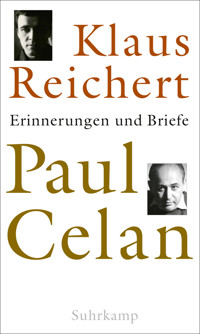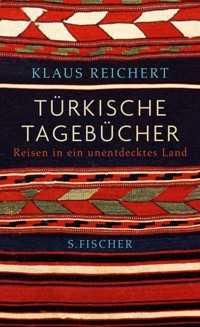14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was fasziniert die Menschen an den Wolken? Wollen sie uns etwas sagen? Göttliche Drohungen? Oder sind es rein thermische Gebilde? Wolken sind ständig in Bewegung: Das macht es schwer, sie in den Griff zu bekommen – und zugleich zu einem Sinnbild für das Gestaltlose, Ungreifbare, Begriffslose. Klaus Reichert nähert sich in seinem neuen Buch den Wolken von mehreren Seiten: der Bildenden Kunst, der Musik, der Dichtung. Durch Befragung der Meister wie u.a. Turner, Constable, Ruskin, Goethe, Ligeti, durch eigene Beobachtungen, Lektüren und Erinnerungen versucht er, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Entstanden ist ein faszinierender, zwischen Wissenschaft und Literatur changierender Text, der das Unmögliche unternimmt: das Nicht-Darstellbare darzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Prof. Dr. Klaus Reichert
Wolkendienst
Figuren des Flüchtigen
Über dieses Buch
Was fasziniert die Menschen an den Wolken? Wollen sie uns etwas sagen? Göttliche Drohungen? Oder sind es rein thermische Gebilde? Wolken sind ständig in Bewegung: Das macht es schwer, sie in den Griff zu bekommen – und zugleich zu einem Sinnbild für das Gestaltlose, Ungreifbare, Begriffslose. Klaus Reichert nähert sich in seinem neuen Buch den Wolken von mehreren Seiten: der Bildenden Kunst, der Musik, der Dichtung. Durch Befragung der Meister wie u.a. Turner, Constable, Ruskin, Goethe, Ligeti, durch eigene Beobachtungen, Lektüren und Erinnerungen versucht er, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Entstanden ist ein faszinierender, zwischen Wissenschaft und Literatur changierender Text, der das Unmögliche unternimmt: das Nicht-Darstellbare darzustellen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg
Coverabbildung: John Constable, Wolkenstudie / Victoria & Albert Museum, London, UK / Bridgeman Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490215-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Frontispiz
»Down Time’s quaint stream
Frühe Himmel
Einleitung
Elsässische Tagebücher
Rittershoffen, 12. August 1998
13. August 1998
20. August 1998
Rittershoffen, 9. August 1999
11. August 1999
17. August 1999
18. August 1999
Hera mit Amboß
12. August 2011
Jacob van Ruisdael
Prosagedichte 1
Sommerwölkchen
Leicht und schwer
Müßiggang
Chaos/Wolke
Psalm 18,8–16
Prolog aus Zitaten
Katastrophenwolken 1
Eyjafjallajökull
Elsässische Tagebücher
Rittershoffen, 27. Mai 2006
4. August 2008
9. August 2008
10. August 2008
Rittershoffen, 8. August 2011
9. August 2011
13. August 2011
22. August 2012
6. Oktober 2012
Proteus, der Meergreis
John Constable
Correspondance
Prosagedichte 2
Maihimmel
Verkohlte Wolken
Céleste
Iris
Zerwühlte Betten
Franz Liszt
Zitate
Orphischer Hymnus
Caliban spricht:
Katastrophenwolken 2
Krakatau
Elsässische Tagebücher
Elsaß, 11. Mai 2013
Rittershoffen, 22. Juni 2013
Rittershoffen, 11. August 2013
Trüber Abend
12. August 2013
15. August 2013
Mythen 3
Helena
William Turner 1
Turners Dunkel
Prosagedichte 3
Abendhimmel gegen halb elf
Müde Wolke
Radierung von Rembrandt
Wäsche im Wind
Zitate
Die Wolke
Die Tonmalerei Richard Wagners
Tambora
Elsässische Tagebücher
Rittershoffen, 9. Juni 2014
10. Juni 2014
[Kapitel]
11. Juni 2014
Rittershoffen, 8. August 2014
11. August 2014
12. August 2014
14. August 2014
15. August 2014
Io, die Wandelnde
William Turner 2
Regulus
Heraklit
Jean Paul
Van Goghs Klangfarben
Skaptár-jökull
2. April 2015
Ostern, 5. April 2015
6. April 2015
16. Juli 2015
21. Juli 2015
23. Juli 2015
24. Juli 2015
30. Juli 2015
Berlin, 8. August 2015
William Turner 3
Hotel Europa
Tintorettos ›Eherne Schlange‹
Turners Shakespeare-Umkehr
Turners Kippe
Turners Lektüre in Venedig
Cumulus
Regenwolke
Königin der Luft
Prosagedichte 4
Alternde Wolken
Zerlumpte Wolken
Aristophanes, Die Wolken
Zitate
Charles Baudelaire
Stefan George, ›Entrückung‹
Arnold Schönberg, II. Streichquartett, letzter Satz
Ferruccio Busoni
Tagebücher
Im Zug Hamburg-Berlin, 24. Juni 2004
Rügen, 8. August 2005
Wien-Schwechat, 25. November 2007
Nach Leipzig, 11. Dezember 2008
Nach Wien, 6. Februar 2009
Sils Maria, 21. Juli 2009
Sils Maria, 22. Juli 2009
23. Juli 2009
Fextal, 23. Februar 2010
Frankfurt, 22. Oktober 2012
24. März 2013
13. Juni 2014
19. Juni 2014
21. Juni 2014
22. Juni 2014
26. Juni 2014
28. Juni 2014, Berlin–Frankfurt
Ende Juni 2014
6. Juli 2014
15. Juli 2014
16. Juli 2014
16. September 2014
23. September 2014
2. Oktober 2014
26. November 2014
William Turner 4
Tizians Verkündigung
Erinnerung an Tizians Laurentius
Splitter 2
Hopkins’ Wolken
Zitate
Rainer Maria Rilke
William Wordsworth, The Excursion
Claude Debussy
Tagebücher
London, 9. bis 12. Januar 2015
Berlin, 16. Januar 2015
17. Januar 2015
31. Januar 2015
Wien, 11./12. Februar 2015
Wien, 12. Februar 2015
Dresden, 15. März 2015
19. März 2015
25. Juni 2015
29. Juni 2015
5. September 2015
Zürich, 7. Oktober 2015
Frankfurt, 8. November 2015
William Turner 5
Splitter 3
Samuel Beckett
Zitate
Valéry
György Ligeti
Venezianische Tagebücher
22. Juli 2008
29. Dezember 2008
31. Dezember 2008
1. Januar 2009
25. Juli 2009
2. Januar 2011
26. Juli 2012
28. Juli 2012
8. August 2012
28. Dezember 2012
29. Dezember 2012
30. Dezember 2012
31. Dezember 2012
1. Januar 2013
2. Januar 2013
3. Januar 2013
4. Januar 2013
5. Januar 2013
6. Januar 2013
Caspar David Friedrich
›Wanderer über dem Nebelmeer‹ (1818)
›Das Riesengebirge‹ (um 1830–35, Berlin)
›Klosterruine Eldena im Riesengebirge‹ (um 1831, Greifswald)
Über die Hyperbel
›Großes Gehege bei Dresden‹ (1831/32)
Splitter 4
Goethes Wolkenlehre (nach Albrecht Schöne)
Wetterzeichen
Schönberg und das Wetter
Zitate
Etel Adnan, Jahreszeiten
Etel Adnan, Reise zum Mount Tamalpais
Etel Adnan, Von Frauen und Städten
Venezianische Tagebücher
Venedig, 12. Juli 2013
13. Juli 2013
Von Venedig aus: Poreč, Dalmatien, 15. Juli 2013
Dubrovnik, mit dem Schnellboot zur Hirschinsel Lopud, 20. Juli 2013
Auf der Autostrada von Dubrovnik nach Zadar, 21. Juli 2013
Weiter die dalmatinische Küste hoch, 22. Juli 2013
Wieder Venedig, 24. Juli 2013
27. Juli 2013
28. Juli 2013
21. August 2014
23. August 2014
24. August 2014
5. August 2014
27. August 2014
28. August 2014
Carl Gustav Carus
Splitter 5
Zitate
Botho Strauß
Johan Christian Dahl
›Gewitterluft‹ (1835, Oslo)
Ruskins Wolken
Cumulus
Ruskins Vögel
Venezianische Tagebücher
Venedig, 28. Dezember 2014
29. Dezember 2014
30. Dezember 2014
31. Dezember 2014
1. Januar 2015
2. Januar 2015
3. Januar 2015
5. Januar 2015
Alfred Stieglitz (1864–1946)
Venezianische Tagebücher
Venedig, 10. August 2015
14. August 2015
15. August 2015
17. August 2015
19. August 2015
22. August 2015
Splitter 6
Barbara Klemm
»Blick auf die Alte Brücke«, Frankfurt 2013
Barbara Klemm, ›Wolkenstudie 2013‹
Tagebücher
Athen, Ende Januar 2014
1. Kapitel
2. Kapitel
Zum Schluß
Archilochos
Virginia Woolf
Homer
Dank
Bibliographie
Abbildungen
Detail aus dem Tympanon der Abtei Saint-Pierre in Moissac
»Down Time’s quaint stream
Without an oar
We are enforced to sail
…
Without a surety from the Wind
Or schedule of the Tide –«
Emily Dickinson
Für Moni
In un mai spento amore –
Frühe Himmel
Du fragst mich nach meiner ersten Erinnerung an eine Wolke. Ich habe keine. Natürlich, es gab Regen, es gab Schnee, aber die waren vor dem Fenster oder auf den Wegen und Wiesen. Hast du nicht manchmal zum Himmel geblickt? Nein. Oder nur beklommen, wenn ein lauter werdendes Brummen über mir zu hören war. Einmal trudelte ein englisches Aufklärungsflugzeug niedrig am Sommerhimmel, das wenig später im weiten großväterlichen Garten aufschlug. Zerbeultes Blech, Leichtmetall. Ohne den Piloten. Weiter nichts? Doch. Die Nachthimmel. Aber ich sah sie nicht, obwohl sie voller Christbäume standen, wie es hieß, ich hörte sie in den Nächten im Luftschutzkeller. Da war wieder das erst langsame grollende Brummen, dann der anschwellende Bocksgesang, der sich in einem rasenden, rasselnden Taumel austanzte und entlud, der wie verhaltene Diarrhoe platzte, wieder und wieder. Ohrenbetäubendes Lärmen, schrilles Gekrisch, das war der Himmel für den Sechsjährigen. So hatte er sich die Himmlischen Heerscharen nicht vorgestellt. Als nach einer der vielen Nächte alles abgebrannt war, kam der Gestank der Hölle dazu. Schwefel, Phosphor und die beizenden, die Augen und Nase brennenden Reste der Dinge, mit denen ich gelebt hatte. Das da oben war für dich die Drohung, die Katastrophe. Wann hat sich das geändert? Lange nicht. Nach der Ausbombung waren meine Mutter und ich bei Bauern evakuiert und liefen jeden Morgen sieben Kilometer zum Trümmerkeller der Großeltern und am Nachmittag wieder zurück zum Dorf. 1944/45 war ein schneereicher Winter. Wege, Büsche, Bäume waren eins unter dem Weiß, und wir stapften, dunkle Gestalten. Die Tiefflieger kündigten sich nicht brummend an, sie sirrten sekundenschnell silbern heran, kaum daß man sie hatte kommen hören, und schossen ihre Garben in den um uns aufspritzenden Schnee. Manchmal um Haaresbreite. Aber was heißt das schon in dem Blitzen und Knattern ringsum. Hast du nicht Todesangst gehabt? Nein. Ich weiß es nicht. Mich interessierten eher die Lamettaknäuel, die die Amerikaner abgeworfen hatten, um das Radarsystem der Deutschen zu stören. Die glitzerten anders in der Sonne als der Schnee, und ich könnte die Fäden vielleicht entwirren und an den Christbaum hängen. Der ganze Schmuck war ja verbrannt. Und als der Krieg zu Ende war? Ich weiß noch, daß wir Buben in der Pause im Schulhof zusammenstanden, als wieder das Brummen zu hören war, ein langsames, schwerfälliges Brummen. Es war ein einzelner Bomber mit dem roten Stern auf dem Rumpf und den Flügeln. Wir Buben sahen uns wissend an. Jetzt kommt der Russe. Jetzt? Bald. Spätestens im Herbst. Aber er kam dann doch nicht, und der Himmel war leer und blau. Und die Wolken, wann kamen die? Ich sehe mich vor einer Wiese stehen, so weit das Auge reichte und wie ich noch keine gesehen hatte. Blumen über Blumen in leuchtenden Farben, mehr als mein Farbkasten zu bieten hatte. Diese vielen verschiedenen Töne. Die roten vor allem, die blauen, die gelben, alle gerahmt und hervorgehoben von festlichem, glänzendem Grün. Schöner als Salomonis Seide. Der Anblick fuhr durch mich hindurch wie ein Schauer aus Glück und dem Verlangen, ihn festhalten zu wollen. Ihn zu beschreiben. Aber wie? Ich legte mich vorsichtig, um die Blumen nicht zu zerdrücken, an den Rand der Wiese, und da sah ich sie über mir, zum ersten Mal wirklich und wie für mich bestimmt, die Wolken, wie sie in dicken, silberweißen Haufen vor dem Blau dahinzogen, langsam, gemessen und lautlos. Friedliche Heerscharen. Und wenn sie einen Schatten über die Wiese warfen, leuchteten die Blumen in wieder anderen, dunkleren Tönen. Ja. Ich habe die Wiese wirklich am Abend beschrieben. In der ungelenken steilen Schrift des Siebenjährigen. Aber als ich die Sätze durchlas, merkte ich, das ist nicht die Wiese, die ich gesehen hatte, das sind nicht meine Wolken. Seitdem steht der Sommertag im Gedächtnis als erstes Beispiel für die Unbeschreibbarkeit der Dinge, die das Geheimnis ihrer Schönheit nicht preisgeben. Dieses Da, das immer ein Dagewesensein ist. Dazu der Sporn, wie in die Pferdeflanke, es dennoch, wieder und wieder, zu versuchen. (Fail and fail again. Fail better next time.)
»Im Gras, das über Ursachen
und Folgen wächst,
muß jemand ausgestreckt liegen,
einen Halm zwischen den Zähnen,
und in die Wolken starrn.«
(Wislawa Szymborska, ›Ende und Anfang‹)
Einleitung
John Ruskin hat die Wolken mit dem Menschenleben verglichen. »Denn was ist euer Leben? Ein Dampf (vapour, atmís) ist’s, der eine kleine Zeit währt, darnach aber verschwindet«, wie es im Jakobusbrief heißt. Menschenleben und Wolken sind ›ihrer Natur nach‹ verwandt: in ihrer Flüchtigkeit, ihrem Dahineilen, ihren großen und kleinen, plötzlichen oder langsamen Veränderungen, in ihrer Helle und Schwärze, Heiterkeit und Verlorenheit, Fülle und lumpigen Schäbigkeit. »Was ist Identität?« fragt Virginia Woolf. Sie ist ständig im Fluß, »ändert in jedem Augenblick ihre Gestalt in Reaktion auf die sie umgebenen Kräfte«. Aber es ist nicht nur die Flüchtigkeit, die Unbeständigkeit, die beide, Wolke und Menschenleben, verbindet, es ist auch ihr Geheimnis: »daß ihre Wege im Dunkel sich verflechten und ihre Formen und Verläufe (Gänge, Züge) nicht weniger launenhaft (fantastic) sind als spukhaft und obskur, so daß in der Nichtigkeit unseres Wolkenlebens, die wir nicht fassen, im Schatten, den wir nicht durchdringen können, wahrhaft gesagt werden kann, ›der Mensch geht dahin in einem eitlen (vain) Schatten und es ist eitel, daß er sich ängstet‹.«
Seit der Mensch aufrecht geht, richtet er den Blick zum Himmel – ängstlich, erwartungs- und hoffnungsvoll. Es gibt eine Korrespondenz zwischen oben und unten. Der Himmel will uns ›etwas sagen‹. Er ist Wetter und Zeichen zugleich. ›Da oben‹ wohnen die Götter. Sie können es regnen lassen oder auch nicht und den Schrecken der Dürre verbreiten. Der oberste Gott der Hebräer, der mit dem unaussprechlichen Namen, ist ursprünglich ein Wettergott. Er kann Frösche und Heuschrecken regnen lassen. Er zieht vor den Kindern Israel in einer Wolke her. Er reitet auf einem Cherub auf einer schwarzen Wolke und schickt seine Pfeile, die Blitze, herab. Zeus, der Wolken(ver)sammler, ist oft mit einem Bündel Blitze dargestellt, die später als Pestpfeile gedeutet wurden. Als Wolke schwängert er Io, die schöne Priesterin der Hera. In der Nacht vor Cäsars Ermordung stürmt und wetterleuchtet es, scheuen die Pferde. So auch in der Nacht, als Macbeth König Duncan ersticht. Die Götter wissen, was die Menschen planen, und sagen es in ihrer Sprache. (Noch Arnold Schönberg will in seinem Kriegs-Wolkentagebuch von 1914 kommende Schlachtverläufe, Siege und Niederlagen, aus Wolkenbildungen ablesen.)
Auch in der christlichen Bildwelt wohnen Gott, die Engel und Heiligen im Himmel, sie sind sichtbar gemacht, wie sie da thronen und lagern auf Wolkenstühlen und -bänken. Aber es gibt nicht mehr die Korrespondenz zwischen oben und unten; es sind geschiedene Sphären, der sublunare, dem Wechsel unterworfene Bereich der Menschen und der ewige darüber, Diesseits und Jenseits. Die gemalten Wolken kommen nicht aus der Anschauung, sie sind Phantasiegebilde, manchmal sogar zoomorph wie bei Mantegna. Das ändert sich, als die Wolke ›als solche‹ aus dem Fensterausschnitt oder dem Hintergrund nach vorne rückt. Aber erst im siebzehnten Jahrhundert wird die (alte) Korrespondenz zwischen unten und oben (Landschaft und Himmel, kreisend, aufeinander verweisend) wieder wichtig und auch im Bild sichtbar, mit der (neuen) Annahme, daß die Wolken von unten kommen, nicht von oben. (Die Niederländer, Claude Lorrain, Poussin) Der Himmel wird eine Sache der Erde und des Wassers, nicht Gottes und seiner Heerscharen.
Seit dem achtzehnten Jahrhundert beginnt die wissenschaftliche Erforschung des Himmels. Nach Linnés Systematisierung der Pflanzen- und Tierwelt, nach Lyalls Geologie soll die Natur ihr letztes Geheimnis preisgeben: den Aufbau und die Struktur, das heißt die Gesetzmäßigkeit des Flüchtigsten, des ›Zufälligen‹. Es war schließlich Luke Howard, der 1803 seine ›Theory of Clouds‹ vorstellte, in der er die bis heute geltende Terminologie vorschlug: die Grundtypen Cirrus, Cumulus, Stratus, Nimbus mit verschiedenen Zwischenstufen und Übergängen. Goethe, seit Jahren mit meteorologischen Fragen und Wolkenstudien beschäftigt, hat sich das System angeeignet und Gedichte zu ›Howards Ehrengedächtnis‹ geschrieben. Er versuchte auch, Caspar David Friedrich zu bereden, sich mit Howards System zu beschäftigen, der aber winkte ab, denn er wollte seine Wolken nicht haben, wie er sie ›richtig‹ sehen sollte, sondern wie er sie – symbolisch – sah; so stimmen sie meteorologisch auch nicht. Friedrichs Dresdener Freunde, Carl Gustav Carus und Johann Christian Dahl, hingegen arbeiteten mit Howards Typen. Turner? Ja und nein; er skizzierte kurz, malte aber im Atelier und war an Effekten, am ›Interessanten‹ interessiert. Ruskin? Er studierte jahrzehntelang Wolken nach eigener Anschauung, nicht nach einem System, und entdeckte Analogien zwischen Wolken und vegetabilischen, geologischen und kristallinen Formen. Und Constable? Für ihn bestand kein Widerspruch zwischen Wissenschaft und Kunst; er sah die eine als Voraussetzung der anderen. Drei Jahre lang, in den 1820er Jahren, malte und skizzierte er täglich auf Hampstead Heath die Himmelsgebilde – er nannte das ›skying‹ –, notierte Stunde und Windrichtung und versuchte das Flüchtige, Gewöhnliche, Alltägliche (nicht das Spektakuläre wie Turner) so genau wie möglich festzuhalten und es dabei gleichzeitig zu ›dichten‹, in Poesie zu verwandeln, wie er einmal schrieb. Nur Wolken, allenfalls Busch oder Baum, eine Hausecke.
Aber wenn wir zum Himmel aufblicken, dann kaum, um uns in Howards Typen zurechtzufinden. Und wenn wir den abendlichen Wetterbericht anschauen, sehen wir Linien, Kurven, Schraffuren, die etwas anzeigen, was kommen wird oder auch nicht. Nein, die Cirri in eisiger Höhe sind immer noch die gemütlichen Schäfchen, die der Schäfer am weiten Himmelszelt weidet und die wir beim Einschlafen zählen sollen, bis wir darüber wegdämmern wie unter der Äthermaske bei der Mandeloperation. In den Cumuli gegen Abend, bevor wir vom Spielen ins Haus gerufen wurden, sehen wir immer noch den Geist aus der Flasche, die Dschinnen, Vogel Roq oder den Wolf, der uns fressen will.
Wann nehme ich Wolken überhaupt wahr? (Denn es gibt ja Tage in den Städten, an denen ich den Blick überhaupt nicht zum Himmel richte.) Ist es in einer bestimmten (seelischen, mentalen, körperlichen) Gestimmtheit? (Das altgermanische Wort Stimme ist unbekannter Herkunft, und aus diesem Ungrund sprießen Ableitungen, die nichts miteinander zu tun haben.) Oder empfange ich von den Wolken eine bestimmte Stimmung (die so empfänglich macht für die Wolke Zeus)? Habe ich eine Vorstellung vom Unendlichen, sichtbar markiert und bald getilgt in Raum und Zeit? Freuds »ozeanisches Gefühl«? Oder projiziere ich meine Stimmung hinauf und sehe für einen flüchtigen Moment darin etwas wie Verheißung oder Verdammung wie beim Blick in die Augen einer geliebten Frau? Warum schauen Liebende so gern in den Himmel und sind beglückt oder verstimmt von dem Da, das Alles ist und doch gleich vorbei? Sehen wir nach irgendeiner Trennung, einem Vorbei, das Grauen des schroffen Ungestalten? Gibt es ein Wechselspiel, eine gegenseitige Steigerung des Anblicks und meiner Gestimmtheit? (Lear auf der Heide, gepeitscht von Regen und Sturm, von dem er weiß, daß er – zugleich – in seinem Innern wütet.) Ich sehe immer mehr, verliere mich in den Weiten und Tiefen des Himmels und meines Inneren, die gleichermaßen unverstanden sind, Gewölk, das vielleicht ein Wissen verhüllt, und wenn es verfliegt, enthüllt sich nichts als der leere Himmel.
Fürchte ich eine Stimme, die aus der Wolke zu mir spricht? (»Du Narr … deine Seele … mud thou art«, sagt die Stimme aus dem Off in Becketts ›Eh, Joe‹.) Die Vorstellung vom strafenden, rächenden Gott in den Wolken steckt trotz aller Wissenschaft als etwas Unabgegoltenes noch in uns, wenn wir zum Himmel schauen. Der Atavismus, daß am Anfang die Drohung gestanden hat, die Angst vor Vernichtung, das Weltgericht. Oder heutiger gesagt: die erahnte Erinnerung an Verlorenes, Verspieltes, Versunkenes, Verdrängtes, an unbewußt Gebliebenes.
Daß es die Korrespondenz zwischen unten und oben, oben und unten gibt, wie sie ›im Anfang‹ war, zeigen die Reaktionen von Pflanzen und Tieren: lange vor dem Gewitter – wir Menschen wissen noch nicht, ob es kommt oder abzieht – legen die Futterrüben ihre starren Blätterstengel in die Ackerfurchen, damit der Sturm sie nicht bricht, lockern die Spinnen ihre straffen Netze, damit der Wind sie nicht zerreißt.
Eine Geschichte der Wolken, wie die oben skizzierte, wird auf den folgenden Seiten nicht erzählt. Die Skizze dient nur als Gerüst, an dem der Leser sich vielleicht bei einzelnen Stücken orientieren kann. Was folgt, sind unverbundene, nur locker zu Gruppen zusammengestellte, längere oder kürzere Texte verschiedener Art.
Ich habe seit Jahren Wolkentagebücher geführt. Ich wollte etwas festhalten, was sich nicht festhalten läßt, die Zeit stillstellen wie in einer Photographie. Aber wie lassen sich Wolken beschreiben, ohne in ihren bizarren Gestalten ein Vertrautes entdecken oder wiedererkennen zu wollen wie die Kinder, die wir dann manchmal wieder werden? Oder andersherum: ohne das Gesehene nüchtern-terminologisch zu protokollieren? Wie lassen sich Wolken ›als solche‹ in Sprache übersetzen, wenn sie nicht als Projektionsfläche für Gedichte oder Romanfiguren – bei Jean Paul, bei Emily und Charlotte Brontë – erfunden werden? Wiedererkennbare Strukturen lenken ab, man ›sieht‹ dann nichts mehr. Doch lernen konnte ich von John Ruskin, dem unermüdlichen Wolkenleser und -beschreiber, bei dem auch andere in die Lehre gingen. In den fünf Bänden seiner Modern Painters beschreibt er, was er sieht, immer dieselben Formen, die dieselben nicht sind, da sie ja nur einmal sich zeigen. Daß seit Howards Wolkenterminologie eine wissenschaftliche Meteorologie entstand, interessierte ihn nicht. Für ihn blieb Gott der Schöpfer auch der flüchtigen atmosphärischen Erscheinungen. Die Wolken zu beschreiben ist eine Sache, sie darzustellen ist eine andere. Das kann nur der Maler, und das heißt für Ruskin: das kann nur einer, William Turner. Seine Kunst hat Ruskin einmal »service of clouds« genannt: Wolkendienst.
Die Beschreibung von Bildern ist nicht einfacher, obwohl der Himmel in ihnen wenigstens feststeht. Die Schwierigkeit ist, die fixierte Bewegung der Wolken wieder aufzulösen, die Windrichtung zu erfassen, die Distanzen zwischen ihnen, vor allem die Tonabstufungen, besonders im Grau, von dem Paul Klee sagte, es bilde die Balance zwischen allen chromatischen Polaritäten und zeige zugleich den »Schicksalspunkt zwischen Werden und Vergehen«. Solche unendlichen Nuancen kann man vor den Originalen studieren, man kann versuchen, sie zu beschreiben, reproduzieren lassen sie sich nicht. Ich lasse daher Gemälde, die ich beschreibe, eher nicht abbilden, oder nur dann, wenn anderes als die Abstufungen akzentuiert ist. Manche Bilder sollen unkommentiert für sich sprechen.
Es ist aber die Musik, die ein wahres Äquivalent der Wolken, ein bilder- und sprachloses, schaffen kann. Sie macht die Wolken hörbar in der Zeit – von Augenblick zu Augenblick anders im Verlauf, im Kommen und Gehen, Steigen und Sinken, in den Übergängen und Abstufungen, der Dynamik, ja in den Farben, und alles kann gleichzeitig mit- oder gegeneinander verlaufen, verschiedene Rhythmen im gleichen Takt. Nirgends wird lauter gedonnert oder sanfter ausgehaucht, verschwebt als in der Musik. Wo soll man da anfangen? Bei Schuberts Ganymed-Lied, das durch vier Dur-Tonarten streift, sich von den Worten tragen läßt – »Hinauf strebt’s, hinauf. Es schweben die Wolken…« – und in einem kurzen Nachspiel mit immer höheren Akkorden im Klavier verklingt? Oder bei Mendelssohns Elias und der kleinen Wolke, die »auf aus dem Meere gehet« und den Regen verheißt, der dann prasselnd im Orchester niedergeht? Aber da solche Musik auf das Wort bezogen ist, schied sie aus. Es sollten nur solche Stücke oder Ideen zur Musik betrachtet werden, in denen allein aus Klängen Wolken geschaffen werden.
In dem Buch finden sich außerdem kleine Essays, Gestalten aus der Mythologie (Io, Helena, Proteus), verstreute Gedanken, Bilder, Prosagedichte, längere Zitate, aber so neben- und gegeneinander gesetzt, daß sie eine Beziehung ergeben, sich stützen, ergänzen oder aufheben. Eine Lektüre von Seite zu Seite ist nicht nötig – sie widerspräche der Diskontinuität der Wolken. Man schlage das Buch auf, wo man will, so wie man zufällig den Blick zum Himmel aufschlägt, und lasse sich von den eigenen Gedanken und Erinnerungen weitertreiben.
Das Feld bei diesem Thema ist inzwischen gut bestellt. Ich habe mich deshalb bemüht, allzu Bekanntes wegzulassen oder klein zu halten. Zugleich wurde das Thema immer reicher und uferloser in den Lüften, so daß ich mich endlich entschließen mußte, den Ballon landen zu lassen.
Elsässische Tagebücher
Rittershoffen, 12. August 1998
Nach einer Woche stehender Hitze – gestern 41 Grad –, keinem Wölkchen am Himmel, überhellem Vollmond, relativer Abkühlung nachts mit feuchtem Gras schon um Mitternacht wegen der Abstrahlung, heute mittag starke Windböen, ohne Wolken, die sich nach einer Stunde wieder legten. Einfach so. Keine Aufgeregtheit der Vögel oder Insekten, die Ackerwinde schloß ihre Blüten nicht. Dann gegen acht, eine knappe Stunde vor Sonnenuntergang, starke Bewölkung von Westen, Quellwolken, die bald den ganzen Himmel überzogen, von Nimbus und Stratus zu einer Andeutung von Cirrus, mit eiligem Cumulusgeschiebe in der Mittelzone.
Eine ganze Himmelsleinwand voll von bleiblauen Kreisen – Ives Kleinschen Schwämmen – Gouachen, die mal konkav, mal konvex erschienen. Sie wirkten statisch, wie von Ewigkeit, im nächsten Augenblick waren sie verfiedert, obwohl sie, wie es schien, langsam, wie ohne Wind, dahingingen. Darüber und darunter, mit dem Lineal gezogen, ein schmaler rötlicher Streifen, der sich aber nicht wie eine Backstube entwickelte, sondern sich nur wie ein Memento hinschrieb: Gedenke, daß es mich dennoch gibt, die Sonne. Alles blieb an diesem Abendgewölk abstrakt. Kein lockender Bilderdienst. Wie der Ordnungsruf von oben: Ich bin, aber du kannst dir mich nicht vorstellen. Bei Wolkenbildungen eher ungewöhnlich.
Später schien dieser ganze Aufwand sich zu lohnen, indem fast der ganze Himmel unerblickbar blieb: zu, geschlossen, einzelne Sterne, eine nur ahnbare Konstellation, wie um durch die wenigen Löcher im Vorhang diesmal uns da unten zu beobachten, das Publikum. Unsichtbar der abnehmende Mond.
Aber eben, während ich schreibe, gegen halb zwei, beginnt fast unvermittelt ein starkes Gewitter, etwa sechs Kilometer entfernt (über Leiterswiller?), meint es aber nicht recht ernst, oder gerade so ernst, daß der Strom unterbrochen wird. Zaghaftes Rauschen auf der heute gemähten Wiese, die es nötig hatte. Ein bißchen Regen und das Bühnengefunkel und -geknalle drumherum. War das wirklich alles nach der langen Hitze? Die Blitze etwas gelangweilt, verlegen, wie um zu üben, zu markieren, wie es bei Sängern heißt, oder um zu zeigen, daß es zur Vorstellung nur erst klingelt.
13. August 1998
Das Gewitter entwickelte sich noch stark in der Nacht als Naturtheater im Osten über dem Schwarzwald, zu weit entfernt, um das Grollen zu hören. Moni hat es von oben beobachtet, während ich unten schrieb. Kein Regen hier.
Heute starke Wolkenzüge, von West nach Nord, in allen Howardschen Variationen. Mittags wieder die jähen, richtungslosen, unnützen Winde, die ebenso plötzlich aufhörten. Wenn eine graue Wolke vor die Sonne zog, war es gleich kalt. Gegenüber den Abstraktionen gestern, heute ganze Bilderlexika: Trüffelschweine, Elefanten, Feldmäuse, gleich groß, aber kenntlich an der minimal veränderten Gestalt. Der Blick beim Brombeerpflücken leierte wie aus einer Rotationspresse immer neue Abzüge heraus, aber alles sachte und andante, in schönem Gegensatz zu den Scherzi der Figuren.
Nach Sonnenuntergang (gegen Viertel vor neun) ein merkwürdiger Prospekt: ein riesiger roter Gazevorhang, fast vor den gesamten Äther gespannt, der nach unten – etwas sackig zum Westen hin – durchhing. Eine Dekoration von Vanessa Bell. Darüber, von der untergegangenen Sonne nicht mehr erreicht, bleigraue Schwaden.
20. August 1998
Tagelang blauer Himmel. Dürre. Kein Wölkchen, das eine Temperaturschwankung – ein bißchen kälter da oben? – anzeigte. Wie wir sie doch spüren, wenn wir durch den Hagenauer Forst radeln und der Wechsel von Wald und Lichtung uns unmittelbar auf die Haut kommt.
Heute Mittagsstürme, wie von nirgendwoher, die ein Zeitungslesen im Garten unmöglich machen. Eilige verwirrte Vögel hier unten, während höher oben ein paar Krähen schimpfen. Ruhiger Himmel.
Eine Stunde vor Sonnenuntergang, also schon gegen halb acht jetzt, auf das Ziegeldach des alten Hühnerstalls geklettert (im Garten versperrt der hohe Mais den Blick), um den Himmel zu sehen: Ein Brucknersches Ensemble von Wolken, immer die gleichen, die, schaut man, hört man wieder hin, sich schon verwandelt haben. Farbigkeiten, ein ungeheurer Reichtum an Formmodulationen unter und über wechselnder Beleuchtung, wechselnden Streicher- und Bläsergruppen.
Rittershoffen, 9. August 1999
Gestern abend von Venedig aus angekommen. Auf der Höhe von Straßburg riesiges Wolkentheater mit großen Auftritten, vom dahinter liegenden Licht in einem majestätischen Strahlenkranz erleuchtet und eingefaßt.
In der Nacht starker Regen, noch um Mittag tropfen auf der Wiese die Halme. Dabei ist es schwül bis heiß. Am Nachmittag flüchtige Cumuli, ganz weiß, Anflug von Nimbus. Am Abend – etwa von acht bis halb zehn – wieder ein einzigartiges Spektakel mit dem ganzen Himmel als Bühne. Riesige plastizierte Felder in allen Grautönen, von hellem Lichtblau bis zu schmutzigem Lumpengrau. Gestaffelte Perspektiven wie in Bühnenprospekten des achtzehnten Jahrhunderts im Marionettentheater. Verschiedene Tiefenwirkungen: weit hinten die mit der Schere ausgeschnittene Zackenlinie der Dolomiten vor dem Regen – Säntis und Hoher Kasten über Konstanz – vorn, direkt über mir, ein übergroßer undeutlicher Lappen, wie zu nah, als müßte ich erst die Brille putzen oder bis in den Schwarzwald zurücktreten, um die Konturen scharf fokussieren zu können. Nebeneinander scharf und unscharf sehen. Sieht man das auf einer Photographie, weiß man, daß die Entfernung auf ein Objekt eingestellt war (die anderen hätten ebenso klar werden können, wenn der Photograph es gewollt hätte). Hier am Himmel, jetzt, läßt sich nichts mit dem Wechsel der Perspektive erklären. Das Klare ist so klar, wie das Unklare – als Unklares – ›klar‹ ist. (Chinesische Rollbilder.) Und daß es daran nichts zu erklären gibt (Fokuswechsel usw.), läßt die Wolkenbilder wie einen Spiegel der Affekte erscheinen. Natürlich dauert diese Fixierung, die im Augenblick wie auf Dauer gestellt wirkt (die Repeat-Taste), nur wenige Sekunden. Einmal abgeschweift – dem Schwalbenschwarm mit dem Auge gefolgt, wie er pfeilgerade über die Maisspitzen strich –, und beim nächsten Blick nach oben ist nichts mehr, wie es war. Im schmutzigen Lumpen auf einmal ein dunkler Keil, der sich mit dem stumpfen Ende, also im Gegensinn, rasch von West nach Nord bewegt. (Benjamins rückwärts fliegender Engel der Geschichte.) So stand, Schwanz voraus, der Komet Hale-Bob über dem Berg Marmoré im Fextal, vom Fenster der Chrasta aus gesehen, morgens um sechs. Wann war das? (Ich weiß nur, daß Homer ihn zuletzt sah.)
Wie schwer ist es, beim Beschreiben von Wolken Vergleiche zu vermeiden – ›wie Zinnen‹, ›wie Karawanen‹, ›wie Bergrücken‹. Daß wir in ihnen die Bilder wiedererkennen wollen, die wir kennen, ist ein Beweis unserer Torheit dem Unbegreiflichen (!) gegenüber. Und jedes Wie ist eine Fixierung, also das Gegenteil von dem, was ›da oben‹ vor sich geht. Vielleicht ist die Unwilligkeit mancher Scholastiker, ›den da oben‹ zu fixieren, aus Wolkenbeobachtungen abgeleitet. Und man könnte versuchen, wie in der Negativen Theologie, Wolken über das zu erfassen, was sie nicht sind.
11. August 1999
Tag der seit Monaten vermarkteten Sonnenfinsternis, die total nur in einem zweihundert Kilometer breiten Streifen, in dem wir uns befinden, zu sehen sein soll. Gegen elf Uhr gehen wir mit Anna auf einen Stoppelacker Richtung Betschdorf, breiten eine Decke vor einer Strohrolle aus, hocken uns hin und warten. Der Himmel ist von eilig treibenden grauen Wolken überzogen, die manchmal fransig aufreißen. So sehen wir momentan, wie der Mond die Sonnenscheibe ein Stückchen anknabbert und wie er sich dann langsam, langsam darüberschiebt, nur ist die Sicht immer wieder verdeckt durch fetzige Wolken. Aber wie die Sonne allmählich wie ein Halb-, dann ein Vollmond, dann wie eine Sichel aussieht, bleibt es dennoch taghell, als verändere sich nichts. Nur ein paar Schwalben sirren eilig über die Äcker, um sich die Abendnahrung (!) zu schnappen. Nach etwa einer Stunde – es ist immer noch hell – kommt kalter Wind auf. Wenige Minuten vor der totalen Finsternis verriegeln die hetzenden Wolken die Sicht und geben sie nicht mehr frei. Dennoch wird es auf einmal stockdunkel, in kürzesten Sekunden, übergangslos, wie im Orient, wo die Nacht jäh hereinbricht. Auch ohne die Stelle der Verfinsterung zu sehen, ist es ein schauerliches Gefühl, mitten am Tag in einer totalen Schwärze auf einem Acker zu stehen. Vögel schwirren lautlos in Bodennähe, verständnislos irrend, weil ihre Uhr nicht mehr stimmt. Totenstille, ein großes Schweigen und wider besseres Wissen einen Moment lang der Gedanke: wie, wenn es nicht mehr hell würde? Das Aussetzen des für selbstverständlich Genommenen. Zur Kälte setzt jetzt ein heftiger Regen ein, der die Stille noch trostloser macht. Warum sollte das nicht der Beginn einer Sündflut sein? Da kommt der Nachbar, Monsieur Levy, mit dem Auto auf den Acker gefahren, Musik dröhnt aus seinem Radio, um die Geister zu verscheuchen, aber wir empfinden den brutalen Einbruch wie eine Entweihung der Stille, wie gottverlassen sie auch immer war.
Im Moment, wo der Mondschatten hinter den Wolken die Sonne zu verlassen beginnt, hellt sich die Welt wieder auf, ist der Spuk vorbei, als sei nichts gewesen. Etwa zwei Minuten dauerte das Grauen, die Beklemmung, die Angst, wie das Aussetzen der Luft in der Nacht, obwohl das große Schauspiel uns verborgen blieb – die Corona, die Wintergestirne, wie Orion, daneben.
Hunderttausende waren unterwegs in und nach Süddeutschland. Allein nach Stuttgart waren Zweihunderttausend angereist, weil dort die Finsternis ›am klarsten‹ zu sehn hätte sein sollen. Wegen der Wolken sah man dort gar nichts. Auf den Autobahnen Staus wie noch nie in der Geschichte des Landes.
17. August 1999
Am frühen Abend fünf sehr breite, rein weiße gerade Pfeile nebeneinander wie gigantische Notenlinien oder wie Vergrößerungen von Meret Oppenheims Pelzkranz. Daneben ein den ganzen westlichen Himmel deckendes graues Wolltuch mit Noppen, durchsackend, als läge der ganze Sternenhimmel darin.
18. August 1999
Vom Hühnerstalldach aus eine halbe Stunde die untergehende Sonne. Ein Breughelscher Weltuntergang durch Feuer, hin- und herwogende Flammen mit einer Ahnung der Dulle Griet, des Wahnsinns, der über die Erde streicht. Höllenschlünde. Darüber die abziehenden Rauchschwaden – aber wohin denn, wenn die ganze Welt verbrennt? Dann reißt ein immer länger und breiter werdendes hellblaues Loch auf – ein stiller stoischer See, um den die Stürme tosen (Poussins Frankfurter ›Pyramus und Thisbe‹). Der See erscheint auf einmal wie das von einem Satelliten aus gesehene Mittelmeer – rechts die türkische Küste bis hinunter nach Syrien und Israel, daneben Zypern. Dann erscheinen die schneebedeckten Gebirgszüge mit ihren Zacken und Schluchten. Das für das Menschenwissen aufrührerische Meer sieht vom Himmelsauge her glatt und unbewegt aus – die trügerische Galene. Oder ein unbeschriebenes Blatt Papier.
Mythen 1
Hera mit Amboß
Als wir uns gegen Abend nach Sonnenuntergang mit dem Auto Rittershoffen nähern, steht über dem Hagenauer Forst ein riesiger Amboß, grau-schwarz, der Himmel und Erde verbindet. Gleichschenklig, unten spitz zulaufend, ein Trichter, durch den noch nichts stürzt. Es ist absolut still wie ein aussetzender Atem, während wenige Kilometer entfernt, hinter dem Wald, die Welt untergeht.
12. August 2011
Ich, Spätling, sehe den Amboß aus dem Himmel zum ersten Mal, aber er ist den Wolkenlesern lange bekannt.
»Zwei schöne Amboßwolken tief auf der Erdlinie in gegenüberliegenden Quartieren, so daß ich zwischen ihnen stand.«
Gerald Manley Hopkins, 19. Juni 1871
»Zu Sonnenuntergang in einer grauen Wand mit feuchten goldenen Hauben und Driften, hatte das ganze Rund der Skyline waagrechte Wolken in natürlicher Bleifarbe aber die oberen Flächen berggelb, einige mehr, einige weniger rosig. Nadeln oder Strahlen geflochten oder erfüllt mit inklinierenden Kugelflocken brachen sich Bahn. Hinter solchen Wolken amboßförmige weichrote und andere hoch-gewehte woll-vlies tisch-flache gefährlich aussehende Stücke.«
G.M. Hopkins, 1. Juli 1866
Und schon Homer hat die Himmelserscheinung gesehen und sich seinen Vers darauf gemacht. Hera, die Eifersüchtige, Listenreiche, hatte zweimal Hypnos bestochen, ihren Gatten einzuschläfern, um einen Racheplan durchzusetzen. Das erste Mal versuchte sie den verhaßten Zeus-Sohn Herakles zu vernichten, indem sie den Boreas-Sturm ihn über die Ägäis bis nach Kos jagen ließ, wo er, der Starke, um ein Haar als Pirat gesteinigt worden wäre, wäre Zeus nicht gerade noch rechtzeitig aufgewacht. Das andere Mal wollte sie Troja vernichten und gewann Poseidon, die glücklosen Achaier zu stärken, was auch für diesmal – eher schmählich – gelingt: Ajax trifft Hektor mit einem Stein. Da erinnert der erwachte, wütende Gott die Gattin an die Strafe für das erste Mal:
… ich weiß nicht, ob du nicht für die böse Anzettelung wieder
Als erste den Lohn empfängst, und ich dich mit Hieben peitsche!
Oder weißt du nicht mehr, wie du von oben herabhingst? Und an die Füße
Hängte ich dir zwei Ambosse und warf um die Arme ein Band,
Ein goldenes, unbrechbares, und du hingst am Äther und in den Wolken.
Und unwillig waren die Götter auf dem großen Olympos,
Doch lösen konnten sie dich nicht, herangetreten, und wen ich ergriff,
Den packte und warf ich von der Schwelle, bis er zur Erde gelangte,
Nur wenig bei Kräften.
Ilias, XV, 16–24 (Wolfgang Schadewaldt)
Es ist der peitschende Regen, der auf die Erde knallen wird und erst als Amboß (oder zwei) schwer am Himmel hängt. Wie kann man eine solche bizarre Erscheinung verstehen, wenn man nicht eine Geschichte (mythos) erzählt?
Mit den Wolken ist Hera auch in einer anderen Geschichte verbunden. Ixion, der König der Lapithen, der Steinschleuderer, durfte an der Tafel der Olympier speisen und verliebte sich dabei in Hera, mit der zu schlafen den Rachegelüsten der Göttin dem promiskuösen Gatten gegenüber entgegenkommen müßte, wie er meinte. Zeus durchschaute aber seine Absicht und gab einer Wolke, Nephele, Heras Gestalt, die der trunkene Ixion dann selig schwängerte. Die Frucht der Verbindung war Kentauros, der später am Fuß des Pelion mit den Stuten Magnesias die Kentauren zeugte, Mischwesen, die obere Hälfte männlich, die untere weiblich, so Pindar in der zweiten pythischen Ode (»…da erstand ein erstaunliches Heer, das / Ähnlich den Eltern war, / Der Mutter nämlich von unten, von oben aber dem Vater.« Schenk von Stauffenberg). Den bizarren Mischwesen der Wolken hat der Mythos diese Entstehungsgeschichte unterlegt. Man fragt sich, wie das Schwere (der Lapith) mit dem Leichten und Feuchten zusammenzusehen war, und kommt auf die Regenwolke (oder einen wet dream).
Als Strafe für den beabsichtigten Frevel fesselte Zeus den Ixion an ein Feuerrad, das unablässig am Himmel rollte. Die Sonne zwischen den Wolken in der archaischen, vorolympischen Vorstellung? Nach anderen dreht sich das Feuerrad im Tartaros – der Gang der Sonne während der Nacht?
Maler 1
Jacob van Ruisdael
»Wenn ich mich hinsetze, um eine Skizze nach der Natur zu machen, ist das erste, was ich zu vergessen versuche, daß ich jemals ein Bild gesehen habe«, schrieb John Constable in einem Brief. Da hatte er viel zu vergessen, denn das Studium der Alten Meister hat ihn sein Lebtag beschäftigt. Wie haben die Alten den Himmel gemalt, das Licht und die Luft, Wolken und Wind? Verstanden sie, was sie malten, oder malten sie nur, was sie sahen? (»We see nothing truly till we understand it.«) Von denen, die wußten, was sie malten, kommt Claude Lorrain und Jacob van Ruisdael für Constable eine bedeutende Rolle zu.
In der dritten seiner Vorlesungen über Landschaftsmalerei (9. Juni 1836) heißt es: »Die Landschaften Ruysdaels bieten den größtmöglichen Gegensatz zu denen Claude Lorrains. Sie zeigen, wie wirkmächtig das Genie – aus Richtungen, die gegensätzlicher nicht sein können – unsere Bewunderung erheischt. Auf Claudes Bildern scheint fast ausnahmslos die Sonne. Ganz anders Ruysdael. Ihn entzückten – und unsere Augen mit ihm – diese ernst-feierlichen (solemn) Tage, die seinem Land und dem unseren eigen sind, wenn ohne Sturm große rollende Wolken kaum einen Sonnenstrahl durch die Waldesschatten dringen lassen. Durch diese Effekte bekamen die alltäglichsten Dinge ihre Majestät.«
Jacob Isaackzoon van Ruisdael: »Eichen an einem See mit Wasserrosen«, um 1665/69
Über Ruisdaels Bildern liegt eine eigentümliche, leicht schwermütige Stimmung. Sehen wir uns die ›Eichen an einem See mit Wasserrosen‹ an. Die Bäume und das Wasser sind fast dunkel. Das Licht einer unsichtbaren Sonne erhellt das düstere Wasser so weit, daß einige Bäume und die weißen Rosen mit den roten Knospen sich in ihm spiegeln. Wie ein Aufbegehren gegen das Verschattete ragt ein geborstener toter Eichenstamm krumm vor der Baumgruppe in die Höhe – eine halbierte Parabel – und dominiert die linke Bildhälfte. Nur er ist ganz beleuchtet, und der untere Stamm wirft einen grünen Schatten ins Wasser bis zum Bildrand. Es ist der Moment unbewegter Stille, in der das Lebendige ein Schatten ist und das Tote strahlt. Aber es geht ja gleichzeitig weiter. Hinter und über den Bäumen ist der Himmel bewegt: braun-grüne Quellwolken oben, weiß-graue in weiterer Entfernung; die dunklen vorn sind keine Regenwolken, sie sind von der Sonne dahinter verschattet, die hellen sind vom Licht durchhellt, aber es ist der gleiche Wolkentyp – Cumulus stratus –, nur auseinandergerissen durch einen heftigen Wind, der in den hier gemalten Formen seinem eiligen Geschäft sichtbar nachgeht. Unten die Stagnation, oben ein Weiter und Weiter. Ein letzter Blick auf das Wasser, den Tümpel, den See: so könnte er ausgesehen haben, der Teich, in dem Woyzeck sich ertränkte. Und die Wolken zogen dahin wie immer und je.
»Durch den Luftton wird das Helldunkel wie die Färbung in seinen Bildern bestimmt«, schrieb Wilhelm Bode, der Sammler auch Ruisdaels, 1905. »Die Luft durchdringt bei ihm das Ganze. … Keiner hat die Bewegung der Luft, den Bau der Wolken so wahr und gesetzmäßig, die Unruhe und Beweglichkeit so einheitlich und bestimmt zu geben gewußt …wie sie in verschiedenen Schichten übereinander lagern, wie sie sich aufbauen, wie sie von der Sonne beleuchtet sind und mannigfache Reflexlichter erhalten, wie ihre Schatten die Landschaft beleben, wie die Luft Wald und Fels durchdringt, Himmel und Meer verbindet und alle Teile der Landschaft umgibt und in ihren zarten Duft einhüllt…« (Bode, 136)
Das Berliner Bild ›Haarlem von den Dünen im Nordwesten gesehen‹ besteht zu drei Vierteln aus Himmel und Wolken. Die dunklen Wolkenfetzen vorn stehen direkt über dem Gehöft und dem Feld mit Figuren, und deren streifige, unterbrochene Beleuchtung unten – die roten Dächer, eine Buschgruppe, weiße Kleider – zeigt, wo oben die Wolken aufgerissen sind und das Licht hindurchdringt. Auch hier ist wieder der eine