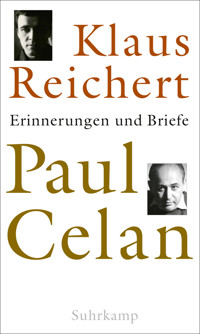9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als in der Wurst noch Wurst war … Erinnerungen an eine Kindheit in der Metzgerei Klaus Reichert wächst mit seinem Bruder Thomas in der Metzgerei auf, die ihr Großvater gegründet hat – und die ihr Vater mit Leib und Seele weiterführt. Ein Familienbetrieb mit Tradition, in dem Arbeit und Leben ineinander übergingen. Nur zu gut erinnert sich Klaus Reichert an die Geräusche der Wurstmaschine morgens um fünf, an die Fleischfachverkäuferinnen in Kittelschürze, an ihren Geruch und ihre Herzlichkeit. Aber auch an das Kühlhaus, in dem die geschlachteten Tiere hingen, wo er mit seinem Bruder verstecken spielte. Eine Zeit, in der das Metzgerhandwerk noch was zählte und Fleisch seinen Preis hatte. Eine Reise zurück und ein unterhaltsames Plädoyer für einen Fleischkonsum mit Maß und Anstand. »Die Welt meiner Kindheit war eine Metzgerei. Ein Laden, eine Wurstküche, Kühlhäuser, ein Hof, unsere kleine Wohnung, ein Kinderzimmer, das ich mir mit meinem Bruder Thomas teilen musste. Von außen betrachtet ein romantischer Familienbetrieb, wo Arbeit und Leben ineinander übergingen. Wir spielten Verstecken zwischen speckigen Schweinehälften und rosigen Rindervierteln, wir bewarfen uns mit Kuhaugen und steckten unsere Arme als Mutprobe bis zur Schulter in blutverschmierte Eimer randvoll mit müffelndem Rinderpansen, glibberigen Kuhdärmen und qualligen Schweinelungen. Wir hatten eine wunderschöne Kindheit. Sie war schön und schrecklich zugleich .« »Ich wünsche dem Buch noch ganz viele Leser, die hat es verdient!« Nele Neuhaus »Das Buch ist echt lustig und herzenswarm.« Hajo Schumacher
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
»Die Welt meiner Kindheit war eine Metzgerei. Ein Laden, eine Wurstküche, Kühlhäuser, ein Hof, unsere kleine Wohnung, ein Kinderzimmer, das ich mir mit meinem Bruder Thomas teilen musste. Von außen betrachtet ein romantischer Familienbetrieb, wo Arbeit und Leben ineinander übergingen. Wir spielten Verstecken zwischen speckigen Schweinehälften und rosigen Rindervierteln, wir bewarfen uns mit Kuhaugen und steckten unsere Arme als Mutprobe bis zur Schulter in blutverschmierte Eimer randvoll mit müffelndem Rinderpansen, glibberigen Kuhdärmen und qualligen Schweinelungen. Wir hatten eine wunderschöne Kindheit. Sie war schön und schrecklich zugleich.«
Zum Autor
KLAUS REICHERT, geboren 1963 in Frankfurt-Höchst, wuchs in einer Metzgerfamilie auf. Er arbeitet als freier Journalist fürs Radio und ist Kommunikationsberater eines Bestattungshauses. Zudem gehört er zu den Gründern der Künstlergruppe Gotensieben, deren Ausstellung »Metzgerei Seele & Söhne« große Beachtung fand. Mit seinem Bruder Thomas, der den Familienbetrieb übernahm, verbindet ihn eine enge Beziehung, bei der es häufig um die Wurst geht. Beide leben im Frankfurter Raum.haxenreichert.de
Die Erstausgabe erschien 2020 unter dem TitelFleisch ist mir nicht Wurst. Über die Wertschätzung unseres Essens und die Liebe meines Vaters zu seinem Beruf bei HarperCollins als Paperback.
Die Ereignisse meiner Kindheit habe ich hier wahrheitsgetreu aufgeschrieben. Auf die Suche nach dem Franßenhof sollten Sie sich nicht machen, die Geschehnisse haben an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Menschen stattgefunden und wurden für den Text verdichtet und literarisch bearbeitet. Teilweise wurden Namen und Orte verändert.
Ungekürzte Ausgabe im HarperCollins Taschenbuch © 2022 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg © 2020 by Klaus Reichert Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München Covergestaltung von Hauptmann & Kompanie, Zürich Coverabbildung Covermotiv: Privatbesitz des Autors: © Klaus Reichert - Sasin Paraksa/Shutterstock Die Bilder im Innenteil stammen aus dem Privatbesitz des Autors: © Klaus Reichert E-Book-Produktion:
Motto
»JE WENIGER DIE LEUTE DAVON WISSEN, WIE WÜRSTE UND GESETZE GEMACHT WERDEN, DESTO BESSER SCHLAFEN SIE.«1
zugeschrieben Otto von Bismarck
»ESST WORSCHT, ES BROT MÜSSET MERR KAUFETT.«
Oma Friedel
1 – Die fabelhaften Butcherboys
1
DIE FABELHAFTEN BUTCHERBOYS
Wie alles begann
»Knaargh!«
Dieses Geräusch begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Es ist ein trockenes, stumpfes Knacken, das nicht nur durch die Ohren in den Körper eindringt. Man spürt es unter der Haut, in den Armen, den Wangen und vor allem in der Brust. Dieses »Knaargh!« ist unvergleichlich, einmalig, und es ist grausam und Furcht einflößend, denn es bringt den Tod.
Ich war fünf Jahre alt, als das Geräusch zum ersten Mal an meine Ohren drang und sich als frühste und zugleich schrecklichste Kindheitserinnerung tief in mir eingrub. Mir standen bei diesem ersten Erlebnis einer Schlachtung, der ich zusehen sollte, die Haare zu Berge.
Im Verlauf meiner Kindheit und Jugend wird das immer wieder passieren. Schon bald nach meiner Geburt hatte sich auf meinem Kopf ein Haarwirbel gezeigt. An guten Tagen verwirbelten sich meine Haare zu einer Art Fragezeichen, an schlechten Tagen standen sie einfach nur stramm in die Höhe. Es sah immer ein bisschen so aus, als hätte ich gerade in die Steckdose gegriffen. Die Erwachsenen um mich herum versuchten ständig, den Wirbel platt zu drücken. Es war wie ein festes Ritual. Anderen Kindern wurden die Bäckchen getätschelt, oder es wurde ihnen an den Ohrläppchen gezogen. Mir drückten meine Eltern, Großeltern, die Metzgereiverkäuferinnen, die Metzgergesellen, Onkel und Tanten, eigentlich alle Erwachsenen, immer den Wirbel platt, der sich Sekunden später wieder aufrichtete.
Es muss eine symbolische Bedeutung auf sich haben mit meinen Haaren, denn dass ich ein sensibles Kind sein könnte, das von dem, was um es herum passierte, zwischenzeitlich geschockt war, darauf kam damals keiner. Sensibilität hielten die Menschen in meiner Welt für eine Art Schwindsucht, der man am besten mit einer großen Portion Ignoranz begegnete und dadurch eben plattmachte.
Die Welt meiner Kindheit war eine Metzgerei. Ein Laden, eine Wurstküche, Kühlhäuser, ein Hof, unsere kleine Wohnung, ein Kinderzimmer, das ich mir mit meinem Bruder Thomas teilen musste. Von außen betrachtet ein romantischer Familienbetrieb, wo Arbeit und Leben ineinander übergingen. Wir spielten Verstecken zwischen speckigen Schweinehälften und rosigen Rindervierteln, wir bewarfen uns mit Kuhaugen und steckten unsere Arme als Mutprobe bis zur Schulter in blutverschmierte Eimer randvoll mit müffelndem Rinderpansen, glibberigen Kuhdärmen und qualligen Schweinelungen. Wir hatten eine wunderschöne Kindheit. Sie war schön und schrecklich zugleich.
Bauernhöfe sind nur im Kinderkanal eine Idylle. In Wirklichkeit sind sie Mast- und Zuchtfabriken oder, wenn es eine Nummer kleiner sein soll, wie der Hof meiner Vorfahren im schwäbischen Großallmerspann, eine gebückte Häuserschar, die in einem Freilichtmuseum aufgebaut dazu dienen könnte, den Besuchern klarzumachen, wie karg, eintönig und hart das Landleben früher war. An den Wänden des Kobens kroch der Schwamm hoch und durch die aufgeklappten Fenster mit den blinden Scheiben zog der scharfe Gestank der Schweinepisse und Kuhscheiße nach draußen über den Hof. Für Stadtmenschen roch es nach Landluft, für Bauern ganz normal.
Die Reicherts waren einfache Leute. Mein Großvater Hans hatte elf Geschwister. Die meisten heirateten in die Höfe der Nachbarschaft ein und blieben in Sichtweite ihres Elternhauses. Die Menschen waren arm und katholisch. Beides schweißte sie zusammen. Man sorgte füreinander und blieb unter sich. Auch weil die Protestanten, die das Dorf in Hohenlohe umzingelt hatten, die Katholiken kräftig ausgrenzten. Als die Not groß war, machte sich der junge Hans Reichert auf den Weg nach Frankfurt am Main, um dort sein Glück zu suchen. Er gründete eine Metzgerei in einem Vorort im Westen der Stadt und sorgte bald aus der Ferne dafür, dass seine Brüder und Schwestern auf der kleinen Scholle überleben konnten.
Zwei Generationen später waren aus den Frankfurter Reicherts bereits Städter geworden. Mein Bruder Thomas und ich bestaunten aus dem Fenster unseres Zimmers die mal gelb, mal tief schwarz rauchenden Schornsteine der Farbwerke Hoechst AG.
Mit einem freundlichen »Rotes Fahrrad, dicke Klicker, guck, da kommt ein Rotfabriker!« begrüßten die Fleischereiverkäuferinnen in Opas Metzgerei die Arbeiter aus dem Werk. Dass hinter der Backsteinmauer die Farbe Rot hergestellt wurde, wussten wir, weil die Männer aus der Fabrik über und über mit rotem Staub eingezuckert waren. Dass mit den Klickern nicht die kleinen Glaskugeln gemeint waren, mit denen wir im Brüningpark Murmeln spielten, blieb noch viele Jahre das Geheimnis der Mädels an der Wurstschneidemaschine.
Im Werk wurde Tag und Nacht gearbeitet, es stank nach Chemiebaukasten, manchmal regnete es Asche, und im Winter fiel Industrieschnee, Flocken dick und rotbraun wie Kastanien.
Auch in der Tierwelt gab es ein paar Besonderheiten, wie sie wohl nur in der Nähe eines Chemiebetriebes der 1960er-Jahre zu bestaunen waren. Die Fische im Main trieben meistens auf dem Rücken an uns vorbei. Angeln brauchten wir nicht, in Ufernähe konnten wir die Fische einfach mit der Hand greifen und aus dem Wasser ziehen, was streng verboten war. Ab und zu streunte im Brüningpark eine rote Katze durchs Gebüsch. Die Tiere wurden angeblich in den Labors des Betriebs für Tierversuche gezüchtet. Da fast alles, was durch das Werkstor nach draußen gelangte, rot eingepudert war, konnten wir die Herkunft der seltenen Katzenart leicht bestimmen. Einmal beobachteten wir, wie ein Rotfabriker ein noch sehr junges rotes Kätzchen anlockte, auf den Schoß nahm und streichelte, was ebenfalls streng verboten war: »Keine Fische und keine roten Katzen anfassen!« Der Fabrikarbeiter entdeckte uns und winkte uns zu sich. Aber auch das hatten uns unsere Eltern verboten: »Wenn fremde Männer winken, dann geht ihr nicht hin!«, hatte uns Mama eingeschärft. Wir blieben also in sicherer Entfernung und behielten den Mann im Auge. Er stand auf, nahm das Katzenjunge in die rechte Hand, lächelte und kitzelte das Tierchen mit dem Zeigefinger an seinem roten Bäuchlein. Dann holte er aus und warf das Rotkätzchen mit Wucht an die Wand. Die kleine Katze fiel zu Boden und miaute jämmerlich. Ihre Beinchen strampelten hilflos in der Luft. Von dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu werden hätte sich für mich nicht schlimmer anfühlen können. Mein Mund und meine Augen waren weit aufgerissen. Ich keuchte und würgte, aber es drang nichts aus meinem Innern, außer einem leisen Wimmern. Der Rotfabriker hob die Katze auf, nahm nun mit seinem ganzen Körper Schwung und schleuderte das Tier diesmal mit großer Kraft an die Mauer. Das Miauen erstarb in dem Moment, als der Leib des Katzenbabys stumpf auf der Steinmauer aufschlug. Reglos blieb das Tier liegen, und der Mann ging achtlos, ohne sich noch mal nach uns umzusehen, davon. Die Katze war mausetot. Meine Haare ragten kerzengerade in die Luft.
Ich hob den kleinen Leichnam auf und hielt ihn wie ein Baby im Arm. Wir verbuddelten das Rotkätzchen im Schatten der Werksmauer unter einem Ginsterbusch.
Die Stadt war für Tiere ein feindlicher Ort. Auf dem Land schien das anders zu sein. Katzenbabys waren grau getigert und hießen Muschi, Mausi oder Mikesch. Meine Tanten und Cousinen, die eigentlich die Tanten und Cousinen meines Vaters waren, brachten uns bei, dass man das Fell nicht gegen den Strich streichelt und den Tieren auf keinen Fall die Barthaare ausreißen darf, da sie sonst beim Sprung vom Dach nicht auf den Füßen landen würden.
Für uns Stadtkinder war der Hof in Großallmerspann, von dem unser Großvater stammte, das Paradies. Ein endloses Summen, Gackern und Muhen.
Wir spielten Verstecken im nach Löwenzahn und Butterblume duftenden Heu und machten Purzelbäume im feuchtwarmen Gras hinter dem Hühnerhaus. Wir patschten barfuß durch die Kruste lehmiger Kuhfladen und durften an dem Strick ziehen, mit dem die kleinen Kälbchen an ihren Vorderläufen aus einem faltigen Loch unter dem Kuhschwanz in die Welt gezogen wurden. Es gab ein Plumpsklo, auf dem Küchenherd blubberte die Milch, und Tante Maja, Tante Fränze und Tante Helene trugen über ihrem Dutt ein Kopftuch. Wir spürten die rauen Hände von liebevollen Menschen, die uns Kindern in die Wangen kniffen und die Köpfe tätschelten – mir natürlich den Wirbel –, die viel Zeit hatten, wenig sprachen und noch weniger lachten und die mit uns, wie mein Onkel Anton, mit dem Traktor gemächlich über die Felder Hohenlohes tuckerten.
An dem Tag, als ich und die Idylle des Hofes ihre Unschuld verlieren sollten, hatte mein Vater Willi uns und Opa Hans in seinem alten VW Käfer nach Großallmerspann kutschiert. Nach der Ankunft hatten sich Papa und Opa schweigend umgezogen. Sie trugen ihre gestreiften, groben Metzgerkittel, wächserne Schürzen und grüne Gummistiefel.
Onkel Anton führte ein Schwein aus dem Stall auf den matschigen Hof hinaus. Ich war sehr aufgeregt, da ich die Schweine bisher immer nur dann habe sehen können, wenn mein Onkel mich hochgehoben und über das Gatter hat schauen lassen. Einem der Tiere jetzt von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, machte mir Angst. Ich wäre gerne weggelaufen, konnte aber keinen Fuß vor den anderen setzen. Mein Bruder Thomas traute sich ganz nah ran und kraulte das Schwein hinter den Ohren. Die Wutz grunzte genüsslich. Sie war es gewohnt, in der Nähe von Menschen zu sein. Das Tier vertraute der Hand, die es fütterte. Sanft, aber mit Nachdruck schob mich Papa mit seinen riesigen Händen zur Seite. Die Hände meines Vaters waren rau und voller Hornhaut und Narben. Da er mich nie geschlagen hat, habe ich sie als zärtlich in Erinnerung behalten. Oft griff er mir wie einem jungen Welpen von hinten in den Nacken und delegierte mich so sachte in die Richtung, in die er mich haben wollte. Das Schwein stand nun ganz still und beäugte neugierig die Runde. Ich spürte die Aufregung der Erwachsenen und die Konzentration meines Vaters. Er griff zu einem Ding, das ich noch nie vorher gesehen hatte. Es steckte in einem Holzblock. Papa schaute mich an und lächelte: »Ist ’ne Axt.«
Ich berührte mit meinen kleinen Fingern das kalte Eisen. Thomas kletterte auf den Holzblock, um einen besseren Überblick zu haben. Die ganze Verwandtschaft aus dem Ort hatte sich auf dem Bauernhof der Reicherts versammelt. Ich spürte, dass hier etwas ganz Besonderes passieren würde. Meine Onkel, Tanten, Cousinen und die versammelte Dorfjugend waren voller Vorfreude und feuerten meinen Vater an: »Auf geht’s, Willi!«
Schwein, noch am Stück.
»Vorsicht jetzt!«, nickte Papa mir zu.
Ich ließ die Axt nicht aus den Augen. Mein Vater packte den langen Stiel und hob die Axt über seinen Kopf. Er drehte den Schaft so, dass nun nicht die Schneide, sondern der klobige hintere Teil – die Schlagplatte – nach vorne wies. Stille.
Gebannt schauten alle auf den Metzgermeister aus der großen fernen Stadt. Die Menschen aus dem Dorf bewunderten Willi, den Sohn von Hans Reichert, der vor über 30 Jahren Großallmerspann verlassen und in Frankfurt-Höchst den Grundstein für den bescheidenen Wohlstand der Familie gelegt hatte.
Papa biss die Zähne zusammen und zog zischend Luft in seine Lungen, seine Augen quollen vor Anstrengung hervor. Sein Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Er stöhnte laut auf, während die eiserne Wange herunterraste. Mit aller Gewalt schlug mein Vater die Axt auf den Schädel des Schweins.
»Knaargh!«
Die Hinterläufe des Tieres knickten weg, und das Schwein fiel zur Seite um. Mein Vater hatte mit seiner ganzen Kraft den Schädel des Tieres zertrümmert. Die Lefzen flatterten bei seinem letzten Atemzug. Ein heftiges Zittern wanderte durch den massigen Körper des Schweins und sprang dann auf mich über. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, es war gerade so, als würde das entweichende Leben noch einen Umweg durch meinen kleinen Kinderkörper nehmen. Mit dem Zittern drang das Knacken in mich ein und würde mich nie wieder verlassen. Der Wirbel auf meinem Kopf vibrierte. Ich hatte den Tod des Tieres in meinem Innern spüren können. Da war ein monströses Nichts, eine tonnenschwere Angst, Zeit, die nicht vergehen wollte, totale Einsamkeit und die Gewissheit, dass der Tod uns alle irgendwann holen würde. Harter Stoff für einen Fünfjährigen, aber so war es.
Durch die Menge der andächtig schweigenden Zuschauer ging ein kollektives Aufatmen. Tante Fränze und Tante Helene klatschten in die Hände. »Gud gmächt, Willi!« Mein Bruder sprang lässig von seinem Aussichtsblock auf einen Strohballen, dann zu Boden und ließ sich von Onkel Anton auf den Bauch des sterbenden Tieres heben, um aus nächster Nähe zu beobachten, was weiter passieren würde.
Mein Vater zog mich nah zu sich heran. Er hockte vor dem Schwein, das er gerade erschlagen hatte. Ich spürte die Wärme, die von dem sterbenden Körper ausging, und streckte die Hand aus, um das Tier zu streicheln. Zu meiner abgründigen Angst und stillen Verzweiflung gesellte sich ein weiteres Gefühl. Ich hatte Mitleid mit der Kreatur. Mein Vater zog sein Ausbeinmesser aus dem Köcher und hielt es in der rechten Hand. Mit der Linken griff er nach meinen kleinen Händchen, damit sie ihm nicht in die Quere kommen konnten. Seine Pranke umschloss meine Finger. Langsam führte er das Messer an die richtige Stelle am Hals des Tieres. Dann stieß er zu. Das Blut rann über seine Hand. Als er das Messer aus der Wunde zog, zischte eine rote Fontäne aus dem Hals des Tieres und klatschte mir ins Gesicht. Ich wollte schreien, es kam aber kein Laut aus meiner Kinderkehle. Die umstehenden Schlachtgehilfen lachten, und eine meiner Tanten schob eine Blechschüssel unter den klaffenden Schnitt, aus dem die letzten Herzschläge das Blut pumpten.
»Aus dem Bübele wird amol kei Metzger!«, bemerkte Tante Maja und begann den rot blubbernden Saft zu schlagen, damit er nicht gerann. Mein Vater hob mich lächelnd hoch und wischte mir mit seinem Taschentuch das Blut aus den Augen. Ich sah aus wie nach einem Frontalzusammenstoß, war aber unverletzt. Zumindest von außen. Thomas rutschte vom Bauch des Schweins und ging neben der Blechschüssel in die Hocke. Er steckte seine Finger in die warme Flüssigkeit und malte damit zwei Streifen auf seine Backen. »Komm, wir spielen Winnetou. Ich bin der Häuptling.« Doch an Spielen war noch nicht zu denken. Das Schwein wurde erst mit heißem Wasser überbrüht, damit sich die Borsten leichter entfernen ließen. Das sollten wir Kinder übernehmen. Mein Vater drückte uns die Glocken in die Hand, metallene Becher in Glockenform, mit denen wir das Tier abschabten. Opa Hans nickte seinem Sohn kurz zu und signalisierte ihm so, dass er mit seiner Arbeit zufrieden war. »Net geschännt is gelobt!« Opa Hans, mein Vater Willi und auch mein Bruder Thomas später hielten sich nie mit Lobhudeleien auf.
Opa holte aus der Scheune einen überdimensionalen Bunsenbrenner und flämmte über das Tier, sodass auch die letzten Härchen weggekokelt wurden. Es stank auf dem Hof nach verbrannten Borsten, Männerfürzen und Blut.
Nachdem das Tier an den Hinterläufen aufgehängt worden war, stach unser Vater sein Messer in Höhe des Pos in das leblose Schwein, die Beckenfuge riss auf, und mein Vater stemmte sich mit dem Messer in der Hand in die geöffnete Bauchhöhle und drückte das Messer mit der Spitze nach außen nach unten, Bauch und Brustbein spreizten sich auseinander. Diese Schneidetechnik wurde angewandt, um die Därme und Organe nicht zu beschädigen.
Mit den Händen drängte er den klaffenden Bauch und Brustraum auseinander und zog die Därme, den Magen, die Leber und die anderen Organe raus zu uns ins Freie. Die Innereien baumelten vor unseren Nasen herum und wurden aus nächster Nähe in Augenschein genommen. Ich fand das kein bisschen eklig, meine Neugierde war mittlerweile viel größer als meine Angst, auch weil die Menschen um mich herum ruhig und gelassen das taten, was getan werden musste. Die anfängliche Aufregung der Erwachsenen war der Routine gewichen. Ich stupste mit meinem kleinen Zeigefinger an einen graublauen Sack, der weich und warm war.
»Da is de Maga, de Bauch«, klärte mich Onkel Anton auf und deutete mit seinem Zeigefinger in Richtung meines Bauchnabels. Ich nahm einen dünnen Schlauch in die Hand und drückte zu. Grünliche Pampe quatschte davon.
»De Darm«, erklärte mir Tante Fränze und schnitt den Schlauch am Magenausgang ab. Alles zusammen landete in einem großen Bottich und wurde mit warmem Wasser übergossen. Mein Vater löste aus der Brust des Tieres einen braunroten Fleischklumpen und drückte ihn vor meinem Gesicht zusammen und auseinander.
»So hat des Herz geschlache.« Solche Bilder kennt die Generation nach uns nur aus Splatter- und Zombiefilmen.
Kopfloses Schwein, Opa Hans und Papa Willi.
Papa zerlegt das Schwein.
Tante Fränze und Tante Helene schlugen immer weiter in einer großen Schüssel das Blut, später wurde daraus Blutwurst gemacht. Unser Vater schnitt die restlichen Innereien fachmännisch von dem Schweinekörper ab und hackte das tote Tier mit der Axt in zwei Hälften. Die Panik, die beim Töten durch meinen Körper gewabert war, war bereits einer stillen Neugierde gewichen. Mein anfängliches Entsetzen wurde von meinem kindlichen Forscherdrang überlagert. Ich konnte meinen Blick nicht mehr von dem Geschehen abwenden und war Jahre später der Einzige, der im Kino nicht die Augen schloss, als sich Leonardo DiCaprio als The Revenant vor Kälte bibbernd in einen ausgenommenen Pferdekadaver verkroch.
An das stumpfe »Knaargh«, dieses grauenvolle Geräusch, das nur eine Axt beim Aufprall auf den Schädel eines lebendigen Wesens erzeugen kann, muss ich jetzt viele Jahre später denken.
Dieses Mal trage ich den groben Metzgerkittel, eine wächserne Schürze und grüne Gummistiefel. Thomas hat mich mit seinen Arbeitsklamotten ausstaffiert. Er ist mittlerweile Metzgermeister und Präsident der Frankfurter Fleischer-Innung, und er führt unseren Familienbetrieb in dritter Generation erfolgreich weiter. Ich erwische mich auch nach Jahrzehnten immer noch dabei, dass ich von »unserer« Metzgerei rede, obwohl ich diesen Beruf nie gelernt habe. Mein Bruder ist in die Fußstapfen von Willi Haxen-Reichert getreten, der die Firma von seinem Vater Hans Reichert übernommen hat. Auf der Skala der am wenigsten angesehenen Tätigkeiten rangiere ich mit meiner Arbeit vielen Umfragen zufolge unterhalb des verlorenen Ansehens der Metzgerzunft. Ich bin Journalist geworden. Hinter mir folgen nur noch Politiker.
Heute ist Schlachtfest auf dem Franßenhof im Rheingau, ein Showbetrieb, der Kindern lustiges Landleben vorgaukelt und unter der Hand gelegentlich den interessierten Kunden des hofeigenen Bioladens anbietet, bei einer Hausschlachtung dabei zu sein. Hausschlachtung hat als Begriff heute allerdings ausgedient. Die Menschen, die dem Metzger bei seinem blutigen Handwerk über die Schulter schauen wollen, sind Gäste eines Schlachtfestes. Sie wollen wissen, wo ihr Essen herkommt und wie aus dem Schwein eine leckere Fleischwurst wird. Es sind mündige Konsumenten, die nicht nur behaupten, die Natur zu lieben, und sie dann aber oft nur aus der neuesten »Landlust« kennen. Es sind Menschen, denen es nicht mehr reicht, sich mit dem Bioetikett ein gutes Gewissen zu kaufen. Diese Leute sind schon einen Schritt weiter. Sie wollen mit eigenen Augen sehen, was passieren muss, damit wir leben können wie im Schlaraffenland.
Die Schlachtfestgäste starren mich an. So müssen sich im Mittelalter Henker gefühlt haben, bevor sie die Delinquenten ins Jenseits beförderten. Zum ersten Mal verstehe ich, dass die Henkerkapuzen nicht nur eine morbide Tracht waren. Gerne würde ich jetzt so eine Kapuze tragen.
Ich soll nicht, wie einst mein Vater, mit einer Axt zuschlagen. Ich soll humaner sterben lassen. In meiner Hand halte ich unbeholfen einen Bolzenschussapparat. Auch dieses Tötungsgerät gehörte meinem Vater. Warum er ihn damals in Großallmerspann nicht benutzt hat, kann ich ihn leider nicht mehr fragen. Mein Vater Willi ist mittlerweile dort, wo ich das Schwein vor mir hinbefördern soll. Ich hoffe, dass mein Vater trotz der vielen Tiere, die er geschlachtet hat, einen gemütlichen Platz im Jenseits gefunden hat, vielleicht sogar im Himmel. Bestimmt, denke ich und ermahne mich, bei der Sache zu bleiben. Meine Gedanken schweifen immer wieder ab, fast so, als würde mein Unbewusstes hart daran arbeiten, zu verhindern, was getan werden muss und jeden Tag vieltausendfach, wenn nicht sogar millionenfach getan wird.
Der Eber Engelbert muss heute dran glauben. Das Schwein ist schon etwas über die Zeit. Das Fleisch von älteren Tieren fängt an zu stinken. Der Ebergeruch ist für die feinen Nasen der Fleischliebhaber eine Zumutung. Aber es gibt da einen Trick, der auch dieses Fleisch genießbar macht. Engelbert wurde vor acht Wochen einer kleinen Operation unterzogen. Die Bäuerin Judith Franßen hat ihm die Hoden abschneiden lassen.
Ich hatte das dringende Bedürfnis, mir schützend in den Schritt zu fassen, als Thomas mir diese Details aus dem Leben von Engelbert und seiner Verwandtschaft auftischte.
Nach einer kurzen Betäubung baumelte da nichts mehr zwischen den Hinterbeinen des stolzen Edelebers. Die dicken Klöten waren jahrelang für die Besucher des Hofes ein echter Hingucker gewesen. Die meisten Ferkel werden schon Stunden nach der Geburt kastriert, da sie von vornherein keine Zukunft als Zuchttiere haben, sondern als Kotelett in die Fleischtheke wandern werden. Bei den meisten Ferkeln spart man sich die Betäubung, was eine echte Schweinerei ist.2
Mein großer Bruder war immer der unbestrittene Thronfolger unserer Metzgerdynastie. Hart im Nehmen, noch härter im Austeilen, ein unerschrockener Haudrauf, mit dem man besser keinen Streit anfing. Und ich schon gar nicht. Er nahm sich, was er wollte, anfangs meine Legosteine, später dann mein Bonanza-Rad und noch später meine Led-Zeppelin-LPs. Ich habe mich kein einziges Mal getraut, die Faust gegen ihn zu erheben, was auch schwierig geworden wäre aus dem eisernen Schwitzkasten heraus, in dem ich regelmäßig bei der kleinsten Meinungsverschiedenheit landete. Mein Bruder war schon als kleiner Junge ein Alphatier, ein Chef, der alle nach seiner Pfeife tanzen ließ. Für mich hatte das den Vorteil, dass sich in unserem Viertel keiner an mich rantraute, und wenn ich doch mal ein paar Backpfeifen einstecken musste, hat Thomas den Jungs die Fresse poliert. Bis heute hilft mir der Gedanke, dass im Fall der Fälle mein Bruder die Keule auspacken und mich beschützen würde. Das Wort Bruderliebe muss für uns erfunden worden sein.
Jetzt erwartet mein großer Bruder von mir, dass ich anpacke und das mache, womit er seit Jahrzehnten seinen Lebensunterhalt verdient und womit meine Familie dafür gesorgt hat, dass ich Abi machen und zur Uni gehen konnte und bis heute ein angenehmes Leben führe.
Der rosige Körper des Schwäbisch-Hällischen Landschweins hat große schwarze Flecken, die ihm ein lustiges, clownhaftes Aussehen verleihen. Engelbert ist der Star bei den Kindern, auch wegen seines freundlichen Gemüts und der unendlichen Geduld, mit der er sich betatschen lässt, vorausgesetzt, die Kinder werfen ihm eine Handvoll Pressfutter hin, das man neben seinem Gatter an einem umgebauten alten Zigarettenautomaten ziehen kann.
Heute gibt es kein Futter für den Eber. Heute wird gestorben. Engelbert schmiegt sich an meine Hüfte. Er ist die Nähe von Menschen gewohnt. Er vertraut mir. Er hebt den Kopf und schaut mir freundlich in die Augen.
»Auf jetzt!«, fordert mein Bruder mich auf. Thomas hat an seinem Gürtel den Köcher mit den Ausbeinmessern und einen Stahl hängen. Damit schärft er das Messer, das ich Engelbert gleich in die Halsschlagader rammen soll. Auch mein Vater hatte damals einen solchen Stahl am Gürtel, und die Aussicht, gleich dem Tier die Gurgel durchzuschneiden, schickt mich in Gedanken noch einmal auf die Reise zurück zu einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen.