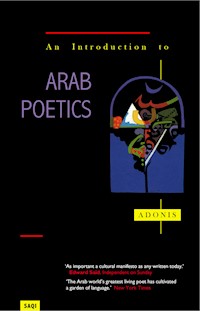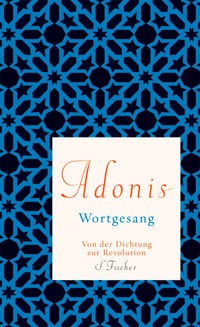
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Adonis ist der interessanteste und wichtigste arabische Dichter und Denker. Der in Paris lebende Syrier ist dafür prädestiniert, die kritische Lage der arabischen Länder zu kommentieren. In seinen Essays zur arabischen Dichtung, zu Politik, Kultur und Gesellschaft fordert Adonis eine Zwiesprache zwischen Autor und Leser, die darin besteht, dem anderen zuzuhören, über sich selbst nachzudenken und zu wissen, dass niemand die Wahrheit kennt. Adonis denkt politisch und fühlt als Dichter. Ein Buch, das einem den Schlüssel zur arabischen Poesie gibt und zugleich einen verblüffenden, höchst interessanten Bogen von der Dichtung zur Revolution schlägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Ähnliche
Esber Adonis
Wortgesang
Von der Dichtung zur Revolution
FISCHER E-Books
Inhalt
Der Dichter als Essayist Mit Adonis Denken [1]
Vorwort von Stefan Weidner
Seit der ägyptische Romancier Nagib Machfus (1911–2006) im Jahr 1988 den Nobelpreis für Literatur erhielt und noch einmal verstärkt nach dem 11.9.2001 haben die deutschen Leserinnen und Leser die arabische Literatur ein zweites Mal entdeckt. Bedenkt man, dass die erste Entdeckung der orientalischen Literaturen, ausgehend von Herder und Goethe, gipfelnd in den Übersetzungen von Friedrich Rückert, sich bereits im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert vollzog, hat es bis zu dieser Wiederentdeckung recht lange gedauert. Anders als vor zweihundert Jahren ist es diesmal vor allem die zeitgenössische Literatur, die im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Wir lesen die Romane und Gedichte von Autoren unserer Lebenszeit, wir laden sie ein, hören ihnen zu, diskutieren mit ihnen, während weder Goethe noch Rückert einen einzigen muslimischen Autor ihrer Gegenwart kannten, geschweige denn gelesen oder getroffen hätten. Die Einseitigkeit jener Zeit spiegelt sich seitenverkehrt in unserer: Die große Unbekannte ist heute die klassische arabische Literatur, abgesehen vom Spezialfall »Tausendundeine Nacht«. Die ältere orientalische Literatur jenseits davon wird heutzutage bei uns nicht mehr gelesen und kann mangels lieferbarer Übersetzungen auch gar nicht gelesen werden.
Der andere blinde Fleck in unserer Rezeption der arabisch-islamischen Kulturen liegt auf dem Feld des Denkens, der Philosophie und der Essayistik. Unter den rund fünfhundert Büchern von etwa zweihundert arabischen Autoren, die derzeit auf Deutsch vorliegen, findet man sehr viele Romane, einige Gedichtbände, aber nur eine Handvoll theoretischer Schriften. Die fiktionale Schlagseite in unserer Rezeption der arabischen Kultur ist ein Politikum: Sie spiegelt nicht nur die weitverbreitete Auffassung, der Islam kenne keine Aufklärung, sie ist für dieses Zerrbild auch mit verantwortlich.
Angesichts solcher Rahmenbedingungen dürften die vorliegenden Essays von Adonis ein wahrer Augenöffner, eine kleine Offenbarung sein. Hier tritt ein zeitgenössischer orientalischer Dichter als eminenter Kulturkritiker und Essayist auf; hier werden vor dem staunenden Leser die Schätze des arabischen Denkens und Dichtens über einen Zeitraum von fast eintausendfünfhundert Jahren ausgestreut, neu geprüft und bewertet – Schätze, die selbst die Romantiker aus der Fassung gebracht hätten, so unbekannt waren bei uns noch vor zweihundert Jahren die meisten der hier genannten Werke und Autoren.
Mit einem fast mehr an Nietzsche als an die Aufklärung gemahnenden Furor unterzieht Adonis in der hier präsentierten Auswahl aus seinen kulturkritischen Schriften die islamisch-arabische Kultur einer Fundamentalkritik, einer kompletten Revision. Wer bislang geglaubt hat oder sich hat einreden lassen, Kritik an der Religion sei in der islamischen Welt nicht möglich, wird hier stante pede eines Besseren belehrt. Wer trotzdem zweifelt, dem sei versichert: Alle Bücher, aus denen die hier übersetzten Aufsätze stammen, sind in der arabischen Welt erschienen, in fast allen Ländern frei zu kaufen und vom Verfasser dieser Zeilen ebendort erworben worden!
Adonis, freilich, ist nicht zuerst Kulturkritiker, sondern Dichter.[2] Geboren wurde er 1930 im syrischen Alawitengebirge, dem Hinterland der Hafenstadt Lattatia, in einfachsten, bäuerlichen Verhältnissen. Sein Vater war der Imam des Dorfs, er leitete das Gebet. Von ihm lernte Ali Ahmad Said Esber, so sein eigentlicher Name, lesen und schreiben, bekam die Grundkenntnisse des klassischen, arabisch-islamischen Curriculums vermittelt: den Koran und seine Wissenschaften, das reiche Erbe der klassischen Dichtung. Wie jeder traditionell gebildete Araber kennt es Adonis bis heute auswendig – er ist also genauso wie Goethes Hafis ein hafis: »einer, der im Gedächtnis den Koran aufbewahrt«. Es handelt sich dabei um ein Verhältnis zur eigenen Tradition, wie es in unseren Breiten selbst gebildetere Zeitgenossen nicht mehr haben. Diese Tradition ist nämlich nicht angelesen oder anstudiert, sondern sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen und wie eine Muttersprache intuitiv erlernt.
Ein glücklicher Zufall öffnet diese seit Jahrhunderten in sich verharrende Welt für den jungen Ali Ahmad: Der erste Präsident des 1941 formell aus der französischen Mandatsherrschaft in die Unabhängigkeit entlassenen Syrien, Shukri al-Quwatli (1891–1967), reist durch das Land. Als er das Alawitengebirge besucht, wird der aufgeweckte Junge ausgewählt, ein Gedicht aufzusagen. Der Präsident spendiert dem Jungen zur Belohnung den Besuch einer weiterführenden Schule in der benachbarten Hafenstadt Tartus. Es ist die Schule der französischen Laienmission. Zur klassisch islamischen Bildung gesellt sich nun die westliche, eine Verdopplung der kulturellen Identität, die wir unter den Gebildeten vieler ehemals kolonisierter Länder finden und die sowohl einen (gerade im Vergleich zur abendländischen Kultur) erweiterten Horizont als auch eine starke Prädisposition zur Identitätskrise zur Folge haben kann.
Dieser Sprung im Alter von vierzehn Jahren aus dem Dorf in die Hafenstadt ist ein Sprung in die Welt und eröffnet dem Jungen zugleich Einblick in die aktuellen kulturpolitischen Debatten des neugegründeten, künstlichen Staates.[3] Die Meinungsführerschaft hat eine Gruppe um den charismatischen Antun Saadeh (1904–1949) inne, Gründer und Vordenker der sogenannten Syrischen Volkspartei (PPS, Partie Populaire Syrien). Die in der Opposition befindliche Bewegung versprach, die Identitätskrise des gerade erst aus der Mandatherrschaft entlassenen, nach dem Ersten Weltkrieg künstlich aus den Trümmern des Osmanischen Reiches geschaffenen Staates Syrien zu lösen. Ihnen schwebte ein sogenanntes Großsyrien vor – eine Vorstellung, die nicht mit derjenigen unserer Urgroßväter von Großdeutschland zu verwechseln ist, sondern schlicht die traditionelle Einheit des östlichen Mittelmeerraums (mit den heutigen Ländern Syrien, Libanon, Jordanien, Israel/Palästina und Zypern) in einem Staat zusammenfassen und damit die artifizielle Aufspaltung rückgängig machen wollte, die im Vertrag von Sèvres entsprechend französischen und englischen Kolonialinteressen beschlossen wurden war. Dabei sollte die ethnische und religiöse Heterogenität nicht übertüncht oder glattgebügelt werden, wie es später die Staaten in der Region versucht haben und versuchen (einschließlich Israels, das sich bekanntlich als explizit jüdischer Staat versteht), sondern sie sollte auf einen älteren, ja den ältesten gemeinsamen Nenner zurückgeführt werden: Phönizien und seine vorderorientalischen Nachfolgereiche. Saadehs »Großsyrien« war als Staat des Mittelmeers konzipiert, nicht des Orients. Diese Vision wirkt bis heute suggestiv und grenzt sich nicht zuletzt gegen die Vereinnahmung durch den Islam ab. Wenn sie gegenwärtig allzu phantastisch klingt, muss man sich klarmachen, dass Mitte der vierziger Jahre die nahöstlichen Grenzen noch jung waren und nur wenig weiter südlich, in Palästina, heiß umkämpft (wie ja zum Teil noch heute).
Wichtig für unseren späteren Dichter Adonis ist dabei ein Detail. Im Zuge der Entdeckung des vorderorientalischen Erbes und des Versuchs seiner Wiederbelebung (also einer künstlichen, ideologisch motivierten Renaissance) wurde auch die vorderorientalische Mythologie neu gelesen, nicht zuletzt die Wiederauferstehungsmythen von Tammuz und Adonis (arabisch Adûnîs). Vor diesem Hintergrund wählte der junge Dichter sein Pseudonym, und es brachte ihm Glück – schon als Schüler konnte er unter diesem Namen seine ersten Gedichte veröffentlichen. Mit der Zeit verblasste die politische Konnotation, und Adonis, der Dichter, ist heute bekannter als die nahezu vergessene politische Strömung, der er seinen Namen verdankt.
Vom weiteren Werdegang muss hier nicht jedes Detail interessieren. In Damaskus studierte Adonis Literaturwissenschaften und knüpfte Kontakt zu Schriftstellerkreisen. Er lernte die Frau kennen, mit der er bis heute verheiratet ist, die Literaturwissenschaftlerin Khalida Said. Vom zweijährigen Militärdienst verbrachte er wegen politischer Aktivitäten (für die genannte PPS) elf Monate im Gefängnis. Dann entzog er sich der zunehmenden Enge und politischen Unterdrückung in Syrien und ging nach Beirut, das im Begriff war, sich in das »Paris des Nahen Ostens« zu verwandeln, und wo für zwei Jahrzehnte, bis zum libanesischen Bürgerkrieg (1975–1990), Prosperität und kulturelle Freiheit zusammenfanden. Mit dem aus den USA zurückgekehrten libanesisch-christlichen Dichter Yusuf al-Khal (1917–1987) gründete er 1957 die heute legendäre Literaturzeitschrift Shi’r (»Dichtung«), in der fast die gesamte dichterische Avantgarde der arabischen Welt publizierte und gegen die alten Formen und Themen in der Dichtung aufbegehrte. Die Zeitschrift war auch die erste Adresse für die ins Arabische übersetzte abendländische Lyrik. Sogar deutsche Dichter wurden hier publiziert, vor allem in der Übersetzung des auch bei uns als Dichter bekannten Fuad Rifka (1930–2010).
1960 ging Adonis mit einem Stipendium für ein Jahr nach Paris, wo er seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre hoch über der Stadt in einem der Wohnsilos des Wolkenkratzervororts La Défense wohnt – eine eigenwillige, architektonischen Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossene Art des Elfenbeinturms. Wer ihn dort oben besucht, beginnt zu ahnen, dass es keine graue Theorie ist, wenn Adonis über die Moderne redet. Was die französische Kultur insgesamt betrifft, wird Adonis’ intensive Beziehung zu ihr im Rahmen der hier publizierten Aufsätze vor allem in »Sufismus und Surrealismus« deutlich.
Der zweite große westliche Einfluss auf das Werk von Adonis ist jedoch, vielleicht zur Überraschung vieler, deutsch! Nietzsche und Heidegger in der Philosophie, Novalis, Rilke und Benn in der Literatur sind die Namen, auf die sich Adonis immer wieder beruft. In den hier vorgelegten Texten sind die Nachwirkungen von Nietzsche und Heidegger kaum zu übersehen – die Nietzsches in der Kritik der Religion und der erstarrten Tradition, diejenigen Heideggers im Ringen um einen anderen Begriff der Modernität, in der Kritik an der rein äußerlichen Übernahme der Technik, einem Umgang mit der technisierten Lebenswelt, der seelenlos und kulturlos ist. Aber auch die Neigung zur deutschen Philosophie verdankt Adonis seinem ersten Paris-Aufenthalt in den sechziger Jahren. Das erstaunt nicht. Husserl, Heidegger und Nietzsche waren prägende Gestalten für fast alle nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutenden französischen Intellektuellen wie Sartre, Foucault und Derrida. Wer 1960 in Paris war und sich für Philosophie interessierte, konnte diesen deutschen Einfluss gar nicht verpassen.
Mit der vertieften Aneignung westlichen Gedankenguts legte Adonis in Paris die Fundamente für die sich nach seiner Heimkehr in den Libanon vollziehende Rückkopplung mit dem älteren arabisch-islamischen: Adonis gab eine bis heute unübertroffene Auswahl aus der klassischen arabischen Dichtung in einer dreibändigen Anthologie heraus. Nichts Besonderes, mag der arglose deutsche Leser denken, der alle paar Jahre von Philologen und Kritikern mit einer umfangreichen Auswahl aus unserer Lyrik beschenkt wird. Aber mit Adonis tat dies jemand, der als Dichter nicht zu Unrecht als ein die Traditionen auf frivole Weise umdeutender Bilderstürmer galt, einen, der auf das Alte nicht viel zu geben schien; nun aber schien er gerade dieses Alte pflegen zu wollen! Die neue arabische Lyrik, die bessere jedenfalls, der sich auch Adonis verpflichtet fühlte, kann ihre Möglichkeiten, ihren sprachlichen Reichtum nur erschließen, indem sie sich ihrer Geschichte bewusst ist, lautete die Botschaft dieser Rückeroberung des literarischen Erbes – sich ihrer bewusst ist, ohne an sie gekettet zu sein.
Dazu muss man wissen, dass die arabische Sprache, jedenfalls die hochsprachliche Literatur- und Schriftsprache, seit ihrer Kodifizierung durch Koran und Koranphilologie im siebten und achten Jahrhundert nach Christi (dem ersten und zweiten Jahrhundert der 622 anhebenden islamischen Zeitrechnung), morphologisch gleich geblieben ist. Entwickelt haben sich allein die verschiedenen Dialekte, die jedoch nur in Ausnahmefällen verschriftlicht werden, etwa in bestimmten literarischen Genres, dem Theater, der Dialektdichtung, der volkstümlichen Erzählung; oder wie kurzzeitig einmal im Versuch, den libanesischen Dialekt, geschrieben mit lateinischen Buchstaben, als unabhängige Sprache festzuschreiben (vgl. den Essay »Sprache und Identität« in diesem Band). Aufgrund dieser Sprachgeschichte ist das Hocharabische zwar niemandes eigentliche Muttersprache und muss gelernt werden wie etwa Deutschschweizer Hochdeutsch lernen müssen. Wer diese Sprache aber einmal beherrscht, dem steht ein Vokabular, eine Ausdrucksfülle und eine Tiefe der literarischen Tradition zu Gebote, die mit nichts in der westlichen Hemisphäre vergleichbar ist: Eintausendfünfhundert Jahre ununterbrochene Sprach- und Literaturgeschichte, von der vorislamischen Lyrik bis ins 21. Jahrhundert.
Klar ist aber auch, dass man sich von einem derart übermächtigen, überpräsenten Erbe erst einmal befreien und loslösen muss, bevor man es auf eine genuin moderne Weise neu fruchtbar machen kann. Viele arabische Dichter gehen diesen schwierigen Weg heute nicht mehr. Sie bleiben dem Erbe, besonders den traditionellen Formen in der Dichtung, unkritisch verhaftet, stehen in einer naiven Kontinuität zu ihm. Oder – dies ist der Fall vieler Jüngerer – sie kappen die Nabelschnur zur Tradition völlig oder haben überhaupt nie Gelegenheit oder Interesse gehabt, diese vertieft kennenzulernen. Das Resultat ist entweder eine weitgehend verwestlichte oder aber eine oberflächliche, dem unmittelbaren Zeitgeist verhaftete Lyrik. Es ist jedoch offensichtlich, dass beide Haltungen defizitär sind und fast zwangsläufig in eine poetische Identitätskrise münden, sobald sie reflektiert werden. Adonis aber tut in den hier versammelten Essays genau dies: Er reflektiert die verschiedenen arabischen Positionen zur Tradition, zur Dichtung, zur Religion; thematisiert, indem er die Widersprüche aufzeigt, die Identitätskrise selbst. Indem er die Problematik der althergebrachten und unreflektierten Weltanschauungen offenbart, ermöglicht dieser von Adonis vollzogene Perspektivwechsel zugleich eine sehr originelle Lösung.
Das theoretische Werk von Adonis geht zwar von der Dichtung aus und steht in ihrem Dienst. Aber da die Dichtung nach Adonis ein Humanum ist, eine anthropologische Grundkonstante, ein zentraler Faktor der menschlichen Existenz, ein Ideenkraftwerk, ja die Manifestation von Kultur überhaupt – deswegen ist das Reden, das Ausgehen von der Dichtung, ein Reden über die Kultur und das Dasein überhaupt. Vielleicht ist dies das für uns Überraschendste und Gewöhnungsbedürftigste an den hier versammelten Texten. Dichtung, wenn nicht die Literatur insgesamt, gelten als randständig, als marginal in der Gesamtheit unserer Kultur. Sogar unsere Dichtung selbst erhebt kaum noch den Anspruch, mehr sein zu wollen, und ihre Bescheidenheit ist realistisch. Eine Theorie der Kultur würde bei uns von der Medialität insgesamt ausgehen, und die Marginalisierung der Dichtung in unseren Breiten ist womöglich nichts anderes als eine mediale Verdrängung, welche der arabischen Welt erst noch bevorsteht und die sich in Gestalt der Facebook-Revolten und der omnipräsenten Satellitenfernsehsender bereits lautstark ankündigt.
Als Kritik an der inhaltsleeren Technisierung der Welt, der Vermittlung auf allen Kanälen, aber der Vermittlung von nichts wird freilich auch diese Medialität von Adonis reflektiert. Und schließlich tritt die Dichtung bei Adonis, wir lesen es aus diesen Essays von Anfang an heraus, in Konkurrenz zur Religion, ein Gedanke, der natürlich auch in unserer Literatur nicht unbekannt ist. Er findet sich bereits bei Herder angelegt, wenngleich dort die Poesie immer noch im Dienst der Religion, des »Gefühls« steht. Wir finden ihn weitgehend emanzipiert in der deutschen Frühromantik wieder. Und im zwanzigsten Jahrhundert, das heißt postnietzscheanisch, finden wir ihn im Surrealismus, aber auch bei so hochgradig nüchternen Schriftstellern wie Hermann Broch und Robert Musil, mit dem die denkerischen Positionen von Adonis, wie wir noch sehen werden, verblüffende Schnittmengen aufweisen.
Dichtung und Religion sind die beiden Pole, zwischen denen sich in diesen Artikeln eine Spannung aufbaut, die sich im Begriff der Modernität schließlich entlädt. Literaturgeschichtlich mit zahlreichen Belegen abgesichert, findet sich diese Denkbewegung beispielhaft in den vier Vorlesungen, die Adonis 1984 am Collège de France gehalten hat. Sie wurden unter dem Titel »Einführung in die arabische Poetik« auf Französisch und Arabisch als Buch veröffentlicht, mit ihnen beginnt die hier vorgelegte Auswahl.
Die ersten drei Vorlesungen skizzieren die Polaritäten, zwischen denen sich die traditionelle arabische Kreativität seit ihren Anfängen in der vorislamischen Dichtung bewegt hat. Sie skizzieren sie aber nicht mit den Augen eines modernen, westlichen Kritikers, sondern exakt so, wie sie von der mit den ersten Koranforschungen anhebenden arabischen Philologie gelesen und gedeutet wurden. »Geschichte der arabischen Dichtung« bedeutet hier also das, was über die arabische Dichtung im Laufe der Geschichte gesagt und geschrieben wurde, wie sie gelesen und verstanden wurde, wie sie kategorisiert und bewertet wurde. Es ist eine Geschichte der Rezeption in Gestalt von Poetiken.
Eine eigentliche Einführung in die arabische Dichtung im Sinne einer kleinen Literaturgeschichte sind diese Vorlesungen daher nicht, wollen sie nicht sein. Stattdessen wird vor dem verblüfften westlichen Leser das Füllhorn der mittelalterlichen arabischen Philologie ausgeschüttet. Die Vielzahl fremder Namen, der Reichtum der Diskurse, der dabei nur angedeutet wird, überrascht, ja überfordert womöglich im ersten Moment. Freilich ist diese Überforderung nichts anderes als das Indiz eines Wahrnehmungsdefizits, einer veritablen Bildungslücke. Denn der Reichtum an philologischer Forschung, an Diskursen über Sprache und Literatur in der arabischen Welt seit dem siebten Jahrhundert, mit den Zentren Bagdad, Aleppo, Kairo und Córdoba, übertrifft an Fülle und intellektuellem Gehalt nicht nur alles, was in Europa bis weit ins Hochmittelalter hinein gedacht und geschrieben wurde, er muss nicht einmal einen Vergleich mit der griechischen und römischen Antike scheuen. Jenseits orientalistischer Fachkreise weiß davon in unseren Breiten selbst der literaturwissenschaftlich Interessierte nichts, es fehlen die Sprachkenntnisse, die Übersetzungen, die zusammenfassenden Darstellungen. Auch insofern ist gerade dieses Werk von Adonis so wichtig. Es vermittelt uns nicht nur Einblicke in den Umgang eines arabischen Schriftstellers mit seinem Erbe, es lässt auch, gleichsam wie mit der Kamera aus der Luft aufgenommen, dieses Erbe in einem breiten Panorama an uns vorbeiziehen. Welche Landschaften! Und dabei ist das nur der Blick aus dem Flugzeug. Wie wäre es erst, wenn man mittendrin stünde?
»Poetik und vorislamische Mündlichkeit«, »Poetik und Koran«, »Poetik und Denken« lauten die Überschriften der ersten drei Vorlesungen, der drei Pole, zwischen denen es so sehr knistert. Dabei hatten nach Mohammeds Tod zumindest die frühe arabische Dichtung und der Koran in den Augen der späteren arabischen Philologen eine Art Modus Vivendi gefunden, eine Allianz gebildet, um den unliebsamen Dritten, den eigentlichen Störenfried, die intellektuelle Dynamik nämlich, außen vor zu halten. Die dreibändige Studie zur arabisch-islamischen Geistesgeschichte, die Adonis Anfang der siebziger Jahre in Beirut unter dem Titel »Das Statische und das Dynamische« vorlegte, entdeckt in diesem Gegensatz ein Leitmotiv der arabischen Kultur, das sich zu den verschiedensten Epochen und Bedingungen immer wieder bemerkbar macht. Dabei wäre die Annahme grundfalsch, dass etwa die religiösen Elemente pauschal die verharrenden und rückschrittlichen Kräfte repräsentierten, die dichterischen und denkerischen pauschal die Kräfte der Erneuerung. Nicht Religion an sich ist dies oder das, sondern wird als statisch oder dynamisch gelebt und verstanden. Das Religionsverständnis der Sufis zum Beispiel ist eines von äußerster geistiger Beweglichkeit. Die Dichtung hingegen, wenn sie nicht mehr sein will als die Nachahmung des Althergebrachten, kann ein Hort des Rückschrittlichen werden und sich dabei hervorragend mit einem starren, dem eigenständigen Denken abholden Verständnis des Korans paaren. Für beide Einstellungen fanden und finden sich die entsprechenden Philologen und Propagandisten. Zentrale Kampfbegriffe sind dabei die (unerlaubte) Neuerung (badi’; vor allem von den Gegnern dieser Neuerung benutzt) und »Modernität«, ein eher positiv besetzter Begriff.
So irritierend es für westliche Leser sein mag, für die der Begriff des Modernen erst im 18. Jahrhundert Gestalt annimmt (etwa in der mit den mittelalterlichen arabischen Diskussionen vergleichbaren »Querelle des anciens et des modernes«), wenn er nicht gleich erst mit der Kunst und Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts assoziiert wird: Die Moderne ist eine arabische Erfindung und absolvierte ihren ersten Auftritt in Bagdad im ausgehenden achten Jahrhundert! In den Hauptrollen: der Kalif Harun Ar-Raschid, der Dichter Abu Nuwas und eine ganze Armee von Frömmlern und Bewahrern. Das Tragische an dieser Uraufführung der Moderne bestand nun darin, dass sie unmittelbar mit den politischen Auseinandersetzungen der Zeit zusammenhing und von ihr instrumentalisiert wurde: Es gab keine Unschuld in den ästhetischen Fragen, in der Interpretation des Korans, ja nicht einmal in der Philologie und im Aufsagen von Versen. Dies wiederum hängt nicht damit zusammen, dass der Islam einen größeren politischen Anspruch hat und weltliche und religiöse Macht hier nicht ordentlich getrennt wären, sondern liegt an der Instrumentalisierung der Religion durch die Macht, was auch Adonis beklagt. Zum Beispiel in der dritten Vorlesung, wo er schreibt: »Zwar existiert innerhalb der arabischen Gesellschaft ein Bestreben nach Trennung der Religion von jedweder Art von Herrschaft. Im Gegensatz dazu steht jedoch das Bestreben der Herrschenden, die Religion, da von Gott offenbart, als Grundpfeiler im Leben der Araber und als deren vollkommenstes Wissen zu verstehen. Deshalb ist für sie die Religion auch ein fundamentales Element zur Gewährleistung der Stabilität des politischen Systems, ja Politik und Religion gehen in dieser Hinsicht eine beinahe organische Verbindung ein. Man erkennt hier ganz klar, dass die Freiheit des Hinterfragens und des beharrlichen Nachforschens vor dem Hintergrund eines Systems, das so sehr jene Verbindung betont, ein Ding der Unmöglichkeit ist – umso mehr, wenn diese Freiheit auf den religiösen Bereich bezogen wird. Auf diese Weise wird Politik praktisch zu einer Art von religiöser Unterwerfung und einem Glaubensbekenntnis gegenüber dem herrschenden System. Alles andere wird automatisch als eine Art Abfall vom rechten Glauben und als Gotteslästerung hingestellt.« Fortschrittliche und rationale religiöse Strömungen wie die Mu’tazila haben sich dabei ebenso für die Despotie vereinnahmen lassen wie die frömmlerischen und reaktionären Kräfte und nicht zuletzt die Dichter: Panegyrik, das Herrscherlob als eine der wichtigsten Untergattungen der arabischen Lyrik seit alters her, stammt aus der Feder von guten wie schlechten, »modernen« wie konventionellen, archaisierenden Dichtern. Die »moderne« Schule jedoch, hier mit Adonis immer verstanden im Sinne der ersten arabischen Moderne des achten und neunten Jahrhunderts in Bagdad, stellt sich den Fragen der Zeit und begreift Kultur, Identität und Weltanschauung als dynamisch, im Fluss befindlich. Sie stellt Fragen, statt Antworten zu geben, sie eröffnet einen Raum von Möglichkeiten und Perspektiven, in dem sich die Gesellschaft ebenso wie das Individuum weiterentwickeln können.
In der inspirierten Auseinandersetzung mit dieser alten »Moderne« gewinnt Adonis die Maßstäbe für eine autochthone Kritik der arabischen Kultur der Gegenwart. Die alte Moderne war eine rein kulturelle, ihr fehlten diejenigen Aspekte, die unsere spätere Moderne ausmachten: Industrialisierung, Technisierung, Ökonomisierung, Medialisierung. Geistig und kulturell, poetisch, philosophisch und philologisch waren alle Errungenschaften der späteren Moderne jedoch bereits präsent, unabhängig von den heute mit der Moderne assoziierten soziologischen und ökonomischen Begleitumständen.
Mit dem Konzept der rein kulturellen Moderne leistet Adonis zweierlei: Zum einen wird Moderne, verstanden als geistige, weltanschauliche Offenheit, als Möglichkeitssinn und Fragelust denkbar auch unabhängig von den potentiell negativen Begleitumständen der heutigen industriellen und technischen Moderne. Zum anderen wird es damit möglich, das rein technische, äußerliche Verständnis von Moderne zu attackieren, das in der gegenwärtigen arabischen Welt – und wohl nicht nur dort – dominiert. Fragt Musil im »Mann ohne Eigenschaften«[4], warum die Menschen, wo sie doch Wolkenkratzer bauen, sich nicht auf Wolkenkratzer, sondern immer noch auf Pferde setzen, wenn sie posieren wollen (eine Frage, die von heute aus und mit Adonis betrachtet eher an die Emire der Golfstaaten gerichtet scheint, die ja wirklich noch mit Pferden renommieren, während sie zugleich die höchsten Häuser der Welt bauen, als an das Wien der Gründerzeit, in dessen architektonischem Kosmos der »Mann ohne Eigenschaften« spielt), so dreht Adonis dieses Bild um und verstärkt es: Das Bewusstsein muss nicht zur Moderne aufschließen, sondern die (technische, veräußerlichte) Moderne muss allererst zu Bewusstsein kommen, ihre geistigen Vorbedingungen kennenlernen. Nicht der Geist muss sich der Technik angleichen, sondern der Gebrauch der Technik soll geistvoll werden.
Es ist klar, dass diese Umkehrung nur im Kontext einer Kultur gedacht werden kann, die innerhalb eines Jahrhunderts aus weitgehend mittelalterlichen Verhältnissen in die Moderne geschleudert wurde, wo also die Diskrepanz zwischen modernem Sein und vormodernem Bewusstsein noch weitaus größer, spürbarer und schmerzlicher ist als in Europa. Und wo gleichzeitig die Erinnerung an eine vormoderne Vergangenheit mit einem modernen Bewusstsein noch irgendwie lebendig, wenn auch nicht wirklich gelebt ist.
So macht Adonis bei der Lektüre Baudelaires die verblüffende Entdeckung: Das kenne ich doch, das hatten wir bereits, zum Beispiel in Gestalt von Abu Nuwas. Wir haben es nur vergessen. Die Moderne ist keine europäische Erfindung, geschweige denn ein europäischer Besitz. Sie stürzt die arabisch-islamische Kultur auch nur dann in eine Identitätskrise, wenn diese ihr eigenes vormodern-modernes Erbe verleugnet, also Wolkenkratzer baut, auf Pferden posiert, aber das Reiten schon lange verlernt hat und die neuste Technik mit einem mittelalterlichen Bewusstsein (miss-)braucht. Diese Rückbesinnung auf ein alternatives, verdrängtes Erbe entdeckt die kulturelle Moderne als menschliche Grundkonstante, die nicht nur keiner Kultur, sondern auch keiner Zeit spezifisch eignet. Abu Nuwas etwa steht einem Baudelaire ebenso nah oder fern wie einem Catull oder einem Li Tai-bo, der den Wein ein halbes Jahrhundert vor Abu Nuwas in China nicht weniger schön besungen hat.
Mit den durch die Beschäftigung mit dem verdrängten dichterischen Erbe gewonnenen Maßstäben einer kulturellen Moderne durchleuchtet Adonis in den auf die Vorlesungen am Collège de France folgenden Essays die unterschiedlichsten Aspekte der arabisch-islamischen Kultur der Gegenwart. Das Resultat ist immer ein neuer, ebenso inspirierender wie kritischer Blick auf vermeintlich abgehandelte Themen: Der Koran? Ein hochmoderner, gar nicht auszuschöpfender Text – nur dass man, um dies zu festzustellen, kein Gläubiger sein muss, schon gar kein Fundamentalist. Man muss nur … Dichter sein! Dann aber empfiehlt es sich sehr, vom Koran zu lernen, sich an ihm zu messen, ja ihn möglichst zu übertreffen, wie dies so mancher mittelalterliche arabische Dichter versucht hat. Es gilt dabei, den Text lebendig zu halten, ihn zu schützen vor den immer schon fertigen, vorgängig festgelegten Interpretationen, mit anderen Worten, vor Missbrauch.
Die politische Dimension dieser neuen Lesart des Erbes und des Korans ist in den vorliegenden Essays unübersehbar. »Wenn die Religion dem freien Nachdenken über Gott, den Menschen und die Welt kein Forum bieten kann, wozu ist die Religion dann da, und worin liegt ihr Nutzen?«, schließt Adonis seinen »Aufsatz zur Erneuerung im Islam«. Was Adonis in seinem Blick auf die Religion vom typischen abendländischen Islamkritiker unterscheidet, liegt genau darin, dass er für seine Kritik einen anderen Hintergrund, ein anderes Wissen und eine ganz andere Vision hat als die engstirnigen Ideologien, Nationalismen und Fundamentalismen, die unserer Islamkritik zugrunde liegen.
Die Kritik an den reaktionären Kräften im Islam schließlich ist es auch, die Adonis im letzten und jüngsten der hier vertretenen Texte bei seiner Einschätzung des Aufstands in Syrien eine gewisse Zurückhaltung diktiert. Diese Zurückhaltung ist für westliche Leser freilich zunächst kaum spürbar. Der Text scheint explizit, kritisiert unzweideutig die herrschende Baath-Partei und ihr System der Einparteienherrschaft nach dem Vorbild der ehemaligen Ostblocksstaaten, fordert zu Gewaltlosigkeit, Reform und freien Wahlen auf. Übelgenommen wurde ihm von syrischen Oppositionellen gleichwohl, dass der Präsident in den Augen von Adonis noch nicht vollständig diskreditiert scheint, denn er ist es, der die Reformen – von oben – in die Wege leiten soll: »All diese Fragen müssten von Präsident Assad zum Gegenstand intensiver Debatten erkoren werden, und zwar im Zuge eines allgemeinen nationalen Dialogs.« Eine vom Präsidenten initiierte Demokratie ist jedoch in den Augen der erstarkten syrischen Opposition keine echte.
Allerdings werden die Befürchtungen von Adonis gegenüber einer islamisch-fundamentalistischen Machtübernahme nach dem Sturz des Regimes oder angesichts bürgerkriegsähnlicher Zustände wie in Irak auch von vielen Syrern, nicht zuletzt vielen Christen geteilt. Seine Stimme ist daher durchaus als authentische Stimme zu würdigen, wenn sie auch nicht die Stimme der zu allem entschlossenen Opposition ist.
Die Essays von Adonis, vor allem sein Konzept der kulturellen Moderne, seine rélecture des klassischen und religiösen Erbes, haben unter arabischen Intellektuellen eine weitreichende Wirkung entfaltet und die Beschäftigung damit vor allem auch unter den säkularen Bildungseliten rehabilitiert. Dabei ist der einzige unter den hier versammelten Texten, der explizit für ein westliches Publikum geschrieben wurde (wenngleich nachher mit großem Erfolg auf Arabisch publiziert), die »Einführung in die arabische Poetik«. Alle anderen Texte sind zuerst auf Arabisch publiziert worden und richten sich vornehmlich an ein arabisches Publikum. Wen die Offenheit, ja Dreistigkeit wundert, mit der Adonis die Religion und religiöse Traditionen relativiert, ja teils angreift, unterschätzt die Freizügigkeit, mit der nicht erst seit dem Revolutionsjahr 2011 in der arabischen Welt öffentlich über die Religion diskutiert werden kann und diskutiert wird. Die Beschränkungen, die es gibt, sind schon aufgrund der Größe und Vielgestaltigkeit der arabischen Welt punktuell und lassen sich leicht umgehen. Das einzige Land, in dem Adonis nicht auftreten könnte, wenn er wollte, ist Saudi-Arabien – der engste arabische Verbündete des Westens.
Die Texte wurden in Absprache mit Adonis ausgewählt, der dabei Herausgeber und Übersetzer großzügig freie Hand ließ, und sind hier in chronologischer Anordnung präsentiert, wobei sich die Einteilung in die drei Themenblöcke Poesie, Religion und Politik nahezu von allein ergeben hat. Die Texte müssen aber nicht in der vorliegenden Reihenfolge gelesen werden, im Gegenteil: Jeder steht für sich und enthält eine geschlossene Argumentation. Mögen sich die Leserinnen und Leser den Gedankenreichtum nach den eigenen thematischen Vorlieben erschließen!
Einführung in die arabische Poetik
1. Vorlesung
Poetik und vorislamische Mündlichkeit
1
Ich verwende den Begriff Mündlichkeit unter dreierlei Aspekten: erstens im Hinblick auf die Tatsache, dass die arabische Dichtung in vorislamischer Zeit auf mündlicher Basis innerhalb einer oral-auditiven Kultur entstanden ist; zweitens im Hinblick darauf, dass uns diese Dichtung nicht in einer von Beginn an schriftlich fixierten Form erreicht hat, sondern dass sie im Gedächtnis eingraviert und mündlich weitertradiert wurde. Drittens geht es mir darum, die Merkmale der Mündlichkeit in der vorislamischen Dichtung zu untersuchen sowie die Intensität ihres Einflusses auf die arabische Dichtung in den nachfolgenden Epochen, vor allem auf ihre Ästhetik.
2
Die vorislamische Dichtung ist ein Kind der Vortragskunst. Damit meine ich, sie entstand durch Zuhören, nicht durch Lesen; durch Singen, nicht durch Schreiben. Bei dieser Dichtung war die Stimme gleichsam der Lebensatem, eine Musik des Körpers. Sie war das gesprochene Wort und gleichzeitig weit mehr als das. Denn sie übermittelte die Worte und gleichzeitig das, was Worte allein nicht zu übermitteln vermögen, vor allem wenn sie schriftlich fixiert sind. Darin zeigt sich, wie eng, vielschichtig und komplex die Beziehung zwischen Stimme und Wort sowie die zwischen dem Dichter und seiner Stimme ist. Es ist eine Beziehung zwischen der Einzigartigkeit des Dichters und der Präsenz seiner Stimme, welche sich beide nur schwer definieren lassen. Wenn wir die Worte gesungen hören, dann vernehmen wir nicht allein die Laute der einzelnen Buchstaben, sondern auch die Seele dessen, der diese artikuliert – wir hören das, was über das rein Physische hinaus- und in den spirituellen Bereich hineinreicht. Das bedeutungstragende Element ist hier nicht das isolierte Wort, sondern das Wort in Kombination mit der Stimme, der »Wortmusik«, dem »Wortgesang«. Es verweist also nicht einfach auf eine bestimmte Bedeutung, sondern ist eine Kraft, die auf Verschiedenstes hinzuweisen vermag. Es ist das in gesungene Sprache verwandelte Ich. Es ist das Leben in sprachlicher Gestalt. Daher rührt in der vorislamischen Dichtung die tiefe Übereinstimmung zwischen den lautlichen Wertigkeiten des Wortes und dessen emotionalem und affektivem Gehalt.
3
Die orale Kultur setzt zunächst einmal Zuhören voraus. Denn die Stimme verlangt vor allem nach einem Ohr, das sie wahrnimmt. Deshalb verfügte die orale Kultur über eine spezielle Technik des dichterischen Vortrags, die nicht darauf basierte, was ausgedrückt werden sollte, sondern darauf, wie man es ausdrückte. Dies umso mehr, als der vorislamische Dichter im Allgemeinen Dinge zur Sprache brachte, die dem Zuhörer schon vorher bekannt waren: seine Sitten und Traditionen, seine Kriege und Ruhmestaten, seine Triumphe und Niederlagen. Die Originalität des Dichters lag also nicht darin, was er zum Ausdruck brachte, sondern mit welcher Methode. Je kreativer und persönlicher er sich dieser bediente, desto stärker kam seine Individualität zum Tragen und desto größer war die Bewunderung seitens des Zuhörers. So kam dem vorislamischen Dichter die Aufgabe zu, die kollektiven Erfahrungen der Gemeinschaft, ihre alltäglichen, weltanschaulichen und moralischen Erscheinungsformen auf singuläre Weise abzubilden, in einer individuellen dichterischen Sprache. Man könnte somit sagen, dass der vorislamische Dichter sich selbst nur dadurch zum Ausdruck brachte, indem er sich zum Sprachrohr der Gemeinschaft machte. Er war einer, der mit seinem Gesang Zeugnis ablegte. Wir sollten uns also nicht über jenes Paradox in der vorislamischen Dichtung wundern: Einheit des Inhalts einerseits, Vielfalt des Ausdrucks andererseits.
4
Dem Rezitieren (inschad) und Memorieren kam sozusagen die Funktion eines Buches zu, durch welches die vorislamische Dichtung zum einen verbreitet, zum anderen bewahrt wurde.
Wenn wir den Ursprung des Wortes naschid (›Lied‹, ›Hymne‹) im Arabischen zurückverfolgen, erkennen wir, dass dieses ›Stimme‹ und ›Heben der Stimme‹ bedeutet, so wie es auch die rezitierte Dichtung selbst bezeichnet. Aus dem Prinzip, dass die vorislamische Dichtung für den Vortrag bestimmt war, ergab sich als weiteres Prinzip, dass der Dichter selbst seine Gedichte vortragen sollte. Denn Dichtung klingt besser aus dem Mund ihres Verfassers, wie es al-Djahiz (777–869)[5] ausdrückt. Hier deutet sich an, dass die Araber in vorislamischer Zeit den dichterischen Vortrag als eigenständige Begabung betrachteten, zusätzlich zur Gabe des dichterischen Ausdrucks. In der Tat kam der Begabung zum Vortrag eine außerordentliche Bedeutung dabei zu, die Zuhörerschaft für sich einzunehmen, in den Bann zu schlagen, zu beeindrucken. Was umso wichtiger war, als dass das Hören für die Menschen in vorislamischer Zeit die Grundlage für sprachliches und musikalisches Bewusstsein war. Oder wie Ibn Khaldun (1332–1406)[6] es ausdrückt: »Der Vater aller Zungenfertigkeiten ist das Hören.« So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass ein Gedicht umso mehr beeindruckte, je besser der Vortrag war.
Der dichterische Vortrag ist nichts anderes als eine Art von Gesang. Das literarische Erbe der Araber strotzt von Hinweisen, die das bestätigen. Oft wurden die vortragenden Dichter mit singenden Vögeln verglichen, und die vorgetragenen Gedichte mit deren Gezwitscher. Ein berühmter Ausspruch bringt das, was wir meinen, auf den Punkt: »Der Gesang ist der Leitzügel der Dichtung.« Und bei Hassan Ibn Thabit (653–660)[7], dem sogenannten »Dichter des Propheten«, heißt es in einem ebenfalls berühmten Vers:
Singen sollst du, wenn du ein Gedicht aufsagst – Gesang ist die Arena der Dichtung!
Hier offenbart sich uns die organische Verbindung zwischen Dichtung und Gesang in der vorislamischen Zeit, und man versteht, was gemeint ist, wenn al-Marzubani (910–994)[8] sagt: »Die Araber maßen die Dichtung am Gesang«, oder: »Der Gesang ist die Waage der Dichtung«. Ibn Raschiq[9] zufolge war der Gesang der Ursprung von Reim und Versmaß. Weiter führt er aus, Versmaße seien die Fundamente der Melodien und Gedichte die Stimmgabeln für den richtigen Ton. Den deutlichsten Beweis dafür, dass Dichtung für die vorislamischen Araber Rezitation und Gesang in einem bedeutete, liefert das »Buch der Lieder« des Abu l-Faradj al-Isfahani (897–967)[10], welches in 21 Bänden vorliegt und mit dessen Niederschrift er fünfzig Jahre zubrachte.
Ibn Khaldun geht diesem Phänomen auf den Grund, indem er sagt: »Der Gesang galt schon in alten Zeiten als Kunstgattung, denn er war eng mit der Poetik verbunden, ja er war deren melodische Ausgestaltung. Mit ihm beschäftigten sich in ihrem Bemühen, sich die Methoden der Dichtung und ihrer Disziplinen anzueignen, auch die herausragendsten Dichter und Gelehrten des Abbasidenreichs.« An weiterer Stelle definiert er den Gesang als »melodische Ausgestaltung von Gedichten, deren Versmaß sich daraus ergibt, dass man die Laute in regelmäßige Intervalle einteilt.«
Was den dichterischen Vortrag selbst anbelangt, so unterlag dieser in vorislamischer Zeit besonderen Traditionen, die auch in den nachfolgenden Epochen noch Bestand haben sollten. So pflegten manche Dichter beispielsweise im Stehen zu rezitieren. Andere lehnten es stolz ab vorzutragen, solange man ihnen keine Möglichkeit zum Sitzen bot. Wiederum andere machten Bewegungen mit den Händen oder dem ganzen Körper, so wie al-Khansa’ (gestorben ca. 644)[11], die, wie es in den Überlieferungen heißt, »ekstatisch hin und her schwankte und dabei den Blick gesenkt hielt«. Daran lässt sich sehen, wie es in der Mündlichkeit zu einem Zusammentreffen von stimmlicher und körperlicher bzw. von sprachlicher und gestischer Wirkung kommt.
Einige Dichter trugen während der Rezitation ihrer Gedichte elegante, speziell dafür vorgesehene Kleidung, so als wäre der Vortrag eine Hochzeitsfeier oder ein religiöses Fest. Auch in späteren Epochen gab es solche, die sich nach Art der vorislamischen Dichter kleideten – dabei die ungebrochene Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit betonend.
Einer der Dichter, die in vorislamischer Zeit für die exzellente Qualität ihres Vortragsstils bekannt waren, war al-A‘scha, der vom Kalifen Mu‘awiya (605–680)[12] »Zimbel der Araber« genannt worden sein soll. Für diese Bezeichnung existieren die unterschiedlichsten Erklärungen: Eine besagt, er habe »sein Publikum durch seinen genuin arabischen Vortragsstil in Begeisterung versetzt«; eine andere, er habe seine Verse hymnisch vorgetragen; eine weitere, seine Dichtung sei von den Arabern oft gesungen worden. Oder es wird die Qualität seiner Dichtung oder seines Vortragsstils gerühmt. All diese Erklärungen stellen eine Verbindung zwischen Dichtung, Rezitation und Gesang her. Darauf zielt auch ein Ausspruch von al-Farazdaq (640–728)[13] ab, den er an den Dichter ‘Abbad al-‘Anbari richtete, nachdem er dessen Vortrag gehört hatte: »Dein Vortragsstil lässt die Verse in meinem Geiste noch schöner erscheinen.«
5
Der dichterische Gesang (naschid) war wie ein Körper mit Versmaß, Rhythmus und Melodie als dessen Gliedmaßen. Von seiner gesanglichen Beherrschung hing ab, was für eine Wirkung er auf das Gehör ausübte. Der naschid war eine stimmliche Kunstfertigkeit, die eine andere sich mit ihr ergänzende Fertigkeit erforderte, nämlich die Kunst des Zuhörens. Jene Beherrschung erwuchs aus einer schrittweisen Herausbildung spezieller rhythmischer Strukturen.
Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass Rhythmus in vorislamischer Zeit zum ersten Mal in jener Art von Reimprosa auftrat, die man sadj‘ nannte. Demnach wäre die Reimprosa die früheste Form der vorislamischen oralen Dichtung, im Sinne einer lyrischen Sprache mit einem einheitlichen Muster. Dem folgte der radjaz, welcher entweder – wie der sadj‘ – aus nur einem Halbvers, aber mit einem Versmaß aus regelmäßigen rhythmischen Einheiten, gebildet wurde oder aber aus zwei Halbversen. Die Qaside war die Vollendung der rhythmischen Entwicklung. Sie bestand aus zwei gleich langen, metrisch gebundenen Halbversen, die an die Stelle von zwei gleich langen Sätzen in Reimprosa traten.
Die Wurzel des Wortes sadj‘ verweist auf ›Gurren‹ und ›Gesang‹. Man sagt: sadja‘at al-hamama (»Die Taube gurrte«; sie machte also mit ihrer Stimme ein Geräusch des Werbens und des Frohlockens), und: sadja‘at al-naqa (»Die Kamelstute gab sehnsuchtsvolle, in die Länge gezogene Laute von sich«). Die Laute der Taube ähneln denen der Kamelstute in ihrer Dauer und Gleichförmigkeit. Dadurch erklärt sich, dass sadj‘ auch ›gleichförmiges Voranschreiten‹ bedeutete. Der Ausdruck wurde so zu einem Terminus in der Rhythmik, und das Verb sadja‘a bekam den Sinn ›in gereimter Form sprechen, wie in Gedichten, aber ohne Metrum‹. Das Verbalnomen sadj‘ nahm die Bedeutung ›Gleichmäßigkeit, Regularität, sprachliche Ähnlichkeit‹ an, in dem Sinne, dass jedes Wort im Satz dem ihm korrespondierenden Wort ähnelt.
Die sadj‘ genannte Reimprosa existiert, von der Technik her gesehen, in drei Varianten:
Beide Teile haben die gleiche Gewichtung und die gleiche Länge, wobei sich die Endreime lautlich jeweils exakt entsprechen. Diese Variante wird Doppelung genannt.
Jedes der Wörter in einem der beiden Teile reimt sich mit dem ihm korrespondierenden Wort des jeweils anderen Teils.
Diese Form der Reimprosa ist den Rhetorikern zufolge die beste, sofern sie nicht übertrieben wirke.
Die Teile sind gleichwertig, wobei die Endreime aus artikulatorisch ähnlich gebildeten, aber nicht unbedingt identischen Lauten bestehen.
Wie allgemein bekannt, erlebte die Reimprosa in frühislamischer Zeit einen Niedergang und wäre beinahe verschwunden. Möglicherweise lässt sich dies, wie man vermutet hat, auf seine Verbindung mit Wahrsagerei und der Figur des Wahrsagers in vorislamischer Zeit zurückführen. Der Prophet Mohammed soll ihn gemäß einem von ihm überlieferten Ausspruch sogar untersagt haben: »Hütet euch vor der Reimprosa der Wahrsager!« Angeblich verbannte er ihn auch aus Gebeten und Ansprachen, wegen seiner Ähnlichkeit mit dem, was die Wahrsager bei ihren Vorhersagen prophezeiten.
Dennoch trat die Reimprosa in darauffolgenden Epochen wieder in Erscheinung. Man verwendete sie vor allem für die literarische Prosa in Ansprachen, Briefen und Makamen[14]. Dieser Gebrauch nahm in späterer Zeit dermaßen übertriebene und gekünstelte Ausmaße an, dass sie nur noch zu einer sinnentleerten Form wurde.
Die Qaside ihrerseits besteht aus Halbversen. Man verwendet das von derselben Wurzel abgeleitete Verb qasada in Sätzen wie: »Er brach das Rohr in zwei Hälften.« Die Bezeichnung ›Qaside‹ käme also demnach nicht von qasd in der Bedeutung ›Absicht, Ziel‹, bezöge sich also nicht auf den Inhalt des Gedichts, sondern auf dessen äußere, in zwei Halbverse geteilte Form. Ibn Khaldun glaubt jedoch im Unterschied dazu, die Bezeichnung ›Qaside‹ rühre daher, dass deren Verfasser – um zu seinem »Ziel« (qasd) zu gelangen – von einem Kunstgriff zum nächsten übergehe, von einem Thema (maqsud) zum anderen, indem er das erste Thema und seine Aspekte so lange bearbeite, bis es zu dem zweiten Thema passe. Al-Djahiz gibt eine andere Erklärung: Die Qaside sei so genannt worden, »weil deren Verfasser sie mit seinem Verstand geschaffen hat, und weil er eine Absicht damit verfolgt […] und sich um deren Verschönerung bemüht.«
Die Qaside war die in der Poetik vorherrschende Form, möglicherweise weil sie es am besten vermochte, den seelischen Bedürfnissen gerecht zu werden, und weil sie am besten für das Singen und Rezitieren geeignet war.
Die Tatsache, dass der Vers in der Qaside eine unabhängige Einheit für sich darstellt, geht, wie wir meinen, auf Gegebenheiten der Rezitation und des Gesangs zurück sowie auf Gegebenheiten, die mit der akustischen Rezeption in Verbindung stehen, nicht jedoch auf die arabische Mentalität, wie einige behaupten, denen zufolge es sich um eine am Teilaspekt und nicht am Ganzen interessierte Mentalität handele.