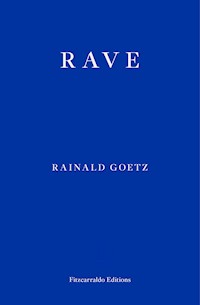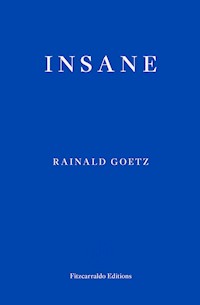23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
WRONG ist ein Band mit kleineren interventionistischen Texten, die in den letzten fünfzehn Jahren, der Zeit der Arbeit am Buch SCHLUCHT, entstanden sind.
WRONG: Auftritt, Vortrag, Lehre, Interview, Kritik: alles falsch, alles immer wieder: wrong. Und doch ist es wichtig, daß man sich als Autor auch direkt, mit solchen Textaktionen, am öffentlichen Gespräch beteiligt, lebendig, wirr, flirrend, das Ich ungeschützt präsentiert, nicht nur in die finale Totengestalt des Werks hineinkonzentriert.
So schreiben, wie man reden würde, wenn man dem Gegenüber schnell erklären will, was man zu Joachim Bessing denkt, zu Michel Houellebecq, zu Albert von Schirnding oder zum Rechtsstreit des Suhrkamp Verlags mit dem Investor Barlach. In den Interviews geht es um die eigenen Bücher, den Fotoband elfter september 2010, den Roman Johann Holtrop oder das Theaterstück Reich des Todes. In zwei Reden und zwei Aufsätzen – der Antrittsvorlesung »Leben und Schreiben«, der Rede »Büchnerpreis«, der Produktionspoetik »Spekulativer Realismus« und der Rezeptionspoetik »Absoluter Idealismus« – hat Rainald Goetz seine Autorschaft grundlegend zu bestimmen versucht, aber vom Gestus her auch hier inspiriert von der Direktheit der mitmenschlichen Begegnung und dem Darlegungsfuror in mündlicher Rede. Dadurch ist WRONG ein helles Buch geworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
und müßte ich gehenin dunkler Schlucht VI
Schlucht6
Irre. Roman
Krieg. Stücke
Hirn. Schriftzugabe
Kontrolliert. Geschichte
Festung. Stücke
1989. Material
Kronos. Berichte
V.Heute Morgen
Geschichte der Gegenwart
Rave. Erzählung
Jeff Koons. Stück
Dekonspiratione. Erzählung
Celebration. Texte und Bilder zur Nacht
Abfall für alle. Roman eines Jahres
VI.Schlucht
Frühes 21. Jahrhundert
Klage. Tagebuchessay
loslabern. Bericht
Johann Holtrop. Roman
elfter september 2010. Bilder eines Jahrzehnts
Lapidarium. Stücke
wrong. Textaktionen
Rainald Goetz
wrong
Suhrkamp
Michel Houellebecq
November 2006
Impressionisten
Fotobuch
Antrittsvorlesung
Tagebuch, Sommer 2012
Johann Holtrop
Barlach vs. Suhrkamp
Joachim Bessing
Stücke schreiben
Schillerpreis
Spekulativer Realismus
de:bug
Siegfried Unseld
Albert von Schirnding
Büchnerpreis
Insane
Moral Mazes 24
Reich des Todes
Johann Holtrop auf der Bühne
Absoluter Idealismus
Soziale Energie
Baracke
Wrong II
Moritz von Uslar
ein huschendes Schreiben
ein flatterndes Denken
SOZIALE ENERGIE
Elend der Liebe
zu Michel Houellebecqs neuem Roman »Die Möglichkeit einer Insel«
Cicero, Oktober 2005
und ich bin dann immer
in Entzücken und süßer Panik
1
Elohim wartet. Der Bus kommt nicht. Es ist ein herrlicher Morgen. Über dem Brachgelände an der Rennbahnstraße im Nordosten Berlins geht hinter hohen Pappeln und verrotteten Sportanlagen im nationalsozialistischen Brutalostyle die Spätsommersonne auf. Autos und Laster donnern an der verlassenen Bushaltestelle vorbei. Die Luft ist kühl und dunstig, wo die Sonne hinscheint, riecht es nach Laub. Die Spielothek gegenüber, im Parterre des Comfort Hotels einquartiert, entläßt zwei Kunden, sie kommen langsam auf die Haltestelle zu, gehen ratlos daran vorbei, ins Nirgendwo ihrer Bestimmung. Dort in der Ferne, von woher der Bus nicht kommt, sind die Zukünftigen vielleicht schon erschienen, von Michel Houellebecq in die Gegenwart der Menschen transportiert mit Hilfe der Worte seines neuen Romans. Vor denen er warnt, fürchten soll der Leser seine Worte. Aber warum? Morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter. Elohim lehnt jetzt am schwarz geschwungenen Eisengeländer der Weidendammbrücke im Zentrum Berlins. Hier ist die Welt dicht belebt von Passanten und schlendernden Touristen, die beim Bahnhof Friedrichstraße, von der schrägen Abendsonne sattfarbig beleuchtet, ein beinahe hochgestimmtes Gefühl feierabendlich vitaler Großstadtturbulenz erzeugen. Elohim raucht. Der Körper muß noch vernichtet werden, die Gedanken banalisiert. Handelt „Die Möglichkeit einer Insel“ auch von der Wirklichkeit dieser Welt? Wie verrottet ist die Welt eigentlich wirklich?
2
Es macht auf jeden Fall eine sagenhaft gute Laune, Michel Houellebecqs neues Buch zu lesen. Sein materialistischer Fundamentalpessimismus wird in einer comic-haft überzeichneten Heiterkeitserzählweise präsentiert. Die Handlung verläuft vorhersehbar simpel, abstrus und grotesk zugleich, vorallem auch spannend. Die Sprache der einzelnen Sätze ist klar und durchsichtig, von einer fröhlichen Uneitelkeit, der Stil insgesamt dabei abgründig und schwer dekodierbar, Neugier entsteht. Seine Philosophie ist im Kern platt und wahr, in den Konsequenzen Unsinn, der Aufruhr erzeugt und dazu agitiert, Gegenpositionen auf ihre Konsequenzen hin zu durcheilen. Man liest einen futuristischen Roman, fast ganz ohne fiktive Zukunftswissenschaft, inhaltlich und textformtechnisch eher eine historische Meditation über die Entstehung der christlichen Religion, aus mittelalterlicher Sicht. Und man liest den Lebensbericht einer Ich-Figur, die den Roman maximal nah an das Autor-Ich Michel Houellebecq bringt, voyeuristische Einblicke bietet und sich entzieht, so die Verstehensrecherche des Literarischen provokativ anspringen läßt. Und es ist ein pornographischer Roman, der von Sexualität handelt und deshalb auch in gut dosierter Häufigkeit von Ficken und Blasen berichtet, wobei diese expliziten Stellen aber von einer fast kalauerhaft abgewichsten – ha, ha, würde hier bei Houellebecq stehen – Kargheit und Abgeklärtheit sind, die zugleich eine Tiefe des Animalischen spüren lassen, das zur Wahrheit der menschlichen Sexualität auch dazugehört.
An keiner Stelle des Buches wird irgendeiner dieser Widersprüche aufgelöst oder eindeutig entschieden, obwohl der Text selber seiner Tendenz zu offensiv stammtischmanierhafter Simplizität immer wieder gerne, grimmig und lustvoll folgt. Grelle Zugespitztheitssätze stehen da, um das von ihnen Gesagte zu behaupten und damit auch los zu sein, in Frage zu stellen oder direkt dem Hohngelächter auszusetzen. Es ist das Schicksal der Worte, in gedruckter Form zur Wahrheit zu wollen, von der Wahrheit nicht loszukommen und in Wahrheit verkrallt die Wirklichkeit und deren immer auch antisprachliche Dimension nie zu greifen zu kriegen. Und es ist eine Aufgabe der Literatur, diese Atombindungskräfte zwischen Wahrheit und Worten zur Explosion zu bringen, um dennoch so ausgerechnet aus Worten ein Kunstwerk von wirklichkeitsanaloger Qualität und Komplexität entstehen lassen zu können. Michel Houellebecq ist ein Meister dieser Kunst, und die Freude bei der Lektüre seines vierten Romans ist auch eine an seiner handwerklichen Meisterschaft. Die Könner-Romane der Amerikaner und Engländer, Franzen, McEwan, Roth, sind reaktionärer, ranziger Angeberstumpfsinn gegen diese Gegenwartsliteratur aus dem Herzen Europas. Allein die Art, wie komplett enthemmt Michel Houellebecq an seiner Zigarette saugt, zeigt einem Elohim alles: wie er im Geist lebt und denkt.
3
Auf der Hinterseite des Bahnhofs Zoo drängen sich im Museum für Fotografie die Kunst- und Nachtlebenleute bei der Präsentation des neuen Buches »truth study center« von Wolfgang Tillmans. In der Buchhandlung König werden auf eine Leinwand seine Fotos projiziert. Er beantwortet Fragen, signiert seine Bücher, und der Taschen-Verlag spendiert Brezeln und Kölsch. Dann stehen die Leute auf dem Gehweg vor dem Haus, trinken und plaudern. Es ist einer der letzten warmen Abende dieses Sommers. Der Härte des mit Worten Gesagten die Anmut und Melancholie der Bilder entgegenstellen: mögliche Poetologie.
Der Fokus von Houellebecqs Roman ist auf ein geistig kaum erreichbares Spezifikum der Realität gerichtet, auf den Körper. Er blickt zunächst vorbei am Gesellschaftlichen, durch das Menschliche hindurch auf die Basalfaktizität des körperlichen Lebens der säugetierischen Kreatur, die auch Mensch ist. Versuchsaufbau: Wenn man die exzessive Betonung des Körperlichen, wie sie alltäglich medial und real vorgeführt und zugleich verbal negiert wird, wirklich ernst nehmen würde, könnte man dann die Gesetze, die die Lebensgeschichten der Menschen bestimmen, eventuell besser verstehen? Erkennen, woran das Zusammenleben der Menschen krankt und ob Erlösung denkbar ist? Der Roman als wissenschaftliches Institut für Grundlagenforschung, an dem eine futuristische Spekulation experimentell getestet wird: wie würde ein vom Körper befreites ewiges Leben ausschauen, individuell, für den einzelnen, und über eine lange Generationenfolge hingeweg fürs Ganze der Menschheit? Aber zugleich kapituliert der Roman von Anfang an vor der grotesk hybriden Grundsätzlichkeit seiner eigenen Fragestellung, zerstört die eigene philosophische Ambition, um sich der anderen Seriosität der literarischen Wahrheitssuche zu unterstellen. Houellebecq ist ein von philosophischen Obsessionen getriebener Autor, aber klug genug, sich nicht wirklich selber für einen Philosophen zu halten. So radikalisiert er seine Gedanken über den Körper, tippt die Extreme an: Rassismus, Schönheit, Jugend, sexuelle Lust, die Macht des Stärkeren, Gewalt, und kommt in alldem zu Wahrheiten ultrareaktionärer Konsequenz. Entzieht sich dieser Konsequenz aber immer wieder ins Erzählerische, leichthin, offen, ins Bildgeführte seiner Szenen, Episoden und Visionen. Er ist fasziniert von der Vision menschenleerer, weiter Unendlichkeitslandschaften, abstrakter Formationen der Erde, wie er sie in seinem »Lanzarote«-Buch auch fotografisch dokumentiert hat.
Aber auch die alltägliche Szenizität seiner Erlebnisbeschreibung hat eine einleuchtende visuelle Plausibilität von soghafter Kraft. Immer sieht man als Leser seine Helden ihr Leben erleben, Bild für Bild, sichtbare Situationen und Stationen reihen sich aneinander, prägen den Eindruck, den man vom Ganzen der Geschichte des Romans hat. In diesen Szenen agieren seine Helden, sie reden und handeln, man wird nicht mit ausgedachtem Gedankengelabere, mit Innentextsuada der Figuren belästigt. Nicht was die Figuren denken, wird mitgeteilt, sondern Gedanken, die in jeweiligen Situationen möglich sind, also Denkbares, Philosophie, Objektivität. Beides entspricht sich und hält sich gegenseitig: das Geschaute und die Philosphie, das sinnlich Konkrete der Bilder und das philosophisch Spekulative der Ideen. Und weil Houellebecq auf die Beiläufigkeit und Alltäglichkeit seiner Sprache genauso viel Wert legt wie auf die mittlere Durchschnittlichkeit seiner Helden, entsteht ein zugleich traditioneller und hochmoderner Realo-Stil des Erzählens: der unprivilegierte Blick.
Schauen heißt auch Angst und Distanz, bedrohliche Körper im Raum. Die zu begehren, in pornographischer Obsession, Sehsinnbesessenheit, Dunkelkammer, die den Realexzeß der Leiber will, personenfreien Sex. Und das Wegsein von Liebe, die geschlossenen Auges ahnen, tasten, fühlen könnte, soll sein. Der Anmut und Würde der Bilder auch die geballte Ordinärheit und Brutalität, den perversen Alltagsirrsinn auf den Straßen, entgegensetzen. Hinschauen, weggehen. Die Welt umarmen.
4
Der Held des Buches, »Daniel«, ist erfolgreicher Komiker. Er schreibt einen Lebensbericht, mit dem er für die Nachwelt Zeugnis von sich selbst gibt. Seine öffentliche Karriere hat einen Punkt erreicht, der ihn mit Überdruß erfüllt. Er kann das Lachen seines Publikums nicht mehr ertragen. Bei einem Interview lernt er »Isabelle« kennen, die Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Lolita, und sie verlieben sich ineinander. Daniel dreht Pornofilme, Isabelle altert. Nach drei Jahren heiraten sie und ziehen sich auf sein Anwesen im Süden Spaniens zurück. Er will keine Kinder, sie schafft einen Hund an, »Fox«, die Liebe geht kaputt. Über Fox lernen sie ein benachbartes Ehepaar kennen, deren Sohn Mitglied einer Sekte, der »Elohimiten«, ist. Daniel und Isabelle trennen sich, sie geht zurück zu ihrer alternden Mutter. Daniel wird als VIP zu einem Lehrgang der Sekte eingeladen. Einer der Elohimiten, »Vincent«, ist Künstler. Daniel trifft ihn in Paris, lernt Vincents Kunst kennen und versucht selber einen beruflichen Neuanfang als Schreiber zynisch radikaler Filmdrehbücher, scheitert aber. Daniel ist 47, ausgebrannt, am Ende.
Im zweiten Teil verliebt sich Daniel in die 22jährige Schauspielerin »Esther«, auch Studentin der Philosophie. Sie besucht ihn im Süden Spaniens, er sie in Madrid. In der Sexualität mit ihr erlebt Daniel ein neues, bisher nicht gekanntes Glück. Er lernt die Liebe kennen, lebt im Paradies, für Wochen. Plötzlich merkt er, wie alt er ist, daß er ein alternder Mann ist, für Esther zu alt. Er fühlt die Schande des Alters, zerbricht daran. Beim Winterseminar der Elohimiten auf Lanzarote wird der Prophet ermordet. Vincent enthüllt, daß er der Sohn des Propheten ist. Nach drei Tagen erscheint er als Reinkarnation des Ermordeten, der erstmals geglückte Klon eines Menschen. Daniel wird zum Mitwisser dieses Gründungsmythos’ der Elohimiten. Er läßt sich seine DNA entnehmen und tritt so offiziell der elohimitischen Kirche bei. Die Wiederbegegnung mit Esther ist eine Katastrophe. Bei ihrer Geburtstagsparty macht sie Daniel, der sich in seiner Verzweiflung aufs lächerlichste vor ihr erniedrigt, endgültig fertig. Daniel fährt nach Biarritz, wo seine frühere Frau Isabelle lebt. Er kauft sich ein Notebook, um sein Leben aufzuschreiben. Nach dem Wiedersehen mit Isabelle zieht er wieder bei ihr ein, aber es ist zu spät, sie trennen sich ein zweites Mal. Isabelle bringt sich um, Daniel erbt den Hund. Er ist in Paris beim Ausbau der elohimitischen Kirche und ihrem beginnenden weltweiten Siegeszug dabei. Mit dem Schreiben seines Lebensberichts bereitet er sich auf seinen Selbstmord vor und verschwindet schließlich im Kommentar von »Daniel 25«, der seinen Lebensbericht zwei Jahrtausende nach der Niederschrift lesende und kommentierende Klonnachfolger seiner Person.
4.2
Das Leben des Menschen ist wirr, aber es verläuft doch, zumindest in seinem äußerlichen Ablauf, auch der Chronologie der Tage und Jahre, der Logik der Zeit unterworfen. Es erzeugt eine naive, dabei tiefe Empathie, das Leben des Helden in dieser geraden Form, auf diese Temporalgerade hinfiktionalisiert, erzählt zu bekommen. Die Unerbittlichkeit des zeitlichen Ablaufs ist in sich tragisch, am Ende des Lebens von Daniel ist der Leser emotional so mitgenommen, ausgelaugt, zermalmt wie Daniel selbst.
Die Grundidee der elohimitischen Kirche ist ein geistiger Auftrag: jeder Mensch muß das Leben seines Vorgängers studieren, seinen Lebensbericht lesen und kommentieren, sich so dessen Erfahrungen und Denken zu eigen machen und schließlich selbst einen Lebensbericht verfassen. Körperlich ist der Mensch durch die Realisierung der Klontechnologie unsterblich geworden, die geistige Erbschaft der Individualität aber kann er nur durch eine bewegend altertümliche Aktivität, durch lesenden Nachvollzug früherer Lebensgeschichten, für sich gewinnen.
Die Kommentare der Klonnachfolger von Daniel will man anfangs kaum zur Kenntnis nehmen. Alle paar Seiten unterbrechen sie die Erzählung der Lebensgeschichte von Daniel, nerven mit futuristisch religiösem Vokabular, technoidem Spinnkram und uninteressanten eigenen Minimalerlebnissen. Aber sie sind vergleichsweise kurz, und so merkt man bald, daß sie hier zunächst einmal eine erzähltechnisch rhythmisierende Funktion haben. Es macht den chronologisch gerade durcherzählten Lebensbericht besser lesbar und nachvollziehbarer, wenn er immer wieder unterbrochen und so, rein äußerlich, zu kleinen, szenisch kompakten Geschehniseinheiten zusammengestaucht wird. Der Vorgänger-Roman „Plattform“ hat mit der ununterbrochenen Geradlinigkeit der Erzählung experimentiert, auch um die komplizierter zeitverschachtelte Struktur der „Elementarteilchen“ zu überbieten. Was sich aber allzu widerstandslos liest, kann man nicht so gut behalten. Das hat die Intensität von „Plattform“ geschwächt. In „Die Möglichkeit einer Insel“ ist es gerade das regelmäßig eingespielte Störgeräusch der futuristischen Nebenerzählung, das die eigentliche Gegenwartsgeschichte von Daniels Leben umso deutlicher zur Wirkung bringt.
Der Kunstgriff ist simpel, effektiv und einleuchtend zugleich. Denn er ruft nebenher altvertraute Assoziationen aus der Tiefe der abendländischen Tradition auf. Schon allein die Art, wie Namen und Ziffern zu visuellen Einheiten kombiniert sind, läßt an die Bibel denken. Daniel 24,2, Marie 23, Esther 1, Daniel 1,28. Das klingt wie: 1. Korinther 13,4-8 oder Genesis 1,2. Über den Haupthelden des Buches Daniel erfahren wir im sonstigen Alten Testament nichts, meldet die Bibel. Das Buch Daniel gehört zu den prophetischen Büchern, das Buch Ester zu den geschichtlichen. Das Buch Houellebecq ist Literatur, das heißt Text, der sich auf Texte über die Welt bezieht, in einer Weise, die dem Menschen entspricht. „Isomorphe à l’homme, le roman devrait normalement pouvoir tout en contenir“, heißt es bei Houellebecq: von gleicher Gestalt wie der Mensch, sollte der Roman normalerweise alles von ihm enthalten können.
Die hier gewählte Form einer fiktiven Autobiographie schließt das Buch außerdem mit allen anderen bisherigen Autobiographien und Lebenszeugnissen kurz, von Augustinus über Pascal zu Daniel Küblböck, vorallem aber natürlich mit Proust. Dessen innerer Unendlichkeit an Details und psychischer Letzterforschung wird hier ein Radikalismus des Banalen, Bekannten, zu Tode Gedroschenen, eine innerlich verwüstete Welt entgegengehalten. Was folgt aus dieser fast spielerisch eingenommenen Position der Untröstlichkeit?
5
Im Ende war die Erde wüst und leer.
Auch diesen Kalauer der futuristischen Perspektive versagt sich Houellebecq nicht. Daniel ist schließlich Komiker gewesen. Das Kaputteste an platten Scherzen war seine Welt. Doch sein Spott, den das Publikum ihm mit vielen Millionen und einem ihn erdrückenden Ruhm entgolten hat, war in Wirklichkeit nicht einmal böse genug. Viel schlimmer als darin vorhergesehen, hat sich die Menschheit in den unserer Gegenwart folgenden Jahrhunderten zugrunde gerichtet. Isolierte Neomenschen sitzen in absoluter Einsamkeit hinter ihren Computern, selten in abstraktem Funkkontakt mit ihresgleichen, treten kurz vor ihrem Tod in das Intermediärstadium ein und versterben. Um kurz darauf von einem genetisch identischen Nachfolge-Individuum ersetzt zu werden. Die einzelnen Anwesen der Neomenschen sind von einem Elektrozaun umgeben, vor der Wüste draußen so geschützt. Dort irren versprengte Horden von Wilden, auf dem Niveau eher von Affen als von frühen Menschen, durch eine von Dürre und Verringerung zerstörte Restwelt, von den Neomenschen dabei ohne jede Emotion beobachtet. Grausamkeit, Leid, Gewalt, ständiger Schmerz und primitivste Regeln sexueller Dominanz bestimmen das Leben dieser demnächst aussterbenden Wilden. Für die Zukunft ist von der Höchsten Schwester nach einer noch bevorstehenden Dritten Verringerung die Rückkehr der Feuchtigkeit und das Erscheinen der Zukünftigen angekündigt.
Jahrhunderte vergehen. Einzelne Neomenschen stellen ihre Existenz, die nur in physischer Gegenwart eines Hundes, sonst ohne jeden körperlichen Kontakt zu einem anderen neomenschlichen Wesen verläuft, ausschließlich der reinen Erkenntnis gewidmet, in Frage, widersetzen sich geistig ihrer Isolation, verlassen ihr schützendes Anwesen und ziehen zu Fuß über die verwüstete Erde richtung Westen, auf der Suche nach ihresgleichen. Möglicherweise in der Gegend von Lanzarote soll sich eine neue Gemeinschaft von Neomenschen zusammengefunden haben, irgendwo in der Mitte der Zeit gebe es angeblich »die Möglichkeit einer Insel«. Der zweite Kommentator von Daniels Lebensbericht, »Daniel 25«, ist ein solcher neomenschlicher Rebell. Er bedauert das jähe Ende seines Vorgängers. Ein Gedicht, das der noch kurz vor seinem Selbstmord für Esther geschrieben hat, veranlaßt ihn, das Abenteuer zu wagen: gemeinsam mit dem Hund Fox verläßt er seine geschützte Residenz und macht sich auf den Weg der Suche nach der hypothetischen neomenschlichen Gemeinschaft, ein Rückkehrversuch eigentlich zur früheren Menschheit. Der von ihm hinterlassene Kommentar, ein Epilog ohne Pointe, findet zwar das Meer, aber keine Antwort auf die Aporie des Daseins, keine neue Gemeinschaft, und läuft aus wie die Wellen des Wassers am Strand, in sanftem rosa Rauschen, unerlöst.
5.2
Aus der Körperlichkeit ausgestoßen: der Intellektuelle, der Alte, der kranke, schwächliche, unschöne Mensch. Er sieht sich einer Welt von Gesunden gegenüber, die mit einer abenteuerlichen Lust ihre Körper öffentlich zur Schau stellen, einander zur Besichtigung darbieten, zur jederzeit möglichen gegenseitigen Benutzung im Sex. Der Ausgestoßene sieht das nur, kommt nicht in Frage als Partner in diesem Spiel, das Starke, Schöne, Große und Junge verbindet. Daß eine hochverfeinerte Spätkultur in ihrem Existenzkern, den gesellschaftlich genormten Bedingungen der Fortpflanzung, derartig zu archaischer Brutalität und Direktheit zurückkehrt, ist ein verstörendes Zeichen von finaler Kaputtheit und uranfänglicher Vitalität zugleich. Die Schwachen haben dann die Liebe erfunden. Sie sehnt sich nach Dauer, Zuneigung, Hingabe und Ausschließlichkeit, nach Bindung an den einen anderen Menschen, ungeteilt. Die bisher vorliegenden Zeugnisse belegen, daß dieser Lebensentwurf nicht gelingt. Seit Kinder nicht mehr automatisch Folge sexueller Vereinigung sind, ist der Verbindung von Mann und Frau in Liebe zusätzlich die materiale Selbstverständlichkeitsbasis entzogen. Glück der Freiheit, Einsamkeit, mönchische Existenzen mit geistlichem Schwerpunkt, exzessive Promiskuität, oder fern jeder sexuellen Aktivität vertrübende Singleexistenzen, Alltagsverwahrlosung dieser Einzeller, die massenhaft in den Großstädten leben, deren Körper nur noch für sie selbst da ist, für keinen anderen Körper mehr sonst. Die Gesellschaft experimentiert mit den Folgen der sexuellen Revolution erst seit knapp vierzig Jahren. Houellebecq hat sich zum Chronisten dieser öffentlichen Bedingungen für individuelles Unglück gemacht. In früheren Romanen war der fiktive Erlösungsfluchtpunkt: endloser Sex mit unendlich vielen Sexorganen. Diesmal probiert er es mit der Liebe. Das resultierende Desaster ist schlimmer als alle anderen davor. Am Ende steht auch hier der unausweichlich hergeleitete Bilanzsuizid. Die Wahrheit des heute lebenden Menschen kann nur die Selbstabschaffung sein.
Im Namen des Volkes, Urteil.
6
Glücklich ist die Zeit mit Anfang zwanzig. Schwer alles, was später kommt.
Elohim schwebt die Rolltreppe nach unten im Berliner Kaufhaus Lafayette. Hier glitzert die Welt im elektrischen Licht, es funkeln die Waren, das Essen, die Blumen, bunt lacht das Kaufhaus den Reichen und Alten, den Fetten und Satten entgegen, und sie strahlen zurück. Sie kommen hierher, um Geld auszugeben, sie wissen, was ihnen schmeckt und gefällt, die physische Lust der Sinne ist zusätzlich geistig belebt, kompliziert und potenziert, jeder Cent und jeder Euro, der hier in die Luft geschmissen wird, explodiert in Myriaden klitzekleiner Moleküle von Glück, das auf die Menschen von oben niedergeht, sanft. Sie heben die Gesichter. Die Zukunft ist ja schon da. Sie kennen die Namen von uralten Fischen, Krebsen und Muscheln, die für sie gezüchtet und gefangen, dann zubereitet worden sind zum Essen, da liegen sie tot auf den Tellern. Und die Menschen essen, sie reden und lachen, der ältere Herr am Stehtisch beim Käse hebt sein Glas Wein, die ihn begleitende ältere Dame, selbst eine Kröte von monumentalen Maßen, nickt ihm zu, von Lust erfüllt und Freude. Eine Ekelattacke, geruchssinngetriggert, durchjagt Elohims tieferes Hirn, im Cortex reagiert ein Gegengedanke sofort: falsch. Falsch ist es zu glauben, man wüßte, wie man sich all dem hier valide entziehen könnte, nur weil man es nicht versteht und selbst nicht teilnimmt daran. Die Düsternis von Houellebecqs Diagnose stößt jeden auf sich und seine ureigene individuelle Existenz zurück. Wissen wollen, was man selber denkt. Es gibt so viele Welten wie Menschen. Das sprachlich Gezeigte muß eitern vor Elend. Aber wo Leben vom Glück gestreift ist, steht auch nicht immer nur ein leises Kitschwort wie: Leben.
Da endet auch schon die Sinnenlustgrotte im Untergeschoß des Lafayette. In der Französischen Buchhandlung direkt daneben liegt Houellebecqs Buch im Original stapelweise neben der Kasse. Jedes einzelne Exemplar dieses Buches ist ein perfektes Objekt, das gegen alles, was in ihm gesagt wird, zugleich protestiert, sich selbst widerlegt. Elohim zahlt. Die Transaktion gelingt. Das Buch wird ihm gegeben. Thank You For Shopping With Us. Sehr gerne. Bald werden die Augen die Buchstaben abtasten, lesen.
Draußen ist es inzwischen fast schon dunkel geworden. Der Herbst kommt. Eine kleine asiatische Frau wird in Handschellen, mit auf den Rücken gefesselten Händen, von zwei Polizisten über die Straße zum Streifenwagen geführt. Sie hat ihr Gesicht nach hinten gedreht, fragend. Der Freie darf sein Rad aufsperren, er setzt sich darauf und radelt los. So radelte er hin.
November 2006
Tempo
Jubiläumsausgabe
Unverwischte Bilder,
in denen der Haß nicht das Zerstörte ist, nicht Präzision. Die Trottelwelt trotzdem nicht widerlegen, in ihr auch nicht mehr nicht mitleben, nicht schreckhaft aufflattern, nicht angstlos und nicht unabgehärtet. Nie vergessen, wie das geht.
Gegen die Firma Debitel Klage nicht einreichen. Kein Handy zurückgeben, den Trottelvertrag nicht anfechten, sich nicht informieren. Nicht schlafen, nicht schlafen. Kein mündiger Kunde werden, kein Grauen, kein Stumpfsinn der Sachen, nicht niedergedrückt, von keinem noch so ungigantischen Müssen, keiner Wahl zwischen Optionen, die man nie wollte, aber auch nicht mehr oktroyiert bekommt vom Antiphantasma des Trottelkollektivs, das der komsumistisch-industrielle Herrschafts- und Unterdrückungsapparat nicht bedient, nicht stimuliert, nicht auspreßt bis auf den letzten Tropfen. Nicht mehr unaufgeklärt über den Terror der Waren, wie noch zuletzt über politische Macht. Nicht unendlich angewidert, nicht abgestoßen sein, endlich nur noch ewig angekotzt von allem, wie es nie war und nicht mehr ist, der ganze Dreck, die nirgends unversammelten Idioten, die das alles betreiben, Aussageflucht, Narrationsmüll, Nichtideen, das All und Nichts der Dinge und des Todes: ah, aua, ach.
Bunker der Abscheu. Den nie mehr verlassen und nie mehr hinaustreten ins Freie. Wo bin ich denn hier? Nicht im Gespräch mit Freunden wäre ich vielleicht wie früher nie mehr -
Wiese, Wald, Musik.
Das wiedergefundene Licht
Impressionisten in Berlin
Vanity Fair, 31. Mai 2007
Warum ich nicht mehr schreiben konnte, Anfang der Nullerjahre, konnte ich nicht erkennen. Die Textmaschine war kaputt, das innerste Ich. Ich versuchte, noch einmal ganz von vorne anzufangen, ganz außen, mit dem Schreiben von Kritiken. Die Freude am Standardtext, den man abliefert, die Scham, in Phrasen zu denken. Die Wiedereroberung des Schreibens, das wiedergefundene Licht.
Als der Sommer der Gegenwart begann, flirrte das Licht der 1870er Jahre über den Wiesen und Gärten in der Umgebung von Paris. Die Blüten von Argenteuil waren rot, die Birken und Pappeln hell beblättert, beigeweiß standen die Wolken am Himmel, der Himmel war blau, und tiefgrün schimmerte der Bach im Gegenlicht unter den hohen Bäumen von Valmondois. Geahnte Figuren, Menschen am Sonntag, am Meer, ein junges Liebespaar auf einem Kahn. Hüte, Schirme, Picknick, Glanz. Der Glanz einer plötzlich ganz simplen Plausibilität: Ja, so sieht die Welt aus. So hat sie sich angefühlt damals, mit 16 oder 18, auf der ersten Reise nach Paris, im Musée d’Orsay, auf der Suche nach den hellen Lichtwerken der legendären Impressionisten.
Spontan und direkt wirkt der Realismus dieser Bilder auf den anfänglichen, künstlerisch ungebildeten Blick, eine naive Freude geht aus von ihrer leuchtenden Stimmung und erneuert sich in jeder Generation. Das hat auch dazu geführt, daß diese Art Wirklichkeitsdarstellung als überzuckert, verkitscht und verlogen empfunden wurde, daß man zu viel von diesen Leichtigkeiten gesehen zu haben glaubte. Daß man doch eher gebannt bleibt von den Kaputtheiten des 20. Jahrhunderts, von dessen gebrochener Kunst. Die große Moma-Ausstellung vor drei Jahren in Berlin präsentierte die Kunst des 20. Jahrhunderts in einer kaum mehr überblickbaren Fülle. Dabei war der Durchbruch in die Hochmoderne paradoxerweise plötzlich als etwas ikonographisch komplett Durchgesetztes, Stillgestelltes, Abgehangenes zu sehen, fast als Kalauer der jüngsten Kunstgeschichte. Aber das Publikum war begeistert, so viele Leute kamen, so lang waren die Schlangen. Es war viel gutes Wetter damals, wie im Jahr davor, im großen Hitzesommer von 2003, und die lila Kissen machten die Betonwelten um den Mies-van-der-Rohe-Bau der Neuen Nationalgalerie zu einem herrlich belebten Ort der Stadt.
Jetzt also wieder, diesmal das Metropolitan Museum: »Die schönsten Franzosen kommen aus New York« meldet das Plakat, gerahmt von den Nationalfarben der französischen Trikolore, bleu-blanc-rouge, die auch die Stars and Stripes der amerikanischen Flagge zeigen, und in der Mitte sieht man einen dieser Klassiker, »Im Boot«, von Édouard Manet.
Okay, wie war das nochmal: Monet? Manet? Renoir? Degas? Welcher ist welcher und warum und wie? Wenn der Sommer wieder schön wird, werden sich die impressionistisch heiteren Szenen vor der Nationalgalerie auch heuer wieder abspielen; mit Ticketcontainer und Büdchen für Imbiß, Einstein-Kaffee im Freien auf der Steinmauer, die die hintere Terrasse des Museumstempels begrenzt; wo sonst Totraum ist, werden die Besucher Berlins sitzen und chillen und warten, daß die Schlange langsam vorrückt ins Innere, ins Dunkel des Museums, hin zu den Bildern der Helle.
Und dort dann nach den Ikonen suchen. Nach dem erinnerten Gefühl, nach den Mädchen und Blumen, den Wiesen, Bäumen und Gärten, nach den Punkten des Lichts, die die Netzhaut so seltsam vertraut stimulieren. Denn eine tief in die Realität des anatomischen Apparats hineinführende Fragestellung hat die Maler dieser Zeit beschäftigt: was ist das Lichtatom eigentlich, aus dem der visuelle Eindruck entsteht? Experimentell ergab sich die Antwort, die Farbpunkte als isolierte Einzelwesen zu sehen, die erste Zerlegung, der erste Zerfall der Moderne. Die Resultate dieser Abstraktion und Reduktion, die drei Farben Rot, Grün und Blau, werden im inneren Auge von speziell dafür empfänglichen Zellen der menschlichen Retina erwartet, dort aufgenommen, zusammengefaßt, weitergeleitet und erst zuletzt ganz hinten in der Sehrinde des Gehirns zum farbigen Gesamtbild verrechnet. Bei ihrer Suche nach dem lichtbewirkten Gefühl der gesehenen Welt haben die Impressionisten zugleich einen grundlegenden malerischen Hyperbiologismus entdeckt, das trichromatische Sehen der Farben im Auge. Davon, von dieser Spannung zwischen Weltgefühl und Anatomie, flirren diese Bilder genauso wie von dem Licht selbst, das sie erforschen.
Was so anfänglich wirkt auf den impressionistischen Bildern, ist zugleich aber auch ein abendliches Gespräch des alten Europa mit sich selbst. Die Faszination für das Helle kommt aus dem Wissen um düstere Realitäten, die zerlumpten Ränder, den Schmutz, die Massen, Grobheit und Härte, die Miteffekte des Elends der rücksichtslos heraufstürmenden Frühmoderne. Das Bürgertum, das diesen Fortschritt hervorgebracht hat, feiert im Impressionismus die bohèmistische Abwehr von Negativem, das zart Verfeinerte, feiert Blicke und Kleider, ewige Jugend, Freiheit, Empfindung, den individuell geglückten Moment.
In genau in diese Komplikationen wird die Suche nach den Bildern, die man kennt, in der Metropolitan-Ausstellung hier geführt. Denn die bekannten Helligkeitsikonen der Impressionisten sind nur ein Moment, nur der prägnanteste Punkt im Gesamttableau der Kunst des 19. Jahrhunderts; das, was die Pop-Kunst für das 20. Jahrhundert ist, die Sekunde der Wahrheit des Ganzen in Ultraplausibilität, Sophistikation und Naivität. Und der Betrachter findet dann, anstelle des Bekannten, fremde Bilder, komplizierte, interessante Sichten, Welten und Gemälde. Vom artifiziellen Hochspinnertum Ingres’ bis zur himmelsverschlingenden Getriebenheit van Goghs, von der ernsten Suche nach Altmeisterlichkeit beim vorimpressionistischen Manet zum herrlich ratlos vertrashten Renoir der späten 80er und frühen 90er Jahre, daneben der gleichzeitig grimmig solitär auftrumpfende Cézanne. In der frühen Belle Époque dann, als das Lebensgefühl der Impressionisten in den abgedunkelten Salons angekommen war und dort endgültig und paradox abgefeiert wurde: die leicht anverschmuddelten Innenräume Toulouse-Lautrecs, leuchtender Kaufhauskitsch vom alten Redon, der buntwilde Vorexpressionismus bei Matisse, und ein ergreifend tiefsinniges, einfaches Selbstbild des 25-jährigen Picasso. So wird ein erstaunlicher Reichtum von Ideen und Gestalten präsentiert: »Französische Meisterwerke des 19. Jahrhunderts aus dem Metropolitan Museum of Art, New York«. Berlin wird das feiern, zu Recht.
Und ein Staunen erfaßt die Gedanken, ähnlich wie beim Lesen in Prousts Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«: Warum wirkt die ferne Zeit der impressionistischen Vision so nah, so gegenwärtig? Wie ist diese Illusion der Nähe künstlerisch gemacht? – Sie haben Frühe, Licht und Augenblick zu verstehen versucht und Weisheit und Melancholie gefunden.
Nein. Ja. Freude
zum Erscheinen des Fotobuchs »elfter september 2010. Bilder eines Jahrzehnts«
Interview: Christoph Amend
Zeit-Magazin, 9. September 2010
Das Gespräch, das wir in einem leeren Nebenzimmer des Einstein Unter den Linden führten, dauerte nicht lange. Ehe ich es gemerkt hatte, hatte ich mehr von mir erzählt als geplant. Aber Christoph Amend, der einen als Interviewer auf freundliche Art zum Sprechen bringt, bleibt auch danach, bei der Bearbeitung des Interviews, ein seinem Gegenüber loyal zugewendeter Autor. Das ist im Journalismus ungewöhnlich. Er will einen zeigen, aber ohne Gewalt, ohne einem etwas entreißen zu wollen. Die Herzlichkeit seines Interesses geht auf angenehme Art über in den das Gesagte zusammenfassenden Text.
Herr Goetz, in dieser Woche erscheint Ihr Buch »elfter september 2010. Bilder eines Jahrzehnts«. Wie kamen Sie darauf, erstmals einen Bildband zu veröffentlichen?
Auf Anregung meines Lektors Hans-Ulrich Müller-Schwefe, der bei Suhrkamp mein Lektor von Anfang an war. Er hatte die Idee zu einem Projekt, und dann haben wir zusammen überlegt, was ich machen könnte. Ein Ausgangspunkt war das »loslabern«-Zeit-Magazin, das wir letztes Jahr hier gemacht haben. Da waren ein paar Fragen offengeblieben.
Darin haben Ihre Fotos bereits eine große Rolle gespielt. Ist es eigentlich für Sie leichter, mit Bildern zu erzählen als mit Worten?
Nein, es ist viel emotionaler, aufwühlender.
In dem Buch ziehen Sie eine Bilanz des gerade zu Ende gehenden Jahrzehnts. Wie war es für Sie?
Das weiß ich nicht. Ich habe das Buch gemacht, um es herauszufinden. Ich hatte die Jahre in der Zeit selbst als extrem düster empfunden, ein Finsternisexzeß. Aber auf den Fotos ist das so direkt gar nicht drauf, das hat mich verwundert. Der springende Punkt bei der Konzeption des Buches war: totale Konzentration auf die Bilder, schwarz-weiß, ein Layout, das durch seine Ruhe starke Effekte ermöglicht, darunter knappe, öffnende Bildunterschriften. Das führte jetzt zu diesem Buch. Man nimmt es in die Hand, blättert ein bißchen darin und hat es sofort intuitiv erfaßt, hat es drin. Andererseits kann man auch richtig einsteigen und sich sehr darin vertiefen. Eine weiterer Punkt war: Suhrkamp, mein Verlag, ist in diesem Frühjahr von Frankfurt nach Berlin gezogen, da wollte ich darauf reagieren.
Wie fanden Sie den Umzug?
Erst war ich entsetzt, ich lebe ja in Berlin. Ich hatte das Gefühl, die Eltern ziehen in die Stadt, in der man wohnt. Als ich das der Verlegerin mal gesagt habe, war sie gleich ganz beleidigt.
Sie ist nur wenige Jahre älter als Sie.
Genau. Aber dann sagten meine Lektoren, sie freuten sich auf den Umzug, und von dem Moment an habe ich mich auch gefreut. Dann gab es diese Einweihungsfeier in Berlin, an diesem strahlenden Wintersonnentag, im neuen Verlagshaus in der Pappelallee, wo ich so glücklich war und dachte: hier kann jetzt wirklich etwas losgehen. Das spiegelt das Buch auch ab, dieses Gefühl. Ich war jetzt praktisch jeden zweiten Tag dort im Verlag, um das Layout zu machen, neue Bilder abzuliefern, am Computer von Frau Knapitsch, meiner Herstellerin, mit der ich schon die »Heute Morgen«-Bücher vor Jahren gemacht habe, ist das Buch konkret entstanden. Das wäre gar nicht gegangen, wenn der Verlag noch in Frankfurt wäre.
Sie fotografieren viel, und das schon seit Jahren. Woher kommt diese Leidenschaft? Von Ihrer Mutter? Sie ist Fotografin.
Ja, ich bin von frühester Kindheit an mit diesem ganzen Dunkelkammer-Gewese aufgewachsen und habe das als etwas Faszinierendes, Schönes erlebt. Ich habe immer viel geknipst und damit seit Ende der neunziger Jahre so extrem Gas gegeben, daß das Material gar nicht mehr zu verwalten war.
Sie müssen ein riesiges Archiv besitzen.
Unfaßbar groß, ja, aber von Archiv kann man nicht reden, es gibt keine Ordnung, es liegt alles irgendwie herum. Für dieses Buch habe ich viele tausend Bilder gesichtet und wieder weitere neue Billy-Regale gekauft, um das endlich mal zugänglich ablegen zu können, ein ziemlicher Irrsinn. Jahrelang habe ich jedes Motiv außerdem in Serie fotografiert, das hat die Volumina des Ganzen zusätzlich absurd aufgebläht.
Ein Schwerpunkt des Bands ist der politische Betrieb in Berlin. Sie zeigen Bundestagssitzungen, Pressekonferenzen, Parteizentralen und Politiker wie Kohl, Schröder, Merkel. Jahrelang gab es das Gerücht, daß Sie an einem Roman über den Politikbetrieb schreiben.
Ich hatte den Plan eines Buches über den politisch-journalistischen Komplex. Am Anfang der nuller Jahre kam ich an einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, daß mir meine mediale Beobachtung der Politik keine neuen Erkenntnisse mehr liefert. Ich habe ja vor allem viel ferngesehen, und ich dachte plötzlich, ich muß mal diese Überpräsenz des Fernsehens loswerden. Es ist ja ein irres Privileg, daß ich hier in der Stadt bin, wo das alles real passiert.
Sie haben sich in den Betrieb begeben und recherchiert.
Ja, Bundestag, Kanzleramt, Konrad-Adenauer-Haus. Ich habe es unfaßbar toll gefunden und dachte immer, wenn ich es so toll finde, kommt bestimmt auch etwas Tolles dabei heraus. Es war wie paar Jahre zuvor das Ausgehen im Nachtleben.
Daraus ist Ihr Roman »Rave« entstanden.
Genau. Es war echt unglaublich, an allen diesen Orten in Berlin, die ich nur aus dem Fernsehen kannte, wo die Politik real stattfindet, rumzusitzen und mitzuschreiben, zwischendurch war ich zu Hause und habe die Gedanken dazu aufnotiert. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, daß es mir nicht gelingt, darüber wirklich gut zu schreiben.
Warum ging es nicht?
Ich bin Solist, das Politische lebt aber von der Kollektivität. Man sitzt immer mit den sogenannten Kollegen zusammen, unterhält sich, gleicht sich ab. Ich wurde dauernd von irgendwem angequatscht, gar nicht unfreundlich, aber ich konnte nicht viel sagen, ich habe ja für keine Zeitung geschrieben. Dann fragt wer: »Warst du vorhin auch bei der SPD?«
Eine nette Frage unter Kollegen, Sie wurden eingemeindet.
Ja, man wird eingemeindet, jeder wird eingemeindet, ich konnte aber nur »Ja« sagen, wußte nicht, wie man jetzt weiterreden würde. Da hängen siebzehn Journalisten bei einem Termin herum, jeder kennt jeden, und dann kommt ein Fremder dazu: Was ist denn der jetzt für einer? Da wird man dann verhört.
Was fanden Sie an Ihren Recherchen spannend?
Die Körper, die Räume, das Physische ist extrem spürbar dauernd, ich war von der Intensität richtig geschockt, diese affoiden Instinkte, die die Bewegungen überall choreographieren. Dann so Äußerlichkeiten wie die geordnete Rhythmik der politischen Woche. Montag Parteivorstand, Dienstag Fraktion, Mittwoch Kabinett, Donnerstag Bundestag, Freitag Bundesrat, so etwa. Das wußte ich alles gar nicht.
Das erklärt aber nicht, warum aus Ihrem Buch nichts wurde.
Es gibt eben den optimalen Text zu diesen Dingen schon, täglich, im politischen Journalismus, von Günter Bannas beispielsweise.
Sie reden vom langjährigen Politikkorrespondenten der »Faz«, Günter Bannas.
Ja, der ist unglaublich. Ich habe ihn auch fotografiert und wollte ihn eigentlich in den Bildband reinnehmen mit der Zeile »simply the best«. Seine beschreibende Analyse des politischen Betriebs auf Tageszeitungsbasis ist unerreichbar. Da kommt man als Literat mit diesem komischen Nervositätssensibilismus überhaupt gar nicht mit.
Ihr Buch ist also, etwas zugespitzt, an Günter Bannas gescheitert?
Ja, sehr zugespitzt gesagt, aber es stimmt.
Im Nachtleben gab es keinen Günter Bannas, deshalb konnten Sie »Rave« schreiben?
Im Nachtleben gab es natürlich auch journalistische Reflexe, aber das war fast immer Unsinn, da habe ich oft aufgeschrieen: das ist Lüge! Das ist anders, das muß man besser machen. Und ich wußte: das kann ich. Jetzt in Berlin saß ich oft zwei Sitze neben oder hinter Günter Bannas, der ist überall, der geht nach wie vor überallhin und schüttelt dann täglich diese unglaublichen Texte aus dem Ärmel. Ähnlich übrigens Volker Zastrow, Eckart Lohse oder Dirk Kurbjuweit. Die können alle erzählen. Die praktizieren das dauernd, Porträt und Analyse, Recherche, Reportage, der politische Alltagsjournalismus ist dadurch insgesamt auf einem faszinierend hohen Level.
Was haben Sie gemacht, als Ihnen nach sechs, sieben Jahren Arbeit klarwurde: Aus dem Buch wird nichts?
Es war schon sehr deprimierend. Nicht schön. Dann wird man dauernd gefragt, wann das Buch kommt.
Sie wußten längst, daß es nie fertig werden würde.
Nein, das nicht. Aber vielleicht dauert es noch fünfzehn Jahre.
Der Schriftsteller Franz Xaver Kroetz hat unserer Interviewerin Herlinde Koelbl kürzlich gesagt: »Ich habe immer wieder versucht zu schreiben, aber da kommt nichts. Es ist vorbei.«
Unglaublich, wie er das am Ende des Gesprächs einfach so sagt. Es provoziert ja logischerweise auch viel Hohn, wenn man als notorische Nervensäge, so wie Kroetz oder auch ich, den Beruf plötzlich nicht mehr ausüben kann. Ich könnte darüber jetzt auch gar nicht so reden, wenn sich die Situation für mich nicht doch noch einmal aufgelöst hätte, durch das »loslabern«-Buch. Kroetz kann das, der konnte das immer, alles einfach rausposaunen.
Wie sind Sie aus Ihrer Situation herausgekommen?
Ich habe gedacht: Wie geht es weiter? Irgendetwas muß passieren. Mein Bruder, der auch Arzt ist, hat in der Zeit gerade überlegt, eine Praxis aufzumachen. Da habe ich ihn gefragt, ob ich bei ihm vielleicht als Hilfsarzt mitmachen könnte.
Sie haben das ernsthaft überlegt?
Ja, ich bin Arzt, habe das aber nie richtig praktiziert.
Sie wollten in einer Praxis mitarbeiten und aufhören zu schreiben?
Ja, die Vorstellung, daß ich Schriftsteller bin, war fiktiv geworden. Wenn man nichts mehr schreibt, was man veröffentlichen kann, ist man kein Schriftsteller mehr.
Nach zwei Jahrzehnten als Autor unzähliger Bücher, Theaterstücke, Artikel?
Es gibt ja keine Vergangenheit im Schreiben, es muß aktuell über das reine Notizenmachen, das bei mir immer funktioniert, hinausgehen. Es muß fertiger Text entstehen, der eine andere Qualität hat. Ich merke das während des Schreibens: Jetzt entsteht Text! Wenn dieses Gefühl nicht einsetzt über sehr lange Zeit, wird es eng. Ich habe dann zwei Wochen lang an der Charité einen Wiedereinstiegskurs für Ärzte gemacht, mit lauter Frauen übrigens, und meinem Bruder gesagt, zwei Jahre mindestens würde ich mitmachen.
Wie hat er reagiert?
Er ist Internist, ein eher vorsichtiger Mensch. Er hat gezögert, aus vielen Gründen, hat dann leider doch keine Praxis aufgemacht. Vielleicht hat er auch nicht ganz an meine Zusage geglaubt.
Er hatte ja auch recht im Nachhinein.
Er hatte nicht recht! Ich hätte das auf jeden Fall gemacht mit ihm! Das ist eine große Defizitstelle in meinem Leben: Ich habe den Beruf Arzt zu schnell aufgegeben. Ich habe ihn mit Anfang Dreißig aufgegeben wegen des Schreibens. Ich habe die Abschlüsse gemacht und ein bißchen in der Psychiatrie gearbeitet und dann aufgehört. Bei uns in der Familie sind ja alle Ärzte, das ist wunderbar, mein Interesse an dem Beruf hat über all die Jahre nie nachgelassen. Auch weil das Thema in der Politik, in den Medien gar nicht richtig vorhanden ist, es kommt ja nur als sentimentale Soap vor, Müntefering, Schlingensief, Steinmeier, furchtbar.
In Ihrem Bildband ist die Charité zu sehen.
Ja, es beglückt mich total, daß ich so nahe an diesem legendären Krankenhaus lebe und von meinem Arbeitszimmer aus dauernd diesen Schriftzug sehe.
Wie wäre der Arzt Rainald Goetz?
Als Arzt ist man in einer irren Mühle, da hört das Denken auf.
Sie würden vom Denken entlastet?
Man kann nicht gleichzeitig als Arzt ganztags arbeiten und nachts Schriftsteller sein, das habe ich damals in der »Irre«-Zeit erkannt. Es wäre dann klar gewesen: Jetzt bin ich Arzt, kein Schriftsteller mehr. Danach habe ich mich gesehnt.
Der zweite Schwerpunkt in Ihrem Bildband dürfte Leser Ihrer Bücher nicht überraschen: Es sind viele Journalisten zu sehen. Warum eigentlich?
Die Medien interessieren mich eben.
Die »Süddeutsche Zeitung« hat die Lektüre Ihrer jüngeren Bücher mit der Suche nach pornographischen Stellen verglichen. Weil alle Journalisten wissen, daß in Rainald-Goetz-Büchern viele Journalisten auftauchen, wird die Literatur gar nicht mehr wahrgenommen, weil es nur noch um die Frage geht: Wer kommt vor, und wer kriegt eins auf den Deckel?
Das höre ich immer wieder. Ich finde, daß Resonanzen nie Anlaß für eine Beschwerde sein sollten. Man ist immer selber dafür verantwortlich. Ich könnte es ja anders machen. Mich fasziniert der Bereich aber zu sehr, als daß ich darauf verzichten möchte. Und ich finde auch, ähnlich wie damals beim Ausgehen, daß die Medien literarisch nicht ausreichend erfaßt sind.
Sind Journalisten wirklich so interessant?
Natürlich. Auch die Journalisten selber beschäftigen sich zu neunzig Prozent ihrer Zeit mit dem, was andere Journalisten machen, alles wird wegwerfend gescannt, kenn ich, weiß ich, interessiert mich nicht. Zugleich extrem ängstlich: steht vielleicht doch bei irgendwem plötzlich mal was Neues drin? Wohin geht die Drift? Bin ich noch dabei?
Mein Zweifel ist eher, ob sich viele Leser für manche Details innerhalb der Medienbranche wirklich interessieren.
Was die Leser interessiert, ist mir egal. Mir geht es um die Relevanz des Themas, dieses Weltbereichs, den ich meiner sogenannten teilnehmenden Beobachtung aussetze, von innen, von außen und möglichst böse. Das mag der Journalismus nicht, wenn er so beobachtet wird. Das macht aber nichts.
Stört Sie der Gedanke nicht, daß Ihre Bücher vielleicht deswegen einem größeren, nicht so medieninteressierten Publikum verschlossen bleiben?
Nein, es geht um Wahrheit. Quote ist was für Loser.
Sie haben einmal geschrieben: »Die Welt der Seele ist komplett zugemüllt von den gepanzerten Standards der Frauenzeitschriftenwelt.« Wenn das so ist: Warum schreiben Sie dann nicht anders über die Seele, über Gefühle, Familie?
Das werfe ich mir auch vor. Ich kann das nicht. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt als Schreiber, und natürlich hoffe ich, daß auch dieser Bereich für mich eines Tages beschreibbar wird. Dabei träume ich immer noch von innenlebenfreien Figuren, aber vielleicht kann man so im Erzählerischen gar nicht schreiben, wie ich mir das vorstellen würde.
In Ihrem Buch »loslabern« schreiben Sie, daß Sie »zwischen den Büchern« stehen, »in der Sprache anstatt in der Welt«. Wie steht es sich da?
Ich finde es stressig, aber natürlich auch super.
In einem Interview mit dem »jetzt«-Magazin haben Sie im Jahr 2000 gesagt, natürlich dürfe man das, was nachts beim Ausgehen so gesagt werde, nicht wörtlich nehmen; aber Sie könnten einfach nicht anders.
Stimmt.
Sie nehmen es mit der Sprache genauer als die meisten Menschen.
Nicht die Sprache nehme ich genauer, die Sprache ist sekundär. Es geht um die Inhalte, um das Gemeinte, und erst das führt dann zu der Genauigkeit in der Aufmerksamkeit für die Sprache.
Diese Situationen kennen, glaube ich, viele Ihrer Bekannten, Kollegen, Freunde: Man begegnet Ihnen, Sie überspringen die Small-Talk-Phase, sagen sofort etwas Konkretes, zum Beispiel über einen Artikel, den Sie gelesen haben. Man antwortet– und manchmal beginnt ein Gespräch, manchmal aber brechen Sie es mit einer knappen Bemerkung ab, sichtlich irritiert. Und man selbst weiß gar nicht, wie einem geschieht.
Ja.
Das kann ziemlich anstrengend sein.
Ja, dieser Genauigkeitsfanatismus ist anstrengend, ich weiß, das ist ein Sozialterrorismus, das ist auch falsch. Aber wenn Ungenauigkeit gefragt ist, wenn Gespräche keinen inhaltlichen Gegenstand haben, muß ich mich extrem darauf konzentrieren. Umgekehrt ist es für mich überhaupt kein Problem, sofort in die intensivste inhaltliche Debatte einzusteigen, sofort inhaltlich loszutexten. Aber plötzlich schön locker Konversation zu machen ist echt Streß.
Warum?
Man ist dabei auf Höflichkeit angewiesen, Höflichkeit ist aber nicht sehr weit verbreitet. Je weiter oben die Leute sind, je mächtiger sie sind, umso unverschämter sind die Ordinärheiten im Umgang, das ist die Erfahrung. Ich sitze mit Sloterdijk in einem Gremium, der kommt immer zu spät, jedes Mal, der inszeniert das als Status-Prärogativ, wie soll man mit so jemandem, der offenbar gar nicht weiß, wo er endet, in eine normale Interaktion eintreten? Kontroverse Debatte hingegen geht immer, auch mit einem Sloterdijk. Mit höflichen Leuten, die es natürlich auch gibt, ist alles ganz leicht, auch das Leichte. Insgesamt bleibt das soziale Spiel für mich aber ein geheimnisvoller Vorgang. Erst im Nachhinein, wenn ich mir die Grobheit eines Verhaltens, einer Geste, einer Distanzlosigkeit erklären kann, ist es kein Problem mehr. Aber in dem Moment, in dem es passiert, in dem ich es beobachte: Irritation! Irritation!
Ging Ihnen das immer schon so?
Das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was einen in den Text treibt, weil man dort in absoluter Ruhe und Klarheit die Möglichkeitsgrenzen von Gedanken ausloten kann, die Sachen verstehen. Das geht in der Stille natürlich besser, alleine besser als in einer Gruppe. Was im Sozialen also oft hinderlich ist, hat an den Stellen, die mein Berufsleben geworden sind, einen Sinn. Da freut man sich.
Herr Goetz, wenn man Ihnen eine Weile gegenübersitzt, fallen einem zwei Dinge auf. Sie haben lange Jahre Ihre Haare gebleicht, heute sind sie grau. Gab es einen Moment, in dem Sie beschlossen haben: Jetzt höre ich mit dem Bleichen auf?
Ja, als ich gemerkt habe, daß sie unten an der Haarwurzel, wo sie nachgewachsen sind, plötzlich nicht mehr schwarz waren, sondern schon richtig angegraut. Ich habe mir immer mit einer solchen Begeisterung diese Bleichmittel auf den Kopf geklatscht, daß die ganze Kopfhaut nur so gebrannt hat. Ich dachte dann immer: das paßt, wie das brennt auf dem Kopf. So ist es.
Und plötzlich haben Sie gemerkt, daß Ihre Haare von der Natur entfärbt worden sind.
Ja, ich hätte darauf vorbereitet sein können, es liegt in der Familie, aber ich war Mitte Vierzig, als ich es gemerkt habe. Ich weiß noch, wie ich damals, erstmals mit den grauen Haaren, bei Albert Oehlen in Köln vor der Haustüre stand. Er war richtig schockiert, wie er mich sah, und fand das bodenlos von mir, daß ich plötzlich so ergraut bin. Mich hat das auch erst gestreßt, aber dann dachte ich: gut, das ist also das Alter.
Das andere, was einem auffällt: Man sieht auf Ihrer Stirn die Narbe Ihres Rasierklingenschnitts, vor fast dreißig Jahren auf der Bühne in Klagenfurt. Diese Aktion prägt das Bild von Ihnen bis heute. Haben Sie das jemals bereut?
Nein.
Denken Sie manchmal daran?
Ja.
Und was geht Ihnen da durch den Kopf?
Freude.
Leben und Schreiben
Der Existenzauftrag der Schrift
Antrittsvorlesung
Freie Universität Berlin, 10. Mai 2012
Da stand ich also wieder in einem richtigen Universitäts-Hörsaal, fast fünfzehn Jahre nach meiner Frankfurter Poetik-Vorlesung »Praxis«, ganz unten am Boden in der Arena, vor den erstaunlich steil ansteigenden Bänken, die sich langsam füllten, tatsächlich vorallem mit Studenten. Ich hatte tiefblaue Banner aus dem Umkreis meines neuen Romans »Johann Holtrop« mitbringen wollen, weiß beschriftet, aber die Banner waren nicht fertiggeworden, und mein Hauptziel war sowieso, möglichst konzentriert die als Rede geschriebene Rede zu halten. Ich denke langsam und rede stockend, gerade deshalb mag ich den auf Speed hingeschriebenen RANT. Sah eine Tafel, nahm eine Kreide und malte die Schriftzeichen des Titels an. Nach der Einleitung von Professor Dr. Georg Witte war ich dran, trat in die hintere Ecke des Hörsaals, machte zwei Fotos, dachte an mein Motto, ging ans Pult und fing an zu reden.
immer neu loslegen wie neu
Hallo Berlin!
hier spricht: der 10. Mai 2012
1. Was ist eigentlich ein schöner Satz? – Es beginnt mit einer Haßempfindung.
Am Rad morgens, an der Ampel, eng im Pulk der Wartenden, der Fußgänger, neben einer Frau, die ruhig und breit und komplett arezeptiv dasteht, nichts von dem merkt, was um sie herum vorgeht, denn natürlich hat sie ihre weltabpanzernden Privatsendungsstöpsel im Ohr, hört nichts, merkt nichts, ist als Taube, von sich selbst beschallt, ganz allein in ihrem Eigenraum, –
der totale Irrsinn, in dem dreiviertel der Leute sich morgens durch die dicht bepackte Stadt bewegen, und wie ich neben ihr stehe, und schließlich in den vorbeilaufenden Verkehr hinein starte, ein kleine Lücke im Strom der Wagen, und erleichtert, daß ich da endlich wegkomme aus der Nachbarschaft der ruhig und stier Dastehenden und frei auf der Straße entlangradle, meldet der hirninterne Satzautomat, der auf die Szene reagiert und sie zusammenfaßt:
Mit Wachheit ist nicht zu rechnen. – Zu diesem prägnanten Satz wacht der wortlose Wahrnehmungsstrom in mir also auf, die Gehässigkeit der Empfindung, aus der er kommt, ist damit erledigt, sie öffnet sich auf ein Erheitertsein von der Differenz:
Man selber ist überwach, der Sommer kommt, der Morgen geht vor einem auf, der neue Tag, die Autos rauschen herrlich vor einem vorbei, man will los, los, los, starten, radeln, fahren. Und der andere Mensch, der direkt neben einem auf der Straße steht, ist komplett ANDERS unterwegs, unwach, verschlossen, stabil und in sich ruhend.
Mit einer Wachheit, die einem selbst entspräche, ist bei den anderen also nicht zu rechnen, befindet der Hektiker, dem an jeder zweiten Theke, bei jedem zweiten Weltkontakt, an fast jeder Supermarktkasse die Empfehlung, meist ziemlich imperativisch, von den ruhig in sich Ruhenden gegeben wird: sich bißchen locker zu machen, alles ganz easy, keine Panik, geht schon, wird schon, »nu sind se mal nich so hektisch, junger Mann!«, so original gestern wieder im Rewe. Für Nichtberliner: das berlinische »junger Mann« gilt für alle Alter, wird besonders gern den Leuten ab vierzig, fünfzig aufwärts ironisch übergezogen. Wobei der Sprecher von der Ironie, so selbstverständlich ist ihm sein Sprachgebrauch, gar nichts mehr weiß.
Das wäre also so ein Beispiel. Der schöne Satz kommt aus dem Alltag, bezieht sich darauf, ist sofort verständlich und enthält eine kleine eigene Milliidee.
Eine Sozialtatsache ist sein Gegenstand, nicht etwa etwas Gesehenes, nicht ein Bild, nicht die Genauigkeit einer Beschreibung von etwas visuell Wahrgenommenen, sondern die Beobachtung einer Interaktionsproblematik, eines Menschenverhaltensproblems, eine Irritation im Ablauf des sozialen Flow, die erfaßt, generalisiert, Wort geworden, den Umgang miteinander erleichtert, verbessert, weil man durch verbale Erfassung mit dem Problem besser umgehen kann. Satz will denken, nicht schauen.
Rezeptivität ist die Essenz von Stil.
2. Das Schreiben üben. – Schreiben heißt veröffentlichen, zuerst vor sich selbst. Das in einem Befindliche, die Wahrnehmungen und Gedanken, treten dem Schreiber im Geschriebenen offen sichtbar, klar fixiert gegenüber, erst dort kann er die Worte, die bisher nur in ihm waren, als gedachte oder gehörte, auch wirklich SEHEN.
Der Schreiber schaut die von ihm geschriebenen Worte an und liest sie. Dauernd liest der Schreiber das von ihm Geschriebene: was steht da? Was heißt das? Ist das, was das Geschriebene bedeutet, das Gemeinte? Ist es das, was man hatte sagen wollen?
Die Differenz zwischen Text und Gedanke ist die Essenz dieser dauernd praktizierten Übung des Schreibens: das Lesen der eigenen Schrift. Und das ist die Grunderfahrung des Schreibens: daß das, was da steht, NICHT das sagt, was man hatte sagen wollen, daß der Eigensinn der Schriftlichkeit, der Fixierung, der textlichen Verbalität sich dauernd vordrängt, sehr stark sagt der Text, was er will, nicht was er nach dem Willen des Schreibers sagen sollte. Um diese Autonomie der Schrift, der Textizität von Aussagen, zu erfahren, braucht man selbst als Schreiber diese Erfahrung, und zwar möglichst alltäglich, dauernd, wie groß die Distanz zwischen Aussageabsicht und dem von der Schrift dann Ausgesagten wirklich ist.
Die alltägliche Praxis des Schreibens hat durch die elektronischen Kommunikationsgeräte, das ist oft festgestellt worden, in den letzten Jahren eine spektakuläre Wiedergeburt erfahren. Was da ununterbrochen von allen geschrieben wird, an Mails, Sms, in Foren, Blogs, für Twitter und auf Facebook, hat aber auch zugleich die Standardisierung, das Formelhafte, die Sprüche und Spruchhaftigkeit extrem befördert, so daß es für praktisch keinen Gedanken, für keine Erfahrung, für keine Lebenssekunde einen Hiatus von Sprachlosigkeit noch gäbe, in jeder Situation weiß jeder genau: und jetzt ist dieser Satz dran.
In den 90er Jahren hat Harald Schmidt damit angefangen, die fixierten Sprüche herauszuisolieren, zu wiederholen, zur Besichtigung und Analyse freizugeben. Florian Illies und Benjamin von Stuckrad-Barre haben es zu einer Kunst entwickelt, all diese fertigen Sätze, die Floskeln und die von ihnen bezeichneten Haltungen so zu montieren, daß Heiterkeit und Präzision der Welterfassung für einen hellen Moment in den Texten zusammengefallen sind.
Popliteratur war kollektivistisch, gegenwärtig und herrlich egoman. Flashy, SWISHY. Und natürlich überall ganz schnell sehr stark verhaßt, sogar bei den Protagonisten selbst. Ganz zu Unrecht, wie ich finde. Wir waren Frühromantiker, eine Bewegung, jung, eine Wahrheit, und ganz schnell vorbei. Ich selbst habe die popliterarischen Jahre, gerade weil es mir dauernd bewußt war: das ist ein Augenblick der NÄHE zu ganz vielen fundamental anderen, Fernen, ein ganz kurzer Augenblick nur, ganz besonders schön gefunden, begeistert mitgemacht, die Sache gefeiert. Und auch die textlichen Resultate, die der anderen und die eigenen, lieber gemocht als das meiste davor oder danach.
Das richtige Schreiben geht ganz leicht. Jeder, der da tippt und sendet, weiß das. Wenn das Gefühl stimmt, stimmen auch die Worte. Schreiben ist Atmen. Früher war es das Leben der Schriftsteller, das so konstruiert war, eine Spezialexistenz, privilegiert, auch KRÄNK und phantastisch vertieft auf ALLES hin ausgerichtet usw. Und heute lebt jeder so: schreibt, schreibt andauernd seinen Existenztext mit und vor sich hin.
3. Welche Welt. – Das ist natürlich wunderbar, aber zugleich damit, mit everybodys Ichermächtigung, auch via Eigentext, hat das Gefühl dafür abgenommen, das ist nicht wunderbar, daß eine sehr nichteigene, sehr fremde Welt dem Ich gegenübersteht und in einer Weise unbekannt ist, die jeden beunruhigen sollte, neugierig machen, zu allen möglichen alltäglichen Welterforschungsmaßnahmen animieren usw. Das ist aber nicht der Fall.
Die Welt kommt sehr liquide, permanent und schnell auf den Endgeräten eines jeden an, Nachrichten, Informationen, Stimmungen, Bilder und Filme, vorsortiert vom Kollektiv der Freunde und Bekannten, in einer so unüberblickbaren Masse, daß zum Selbstschutz dagegen die gelangweilte Souveränität hochgezogen wird, die früher den Umgang mit den vom Fernsehen herkommenden Informationsfluten gekennzeichnet hat. Die Geste der Souveränität ist heute die der nach rechts wegwischenden Hand, die das Gesehene abwehrt, wegwischt, als Gelesen markiert und in den Orkus nie wieder an einen heranflutender Totinformation hinabschickt.
Man kann heute mehr und Genaueres leichter wissen als je zuvor, nicht die leichte Zugänglichkeit aber hat es erschwert, davon zu profitieren. Der große Bruch der letzten Jahre kommt von den Abonnements, den Alerts, den Zusendeautomaten, die etwa seit Mitte der nuller Jahre eingesetzt werden, zuerst als Erleichterung, sich nicht dauernd darum kümmern zu müssen, welche Seiten man alle anwählen will, die sich inzwischen ausgewachsen haben zur Verhinderung der Möglichkeit, SELBST eine Seite anzuwählen, einen Blog, der einen gerade interessiert, gezielt anzusteuern, die Sachen drängen alle, einmal abonniert, unangefragt und in definitiv unüberblickbarer Stetigkeit und Massenhaftigkeit auf den Interessierten ein.
Dieses Eindrängen verhindert die Wertschätzung. Auch wertvollste Mitteilungen, hochinteressante Neugedanken von irgendwem in irgendeinem Blog, bekommen so den Status nerviger Werbung, werden zu Abzuwehrendem, zu: weg, weg, weg. Kenn ich, weiß ich, brauch ich nicht.
Jeder Abwehrgedanke blockiert das Denken für die Möglichkeit einer FRAGE nach eben dem Abgewehrten, für Fragen und Suchen überhaupt, beide aber sind Voraussetzung dafür, daß man Antworten verwerten, wertschätzen, zur Weltkenntniserweiterung benützen kann. Man sollte sich von der absolut genialen Informationsmaschine Internet nicht dauernd wie von einem fürchterlichen Drachen aus zig Köpfen heraus ungefragt ANSPUCKEN lassen mit irgendeiner Impfo. Man kann das Internet auch als das weise Orakel benutzen, das es ja auch ist, Fragen eingeben und die Antworten dann sichten und in Ruhe bedenken.
4. Nur für Freunde.