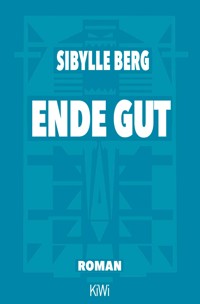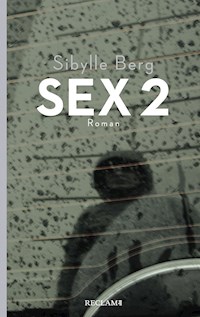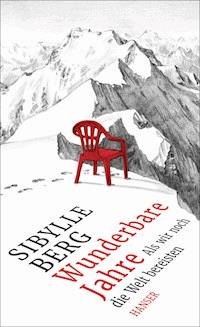
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1. Januar 2016. Sibylle Berg ist in Tel Aviv, Familienbesuch, und draußen gehen die Böller los. Moment mal, Böller zu Neujahr in Israel? Schreiende Menschen kommen die Straße gelaufen. Sie ducken sich, flüchten in Hauseingänge. Was sich unter dem Balkon abspielt, ist kein Fest. Es ist ein Anschlag. Die Autorin ist viel auf Reisen gewesen, jetzt ist der Spaß vorbei. Wollen wir wirklich in einer Welt herumfahren, wo der Strand zur Kampfzone wird, der Konzertsaal zum Bunker, wo neben dem Café die Bomben fliegen? Sibylle Berg erzählt, wie die Welt war, als wir noch Fernweh hatten: schön, abenteuerlich, romantisch. Und sagt, wie sie heute, im 21. Jahrhundert, ist: zum Weglaufen. Aber wohin?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
1. Januar 2016. Sibylle Berg ist in Tel Aviv, Familienbesuche, Bekannte, Freunde, und draußen gehen die Böller los. Moment mal, Böller zu Silvester gibt es nicht in Israel. Zu nervös die Leute, zu angespannt die Situation. Schreiende Menschen kommen die Straße gelaufen. Kinder weinen. Sie ducken sich, sie flüchten in Hauseingänge. Was sich unter dem Balkon abspielt, ist kein Fest, es ist ein Anschlag. Sibylle Berg ist viel gereist und hat darüber viel geschrieben. Jetzt ist der Spaß vorbei. Wollen wir wirklich in einer Welt herumfahren, wo direkt neben den Tourismus- Spektakeln die Armut auf der Straße sitzt und die Bomben fliegen? Sibylle Berg erzählt, wie die Welt war, als wir noch Fernweh hatten: schön, abenteuerlich, romantisch. Und sagt, wie sie heute ist: zum Weglaufen. Aber wohin?
Hanser E-Book
Sibylle Berg
Wunderbare Jahre
Als wir noch die Welt bereisten
Mit Bildern von Isabel Kreitz
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25408-4
© Carl Hanser Verlag München 2016
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Bild: Isabel Kreitz
Satz: Gaby Michel
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de.
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
Inhalt
Krieg. Zum Glück: weit weg. Kosovo (aber irgendwie auch Mazedonien), 15. April 1999
Bedroht durch Gesäße. Thailand, 23. Januar 2009
Im Wunderland der Gardinenkleider. Bayreuth, 31. Dezember 2004
Die Freunde hinter den Bergen. Wallis, Dezember 2014
Irgendwie Hochzeitsgast. London, 1. Juli 2011
Das Totenschiff. Meer, 3. August 2012
Selber schuld! Mergui Archipel, 27. Februar 2002
Italien. Eins. Und ein wunderbarer Film. Bellagio, 3. November 2005
Afrika für Feiglinge. Südafrika, 22. Dezember 2014
Verschwende deine Schönheit, Wien! 19. Juli 2013
Das ist der Norden. Hier wohnt der Freak! Israel 2013
Und wieder ein Traum weniger. Los Angeles, 10. Juli 2006
Mein Leben als Hund. Bangladesch, 24. März 1994
Die gute alte Zeit und der Kaiser. Italien. Zwei. 17. Mai 2010
Blair Witch Project. Weimar, Mai 2001
Und jetzt: Glamour! Cannes, 17. Mai 2000
Der Traum vom Meer. Der zweite Versuch. Seattle-Hongkong, 27. September 1996
Was weiß Herr Sundarum von meiner Zukunft. Indien, 13. April 1995
Und jetzt: In den Dschungel. Amazonas, Brasilien, 5. Februar 1994
Wie seltsam schnell und doch verzögert in der Wahrnehmung sich die Welt verändert. Hat. In den Synapsen stecken immer noch Bilder von früher. Von reizenden Reisen. Da einem, außer einer Darmgrippe, nichts passieren konnte. Entspannt fuhr man nach Griechenland, durchquerte die Wüste Gobi, hockte im Jemen und beobachtete Menschen beim Leben und reiste nach Paris. Cafés unter grünen Platanen, immer schmerzende Füße vom zu vielen Laufen, Endorphine. Das ist gespeichert, das macht ein Ziehen in der Brust, und das überlagert die realen Bilder. Die Metro mit mir darin, die von ungefähr dreißig gewaltberauschten jungen Männern terrorisiert wird. Die Straßen voller obdachloser alter Menschen, die verspannten Gesichter der angeblich so entspannten Pariserinnen, die mit einem Lächeln Kinder und Job meistern. Die gibt es nicht. Es gibt nur gestresste Frauen und Männer, schlecht bezahlt in Verkehrsmitteln gedrängt, in beengtem Wohnraum, verstopften Straßen, sich durch Touristen quälend, die Baguettefotos machen. Der Gestank von Urin auf den Straßen, der Stau auf den Straßen. Und neu im Programm: Die Terroranschläge, die Unsicherheit, Romas auf kleinen Freiflächen zwischen den Autobahnen zusammengedrückt, und ab in den Tunnel. Ah, der tolle Tunnel durch das Wasser nach England! Gab es da schon ein Attentat, oder sind es nur die Flüchtlinge, die jetzt täglich versuchen nach England zu kommen? Ja, du Europäer, da nimmt dir die Welt deine behagliche Tunneltour weg, nimmt dir dein Kitschbild von Paris, und nun bist du in London. Das stand immer für verpasste Gelegenheiten. Die Stadt voller Models, Rockstars, aber du blöde Touristin bist aus Versehen in Whitechapel gelandet, mit deiner unzumutbaren Frauenausstattung, die nicht verhüllt ist. Die ist nicht verhüllt. Dieses niedliche, immer zugige London mit freundlichen Einheimischen gibt es nicht mehr. Gut, da muss man ja nicht hingehen, dann geht man eben woanders hin. Italien ist immer noch reizend; wenn man die 40% jugendlicher Arbeitsloser wegdenkt, kann man noch ans Mittelmeer, Sie wissen schon. Die Boat-People. Es muss ja auch keiner mehr verreisen. Es gibt auf 3Sat und Arte täglich diese wunderbaren Sendungen, in der die Welt in Ordnung ist. Einfache, herzensgute Menschen machen Handwerk, sie sind gastfreundlich, und Attentate finden nicht statt. Entführungen gibt es nicht. Den Ekel vor dem weißen Touristen sehen wir kaum. Und wer nicht fernsehen will, kann Geschichten lesen, von früher. Als wir noch die Welt bereisten.
Krieg. Zum Glück: weit weg
Kosovo (aber irgendwie auch Mazedonien), 15. April 1999
Am ersten Tag sagt die Dame am Flughafen: Ach, Sie fahren da runter, ich mag die Berichte nicht mehr sehen. Da blickt ja keiner durch. Na ja, Krieg ist schon schlimm. Gott sei Dank ist er weit weg. Nach zwei Stunden Flug bin ich in Thessaloniki, nach einer Autofahrt über die Grenze in Skopje. Mazedonien, das kleine Land, gerät außer sich, mit jedem Tag mehr, und eigentlich ist doch gar nichts los. Der Krieg ist hier nicht. Der Krieg ist in Jugoslawien, sichere zehn Minuten entfernt.
Panzer rollen durch die Straßen, das Militär marschiert an der Grenze, nachts hört man Schüsse, Flugzeuge, bei günstigem Wind auch Detonationen. In der Nacht. In den leeren Einkaufspassagen der Hauptstadt laufen Mädchen mit Rollerblades, niemand sagt ein Wort, und irgendetwas stimmt nicht.
Am zweiten Tag steigen die Journalisten in Autos, die sind wie schwere Waffen, sie tragen Kampfanzüge, die Frauen laufen mit harten Schritten, laufen schnell, fahren schnell, vielleicht ist etwas passiert in der Dunkelheit. An der Grenze. In den letzten Stunden ist das Auffanglager Blace zum Schlachthof geworden. Mit Masken gegen den Geruch von Mensch und Angst stehen Soldaten und Polizisten maschinengewehrbewaffnet um das Lager, das so groß ist wie zwei Fußballfelder. Es ist anders als im Fernsehen, das Lager. Man riecht es, man hört es und schaut ihnen in die Augen, den 40.000 Menschen hinter Barrieren, die drängen zur Freiheit, zu den Bussen, wo die Journalisten beobachten, filmen, fotografieren, in Mikrofone reden, in Telefone.
Eine amerikanische Journalistin, gleich einer gut frisierten Wurst, nähert sich der Absperrung. Sie gibt einen rührenden Text per Handy an ihre Redaktion, hält inne, sagt: Es riecht zu streng. Und dreht ab. Die hinter dem Gitter kamen in Güterwagen oder zu Fuß, sie kamen verwirrt, und als sie wussten, dass sie auf mazedonischem Boden waren, hoben sie die Arme in den Himmel. Doch schon wieder Gewehre, schon wieder Soldaten. Sie prügeln ein auf Menschen, die aus dem Lager wollen, in einen Bus, wo vielleicht der Mann sitzt, die Schwester, das Kind. Die mazedonischen Soldaten schauen zu, wie Menschen fast zerdrückt werden, Frauen in Ohnmacht fallen, hören, wie Kinder schreien. Viele haben hohes Fieber, es ist verdammt kalt.
Wir brauchen hier keine Albaner, sagt ein Soldat. Die Flüchtlinge tun mir leid, aber sollen sie doch in Länder, denen es besser geht. All das Geld, das unsere Regierung für die ausgibt, könnten wir gut brauchen. Es hat an die 30 Prozent Arbeitslose in Mazedonien, sagt der junge Soldat. Egal wo Flüchtlinge sind, woher sie kommen, wohin sie flüchten, sie werden überall beschissen behandelt. Er sieht angewidert auf das Schlammloch und rückt seine Maske zurecht. Als eine alte Frau über die Absperrung klettert, stößt er sie zurück. Schlägt noch mal nach. Egal, dass es seine Mutter sein könnte, bei der er vermutlich noch wohnt. Es ist Krieg, da ist der Feind. Der Feind ist, was man selber nicht ist, und nun liegt der am Boden und weint.
Der Boden ist schlammig und kalt, und in einem hektischen Moment, als das Gitter geöffnet wird, um einen mit Lebensmitteln beladenen Traktor passieren zu lassen, gelangen wir ins Lager, das für Fremde gesperrt ist, weil es wirklich keinen guten Eindruck macht. In den Boden sind hastig weggeworfene Dinge gedrückt, überflüssige Dinge, die Erinnerungen waren, oder Spielzeug, oder Leben. Unter Plastikplanen liegen die Alten und schlafen. Schlafen und hoffen vielleicht, dass alles wieder gut ist, wenn sie erwachen. Manche hocken im Dreck und reden, versuchen ein Lachen. Andere haben aufgegeben. Sich von sich entfernt, zu irgendeinem Ort, wo sie allein sind. Der Rest kämpft. Einen sinnlosen Kampf. Sie drängen sich gegen die Gitter, schreien, doch wer will das hören. Die Menschen hier sind müde, sind krank. Sie sehen aus wie wir. Hübsche Mädchen mit Buffalo-Schuhen, Männer mit Chiemsee-Jacken, Studenten, und zwischen ihnen stehe ich im Pulk.
Die Idee, jemand könnte mein Leben austauschen, mit einem von hier: Am Morgen wären Uniformierte gekommen, hätten meine Tür zerschlagen, geschrien, mit der Waffe gefuchtelt, Schüsse hätte ich gehört, einen Rucksack gepackt. Was nimmt man mit von seinem Leben? Wäre dann hier gestanden, alles verloren, über Nacht, das, was ich war, kein Recht mehr, kein Mensch mehr.
Zwischen den Vertriebenen, die mich behandeln, als wäre ich eine von ihnen, die mich stützen, als ich mich zum Gitter bewege, Zentimeter für Zentimeter, die mir auf die Beine helfen, die nicht zucken, als immer wieder Schüsse vom Kosovo her zu hören sind. Über das Gitter, an den Uniformierten vorbei, am Hang sitzend, auf die Bahren schauend.
Hektisch werden sie abtransportiert, Alte, Kinder, Schwangere, die umgefallen sind, viele werden sterben. Und dabei gefilmt. Wenn gerade keine Tragödie zu sehen ist, werde ich gefilmt. Alles, was verstört aussieht, wird festgehalten.
Der Krieg ist nicht hier. Keine Granaten hier. Nur etwas, das man hören kann, sehen, in der Nacht am Himmel. Es ist etwas Widerliches in der Luft, auf der Haut. Es ist eine Unruhe in den Köpfen, Instinkte, die über den Verstand siegen.
Zwei Millionen Menschen leben in Mazedonien. Albaner, Serben, Türken, Bulgaren, Roma existieren in einem fragilen Gleichgewicht nebeneinander, ohne sich zu sehr zu mögen, weil kein Mensch mag, was anders ist als er. Anders als die Serben sind fast alle. Aber wie?
Am dritten Tag in Skopje in einem kleinen, bewachten Haus, der Parteizentrale der Serben. Der Vorsitzende der Serben in Mazedonien, Nebojša Tomović, ist erfreut, dass endlich jemand über sein Volk berichten will, ›das in Mazedonien ein Viertel der Bevölkerung bildet‹. Alle Serben hier stehen geschlossen hinter der Politik Miloševićs, sind bereit, ihrem eigentlichen Vaterland Jugoslawien zur Seite zu stehen. Mit Miloševićs Worten vertritt Tomović die Haltung seiner Brüder: Die Nato ist schuld. Killer, dumpfe Mörder, die Europa teilen wollen. Die Kosovo-Albaner flüchten vor deren Bomben. Die Nato, die mit der UCK kooperiert, und die UCK, die die eigenen Leute vertreibt, um es als Aktion der Serben darzustellen.
Es geht um die Wahrheit, sagt Tomović und beschließt seine Rede mit den Worten: Mit der Ruhe in diesem Land ist es vorbei. Wir werden kämpfen. Tomović gibt uns eine Visitenkarte, die uns Eintritt in serbische Dörfer gewähren soll. Malisia Bozovic, der Generalsekretär der Serbisch-Demokratischen Partei, erzählt das gleiche, erklärt noch, wie die Berichte im Fernsehen entstehen. Archivbilder sind das, und wenn man einen Stacheldraht zeigt, ist das schon ein Konzentrationslager. Alles Lüge, alles Propaganda. Wir lieben die Wahrheit.
Mit einem serbischen Fahrer unterwegs in ein serbisches Dorf. In den Städten leben die Bevölkerungsgruppen nebeneinander, die meisten Dörfer sind rein albanisch oder rein serbisch. Der Fahrer Dragan ist Ingenieur. Er erzählt von seiner Frau, die ein Kind erwartet, von seiner Suche nach Arbeit. In einem Nebensatz sagt er, nächste Woche werde das Kosovo clean sein. Und erzählt, dass die Albaner das meiste Geld im Land haben, viele Frauen und Autos und die besseren Häuser. Er freut sich, dass jemand endlich die ganz normalen Serben zu Wort kommen lassen will, die jetzt in der ganzen Welt unbeliebt sind. Von Peter Handke hat Dragan noch nicht gehört.
Das serbische Dorf Kučevište nahe dem Lager Blace scheint aus Staub und Müll gebaut. Vor dem Kiosk auf einer Bank sitzen ein paar Männer, die aussehen, als seien sie betrunken. Misstrauisch beobachten sie uns, spucken auf den Boden. Der Fehler ist, sich als Medienzugehörige zu erkennen zu geben. Der größere Fehler ist zu sagen, dass wir teils deutsch sind. Die Männer schreien. Dass die Deutschen Nazi-Schweine sind, dass die Serben die Opfer sind, dass die Nato an allem schuld ist, dass das Kosovo den Serben gehört. Nach einer halben Stunde kommt ein kleiner Junge mit dem Bild von Milošević. Die Männer lachen. Sie laufen mit uns durch ihr Dorf, um uns den von Albanern geschändeten Friedhof zu zeigen. Zigaretten werden getauscht. Ein Moment Ruhe, in den ein Auto rast. Ein junger Mann mit kahlrasiertem Schädel springt heraus: Wo sind die Deutschen, schreit er, und in Sekunden sind wir umringt von brüllenden Serben. Die Kinder fangen an, schubsen und stoßen, die Frauen stehen daneben und lachen, als ein dicker Mann mir gegen die Stirn schlägt und schreit: Schaut euch die Nato-Hure noch mal an, gleich wird sie im Wasser treiben. Unser Fahrer versucht zu beruhigen: Es muss doch jemand über sie schreiben, die Vorurteile beseitigen, er sei doch auch Serbe, sagt er und zeigt seinen Ausweis. Vergebens. Der Ausweis sei gefälscht, Dragan ein Verräter. Für eine Minute sind die Männer des Schreiens müde, wir beeilen uns.
Dragan ist beschämt. Die Serben sind nicht so, sagt er.
Dass die serbische Mentalität uns so fremd ist, dieses unverständliche Gefühl von Rache, Blut, Boden und Religion, macht, dass wir glauben, der Balkan sei in einer anderen Welt. Eine andere Welt gibt es nicht. Im Hotel treffen wir einen Nato-Soldaten. Er ist Pressesprecher. Auf meine Frage, ob die deutschen Soldaten Angst hätten, sagt er vorschnell ja. Dann beginnt er, überlegter zu antworten. Soldaten wüssten, was ihr Job ist, und überhaupt, noch sei der Bodeneinsatz nicht entschieden. Noch seien die Nato-Truppen hauptsächlich zum Helfen hier. Und das machten sie gut.
Neben dem Auffanglager Blace hat die Nato ein Camp eingerichtet. Nach den Eindrücken des Lagers erscheint es wie das Paradies. Freude regt sich, über die Europäer, die sich oft selber ihrer Eigenschaften schämen, die hier so nützlich sind, die den Albanern das Gefühl von Sicherheit geben. Doch das Lager ist halbleer. Gerne würden sie die Menschen aus Blace ins Camp holen, sagt Soldat Francis MacGann, doch das sei ihnen nicht gestattet. Die mazedonische Regierung habe Angst, dass die Flüchtlinge sich wohl fühlten und blieben, und wenn die Medien über dieses gut organisierte Camp berichten würden, vermindere das den Druck auf Nato-Staaten und Nachbarländer, Flüchtlinge sehr schnell aufzunehmen.
Am vierten Tag treffen wir in dem albanischen Dorf Studeničani nahe Skopje den Berater des Vorsitzenden der Albanischen Partei und des Bürgermeisters, Memed Zejnulahu. Er hat Tränen in den Augen, als er von seinem Besuch im Lager erzählt. In seinem Dorf hat fast jede Familie Flüchtlinge aufgenommen. Manche Bauern haben ihr Haus zur Verfügung gestellt und sind in die Stadt zu Verwandten gezogen. Er zeigt uns ein kleines Haus, in dem 30 Vertriebene wohnen, die uns danken für die Hilfe der Nato.
Ein paar Minuten von Studeničani entfernt findet gerade eine Anti-Nato-Demonstration statt. Organisiert wurde sie von der Konservativen Partei Mazedoniens und ihrem Vorsitzenden Straso Angelovski. Nato-Soldaten sind Nazis, schreien nach seiner Rede die Bauern auf dem Dorfplatz. Sie heben die Fäuste, gegen alles, das ihre Ruhe stört, ihnen Angst macht. Krieg ist leicht hergestellt. Er entsteht aus Politik, den Rest besorgt das Volk. Frag einen, ob er Krieg will. Keiner wird ja sagen. Frag einen, ob er sein Land verteidigen würde. Alle würden nicken, an vergewaltigte Frauen denken, an ihre Häuser und die Fratze des Feindes, der ihnen nehmen will, was ihr Leben ist. Vielleicht kommt der Krieg nicht nach Mazedonien. Doch lange werden Serben und Albaner hier nicht mehr in Ruhe nebeneinander leben können. Vielleicht. Straso Angelovski sagt, das war die erste Demonstration. Das ganze Land wird jetzt überzogen von Protesten. Gegen die Nato. Die Albaner paktieren mit den Mördern.
Vom serbischen Dorf Staro Nagoricane ist die Grenze zu Jugoslawien nur einige Kilometer entfernt.
Bis vor kurzem waren hier Nato-Truppen, doch die Dorfbewohner haben sie vertrieben. Sagen sie stolz in der Dorfkneipe. Verjagt haben wir sie. An der Wand hängt ein Schild: Wir geben das Kosovo nicht auf. Der Kneipier bietet mir an, sein Bett zu besichtigen, Schnäpse werden eingeschenkt und wieder die serbischen Wahrheiten erzählt. Alles war friedlich vor dem Nato-Angriff. Man will doch nichts als Frieden, die Kinder sollen aufwachsen wie Kinder in Düsseldorf. Wir wollen nur leben wie bisher. Die Albaner haben uns nie gestört, sagt der Kneipier und gibt noch einen aus. Eine Frau kommt in die Kneipe. Vladanka ist lange in Österreich gewesen, leise sagt sie: Passt auf. Sie sind alle falsch, und die Grenze ist nah. Hier im Ort wurden die drei Amerikaner verraten. Die vom Dorf haben die Serben angerufen, und sofort waren sie da.
Ein Serbe lädt uns in sein Haus ein. Auf dem Tisch eine weiße Klöppeldecke. Die Mutter schenkt Kaffee ein. Der Serbe heißt Robert und holt nach ein paar Schnäpsen eine Soldaten-Kappe heraus. Er hat im Bosnienkrieg unter Arkan gekämpft und wird bald wieder zu ihm gehen. Saubermachen, sagt er.
Wir fahren dann. Am fünften Tag. Vorbei an Panzern, an bewaffneten Polizisten. Zu viele Dummköpfe bekommen Waffen im Krieg. Dragan schaut auf die Berge. Die meisten Serben haben das unfruchtbare Bergland, sagt er. Die Albaner sitzen in den ertragreichen Ebenen. Normal wird es hier nicht mehr werden.
An der Grenze in Tetovo sind die Schlagbäume geschlossen. Tausende Vertriebene stehen dahinter. Seit Tagen. Dürfen nicht nach Mazedonien. Wieder frage ich einen mazedonischen Soldaten, warum. Er antwortet wütend: Wir brauchen sie hier nicht, und sehen Sie, die Decken, die nach drüben geschickt werden, sind aus Nato-Beständen. Warum kauft man nicht mazedonische Decken, dann hätten wir auch was davon. Viele Angehörige der Albaner auf jugoslawischer Seite haben sich auf mazedonischem Schlammboden niedergelassen. Sie sehen ihre Verwandten stehen, schwanken, frieren, können nichts tun als zu winken. Da zu sein, wenn die Dämmerung kommt. Und in den Dörfern nahe der Grenze haben die Menschen wieder Angst. Viele sind geflohen. Vor den Serben, vor der Nato, egal wovor, die Angst ist da, denn die Nato ist hier, ist ein Ziel der Serben. Es ist Krieg, da kann sich keiner raushalten.
Im Hotel Continental ist Feierabend. Viele berichten seit Jahren nur über Kriege. Sie können nicht mehr anders, denn nach einem Krieg kommt einem das normale Leben langweilig und unecht vor, denn das, was in einem Krieg geschieht, ist, was Menschen in sich tragen, verdeckt, was ausbricht und zu einer Lautstärke führt, die alles andere als zu leise erscheinen lässt. Ein normales Leben können sie sich nicht mehr vorstellen, die Kriegsreporter. Sie werden hier gebraucht.
In der Nacht fahren gespenstisch viele Busse vom Lager Blace weg. Zum Flughafen, nach Griechenland, nach Albanien. In den Bussen stehen und hocken die Flüchtlinge mit leeren Gesichtern. Ab und zu wird der Bus erhellt von den Lichtern der Fernsehteams. Für Sekunden richten sich die Flüchtlinge auf, versuchen sich übers Haar zu streichen, den Schmutz wegzuwischen, das Fernsehen ist da.
Die Reporter nehmen ein allerletztes Bier in der Bar Europa. Direkt neben dem Lager ist hier Tag und Nacht Betrieb. Reporter und Helfer spülen ihren Ekel herunter, trinken, bis ihr Gefühl der Ohnmacht in etwas Weicheres, Traurigeres umschlägt.
Am sechsten Tag setzt sich der Medienfuhrpark wieder in Bewegung. Als die Reporter in Blace eintreffen, finden sie nur eine riesige Müllhalde. Kein Mensch. Niemand. Oberhalb des Lagers sind frische Gräber. Wie viele Tote mit Blick in die alte Heimat dort liegen, weiß niemand. Die Flüchtlinge wurden über Nacht irgendwohin gebracht. In den Nachrichten heißt es, Milošević liebe die Kosovo-Albaner und lade sie zur Rückkehr ein. Keiner kann überprüfen, was mit den Albanern geschieht, die Milošević lieb hat. Die Grenzen sind vermint.
Die Flüchtlinge sind weg. Nichts zu tun. Im Hotel Continental kehrt Ruhe ein. ›Ben Hur‹ statt CNN-Nachrichten. Morgen werden viele nach Albanien fahren, versuchen, doch in das Kosovo zu kommen oder nach Belgrad. Leer werden die drei Hotels in der Stadt dennoch nicht. Vielleicht geht es in Mazedonien auch los. Ein Bürgerkrieg. Ein Serbenangriff. Ein Journalist zu seinem Kollegen: Die Gräber sollten wir noch machen. Machen wir morgen, antwortet der andere und sieht wieder zu ›Ben Hur‹. Der Krieg ist hier nicht. Noch nicht. Vielleicht passiert wirklich nichts mehr. Dann werden die letzten Geschichten aus dem Müll gemacht, den der Krieg hinterlassen hat, das Land wird lange nicht zur Normalität finden. Aber das ist nicht wichtig. Der Krieg ist ja woanders.
Am siebten Tag wird ein mazedonischer Grenzer von Serben erschossen, Russland ist nervös, die Amerikaner sind nervös. Die Chinesen sind sowieso nervös. Die Jungs bei der Nato haben Angst. Das Kosovo ist zwei Stunden entfernt. Die Dame am Flughafen, es ist eine andere, sagt: Ach, Sie waren da unten. Ich kann die ganzen Berichte nicht mehr sehen. Gott sei Dank ist das alles weit weg.
P.S.
2000. Der serbische Fahrer wurde in irgendeinem Konflikt um irgendwas erschossen.
2014 (Zahlen für 2015 stehen noch nicht definitiv fest) waren weltweit fast 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Im Durchschnitt flohen 42.500 Menschen pro Tag.
50 Prozent aller Flüchtlinge sind Kinder. Auf fünf von sieben Kontinenten (ohne Australien, Antarktis) gibt es bewaffnete Konflikte. 2014 sind weltweit 164.000–220.000 Menschen direkt an Kampfhandlungen gestorben, so viele wie seit 26 Jahren nicht mehr. 2015 starben in Konfliktgebieten mindestens 167.000 Menschen. Über 5 der 7,3 Mrd. Menschen leben in Staaten, in denen es bewaffnete Konflikte gibt.
Bedroht durch Gesäße
Thailand, 23. Januar 2009
Es gibt einen Konsens mittelständischer Bildungsbürgerträume, zu dem zählen der Besuch der Chinesischen Mauer, einmal Nibelungen in Bayreuth, die Liebe zu Frankreich und eine Reise mit dem Orient-Express. Danach kann man sterben. Mein Intellekt funkelt wie der Abendstern am dunkelblauen Himmel über Thailand, und ich warte in der Lounge des Eastern and Oriental Express, die mich an die VIP-Lounge des Flughafens Bombay erinnert, der mich an ein heruntergekommenes Bahnrestaurant in Rumänien erinnert hat. Die mir stets unverständlichen Klimaanlagen dimmen die Raumtemperatur auf Schweiz im Februar. Der Mensch könnte transpirieren, und das hasst er. Zwei Stunden vor Abfahrt des von außen erlesen wirkenden Zuges läuft der Reisende hier auf, um einzuchecken. Eine erlesene Gesellschaft, das Durchschnittsalter so Mitte fünfzig, der Herr mit Bermudas oder gelblichen Baumwollhosen, die er aus rätselhaften Gründen mit einem Gürtel immer über dem Bauchansatz festzurrt. Die Damen tragen überwiegend dünne, traurig wirkende Gesäße in weißen Leinenhosen. Eine Frau führt einen großen federbesetzten Hut mit sich. Vielleicht hat er ihr in einem Krieg das Leben gerettet. Siebzig Prozent der Reisenden scheinen Briten zu sein, der Rest Franzosen und Amerikaner, die stolz sind auf die Erfindung ihres Landsmannes. Der »E&O« entstand nach einer Idee des eisenbahnverrückten Amerikaners James B. Sherwood, dem auch der historische Venice-Simplon-Orient-Express in Europa gehört.
Der Hauptbahnhof Bangkok ist einer der ruhigsten Orte der Stadt; gesittet und reizend sitzen Thailänder zwischen ausufernden Gepäckstücken und warten geduldig. Die erste unangenehme Situation entsteht, als sich die ungefähr sechzig Personen große Reisegruppe, Außerirdischen gleich, hinter einem uniformierten Orientexpress-Manager über einen zehn Meter langen blauen Teppich zum Zug bewegt. Die Passagiere beziehen ihre Kabinen, ihr kleines, eisgekühltes Zuhause während der nächsten drei Tage, während der Zug von Bangkok nach Chiang Mai im Norden fährt. Auf den ersten Blick scheint alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Agatha Christie fällt dem Dümmsten ein, Shanghai Express mit Marlene Dietrich, sogar die plattesten Klischees wollen sich einlösen. Wohin man schaut, Rosenholz und Teak, alte Lampen, alte Teppiche, uniformierte Bedienstete. Die Waggons stammen aus Neuseeland und wurden in Singapur umgebaut und restauriert. Warum nur ist es so saukalt, und warum lassen sich die Fenster nicht öffnen? Da sitzt der Reisende auf einem mäßig bequemen Sofa, schaut durch eine Doppelverglasung, wie der Zug sich langsam durch die Vororte Bangkoks schiebt. Luft möchte man und zwar viel, und zwar warme, den Rauch riechen, den man draußen sieht. Das geht auf dem kleinen Balkonwagen am Ende des Zuges. Hier drängen sich die Raucher, trinken Cocktails und winken den Thailändern zu, die vor Hütten kauern, deren Existenz man in Thailand nicht mehr vermutet hatte. Diese lieben Einheimischen, sie haben ihre Freude am Reichtum der Touristen.
Eine Reise im Orientexpress ist ein teurer Spaß. Aber über Preise redet man nicht in unseren Kreisen, über Geld reden Proleten oder Neureiche, keineswegs die Zielgruppe der hier anwesenden Nostalgiker. Vor Beginn der Zugfahrt hatte der Passagier sich zwischen verschiedenen Tagesausflügen zu entscheiden. Unternehmungen, die jeder Mensch, der bei Trost ist, unbedingt zu vermeiden sucht. Elefanten bei der Arbeit beobachten oder Tempel, am Nachmittag eine Einkaufstour in Seidenfabriken und Schnitzwerkstätten oder eine Stadttour mit Besuch von Seidenfabriken und Schnitzwerkstätten. Es steht dem Menschen auch frei, alleine Chiang Mai zu erkunden oder im Zug auf dem Bahnhof acht Stunden herumzubringen. Aber das ist Zukunftsmusik. Im Moment entfernt sich der weißgekleidete Tross vom Balkonwagen, um in seinen Kabinen den Afternoon-Tee zu nehmen. Jedem Waggon steht ein persönlicher Butler zur Verfügung, der Silberkannen und feine Gebäckteile in die kleinen Löcher bringt. Tee trinken, Suburbs gucken, frieren. Das Schienennetz in Thailand ist noch komplett authentisch geblieben, der Zug wartet auf jede entgegenkommende Lok, es wackelt und ruckelt, und nach einer Stunde entwickelt sich bei den Besitzern schwacher Mägen ein Unwohlsein erster Güte. Doch es bleibt keine Zeit zum Nachdenken, denn gegen sechs macht sich die erste Fütterungsgruppe fertig zum großen Diner. Für Herren besteht strenge Krawattenpflicht, doch warum ein lächerliches Strickchen um den Hals, das jeden Herrn zum Banker macht, irgendwo auf der Welt noch getragen werden muss, ist uneinsichtig.