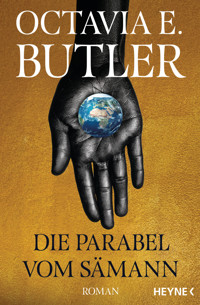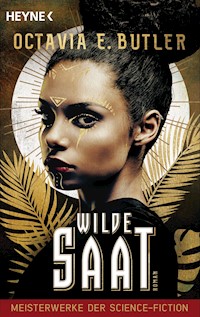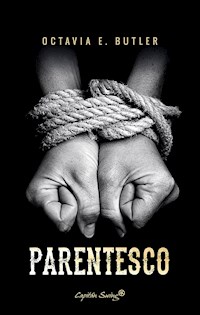12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Um die Menschheit zu retten, muss sie für immer verändert werden
Die ferne Zukunft. Ein Atomkrieg hat die Erde fast vollständig zerstört. Nur einige wenige Menschen wurden von den Oankali, einer geheimnisvollen außerirdischen Spezies, gerettet. Jetzt sollen sie auf ihren Heimatplaneten zurückkehren. Aber die Hilfe der Oankali hat ihren Preis ...
Das einzigartige Science-Fiction-Meisterwerk von der Autorin von DIE PARABEL VOM SÄMANN
»Xenogenesis« beinhaltet die drei Romane »Dämmerung«, »Rituale« und »Imago«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1208
Ähnliche
Das Buch
Die Gegenwart: In einem verheerenden Atomkrieg wird beinahe die ganze Erde zerstört. Jahrhunderte später: Die Schwarze Amerikanerin Lilith Iyapo erwacht an Bord eines Raumschiffs. Die geheimnisvollen Oankali haben die überlebenden Menschen von der verseuchten Erde geholt und in einen Kälteschlaf versetzt. Getrieben von dem Bedürfnis, alles zu verändern, womit sie in Berührung kommen, haben sie die Erde wiederhergestellt und ihre eigenen Gene mit denen der Menschen vermischt – ohne diese vorher nach ihrer Einwilligung gefragt zu haben. Jetzt sollen Lilith und die anderen Überlebenden auf die Erde zurückkehren, doch sie müssen sich ihre alte neue Heimat mit unheimlichen, nicht menschlichen Kreaturen teilen: ihren eigenen Kindern.
In Xenogenesis verwebt Octavia E. Butler, die preisgekrönte Autorin von Die Parabel vom Sämann, so brisante Themen wie Rassismus und Toleranz, Gentechnik und Selbstbestimmung zu einem atemberaubenden Zukunftsabenteuer.
Die Autorin
Octavia E. Butler (1947–2006) war die erste Schwarze Autorin, die sich in der Science-Fiction einen Namen machte. Sie kam in Pasadena, Kalifornien, zur Welt. Obwohl bei ihr Dyslexie festgestellt wurde, machte sie einen Abschluss an der California State University in Los Angeles. Schon mit zwölf Jahren verfasste sie Science-Fiction-Kurzgeschichten. 1976 veröffentlichte sie ihren ersten Roman. Ihr mehrfach preisgekröntes Werk kreist immer wieder um Fragen der kulturellen und geschlechtlichen Identität. Bis zu ihrem Tod lebte und arbeitete Octavia E. Butler in Seattle, Washington. Heute gilt sie mit Meisterwerken wie Kindred, Die Parabel vom Sämann sowie dem Nachfolgeband Die Parabel der Talente weit über die Science-Fiction hinaus als eine der wichtigsten amerikanischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts.
Mehr über Octavia E. Butler und ihre Werke erfahren Sie auf:
OCTAVIA E. BUTLER
XENOGENESIS
DÄMMERUNGRITUALEIMAGO
Aus dem Amerikanischenvon Barbara Heidkamp
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgaben:
DAWN
ADULTHOODRITES
IMAGO
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Ausgabe 07/2024
Copyright © 1987, 1988, 1989 by Octavia E. Butler
Published by Arrangement with Octavia E. Butler Enterprises
Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock(3DStach, Nutthpol Kandaj, vovan und Lex0077)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-31322-7V001
www.diezukunft.de
Erstes Buch
Dämmerung
Erster Teil
1
Am Leben!
Noch immer am Leben.
Wieder am Leben.
Das Erwachen war mühsam, wie immer. Die höchste Enttäuschung. Es war ein Kampf, genug Luft zu holen, um das beklemmende Gefühl des Erstickens zu vertreiben. Lilith Iyapo lag keuchend da und zitterte vor Anstrengung. Ihr Herz schlug zu schnell, zu laut. Sie rollte sich um es herum, fötal, hilflos. Die Blutzirkulation kehrte in Schauern winziger, feiner Schmerzen in ihre Arme und Beine zurück.
Als sich ihr Körper beruhigte und an die Wiederbelebung gewöhnte, blickte sie sich um. Der Raum schien nur schwach erleuchtet, doch sie war noch nie zuvor im Dämmerlicht erwacht. Sie korrigierte sich. Der Raum schien nicht nur dunkel, er war dunkel. Bei einem früheren Erwachen hatte sie beschlossen, dass Realität das war, was immer passierte, was immer sie wahrnahm. Ihr war der Gedanke gekommen – wie oft? –, dass sie vielleicht verrückt war oder unter Drogen stand, physisch krank oder verletzt war. Nichts davon spielte eine Rolle. Es konnte keine Rolle spielen, solange sie auf diese Weise eingesperrt war, hilflos, allein und im Unklaren gelassen wurde.
Sie setzte sich auf, schwankte benommen, dann drehte sie sich um und schaute sich den Rest des Raums an.
Die Wände waren hell – weiß oder grau, vielleicht. Das Bett war das gleiche wie immer: ein massives Podest, das bei Berührung leicht nachgab und aus dem Boden zu wachsen schien. Auf der anderen Seite des Raums war eine Türöffnung, die wahrscheinlich in ein Bad führte. Lilith bekam meistens ein Bad. Zweimal hatte sie keins gehabt, und in ihrer fensterlosen, türlosen Zelle war sie gezwungen gewesen, eine Ecke zu wählen.
Sie ging zur Tür, spähte durch die einförmige Dunkelheit und vergewisserte sich, dass sie tatsächlich ein Bad hatte. Dies hier war nicht nur mit einer Toilette und einem Waschbecken, sondern auch mit einer Dusche ausgestattet. Luxus.
Was hatte sie sonst noch?
Sehr wenig. Da war ein weiteres Podest, vielleicht dreißig Zentimeter höher als das Bett. Man hätte es als Tisch benutzen können, obwohl es keinen Stuhl gab. Und es waren Dinge darauf. Lilith sah das Essen zuerst. Es war der übliche, geschmacklose Klumpen Getreideflocken oder Eintopf in einer essbaren Schüssel, die sich auflöste, wenn Lilith sie leerte und sie nicht aufaß.
Und da war etwas neben der Schüssel. Unfähig, es genau zu erkennen, berührte Lilith es.
Kleidung! Ein Stapel zusammengefalteter Kleidung. Sie schnappte sich die Sachen, ließ sie in ihrem Eifer fallen, hob sie wieder auf und begann sie anzuziehen. Eine helle, schenkellange Jacke und eine lange, weite Hose, beides aus einem kühlen, ganz weichen Material, das sie an Seide erinnerte, obwohl sie nicht glaubte, dass es Seide war, ohne dass sie hätte sagen können, warum. Die Jacke war selbsthaftend und blieb zu, als Lilith sie schloss, ließ sich aber leicht öffnen, als sie die beiden Vorderstreifen auseinanderzog. Die Art und Weise, wie sie aufgingen, erinnerte Lilith an einen Klettverschluss, obwohl nichts dergleichen zu sehen war. Die Hose ließ sich auf die gleiche Weise schließen. Man hatte Lilith von ihrem ersten Erwachen bis jetzt keine Kleidung gegeben. Sie hatte darum gebettelt, doch ihre Entführer hatten sie ignoriert. Als sie jetzt angezogen war, fühlte sie sich sicherer als jemals zuvor in ihrer Gefangenschaft. Sie wusste, dass es eine trügerische Sicherheit war, aber sie hatte gelernt, jede Freude zu genießen, jede Aufbesserung ihrer Selbstachtung, die sie ergattern konnte.
Als sie die Jacke öffnete und schloss, berührte ihre Hand die lange Narbe quer über ihrem Bauch. Sie hatte sie irgendwie zwischen ihrem zweiten und dritten Erwachen bekommen, hatte sie ängstlich untersucht und sich gefragt, was man mit ihr gemacht hatte. Was hatte sie verloren oder dazubekommen, und warum? Und was würde man womöglich noch machen? Sie gehörte sich nicht mehr: Sogar ihr Fleisch konnte ohne ihre Zustimmung oder ihr Wissen aufgeschnitten und zusammengenäht werden.
Es machte sie wütend während späterer Erwachen, dass es Augenblicke gegeben hatte, in denen sie ihren Verstümmlern tatsächlich dankbar gewesen war, dass sie sie hatten schlafen lassen während dem, was immer sie mit ihr gemacht hatten – und dass sie es gut genug gemacht hatten, um ihr später Schmerz oder Invalidität zu ersparen.
Sie rieb über die Narbe und fuhr ihren Umriss nach. Schließlich setzte sie sich aufs Bett und aß ihr geschmackloses Mahl, aß auch die Schüssel auf, mehr weil sie eine andere Textur hatte als aus wirklichem Hunger. Dann begann sie mit der ältesten und vergeblichsten ihrer Aktivitäten: die Suche nach einem Spalt, einem hohlen Klang, irgendeinem Hinweis auf einen Weg aus ihrem Gefängnis heraus.
Sie hatte es bei jedem Erwachen gemacht. Bei ihrem ersten Erwachen hatte sie während ihrer Suche gerufen. Als sie keine Antwort bekam, hatte sie geschrien, dann geweint, dann geflucht, bis sie keine Stimme mehr hatte. Sie hatte gegen die Wände geschlagen, bis ihre Hände bluteten und grotesk anschwollen.
Sie hatte nicht die leiseste Antwort bekommen. Ihre Entführer sprachen, wenn sie bereit waren, und nicht eher. Sie zeigten sich überhaupt nicht. Lilith blieb in ihrer Zelle isoliert, und ihre Stimmen kamen von oben zu ihr wie das Licht. Es gab keine sichtbaren Lautsprecher, genauso wie es keine bestimmte Stelle gab, von der das Licht ausging. Die ganze Decke schien ein Lautsprecher und eine Lichtquelle zu sein – und vielleicht ein Ventilator, da die Luft frisch blieb. Lilith stellte sich in einem großen Kasten vor, wie eine Ratte im Käfig. Vielleicht standen Leute über ihr und blickten durch eine teildurchlässige Glasscheibe oder durch eine Videoeinrichtung herunter.
Warum?
Sie bekam keine Antwort. Sie hatte ihre Entführer gefragt, als sie endlich begannen, mit ihr zu sprechen. Sie hatten es ihr nicht sagen wollen. Sie hatten ihr Fragen gestellt. Einfache zuerst.
Wie alt sie sei?
Sechsundzwanzig, dachte sie im Stillen. War sie immer noch sechsundzwanzig? Wie lange hielt man sie schon gefangen? Sie wollten es nicht sagen.
Ob sie verheiratet gewesen sei?
Ja, aber er war tot, schon lange tot, unerreichbar für sie, für ihr Gefängnis.
Ob sie Kinder gehabt habe?
O Gott. Ein Kind, schon lange tot, mit seinem Vater gestorben. Ein Sohn. Tot. Wenn es ein Jenseits gab, was für ein überfüllter Ort musste es jetzt sein.
Ob sie Geschwister gehabt habe?
Zwei Brüder und eine Schwester, wahrscheinlich tot, zusammen mit dem Rest ihrer Familie. Eine Mutter, schon lange tot, ein Vater, wahrscheinlich tot, diverse Tanten und Onkel, Vettern und Cousinen, Nichten und Neffen … wahrscheinlich tot.
Was für einer Beschäftigung sie nachgegangen sei?
Keiner. Ihr Sohn und ihr Mann waren für ein paar kurze Jahre ihre Beschäftigung gewesen. Nach dem Autounfall, bei dem sie ums Leben gekommen waren, war sie wieder aufs College gegangen, um dort zu überlegen, was sie sonst noch mit dem Rest ihres Lebens anfangen könnte.
Ob sie sich an den Krieg erinnerte?
Verrückte Frage. Konnte jemand, der den Krieg erlebt hatte, ihn vergessen? Eine Handvoll Leute hatte versucht, die Menschheit auszulöschen, und es wäre ihnen beinahe gelungen. Sie hatte durch reines Glück überlebt – nur um, der Himmel wusste von wem, gefangen und eingesperrt zu werden. Sie hatte sich bereit erklärt, ihre Fragen zu beantworten, wenn man sie aus ihrer Zelle herausließ, aber sie stellten sich stur.
Sie erklärte sich zu einem Tausch bereit; ihre Antworten gegen die ihrer Entführer: Wer waren sie? Warum hielt man sie fest? Wo war sie? Antwort gegen Antwort. Wieder stellten sie sich stur.
Also stellte sie sich auch stur, gab ihnen keine Antworten, ignorierte die physischen und geistigen Tests, die sie mit ihr durchzuführen versuchten. Sie wusste nicht, was sie mit ihr machen würden. Sie hatte Angst, dass man ihr wehtun würde, sie bestrafen würde. Aber sie hatte das Gefühl, dass sie es riskieren musste, zu handeln, zu versuchen, etwas zu bekommen, und ihr einziges Zahlungsmittel war Kooperation.
Sie bestraften sie nicht, und sie ließen auch nicht mit sich handeln. Sie hörten einfach auf, mit ihr zu sprechen.
Essen erschien weiterhin auf mysteriöse Weise, wenn sie schlief. Wasser floss weiter aus den Hähnen im Bad. Das Licht leuchtete weiter. Doch darüber hinaus gab es nichts, niemanden, keinen Laut, es sei denn, Lilith verursachte ihn, keinen Gegenstand, womit sie sich amüsieren konnte. Es gab nur das Bett- und das Tischpodest, die sich nicht vom Boden lösten, wie sehr Lilith sie auch malträtierte. Flecken verblassten rasch und verschwanden von ihrer Oberfläche. Lilith verbrachte Stunden mit dem vergeblichen Versuch, das Problem zu lösen, wie sie die Podeste zerstören könnte. Dies war eine der Aktivitäten, die ihr half, halbwegs bei Verstand zu bleiben. Eine andere war zu versuchen, die Decke zu erreichen. Nichts, worauf sie sich stellen konnte, brachte sie in Sprungweite. Versuchsweise warf sie eine Schüssel mit Essen – ihre beste verfügbare Waffe – nach ihr. Das Essen spritzte dagegen und verriet ihr, dass die Decke solide war, nicht irgendeine Projektion oder ein Spiegeltrick. Aber vielleicht war sie nicht so dick wie die Wände. Vielleicht war sie sogar aus Glas oder aus dünnem Kunststoff.
Lilith fand es nie heraus.
Sie arbeitete eine ganze Reihe von Gymnastikübungen aus und hätte sie täglich gemacht, wenn sie eine Möglichkeit gehabt hätte, einen Tag vom nächsten oder Tag von Nacht zu unterscheiden. So machte sie die Übungen jedes Mal, wenn sie länger geschlafen hatte.
Sie schlief viel und war dankbar, dass ihr Körper auf ihre Stimmungsschwankungen zwischen Angst und Langeweile mit einem gesteigerten Schlafbedürfnis reagierte. Das kleine, schmerzlose Erwachen aus solchem Schlummer begann sie schließlich ebenso sehr zu enttäuschen, wie es das größere Erwachen getan hatte.
Das größere Erwachen woraus? Durch Drogen herbeigeführtem Schlaf? Was konnte es sonst sein? Sie war im Krieg nicht verletzt worden, hatte keine ärztliche Hilfe gebraucht. Trotzdem war sie hier.
Sie sang Lieder und erinnerte sich an Bücher, die sie gelesen hatte, an Filme und Fernsehsendungen, die sie gesehen, Familiengeschichten, die sie gehört hatte, an Bruchstücke ihres eigenen Lebens, das ihr so alltäglich erschienen war, als sie noch ein freier Mensch gewesen war. Sie dachte sich Geschichten aus und diskutierte Pro und Contra von Fragen, über die sie sich früher ereifert hatte, irgendwas!
Mehr Zeit verstrich. Lilith hielt aus, sprach nicht direkt mit ihren Entführern, außer um sie zu verfluchen. Sie war zu keiner Kooperation bereit. Es gab Momente, in denen sie nicht wusste, warum sie sich sträubte. Was würde sie aufgeben, wenn sie die Fragen ihrer Entführer beantwortete? Was hatte sie zu verlieren außer Elend, Isolation und Stille? Trotzdem hielt sie aus.
Es kam eine Zeit, als sie nicht aufhören konnte, mit sich zu reden, als ihr schien, dass jeder Gedanke, der ihr in den Sinn kam, laut ausgesprochen werden müsste. Dann bemühte sie sich verzweifelt, still zu sein, doch irgendwie begannen die Worte, wieder aus ihr herauszusprudeln. Sie glaubte, den Verstand zu verlieren, hätte schon angefangen, ihn zu verlieren. Sie begann zu weinen.
Als sie schließlich schaukelnd auf dem Boden saß und darüber nachdachte, ob sie den Verstand verlor und vielleicht auch davon redete, wurde etwas in den Raum hereingelassen – irgendein Gas, vielleicht. Sie fiel rückwärts und sank in ihren zweiten langen Schlaf.
Bei ihrem nächsten Erwachen, Stunden, Tage oder vielleicht Jahre später, begannen ihre Entführer wieder, mit ihr zu sprechen und stellten ihr die gleichen Fragen wie beim ersten Mal. Diesmal beantwortete Lilith sie. Sie log, wenn sie wollte, aber sie antwortete immer. Der lange Schlaf war heilsam gewesen. Sie erwachte ohne besondere Neigung, ihre Gedanken laut auszusprechen oder zu weinen oder sich auf den Boden zu setzen und vor und zurück zu schaukeln, doch ihr Gedächtnis war unbeeinträchtigt. Sie erinnerte sich allzu gut an die lange Zeit der Stille und Isolation. Selbst ein unsichtbarer Fragesteller war vorzuziehen.
Die Fragen wurden komplexer, entwickelten sich zu regelrechten Gesprächen während späterer Erwachen. Einmal steckten sie ein Kind zu ihr – einen kleinen Jungen mit langem, glattem schwarzem Haar und rauchbrauner Haut, heller als ihre eigene. Er sprach kein Englisch und fürchtete sich vor ihr. Er war ungefähr fünf – ein wenig älter als Ayre, ihr eigener Sohn. Neben ihr an diesem fremden Ort zu erwachen, war wahrscheinlich das Erschreckendste, was er je erlebt hatte.
Anfangs versteckte er sich entweder im Bad oder presste sich in die am weitesten von ihr entfernte Ecke. Sie brauchte lange, um ihn davon zu überzeugen, dass sie nicht gefährlich war. Dann begann sie, ihm Englisch beizubringen – und er brachte ihr seine Sprache bei, was immer für eine es war. Sein Name war Sharad. Lilith sang ihm Lieder vor, und er lernte sie sofort und sang sie in fast akzentfreiem Englisch nach. Er verstand nicht, warum sie es nicht auch tat, als er ihr seine Lieder vorsang.
Schließlich lernte sie die Lieder doch. Die Übung machte ihr Spaß. Alles Neue war kostbar.
Sharad war ein Segen, auch wenn er in das Bett machte, das sie teilten, oder ungeduldig wurde, weil sie ihn nicht schnell genug verstand. Er war Ayre im Aussehen und Wesen nicht sehr ähnlich, aber sie konnte ihn berühren. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt jemanden berührt hatte. Es war ihr nicht bewusst gewesen, wie sehr sie es vermisst hatte. Sie machte sich Sorgen um ihn und überlegte, wie sie ihn beschützen konnte. Wer wusste, was ihre Entführer mit ihm gemacht hatten – oder was sie machen würden? Doch sie hatte nicht mehr Macht als er. Bei ihrem nächsten Erwachen war er fort. Experiment abgeschlossen.
Sie flehte ihre Entführer an, ihn zurückkommen zu lassen, doch sie weigerten sich. Sie sagten, er sei bei seiner Mutter. Lilith glaubte ihnen nicht. Sie stellte sich vor, wie Sharad allein in seiner eigenen kleinen Zelle saß und sein scharfer, wacher Verstand mit der Zeit stumpf wurde.
Gleichgültig begannen ihre Entführer eine komplexe neue Reihe von Fragen und Übungen.
2
Was würden sie diesmal machen? Noch mehr Fragen stellen? Ihr einen neuen Begleiter geben? Es interessierte Lilith kaum.
Sie saß angezogen auf dem Bett und wartete, müde auf eine tiefe, leere Weise, die nichts mit physischer Müdigkeit zu tun hatte. Früher oder später würde jemand zu ihr sprechen.
Sie musste lange warten. Sie hatte sich hingelegt und war fast eingeschlafen, als eine Stimme ihren Namen sagte.
»Lilith?« Die übliche ruhige, androgyne Stimme.
Sie holte tief und müde Luft. »Was?«, fragte sie. Doch noch während sie sprach, wurde ihr klar, dass die Stimme nicht wie sonst von der Decke gekommen war. Sie setzte sich hastig auf und blickte sich um. In einer Ecke entdeckte sie die schattenhafte Gestalt eines dünnen, langhaarigen Mannes.
War er der Grund für die Kleidung? Er schien eine ähnliche Montur zu tragen. Etwas, das er ausziehen würde, wenn sie beide sich besser kennenlernten? Großer Gott!
»Ich glaube, Sie könnten der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt«, sagte sie leise.
»Ich bin nicht hier, um dir wehzutun«, antwortete er.
»Nein. Natürlich nicht.«
»Ich bin hier, um dich nach draußen zu bringen.«
Jetzt stand sie auf. Sie wünschte sich mehr Licht, als sie ihn prüfend betrachtete. Scherzte er? Machte er sich über sie lustig?
»Nach draußen? Wozu?«
»Ausbildung. Arbeit. Der Beginn eines neuen Lebens.«
Sie trat einen Schritt auf ihn zu, dann blieb sie stehen. Er machte ihr irgendwie Angst. Sie konnte sich nicht überwinden, an ihn heranzutreten. »Irgendetwas stimmt nicht«, sagte sie. »Wer sind Sie?«
Er bewegte sich leicht. »Und was bin ich?«
Sie zuckte zusammen, weil sie genau das fast gesagt hätte.
»Ich bin kein Mann«, fuhr er fort. »Ich bin kein Mensch.«
Lilith wich bis zum Bett zurück, setzte sich aber nicht. »Sagen Sie mir, was Sie sind.«
»Ich bin hier, um es dir zu sagen … und zu zeigen. Willst du mich nun ansehen?«
Da sie ihn – es – schon ansah, runzelte sie die Stirn. »Das Licht …«
»Es wird sich verändern, wenn du bereit bist.«
»Sie sind … was? Von einer anderen Welt?«
»Von einer Reihe anderer Welten. Du bist eine der wenigen Englischsprechenden, die nie erwogen hat, dass sie sich in den Händen von Außerirdischen befinden könnte.«
»Ich habe es erwogen«, flüsterte Lilith. »Zusammen mit der Möglichkeit, dass ich im Gefängnis sein könnte, in einer Heilanstalt, in den Händen des FBI, der CIA oder des KGB. Die anderen Möglichkeiten schienen nur geringfügig weniger lächerlich.«
Das Wesen sagte nichts. Es stand völlig regungslos in seiner Ecke, und Lilith wusste von ihren vielen Erwachen, dass es erst wieder mit ihr sprechen würde, wenn sie tat, was es wünschte – wenn sie sagte, dass sie bereit war, es anzusehen, und dann, im helleren Licht, den obligatorischen Blick auf es warf. Diese Dinger, was immer sie waren, diese Wesen, waren unglaublich gut im Warten. Sie ließ das hier ein paar Minuten warten, und es schwieg nicht nur, es bewegte auch nicht einen Muskel. Disziplin oder Physiologie?
Sie hatte keine Angst. »Hässliche« Gesichter hatten sie schon lange vor ihrer Gefangennahme nicht mehr erschrecken können. Es war das Unbekannte, das ihr Angst machte. Der Käfig, in dem sie sich befand. Sie wollte sich lieber an egal wie viele hässliche Gesichter gewöhnen, als in ihrem Käfig zu bleiben.
»Also gut«, sagte sie. »Zeigen Sie sich mir.«
Das Licht wurde heller, wie sie vermutet hatte, und was wie ein großer, schlanker Mann ausgesehen hatte, war zwar immer noch humanoid, aber es hatte keine Nase – keinen Wulst, keine Nüstern –, nur glatte, graue Haut. Es war grau – hellgraue Haut, dunkelgraueres Haar auf dem Kopf, das nach unten wuchs, um seine Augen und Ohren herum und an seiner Kehle. Es war so viel Haar vor seinen Augen, dass Lilith sich fragte, wie das Wesen sehen konnte. Das lange, üppige Ohrhaar schien sowohl aus den Ohren heraus als auch um sie herum zu wachsen. Darüber verband es sich mit dem Aughaar und darunter und dahinter mit dem Kopfhaar. Die Insel Kehlhaar schien sich leicht zu bewegen, und Lilith kam der Gedanke, dass dies die Stelle sein könnte, wo das Wesen atmete – eine Art natürliche Tracheotomie.
Sie warf einen flüchtigen Blick auf den humanoiden Körper und fragte sich, wie menschlich er wirklich war. »Nichts für ungut«, sagte sie, »aber sind Sie ein Mann oder eine Frau?«
»Es ist falsch, anzunehmen, dass ich ein Geschlecht haben muss, wie du es kennst«, erwiderte es, »aber zufällig bin ich ein Mann.«
Gut. »Es« konnte wieder »er« werden. Weniger peinlich.
»Du solltest bemerken«, fuhr er fort, »dass das, was du wahrscheinlich als Haar siehst, gar kein Haar ist. Ich habe kein Haar. Die Realität scheint Menschen zu beunruhigen.«
»Was?«
»Komm näher und schau!«
Lilith wollte ihm nicht näher sein. Sie hatte zuerst nicht gewusst, was sie zurückgehalten hatte. Jetzt war sie sicher, dass es seine Fremdartigkeit war, seine Andersartigkeit, seine buchstäbliche Unirdischkeit. Sie fand sich immer noch unfähig, auch nur einen Schritt näher an ihn heranzutreten.
»O Gott«, flüsterte sie. Und das Haar – das was immer es war – bewegte sich. Etwas davon schien auf sie zuzuwehen wie im Wind – obwohl sich kein Luftzug im Raum rührte.
Sie runzelte die Stirn und bemühte sich, zu sehen, zu verstehen. Dann begriff sie abrupt. Sie wich zurück, um das Bett herum bis an die gegenüberliegende Wand. Als sie nicht mehr weiterkonnte, blieb sie an der Wand stehen und starrte ihn an.
Medusa.
Ein Teil des »Haars« wand sich unabhängig, wie ein Nest aufgescheuchter Schlangen, die in alle Richtungen auseinanderfuhren.
Angewidert drehte Lilith das Gesicht zur Wand.
»Es sind keine separaten Tiere«, sagte er. »Es sind Sinnesorgane. Sie sind ebenso wenig gefährlich wie deine Nase oder deine Augen. Es ist natürlich, dass sie sich auf meine Wünsche oder Emotionen oder auf Stimuli von außen bewegen. Wir haben sie auch an unseren Körpern. Wir brauchen sie genauso, wie du deine Ohren, Nase und Augen brauchst.«
»Aber …« Ungläubig drehte sie sich wieder zu ihm um. Warum sollte er solche Dinge – Tentakel – zur Ergänzung seiner Sinne brauchen?
»Wenn du kannst«, fuhr er fort, »komm näher und schau mich an. Ich habe erlebt, dass Menschen glaubten, sie sähen menschliche Sinnesorgane an meinem Kopf, und dann wütend auf mich wurden, als ihnen klar wurde, dass sie sich irrten.«
»Ich kann nicht«, flüsterte sie, obschon sie es jetzt wollte. Konnte sie sich so geirrt haben, so von ihren eigenen Augen getäuscht worden sein?
»Komm«, sagte er. »Meine Sinnesorgane sind nicht gefährlich für dich. Du wirst dich an sie gewöhnen müssen.«
»Nein!«
Die Tentakel waren elastisch. Bei Liliths Ausruf dehnten sich einige von ihnen aus und streckten sich auf sie zu. Sie musste an große, langsam zuckende, sterbende Regenwürmer denken, die nach einem Schauer auf dem Gehsteig lagen. Sie musste an kleine, tentakelbewehrte Meeresschnecken denken – Nacktkiemer –, die auf unglaubliche Weise zu menschlicher Größe und Form angewachsen waren und, abstoßenderweise, mehr wie ein Mensch klangen als manche Menschen. Aber sie musste ihn sprechen hören. Wenn er schwieg, war er völlig fremdartig.
Sie schluckte. »Hören Sie, bitte schweigen Sie nicht. Reden Sie mit mir!«
»Ja?«
»Wieso sprechen Sie überhaupt so gut Englisch? Sie müssten zumindest einen ungewöhnlichen Akzent haben.«
»Leute wie du brachten es mir bei. Ich spreche mehrere menschliche Sprachen. Ich begann sehr jung mit dem Lernen.«
»Wie viele Menschen haben Sie noch hier? Und wo sind wir hier?«
»Dies ist mein Zuhause. Du würdest es als Schiff bezeichnen – ein gewaltiges im Vergleich zu denen, die dein Volk gebaut hat. Was es wirklich ist, lässt sich nicht übersetzen. Man wird dich verstehen, wenn du es ein Schiff nennst. Es befindet sich auf einer Umlaufbahn um deine Erde, ein wenig außerhalb der Umlaufbahn deines Erdenmonds. Was deine Frage anbetrifft, wie viele Menschen hier sind: alle, die euren Krieg überlebten. Wir sammelten so viele ein, wie wir konnten. Diejenigen, die wir nicht rechtzeitig fanden, starben an Verletzungen, Krankheit, Hunger, Strahlung, Kälte … Wir fanden sie später.«
Sie glaubte ihm. Die Menschheit hatte bei ihrem Versuch, sich selbst zu zerstören, die Welt unbewohnbar gemacht. Lilith war sicher gewesen, dass sie sterben würde, obschon sie die Bombardierung ohne einen Kratzer überlebt hatte. Sie hatte ihr Überleben als Unglück betrachtet – die Aussicht auf einen schleichenden Tod. Und jetzt …?
»Ist noch irgendetwas übrig geblieben auf der Erde?«, flüsterte sie. »Etwas Lebendiges, meine ich?«
»O ja. Die Zeit und unsere Bemühungen haben sie wiederhergestellt.«
Lilith hielt inne und brachte es sogar fertig, ihn einen Moment anzuschauen, ohne sich von den sich langsam windenden Tentakeln ablenken zu lassen. »Wiederhergestellt? Warum?«
»Zum Gebrauch. Du wirst irgendwann dorthin zurückkehren.«
»Sie werden mich zurückschicken? Auch die anderen Menschen?«
»Ja.«
»Warum?«
»Das wirst du nach und nach verstehen lernen.«
Sie runzelte die Stirn. »Na schön, ich fange jetzt damit an. Sagen Sie es mir.«
Seine Kopftentakel wogten. Einzeln betrachtet, sahen sie eher wie große Würmer als wie kleine Schlangen aus. Lang und dünn oder kurz und dick, wie … Wie was? Wie seine Stimmung wechselte? Wie sich seine Aufmerksamkeit verlagerte? Lilith blickte weg.
»Nein!«, sagte er scharf. »Ich werde nur mit dir sprechen, Lilith, wenn du mich ansiehst.«
Sie ballte eine Hand zur Faust und grub bewusst die Nägel in die Handfläche, bis sie beinahe die Haut durchbohrten. Durch diesen Schmerz abgelenkt, sah sie ihn an. »Wie heißen Sie?«, fragte sie.
»Kaaltediinjdahya lel Kahguyaht aj Dinso.«
Sie starrte ihn an, dann seufzte sie und schüttelte den Kopf.
»Jdahya«, sagte er. »Dieser Teil bin ich. Der Rest sind meine Familie und andere Dinge.«
Sie wiederholte den kürzeren Namen, wobei sie sich bemühte, ihn genauso auszusprechen wie er und das ungewohnte angedeutete j richtig klingen zu lassen. »Jdahya«, sagte sie, »ich will den Preis für die Hilfe Ihres Volks wissen. Was verlangen Sie von uns?«
»Nicht mehr, als ihr geben könnt – aber mehr, als du hier und jetzt verstehen kannst. Mehr, als Worte dir zunächst zu verstehen werden helfen können. Es gibt Dinge, die du draußen hören und sehen musst.«
»Sagen Sie mir jetzt etwas, ob ich es verstehe oder nicht.«
Seine Tentakel kräuselten sich. »Ich kann nur sagen, dass dein Volk etwas hat, das wir schätzen. Du beginnst vielleicht zu verstehen, wie sehr wir es schätzen, wenn ich dir sage, dass es nach eurer Zeitmessung mehrere Millionen Jahre her ist, dass wir es wagten, uns in den Selbstzerstörungsakt eines anderen Volkes einzumischen. Viele von uns bezweifelten, ob es diesmal klug war, es zu tun. Wir dachten … dass es einen Konsens zwischen euch gegeben hätte, dass ihr vereinbart hättet, zu sterben.«
»Keine Spezies würde das tun!«
»Doch. Einige haben es getan. Und ein paar davon haben ganze Schiffe mit unseren Leuten mitgenommen. Wir haben gelernt. Massenselbstmord ist eins der wenigen Dinge, um die wir uns gewöhnlich nicht kümmern.«
»Wissen Sie jetzt, was mit uns passiert ist?«
»Ich weiß, was passiert ist. Es ist … fremd für mich. Erschreckend fremd.«
»Ja. So ähnlich habe ich selbst empfunden, obwohl es mein Volk ist. Es war … mehr als Wahnsinn.«
»Einige der Leute, die wir auflasen, hatten sich tief unter der Erde versteckt. Sie hatten einen Großteil der Zerstörung verursacht.«
»Und sie leben noch?«
»Einige von ihnen.«
»Und Sie haben vor, sie zur Erde zurückzuschicken?«
»Nein.«
»Was?«
»Diejenigen, die noch leben, sind jetzt sehr alt. Wir haben sie langsam benutzt und Biologie, Sprache und Kultur von ihnen gelernt. Wir weckten immer ein paar gleichzeitig und ließen sie ihr Leben hier in verschiedenen Teilen des Schiffs leben, während du schliefst.«
»Während ich schlief … Jdahya, wie lange habe ich geschlafen?«
Er ging durch den Raum zu dem Tischpodest, legte eine vielfingrige Hand darauf und drückte sich hoch. Die Beine an den Körper angezogen, lief er mühelos auf den Händen zur Mitte der Plattform. Die ganze Bewegungsfolge war so flüssig und natürlich und doch so fremd, dass es Lilith faszinierte.
Abrupt wurde ihr klar, dass er ihr mehrere Meter näher war. Sie sprang zurück, doch dann kam sie sich albern vor und bemühte sich, wieder auf ihn zuzukommen. Jdahya hatte sich kompakt in eine unbequem aussehende, sitzende Position zusammengefaltet. Er ignorierte Liliths plötzliche Bewegung – bis auf seine Kopftentakel, die alle wie im Wind auf sie zuschwangen. Er schien zuzusehen, wie sie ganz langsam zum Bett zurückkam. Konnte ein Lebewesen mit Sinnestentakeln anstatt Augen sehen?
Als sie so dicht an ihn herangekommen war, wie sie konnte, blieb sie stehen und setzte sich auf den Boden. Es fiel ihr schwer, zu bleiben, wo sie war. Sie zog die Knie an die Brust und umklammerte sie ganz fest.
»Ich verstehe nicht, warum ich solche … Angst vor Ihnen habe«, flüsterte sie. »Davor, wie Sie aussehen, meine ich. So anders sind Sie doch nicht. Es gibt – oder gab – Lebensformen auf der Erde, die wie Sie aussahen.«
Er sagte nichts.
Lilith betrachtete ihn prüfend; sie hatte Angst, dass er in eins seiner langen Schweigen verfallen sei. »Ist es etwas, das Sie tun?«, wollte sie wissen. »Etwas, wovon ich nichts weiß?«
»Ich bin hier, um dir beizubringen, dich bei uns wohlzufühlen«, erklärte er. »Du verhältst dich sehr gut.«
Sie hatte ganz und gar nicht das Gefühl, dass sie sich gut verhielt. »Wie haben sich andere denn verhalten?«
»Einige haben versucht, mich zu töten.«
Sie schluckte. Es überraschte sie, dass sie es fertiggebracht hatten, ihn zu berühren. »Was haben Sie mit ihnen gemacht?«
»Weil sie versuchten, mich zu töten?«
»Nein, vorher – um sie dazu zu bringen.«
»Nicht mehr, als ich jetzt mit dir mache.«
»Ich verstehe nicht.« Sie zwang sich, ihn anzuschauen. »Können Sie wirklich sehen?«
»Sehr gut sogar.«
»Farben? Tiefe?«
»Ja.«
Und doch stimmte es, dass er keine Augen hatte. Lilith konnte jetzt sehen, dass dort nur dunkle Stellen waren, wo dicht Tentakel wuchsen. Genauso wie an den Seiten seines Kopfes, wo Ohren hätten sein sollen. Und da waren Öffnungen an seiner Kehle. Und die Tentakel um sie herum sahen nicht so dunkel aus wie die anderen. Trüb durchsichtige, blassgraue Würmer.
»Tatsächlich solltest du wissen«, fuhr er fort, »dass ich überall dort sehen kann, wo ich Tentakel habe – und dass ich sehen kann, ob ich es zu bemerken scheine oder nicht. Ich kann nicht nicht sehen.«
Das klang wie ein schreckliches Leben – nicht die Augen schließen und in die ungestörte Dunkelheit hinter seinen eigenen Lidern versinken zu können. »Schlafen Sie nicht?«
»Doch. Aber nicht so wie du.«
Sie wechselte abrupt das Thema. »Apropos schlafen, Sie haben mir noch nicht gesagt, wie lange Sie mich haben schlafen lassen.«
»Ungefähr … zweihundertfünfzig deiner Jahre.«
Das war mehr, als Lilith auf einmal verarbeiten konnte. Sie sagte so lange nichts, dass Jdahya das Schweigen brach.
»Irgendetwas ging schief, als du das erste Mal geweckt wurdest. Ich hörte von mehreren Leuten davon. Jemand fasste dich falsch an – unterschätzte dich. Du bist in mancher Hinsicht wie wir, aber man dachte, du wärst wie deine Militärleute, die sich unter der Erde versteckten. Auch sie wollten nicht mit uns reden. Zuerst nicht. Nach diesem anfänglichen Fehler ließ man dich ungefähr fünfzig Jahre lang schlafen.«
Sie kroch zum Bettende, Würmer hin, Würmer her, und lehnte sich dagegen. »Ich habe immer gedacht, dass zwischen meinem jeweiligen Erwachen Jahre liegen könnten, aber ich habe es nicht wirklich geglaubt.«
»Du warst wie deine Welt. Du brauchtest Zeit zum Heilen. Und wir brauchten Zeit, um mehr über deine Art zu lernen.« Er hielt inne. »Wir wussten nicht, was wir denken sollten, als sich einige deiner Leute umbrachten. Einige von uns glaubten, sie hätten es getan, weil sie bei dem Massenselbstmord vergessen worden wären … dass sie einfach ihr Sterben beenden wollten. Andere meinten, weil wir sie isoliert hielten. Wir begannen, zwei oder mehr zusammenzustecken, und viele verletzten oder töteten sich gegenseitig. Isolation kostete weniger Leben.«
Diese letzten Worte rührten an eine Erinnerung in ihr. »Jdahya?«, sagte sie.
Die Tentakel die Seiten seines Gesichts hinunter erzitterten und erinnerten einen Moment lang an einen dunklen Backenbart. »Einmal wurde ein kleiner Junge zu mir gesteckt. Sein Name war Sharad. Was ist aus ihm geworden?«
Jdahya schwieg für einen Augenblick, dann streckten sich alle seine Tentakel hoch. Jemand sprach von oben zu ihm auf die übliche Weise und in einer Stimme wie seine eigene, doch diesmal in einer fremden Sprache, abgehackt und schnell.
»Mein Verwandter wird es herausfinden«, sagte er zu Lilith. »Sharad geht es mit ziemlicher Sicherheit gut, obwohl er vielleicht kein Kind mehr ist.«
»Sie haben die Kinder aufwachsen und alt werden lassen?«
»Ein paar, ja. Aber sie haben unter uns gelebt. Wir haben sie nicht isoliert.«
»Sie hätten keinen von uns isolieren dürfen, es sei denn, Sie wollten uns in den Wahnsinn treiben. Bei mir wäre es Ihnen mehr als einmal fast gelungen. Menschen brauchen einander.«
Seine Tentakel wanden sich abstoßend. »Das wissen wir. Ich hätte nicht so viel Einsamkeit ertragen wollen wie du. Aber wir hatten keine Erfahrung darin, Menschen so zu gruppieren, wie es ihnen gefiel.«
»Aber Sharad und ich …«
»Er hat vielleicht Eltern gehabt, Lilith.«
Jemand sprach von oben, auf Englisch diesmal. »Der Junge hat Eltern und eine Schwester. Er schläft zusammen mit ihnen, und er ist noch sehr jung.« Es entstand eine Pause. »Lilith, welche Sprache sprach er?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Lilith. »Entweder war er zu jung, um es mir zu sagen, oder er hat es versucht, und ich habe es nicht verstanden. Aber ich glaube, er könnte Inder gewesen sein – wenn Ihnen das etwas sagt.«
»Andere wissen es. Ich war nur neugierig.«
»Geht es ihm wirklich gut?«
»Ja.«
Sie fühlte sich beruhigt und stellte die Emotion augenblicklich infrage. Warum sollte es sie beruhigen, wenn ihr irgendeine anonyme Stimme versicherte, dass alles in Ordnung sei?
»Kann ich ihn sehen?«, fragte sie.
»Jdahya?«, sagte die Stimme.
Jdahya drehte sich zu ihr um. »Du wirst ihn sehen können, wenn du ohne Panik unter uns gehen kannst. Dies ist dein letzter Isolationsraum. Wenn du bereit bist, werde ich dich hinausführen.«
3
Jdahya wollte sie nicht allein lassen. Sosehr Lilith ihre Einzelhaft hasste, so sehr sehnte sie sich danach, ihn los zu sein. Er verstummte für eine Weile, und sie fragte sich, ob er vielleicht schliefe – in dem Maß, wie er schlief. Sie legte sich hin und überlegte, ob sie sich genug entspannen konnte, um hier neben ihm zu schlafen. Es war so, als ob man schlafen ginge und wüsste, dass eine Klapperschlange im Zimmer war, dass man aufwachen und sie in seinem Bett finden könnte.
Sie konnte nicht einschlafen, wenn sie ihm das Gesicht zuwandte. Aber sie konnte ihm auch nicht lange den Rücken zukehren. Jedes Mal wenn sie einnickte, schreckte sie wieder hoch und sah nach, ob er näher gekommen war. Es erschöpfte sie, aber sie konnte nicht anders. Schlimmer noch, jedes Mal wenn sie sich bewegte, bewegten sich auch seine Tentakel und reckten sich träge in ihre Richtung, als ob er mit offenen Augen schliefe – was er zweifellos tat.
Todmüde, mit schmerzendem Kopf und einem flauen Gefühl im Magen, kletterte sie vom Bett und legte sich daneben auf den Boden. Sie konnte Jdahya jetzt nicht sehen, egal wie sie sich drehte. Sie konnte nur das Podest neben sich und die Wände sehen. Er war nicht mehr ein Teil ihrer Welt.
»Nein, Lilith«, sagte er, als sie die Augen schloss.
Sie tat, als ob sie ihn nicht hörte.
»Leg dich aufs Bett oder hierher auf den Boden«, sagte er. »Nicht dort drüben hin.«
Sie blieb steif liegen und schwieg.
»Wenn du bleibst, wo du bist, werde ich mich aufs Bett legen.«
Dann würde er genau über ihr sein – zu nahe, drohend über ihr aufragend, Medusa, die höhnisch auf sie heruntersah. Lilith stand auf und fiel beinahe aufs Bett. Sie verfluchte Jdahya und weinte zu ihrer Demütigung ein wenig. Schließlich schlief sie ein. Ihr Körper war einfach fertig.
Sie erwachte abrupt und drehte sich um, um Jdahya anzusehen. Er war immer noch auf dem Podest, seine Position hatte sich kaum verändert. Als seine Kopftentakel in ihre Richtung schwangen, stand sie auf und lief ins Bad. Er ließ zu, dass sie sich eine Weile dort versteckte, ließ sie sich waschen und allein sein und in Selbstmitleid und Selbstverachtung schwelgen. Sie konnte sich nicht erinnern, sich jemals so fortwährend gefürchtet zu haben, so die Kontrolle über ihre Emotionen verloren zu haben. Jdahya hatte nichts getan, trotzdem hatte sie Angst.
Als er sie rief, holte sie tief Luft und trat aus dem Bad. »Es klappt nicht«, sagte sie elend. »Bring mich einfach mit anderen Menschen auf die Erde. Ich kann es nicht.«
Er beachtete sie nicht.
Nach einer Weile schnitt sie ein anderes Thema an. »Ich habe eine Narbe«, meinte sie und berührte ihren Bauch. »Ich hatte sie auf der Erde noch nicht. Was haben deine Leute mit mir gemacht?«
»Du hattest ein Gewächs«, erklärte er. »Ein Karzinom. Wir haben es entfernt. Sonst hätte es dich getötet.«
Lilith war plötzlich kalt. Ihre Mutter war an Krebs gestorben. Zwei ihrer Tanten hatten Krebs gehabt, und ihre Großmutter war dreimal deswegen operiert worden. Sie waren jetzt alle tot, umgebracht durch den Wahnsinn eines anderen. Doch die »Familientradition« setzte sich offensichtlich fort.
»Was habe ich mit dem Karzinom verloren?«, fragte sie leise.
»Nichts.«
»Nicht ein Stück Darm? Meine Eierstöcke? Meinen Uterus?«
»Nichts. Mein Verwandter hat dich behandelt. Du hast dabei nichts verloren, was du hättest behalten wollen.«
»Es war also dein Verwandter, der … mich operiert hat?«
»Ja. Mit Interesse und Sorgfalt. Es war eine Menschenärztin bei uns, aber sie war schon alt und todkrank. Sie sah nur zu und instruierte meinen Verwandten, was er tun musste.«
»Wie konnte er genug wissen, um mir zu helfen? Die menschliche Anatomie muss doch völlig anders sein als eure.«
»Mein Verwandter, oder besser mein Verwandtes, ist kein Mann – auch keine Frau. Der Name für sein Geschlecht ist Ooloi. Es verstand deinen Körper, weil es ooloi ist. Auf deiner Welt gab es unendlich viele Tote und Sterbende, die wir studieren konnten. Unsere Ooloi lernten, was für den menschlichen Körper normal oder anormal, möglich oder unmöglich sein konnte. Die Ooloi, die auf den Planeten gingen, unterwiesen die, die hierblieben. Mein Verwandtes hat dein Volk den größten Teil seines Lebens studiert.«
»Wie studieren Ooloi denn?« Lilith stellte sich vor, wie sie sterbende Menschen eingesperrt und jedes Stöhnen und jede Zuckung genau beobachtet hatten. Sie stellte sich vor, wie sie sowohl lebende als auch tote Objekte seziert hatten, wie sie Krankheiten, die sich hätten behandeln lassen, ihren grausigen Lauf hatten nehmen lassen, damit die Ooloi lernen konnten.
»Sie beobachten. Sie besitzen spezielle Organe für ihre Art der Beobachtung. Mein Verwandtes untersuchte dich, beobachtete ein paar deiner normalen Körperzellen, verglich sie dann mit dem, was es von anderen Menschen gelernt hatte, und sagte, dass du nicht nur Krebs, sondern auch ein besonderes Talent für Krebs hättest.«
»Ich würde es nicht Talent nennen. Einen Fluch, vielleicht. Aber wie konnte dein Verwandtes das nur durch … Beobachten wissen?«
»Vielleicht wäre wahrnehmen ein besseres Wort«, sagte Jdahya. »Es spielt viel mehr mit als nur das Sehvermögen. Mein Verwandtes weiß alles, was man aus deinen Genen über dich lernen kann. Und inzwischen kennt es deine medizinische Geschichte und weiß eine Menge über deine Denkweise. Es hat bei den Tests mit dir mitgemacht.«
»Tatsächlich? Ich weiß nicht, ob ich ihm das verzeihen kann. Aber hör zu, ich verstehe nicht, wie es ein Karzinom herausschneiden konnte, ohne … nun, ohne das Organ zu beschädigen, an dem die Geschwulst letztendlich wuchs.«
»Mein Verwandtes hat das Karzinom nicht herausgeschnitten. Es hätte dich überhaupt nicht aufgeschnitten, aber es wollte das Karzinom direkt mit allen seinen Sinnen untersuchen, weil es persönlich noch nie eins untersucht hatte. Als es dann fertig war, veranlasste es deinen Körper, die Geschwulst zu resorbieren.«
»Es … veranlasste meinen Körper, die Geschwulst zu … resorbieren?«
»Ja. Mein Verwandtes gab deinem Körper eine Art chemischen Befehl.«
»Heilt ihr so auch Krebs bei euch selbst?«
»Wir bekommen keinen Krebs.«
Lilith seufzte. »Ich wünschte, wir auch nicht. Er hat genug Elend in meiner Familie angerichtet.«
»Er kann dir nicht mehr schaden. Mein Verwandtes sagt, Krebs sei schön, aber leicht zu verhindern.«
»Schön?«
»Es nimmt die Dinge manchmal anders wahr. Hier ist Essen, Lilith. Bist du hungrig?«
Sie ging auf ihn zu und streckte die Hand aus, um die Schüssel zu nehmen, dann wurde ihr klar, was sie tat. Sie erstarrte, schaffte es jedoch, nicht zurückzuweichen. Nach ein paar Sekunden bewegte sie sich ganz langsam auf ihn zu. Sie konnte es nicht schnell – zugreifen und weglaufen. Sie konnte es fast gar nicht. Sie zwang sich, langsam vorwärtszugehen.
Mit zusammengebissenen Zähnen schaffte sie es, die Schüssel von ihm entgegenzunehmen. Ihre Hand zitterte so schlimm, dass sie den halben Eintopf verschüttete. Sie zog sich zum Bett zurück. Nach einer Weile war sie imstande, zu essen, was übrig geblieben war, dann aß sie auch die Schale auf. Es war nicht genug. Sie war noch immer hungrig, aber sie sagte nichts. Sie war nicht fähig, noch eine Schüssel aus seiner Hand entgegenzunehmen. Eine Hand wie ein Gänseblümchen. Die Handfläche in der Mitte, viele Finger ringsherum. In den Fingern waren wenigstens Knochen; es waren keine Tentakel. Und er hatte nur zwei Hände und zwei Füße. Er hätte so viel hässlicher sein können, als er war, so viel weniger … menschlich. Warum konnte sie ihn nicht einfach akzeptieren? Er schien doch nichts weiter zu wollen, als dass sie bei seinem Anblick oder bei dem Anblick seinesgleichen nicht in Panik geriet. Warum konnte sie das nicht?
Sie versuchte sich vorzustellen, von Wesen wie ihm umgeben zu sein – und wurde beinahe von Panik überwältigt. Als ob sie plötzlich eine Phobie entwickelt hätte – etwas, das sie noch nie erlebt hatte. Aber was sie empfand, war so, wie sie es andere hatte beschreiben hören. Eine echte Xenophobie – und offensichtlich war sie damit nicht allein.
Lilith seufzte und stellte fest, dass sie noch immer müde und noch immer hungrig war. Sie rieb mit der Hand über ihr Gesicht. Wenn so eine Phobie war, dann war es etwas, wovon man sich so schnell wie möglich befreien musste. Sie schaute Jdahya an. »Wie nennt dein Volk sich eigentlich?«, fragte sie. »Erzähl mir doch bitte von ihm.«
»Wir sind Oankali.«
»Oankali. Klingt wie ein Wort in irgendeiner Erdensprache.«
»Das mag schon sein, aber mit einer anderen Bedeutung.«
»Was bedeutet es denn in deiner Sprache?«
»Verschiedenes. Unter anderem Händler.«
»Ihr seid Händler?«
»Ja.«
»Womit handelt ihr denn?«
»Mit uns selbst.«
»Du meinst … Sklaven?«
»Nein. Das haben wir nie getan.«
»Was dann?«
»Mit uns selbst.«
»Ich verstehe nicht.«
Er sagte nichts, schien sich in Schweigen zu hüllen und darin zu versinken. Lilith wusste, dass er nicht antworten würde.
Sie seufzte. »Du wirkst manchmal so menschlich. Wenn ich dich nicht anschauen würde, würde ich annehmen, du wärst ein Mann.«
»Das hast du angenommen. Meine Familie vertraute mich der Menschenärztin an, damit ich lernen konnte, diese Arbeit zu tun. Als sie zu uns kam, war sie zu alt, um noch eigene Kinder zu bekommen, aber sie konnte sehr gut lehren.«
»Ich dachte, du sagtest, sie sei todkrank gewesen.«
»Sie starb schließlich auch. Sie war hundertdreizehn Jahre alt und hatte mit Unterbrechungen fünfzig Jahre wach unter uns verbracht. Sie war wie ein vierter Elternteil für meine Geschwister und mich. Es war schwer, zuzuschauen, wie sie alterte und starb. Deine Leute besitzen ein unglaubliches Potenzial, aber sie sterben, ohne viel davon zu nutzen.«
»Das habe ich auch schon Menschen sagen hören.« Lilith runzelte die Stirn. »Hätten eure Ooloi dieser Ärztin nicht helfen können, länger zu leben – das heißt, wenn sie länger als hundertdreizehn Jahre leben wollte?«
»Sie haben ihr geholfen. Sie schenkten ihr vierzig Jahre, die sie normalerweise nicht gehabt hätte, und als sie ihr nicht mehr helfen konnten, nahmen sie ihr die Schmerzen. Wenn sie jünger gewesen wäre, als wir sie fanden, hätten wir ihr bestimmt viel mehr Zeit geben können.«
Lilith folgte diesem Gedanken bis zu seinem offensichtlichen Schluss. »Ich bin sechsundzwanzig«, sagte sie.
»Älter«, informierte er sie. »Du bist gealtert, sooft du wach warst. Insgesamt ungefähr zwei Jahre.«
Sie hatte nicht das Gefühl, zwei Jahre älter zu sein, plötzlich achtundzwanzig zu sein, weil er es sagte. Zwei Jahre Einzelhaft. Was konnten sie ihr bloß als Entschädigung dafür geben? Sie blickte Jdahya an.
Seine Tentakel schienen zu einer zweiten Haut zu erstarren – dunkle Stellen in seinem Gesicht und an seinem Hals, eine dunkle, glatt aussehende Masse auf seinem Kopf. »Falls kein Unfall passiert, wirst du viel länger als hundertdreizehn Jahre leben«, sagte er. »Und du wirst den größten Teil deines Lebens biologisch sehr jung sein. Deine Kinder werden aber noch länger leben.«
Er sah jetzt erstaunlich menschlich aus. Waren es nur die Tentakel, die ihm jenes Meeresschnecken-Aussehen verliehen? Seine Hautfarbe hatte sich nicht verändert. Die Tatsache, dass er weder Augen, Nase noch Ohren hatte, störte Lilith immer noch, aber nicht mehr so sehr.
»Jdahya, bleib so«, bat sie. »Lass mich näher kommen und dich anschauen … wenn ich kann.«
Die Tentakel bewegten sich wie Haut, die sich sonderbar kräuselte, dann wurden sie wieder fest. »Komm!«, sagte er.
Sie brachte es fertig, sich ihm zögernd zu nähern. Selbst aus nur ein paar Schritten Entfernung betrachtet, sahen die Tentakel wie eine glatte zweite Haut aus. »Hast du etwas dagegen, wenn …« Lilith hielt inne und setzte noch einmal an. »Ich meine … darf ich dich berühren?«
»Ja.«
Es fiel ihr leichter, als sie erwartet hatte. Seine Haut war kühl und fast zu glatt, um richtiges Fleisch zu sein – so glatt und vielleicht so hart wie ein Fingernagel.
»Ist es schwer für dich, so zu bleiben?«, fragte sie.
»Nicht schwer. Unnatürlich. Ein Dämpfen der Sinne.«
»Warum hast du es getan – bevor ich dich darum gebeten habe, meine ich.«
»Es ist ein Ausdruck von Freude oder auch Belustigung.«
»Du hast dich gerade gefreut?«
»Über dich. Du wolltest deine Zeit zurück – die Zeit, die wir dir genommen haben. Du wolltest nicht sterben.«
Lilith starrte ihn an, entsetzt, dass er sie so klar durchschaut hatte. Und er musste von Menschen gewusst haben, die trotz der Aussicht auf ein langes Leben, auf Gesundheit und bleibende Jugend hatten sterben wollen. Warum? Vielleicht hatten sie den Teil gehört, den man ihr noch nicht gesagt hatte: den Grund für all das. Den Preis.
»Bis jetzt haben nur Langeweile und Isolation den Wunsch in mir geweckt, sterben zu wollen«, sagte sie.
»Das ist Vergangenheit. Aber trotzdem hast du nie versucht, dich umzubringen.«
»N… nein.«
»Dein Lebenswille ist stärker, als dir bewusst ist.«
Sie seufzte. »Das wirst du testen, nicht wahr? Das ist der Grund, warum du mir noch nicht gesagt hast, was dein Volk von uns will.«
»Ja.« Sein Eingeständnis beunruhigte sie.
»Sag es mir!«
Schweigen.
»Wenn du irgendeine Ahnung von der menschlichen Fantasie hättest, wüsstest du, dass du genau das Falsche machst«, sagte sie.
»Sobald du diesen Raum mit mir verlassen kannst, werde ich deine Fragen beantworten«, versprach er ihr.
Sie starrte ihn ein paar Sekunden lang an. »Dann lass uns mal anfangen«, meinte sie grimmig. »Entspann dich aus deiner unnatürlichen Position und lass uns sehen, was passiert.«
Jdahya zögerte, dann ließ er seine Tentakel frei fließen. Das groteske Meeresschnecken-Aussehen kehrte zurück, und Lilith stolperte unwillkürlich voll Panik und Ekel vor ihm zurück. Sie fing sich schon nach wenigen Schritten.
»Gott, ich bin es so leid«, murmelte sie. »Warum kann ich nicht damit aufhören?«
»Als die Ärztin das erste Mal in unseren Haushalt kam«, sagte er, »fanden einige von meiner Familie sie so beunruhigend, dass sie für eine Weile von zu Hause weggingen. Ein solches Verhalten war beispiellos unter uns.«
»Bist du auch weggegangen?«
Er wurde flüchtig wieder glatt. »Ich war damals noch nicht geboren. Als ich geboren wurde, waren alle meine Verwandten schon wieder nach Hause zurückgekehrt. Und ich glaube, ihre Angst war stärker als deine jetzt. Sie hatten noch nie so viel Leben oder so viel Tod in einem einzigen Lebewesen gesehen. Es schmerzte einige von ihnen, sie zu berühren.«
»Du meinst … weil sie krank war?«
»Auch als sie gesund war. Es war ihre genetische Struktur, die meine Verwandten beunruhigte. Ich kann dir das nicht erklären. Du wirst es nie so empfinden wie wir.« Er trat auf sie zu und griff nach ihrer Hand. Lilith reichte sie ihm fast automatisch und zögerte nur kurz, als alle seine Tentakel auf sie zuströmten. Sie blickte weg und blieb steif stehen, wo sie war, ihre Hand lose in seinen vielen Fingern.
»Gut«, sagte Jdahya und ließ sie wieder los. »Dieser Raum wird bald nur noch eine Erinnerung für dich sein.«
4
Elf Mahlzeiten später führte Jdahya Lilith nach draußen.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie drinnen war, ob sie diese elf Mahlzeiten wünschte, die sie dann verzehrte. Jdahya wollte es ihr nicht sagen, und er ließ sich auch nicht antreiben. Er zeigte weder Ungeduld noch Ärger, als Lilith ihn drängte, sie hinauszuführen. Er verstummte einfach. Es schien fast, als ob er sich abschalten würde, wenn sie Forderungen stellte oder Dinge fragte, die er nicht beantworten wollte. Ihre Familie hatte sie eigensinnig genannt während ihres Lebens vor dem Krieg, doch Jdahya war mehr als eigensinnig.
Schließlich begann er, im Raum umherzugehen. Er hatte so lange unbeweglich verharrt – hatte fast wie ein Teil der Einrichtung gewirkt –, dass Lilith erschrocken war, als er plötzlich aufstand und ins Bad ging. Sie blieb auf dem Bett und fragte sich, ob er ein Bad zu den gleichen Zwecken benutzte wie sie. Sie versuchte nicht, es herauszufinden. Als er einige Zeit später in den Raum zurückkam, fand sie sich viel weniger durch ihn beunruhigt. Er brachte ihr etwas, das sie so überraschte und entzückte, dass sie es aus seiner Hand nahm, ohne nachzudenken oder zu zögern: eine Banane, reif, groß, gelb, fest, sehr süß.
Lilith verzehrte die Banane langsam, obwohl sie sie am liebsten hinuntergeschlungen hätte; aber sie wagte es nicht. Es war buchstäblich das Beste, was sie seit zweihundertfünfzig Jahren gegessen hatte. Wer wusste, wann es wieder eine geben würde – wenn überhaupt? Sie aß sogar die weiße Innenhaut.
Jdahya wollte ihr nicht sagen, woher die Banane stammte oder wie er an sie gekommen war. Er wollte ihr auch keine zweite holen. Stattdessen vertrieb er Lilith für eine Weile vom Bett und streckte sich flach darauf aus. Er sah wie tot aus, wie er dort so regungslos lag. Lilith machte eine Reihe von Gymnastikübungen auf dem Boden, wobei sie sich bewusst so sehr ermüdete, wie sie konnte, dann nahm sie seinen Platz auf dem Podest ein, bis er aufstand und ihr das Bett überließ.
Als sie erwachte, zog er seine Jacke aus und ließ sie die Büschel von Sinnestentakeln sehen, die überall auf seinem Körper waren. Zu ihrer Überraschung gewöhnte sie sich schnell an sie. Sie waren bloß hässlich. Und sie ließen ihn noch mehr wie ein deplatziertes Meereswesen aussehen.
»Kannst du unter Wasser atmen?«, fragte sie ihn.
»Ja.«
»Ich dachte mir, dass deine Kehlöffnungen aussehen, als wenn sie auch als Kiemen dienen könnten. Fühlst du dich unter Wasser wohler?«
»Es gefällt mir, aber nicht mehr, als mir Luft gefällt.«
»Luft … Sauerstoff?«
»Ich brauche Sauerstoff, ja, wenn auch nicht so sehr wie du.«
Ihre Gedanken wanderten zurück zu seinen Tentakeln und einer anderen möglichen Ähnlichkeit mit einigen Meeresschnecken. »Kannst du mit irgendeinem deiner Tentakel stechen?«
»Mit allen.«
Lilith wich zurück, obwohl sie nicht in seiner Nähe war. »Warum hast du mir das nicht gesagt?«
»Ich hätte dich nicht gestochen.«
Es sei denn, sie hätte ihn angegriffen. »Also das ist mit den Menschen passiert, die versucht haben, dich zu töten.«
»Nein, Lilith. Ich bin nicht daran interessiert, deine Leute zu töten. Ich bin mein ganzes Leben ausgebildet worden, sie am Leben zu erhalten.«
»Was hast du dann mit ihnen gemacht?«
»Sie aufgehalten. Ich bin stärker, als du vermutlich denkst.«
»Aber … wenn du sie gestochen hättest?«
»Dann wären sie gestorben. Nur Ooloi können stechen, ohne zu töten. Einige meiner fernen Vorfahren überwältigten ihre Beute, indem sie sie stachen. Ihr Stich setzte den Verdauungsprozess in Gang, noch bevor sie zu fressen begannen. Und sie stachen Feinde, die versuchten, sie zu fressen. Keine angenehme Existenz.«
»So schlecht klingt es auch wieder nicht.«
»Sie haben nicht lange gelebt, jene Vorfahren. Einige Dinge waren immun gegen ihr Gift.«
»Vielleicht sind Menschen es auch.«
»Nein, Lilith, das seid ihr nicht«, antwortete er leise.
Einige Zeit später brachte er ihr eine Orange. Aus Neugier schälte Lilith die Frucht und bot ihm an, sie mit ihm zu teilen. Jdahya nahm ein Stück aus ihrer Hand an und setzte sich neben sie hin, um es zu essen. Als sie beide fertig waren, wandte er ihr das Gesicht zu – eine Geste der Höflichkeit, wurde ihr klar, da er so wenig Gesicht hatte – und schien sie prüfend zu betrachten. Einige seiner Tentakel berührten sie sogar, und sie zuckte zusammen. Dann begriff sie, dass er ihr nicht wehtat, und hielt still. Sie mochte Jdahyas Nähe nicht, aber es machte ihr keine Angst mehr. Nach … wie viele Tage auch immer es gewesen waren, empfand sie nichts von der alten Panik; nur Erleichterung darüber, dass es ihr irgendwie endlich gelungen war, sie abzuschütteln.
»Wir werden jetzt hinausgehen«, sagte er. »Meine Familie wird erleichtert sein, uns zu sehen. Und du – du hast sehr viel zu lernen.«
5
Lilith ließ Jdahya warten, bis sie sich den Orangensaft von den Händen abgewaschen hatte. Dann ging er zu einer der Wände hinüber und berührte sie mit einigen seiner längeren Kopftentakel.
Eine dunkle Stelle erschien dort, wo er die Wand berührt hatte. Sie wurde zu einer tiefer und breiter werdenden Einbuchtung, dann zu einem Loch, durch das Lilith Farbe und Licht sehen konnte – Grün, Rot, Orange, Gelb …
Es hatte seit ihrer Gefangennahme wenig Farbe in ihrer Welt gegeben. Ihre eigene Haut, ihr Blut – innerhalb der hellen Wände ihres Gefängnisses, das war alles. Alles andere war irgendein Weiß- oder Grauton. Selbst ihr Essen war bis zu der Banane farblos gewesen. Jetzt gab es Farbe hier, und etwas wie Sonnenlicht. Es gab Raum. Weiten Raum.
Das Loch in der Wand vergrößerte sich, als ob es Fleisch wäre, das sich langsam zuckend beiseitekräuselte. Lilith war fasziniert und angewidert zugleich.
»Ist es lebendig?«, fragte sie.
»Ja.«
Sie hatte es geschlagen, getreten, gekratzt, versucht hineinzubeißen. Es war glatt, hart, undurchdringlich gewesen, doch leicht nachgebend wie das Bett und der Tisch. Es hatte sich wie Plastik angefühlt, kühl unter ihren Händen.
»Was ist es?«, wollte sie wissen.
»Fleisch. Mehr wie meins als wie deins. Aber auch anders als meins. Es ist … das Schiff.«
»Das ist doch nicht dein Ernst! Dein Schiff ist lebendig?«
»Ja. Komm heraus!« Das Loch in der Wand war groß genug geworden, dass sie hindurchsteigen konnten. Jdahya zog den Kopf ein und trat hinaus. Lilith machte sich daran, ihm zu folgen, dann hielt sie inne. Es war so viel Raum dort draußen. Die Farben, die sie gesehen hatte, waren dünne, haarähnliche Blätter und runde, kokosnussgroße Früchte, augenscheinlich in verschiedenen Entwicklungsstufen. Alles hing an großen Ästen, die den neuen Ausgang überschatteten. Hinter ihnen war ein weites, offenes Feld mit vereinzelten Bäumen – unglaublich große Bäume –, fernen Hügeln und einem strahlenden, sonnenlosen Elfenbeinhimmel. Die Bäume und der Himmel waren fremd genug, dass Lilith nicht auf die Idee kam, auf der Erde zu sein. In der Ferne gingen Leute umher, und sie sah schwarze, schäferhundgroße Tiere, die zu weit weg waren, um sie klar zu erkennen – obwohl sie selbst auf diese Entfernung zu viele Beine zu haben schienen. Sechs? Zehn? Die Tiere schienen zu grasen.
»Lilith, komm heraus!«, wiederholte Jdahya.
Sie trat einen Schritt zurück, weg von all der fremden Weite. Der Isolationsraum, den sie so lange gehasst hatte, schien plötzlich sicher und tröstlich.
»Zurück in deinen Käfig, Lilith?«, fragte Jdahya leise.
Sie starrte ihn durch das Loch an und begriff augenblicklich, dass er versuchte, sie zu provozieren, sie dazu zu bringen, ihre Angst zu überwinden. Es hätte nicht funktioniert, wenn er nicht so recht gehabt hätte. Sie zog sich in ihren Käfig zurück – wie ein Zootier, das so lange eingesperrt gewesen war, dass der Käfig sein Zuhause geworden ist.
Sie zwang sich, an die Öffnung heranzutreten und dann, mit zusammengebissenen Zähnen, hindurchzusteigen.
Draußen blieb sie neben Jdahya stehen und holte tief und bebend Luft. Sie blickte zurück auf den Raum, dann drehte sie sich hastig wieder um und widerstand dem Impuls, sich in ihn zurückzuflüchten. Jdahya ergriff ihre Hand und führte sie fort.
Als sie sich ein zweites Mal umschaute, war das Loch im Begriff, sich zu schließen, und sie konnte sehen, dass das, woraus sie gekommen war, in Wirklichkeit ein gewaltiger Baum war. Ihr Raum konnte nicht mehr als einen winzigen Bruchteil seines Inneren eingenommen haben. Der Baum wuchs aus einem, wie es schien, gewöhnlichen, hellbraunen Sandboden. Seine unteren Äste hingen dicht voll Früchte. Der Rest des Baums sah fast normal aus, bis auf seine Größe. Der Stamm war im Umfang gewaltiger als manche Bürogebäude, an die Lilith sich erinnerte. Und er schien den elfenbeinfarbenen Himmel zu berühren. Wie hoch mochte er sein? Wie viel davon diente als Gebäude?
»War alles in diesem Raum lebendig?«, fragte sie.
»Alles bis auf einige der sichtbaren Armaturen«, antwortete Jdahya. »Sogar das, was du gegessen hast, wurde aus der Frucht eines der Äste produziert, der draußen wächst. Es war so angelegt, dass es deinen Ernährungsbedürfnissen entsprach.«
»Und wie Kleister schmeckte«, murmelte sie. »Ich hoffe, ich werde nicht noch mehr von dem Zeug essen müssen.«
»Nein. Aber es hat dich sehr gesund gehalten. Speziell deine Diät ermunterte deinen Körper, keine Karzinome zu entwickeln, während deine genetische Anlage, sie zu entwickeln, korrigiert wurde.«
»Sie ist also korrigiert worden?«
»Ja. In deine Zellen sind korrigierende Gene eingefügt worden, und deine Zellen haben sie angenommen und reproduziert. Jetzt wirst du nicht mehr aus Versehen Karzinome wachsen lassen.«
Das war ein eigenartiger Ausdruck, dachte Lilith, doch sie überging es für den Augenblick. »Wann werdet ihr mich zur Erde zurückschicken?«, wollte sie wissen.
»Du könntest jetzt dort nicht überleben – vor allem nicht allein.«
»Ihr habt noch keinen von uns zurückgeschickt?«
»Deine Gruppe wird die erste sein.«
»Oh.« Daran hatte sie nicht gedacht – dass sie und andere wie sie Versuchskaninchen auf einer Erde sein würden, die sich sehr verändert haben musste. »Wie ist es jetzt dort?«
»Wild. Wälder, Berge, Wüsten, Ebenen, große Ozeane. Es ist eine üppige Welt und in den meisten Teilen frei von Strahlung. Die größte Vielfalt an Tierleben findet man in den Meeren, aber es gedeihen auch auf dem Land bereits wieder eine Reihe von kleinen Tieren: Insekten, Würmer, Amphibien, Reptilien, kleine Säugetiere. Dein Volk kann zweifellos dort leben.«
»Wann?«
»Wir wollen nichts überstürzen. Du hast ein sehr langes Leben vor dir, Lilith. Und es wartet hier Arbeit auf dich.«
»So was sagtest du schon mal. Was für Arbeit?«
»Du wirst eine Weile bei meiner Familie leben – als eine von uns, so gut es möglich ist. Wir werden dir deine Arbeit zeigen.«
»Aber was für Arbeit?«
»Du wirst eine kleine Gruppe von Menschen aufwecken, alle Englisch sprechend, und ihnen helfen, den Umgang mit uns zu lernen. Du wirst ihnen die Überlebenskenntnisse beibringen, die wir dir beibringen. Deine Leute werden alle aus sogenannten zivilisierten Gesellschaften sein. Jetzt werden sie lernen müssen, in Wäldern zu leben, sich ihre eigenen Unterkünfte zu errichten und ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen, alles ohne Maschinen oder Hilfe von außen.«
»Werdet ihr uns Maschinen verbieten?«, fragte sie unsicher.
»Natürlich nicht. Aber wir werden euch auch keine geben. Ihr bekommt von uns Handwerkszeuge, einfache Ausrüstung und Nahrungsmittel, bis ihr anfangt, die Dinge selbst herzustellen, die ihr braucht, und eure eigenen Felder zu bestellen. Gegen die tödlicheren Mikroorganismen haben wir euch schon geschützt. Darüber hinaus werdet ihr euch allein durchs Leben schlagen müssen – giftige Pflanzen und Tiere meiden und schaffen, was ihr braucht.«
»Wie könnt ihr uns beibringen, wie man auf unserer eigenen Welt überlebt? Wie könnt ihr genug über unsere Welt oder über uns wissen?«
»Wieso nicht? Wir haben eurer Welt geholfen, sich selbst wiederherzustellen. Wir haben eure Körper studiert, eure Denkweise, eure Literatur, eure Geschichte, eure vielen Kulturen … Wir wissen besser, wozu ihr fähig seid, als ihr selbst.«
Oder sie dachten, sie wüssten es. Wenn sie wirklich zweihundertfünfzig Jahre Zeit zum Studieren gehabt hatten, vielleicht hatten sie recht. »Ihr habt uns gegen Krankheiten geimpft?«, fragte sie, um sicher zu sein, dass sie verstanden hatte.
»Nein.«
»Aber du sagtest doch …«
»Wir haben euer Immunsystem gestärkt und eure Widerstandskraft gegen Krankheiten allgemein verbessert.«
»Wie? Indem ihr was mit unseren Genen gemacht habt?«