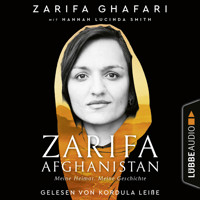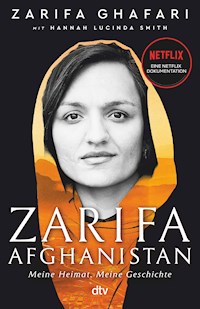
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die weibliche Stimme Afghanistans Zarifa Ghafari ist die weibliche Stimme Afghanistans. Mit 24 Jahren zur jüngsten Bürgermeisterin des Landes ernannt, versuchen Taliban, sie gewaltsam von der Ausübung ihres Amtes abzuhalten. Trotz der Anschläge setzt sie sich unermüdlich gegen Korruption, für Frieden und Frauenrechte ein. Als Vergeltung wird ihr Vater ermordet. Nach dem Einmarsch der Taliban 2021 muss Ghafari fliehen. Doch ihr Kampf geht weiter. Eindringlich schreibt sie über ihr Leben und ihr Engagement. Sie erzählt über das Schicksal afghanischer Frauen und ihre gemeinsame Vision, das Leben in einem Land voll religiösem Fanatismus zu verändern. Ihr Bericht ist Zeugnis und Appell zugleich, Afghanistan nicht zu vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zarifa Ghafari
Zarifa – Afghanistan
Meine Heimat. Meine Geschichte
Aus dem Englischen von Christiane Bernhardt, Sylvia Bieker und Henriette Zeltner-Shane
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Den mutigen Frauen Afghanistans, die sich gegen Brutalität und Extremismus für Freiheit und Menschlichkeit einsetzen.
Prolog
Februar 2022
Changa, Provinz Wardak
Die Männer wollten alles über Deutschland wissen. Nachdem die Jugendlichen die Platten mit Reis und Fleisch und die halb leer gegessenen Schälchen mit Milchpudding abgeräumt und die orangefarbene Kunststoffmatte auf dem Boden zusammengefaltet hatten, auf der sich die verschütteten Körnchen und Zuckerpapierchen gesammelt hatten, hefteten die Dorfältesten ihre Augen auf mich. Sie nippten an ihrem Tee und lauschten in gebannter Stille. Ich atmete tief durch, richtete mein Kopftuch und begann damit, ihnen vom Führerschein zu erzählen.
»Man muss stundenlang Fahrunterricht nehmen!«, sagte ich. »Und dann muss man eine Prüfung ablegen.«
Sie tauschten erstaunte Blicke. Keiner von ihnen war je aufgefordert worden, seine Fahrtauglichkeit beurteilen zu lassen, bevor er sich ans Steuer setzen durfte. Ich legte noch einen drauf.
»Und wenn man die Regeln zu oft bricht, nehmen sie einem den Führerschein weg!«
Jetzt waren sie wirklich schockiert. Deutschland war doch das Land der Freiheit, oder etwa nicht? Was also hatte es damit auf sich, dass einem Mann sein Recht zu fahren verweigert wurde? Zu den richtig harten Brocken war ich noch nicht einmal vorgedrungen – der unerhörte Preis für Kartoffeln im Supermarkt, das Geld, das man an den Staat abführen musste, bevor man seinen Gehaltsscheck auch nur zu Gesicht bekam. Ich wusste, dass dies ungeheuerliche Neuigkeiten für sie wären und sie mir nicht wirklich glauben würden. Hier in Changa, einem abgelegenen Provinznest keine hundert Kilometer, aber eine achtstündige Autofahrt auf unbefestigten Straßen durch die Berge von Kabul entfernt, war man überzeugt, dass alle, die es nach Europa geschafft hatten, dort ein Leben in großem Luxus führten. Und hier war ich, die Gesandte aus dem gelobten Land, eine junge afghanische Frau, die ihnen nicht weniger erzählte, als dass sie vollkommen falschlagen.
Den Männern konnte ich das kaum zum Vorwurf machen: Viel mehr als ihre Hoffnung hatten sie nicht. Changa bestand aus einer Reihe sandfarbener Lehmhütten, es gab weder fließend Wasser noch Strom. Wollte man Handyempfang, musste man weiter hoch in die Berge. Um auf die Toilette zu gehen, begab man sich zu einer Hütte am Berghang. Die Schule, eine islamische Madrassa, bestand aus einem einzelnen Raum für die Jungen, in dem neben großen Stapeln Gebetsmatten, Koranbücher und andere religiöse Schriften entlang der Wand aufgereiht waren, sowie einem den Elementen ausgesetzten Klassenzimmer im Hof. Dort saßen die Mädchen für ihren Unterricht im Schneidersitz am Boden, auch wenn der schmelzende Schnee die hartgestampfte Erde im Februar in Schlamm verwandelte. Ich hätte dort noch nicht einmal ein Tier gehalten.
Den Männern verhieß die Ankunft des Frühlings ein paar angenehme Monate, in denen selbst die, die glaubten, Deutschland sei das Land der Audis für alle, stolz behaupteten, lieber in ihrem Dorf zu bleiben. Im Frühling verschwindet der Schnee von den zerklüfteten Bergen, enthüllt eine Schicht saftiges Gras und bringt an den kahlen Ästen der Apfelbäume junge Blätter zum Vorschein. Mit jedem Tag geht die Sonne früher auf und wärmt die Erde bis in tiefere Schichten; innerhalb weniger Wochen blüht die Natur auf zu einem duftenden Baldachin. Die Männer waten in weiten Shorts und T-Shirts im Fluss am Fuß des Tals, bespritzen sich gegenseitig mit Wasser und johlen vor Freude. Die Frauen sind nicht dabei. Fast alle in Changa, die älter als vierzehn sind, sind verheiratet. Ihnen bleibt kaum Zeit für Vergnügungen.
Einen Großteil der öffentlichen Einrichtungen, darunter die Schule, hatten die Taliban errichtet. In den zwanzig Jahren, die internationale Hilfsorganisationen und NATO-Truppen in Afghanistan verbracht hatten, hat kaum ein Cent der Milliardensummen, die in das Land gesteckt wurden, Dörfer wie dieses erreicht. Vielleicht hätten sie noch nicht einmal mitbekommen, dass das Regime in Kabul 2001 ausgewechselt worden war, hätte es nicht kurz darauf Luftschläge und nächtliche Hausdurchsuchungen gegeben. Das letzte Mal zuvor, dass Fremde nach Changa gekommen waren, war in den 1980er-Jahren gewesen, als zwei französische Ärzte hereingeschneit waren – mal abgesehen von den Amerikanern, die mit ihren Fallschirmen und ihrer Robocop-Ausrüstung aus dem Himmel fielen. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, die Straßen zu befestigen, Finanzmittel bereitzustellen oder ein Abwassernetz zu bauen. Die Skelette der russischen Panzer blieben am Straßenrand liegen, rostende Metallhaufen, die nach dreißig Jahren das gleiche Ocker angenommen hatten wie die Erde. Eine schwedische Hilfsorganisation hatte in der ehemaligen Schule eine notdürftige Geburtsklinik eingerichtet und Frauen vor Ort zu Hebammen ausgebildet, um bei unkomplizierten Geburten helfen zu können. Davon abgesehen hatte für alles hier der Parallelstaat der Taliban gesorgt, von der Bildung über die Sicherheit bis zum Rechtssystem der Scharia. Eines der größten Gebäude der Gegend, das früher dem Gouverneur von Wardak gehört hatte, war inzwischen das Gefängnis der militanten Kämpfer. Aus diesen Gründen, aber auch zu ihrem persönlichen Schutz, unterstützten alle im Dorf die Taliban.
Die neugierigen alten Männer Changas, die Väter und Unterstützer dieser Talib-Jungs, sahen wie die fleischgewordene National-Geographic-Klischeevorstellung von Afghanistan aus. Ihre Turbane, aufwändig aus makellosen Stoffen gerollt, ließen ihren Kopfumfang um die Hälfte größer erscheinen. Sie trugen lange wollene Schals in erdigen Farben, die sie elegant um ihre Schultern und Hälse geschlungen hatten. Draußen, im eisigen Wind der Berge, zogen sie sie über den Kopf und wickelten sie wie eine Maske über Mund und Nase und unter das Kinn, sodass nur ihre eulenhaft bernsteinfarbenen Augen hervorblitzten. Einige Jugendliche taten es ihnen gleich, fügten aber für einen dramatischeren Effekt einen Lidstrich mit Khol hinzu. Sie waren zusammengekommen, um mich zu begrüßen, und luden mich ein, im schönsten Raum ihres Hauses zu essen, der mit dem einzigen Gasofen der Familie geheizt wurde. Wir saßen alle bequem auf dicken roten Polsterkissen, die an den Wänden des Raums ausgelegt waren. Die Frauen hielten sich in einem kälteren Winkel des Hauses auf und warteten, bis sie an der Reihe waren, die Mahlzeiten zu sich zu nehmen, die sie für uns zubereitet hatten.
Für einen außenstehenden Beobachter mochte es aussehen, als hätte sich in Changa seit Hunderten von Jahren nichts verändert, als wäre dieser Ort vom Aufbruch der Welt in die Moderne unberührt geblieben. Doch ein kleines Detail verriet die Wahrheit. Hoch oben an der türkis gestrichenen Wand, mit pinken und gelben Girlanden geschmückt, hing die Fotografie eines jungen Mannes mit dünnem Schnurrbart und Seitenscheitel. Der Abzug war offensichtlich Jahrzehnte alt und von einem professionellen Fotografen gemacht worden, und Mohammed Dschan, der Mann, der auf seine Turban tragenden Nachfahren hinabstarrte, trug Anzug und Krawatte. Anfang der 1970er-Jahre, als das Foto aufgenommen wurde, war er ein junger Verkehrspolizist in Kabul gewesen, der Changa hinter sich gelassen hatte, um ein neues Leben in der Hauptstadt zu beginnen. In Kabul fühlte er sich von der linken Politik und ihrer Verheißung eines progressiven, demokratischen Afghanistans angezogen. Deshalb trat er der Khalq-Fraktion bei, dem sozialistischen Flügel der Demokratischen Volkspartei Afghanistans mit engen Verbindungen nach Russland. Er heiratete, gründete eine Familie und hatte keinen Grund zur Annahme, dass ihre moderne Lebensweise eines Tages ein Ende haben würde.
Im Jahr 1973 jedoch begann sich alles aufzulösen. Zunächst wurde König Mohammed Sahir Schah durch einen von seinem Cousin General Mohammed Daud Khan angeführten Putsch gestürzt, der seinen Verwandten für »korrupt und verweichlicht« erklärte und gelobte, dem Land Demokratie zu bringen. General Khan setzte die Khalq-Partei als Regierung ein und erklärte sich selbst zum Präsidenten. Dies nutzten die Russen und begannen, ihren politischen Einfluss auszuweiten. 1978 verübte eine von Moskau unterstützte kommunistische Partei ihren eigenen Staatstreich, tötete Khan und übernahm die Macht. Geführt wurde die neue Regierung von Nur Mohammed Taraki, einem linken Schriftsteller und Journalisten, der von der Notwendigkeit einer Revolution im Stil der Bolschewiken überzeugt war. Er fing sofort damit an, Privatvermögen einzukassieren und umzuverteilen, und zerschlug die Bourgeoisie, während das Land zugleich in Anarchie versank. Nach nur einem Jahr hatten Flügelkämpfe die neue Regierung gespalten, und im Dezember 1979 überschritt die sowjetische Armee die Grenze. Innerhalb weniger Tage erreichte sie Kabul, setzte ihre eigene Marionettenregierung ein und zettelte damit den zehn Jahre währenden Krieg zwischen der Sowjetunion und Afghanistan an, in dessen Widerstand religiöse Männer kämpften, die sich selbst als die Mudschahedin bezeichneten, Heilige Krieger, denen der gottlose Kommunismus ein Gräuel war.
Mohammed Dschan war nicht länger ein Mann des Fortschritts: Gemäß der Mudschahedin war er nun ein Verräter. Zurück in Changa war die Unterstützung für den Widerstand der Mudschahedin uneingeschränkt. Und so entschied sich Mohammed wie Millionen anderer Afghanen für den Selbsterhalt. Er legte Anzug und Krawatte im westlichen Stil ab, zog mit seiner Familie zurück in sein Dorf, begann als Lastwagenfahrer zu arbeiten und unterstützte fortan die Mudschahedin-Gruppierung von Gulbuddin Hekmatyar, einem brutalen Warlord und islamistischen Fanatiker.
Im Lauf der vier Jahrzehnte nach der Rückkehr Mohammeds nach Changa wechselte das Regime in Afghanistan drei Mal, von sowjetischen Marionetten zur Taliban-Theokratie, zu einer international unterstützten Regierung und schließlich zurück zu den Taliban. In Dörfern wie diesem waren die Unruhen in Kabul jedoch kaum von Bedeutung. Man hatte die Mudschahedin unterstützt, dann, als sie sich als stärkstes Lager erwiesen, die Taliban. Im Jahr 2001, als die Taliban aus Kabul und den anderen Städten verdrängt wurden, zogen sich ihre Kämpfer aufs Land zurück – in Orte wie Changa – und regierten in Form eines Parallelstaats weiter. Im August 2021 wurde der Parallelstaat der Taliban dann einmal mehr Afghanistans eigentlicher Staat.
Die Männer in dem Raum, einige davon waren Söhne von Mohammed Dschan, andere seine Brüder, waren im Großen und Ganzen froh darüber, dass die Taliban wieder das Sagen hatten. Die vorherige Regierung unter Präsident Aschraf Ghani war bis ins Mark korrupt gewesen und hatte einen großen Teil der internationalen Gelder eingestrichen, die das Leben der Afghanen hätten verbessern sollen. Jetzt mussten sich die Dorfbewohner nicht mehr vor nächtlichen Hausdurchsuchungen fürchten und vor fremden Soldaten, die in Anwesenheit ihrer Ehefrauen und Töchter mit ihren schmutzigen Stiefeln ihre Häuser stürmten. Sie hofften, die neue Taliban-Regierung würde jetzt vielleicht etwas Geld in Changa investieren.
Doch in einem Land der Widersprüche war dieses Foto an der Wand noch der geringste – der angesehenste Mann der Familie, festgehalten für die Ewigkeit in seinem schicken westlichen Anzug, den Blick voller Hoffnung auf ein Afghanistan gerichtet, in dem Frauen und Männer gleichgestellt wären.
***
Mein Name ist Zarifa Ghafari. Ich bin Afghanin, geboren 1994 zur Zeit des Bürgerkriegs, aufgewachsen während des ersten Taliban-Regimes. Erwachsen wurde ich nach der auf 2001 folgenden Zäsur, als eine vermeintlich demokratische Regierung von westlichen Armeen, Hilfsorganisationen und Milliarden von Dollar gestützt wurde. Ich wurde als erste Frau Bürgermeisterin der Provinz Wardak, die zum Herzland der Taliban westlich von Kabul gehört. In dieser Funktion wurde ich zu einer der bekanntesten Frauen des Landes und erklärten Gegnerin der Taliban. Drei Mal versuchten militante Islamisten deshalb, mich zu ermorden, und als sie damit scheiterten, töteten sie meinen Vater. Als Afghanistan im August 2021 erneut in die Hände der Taliban fiel, war ich gezwungen zu fliehen. Mit einem der chaotischen Evakuierungsflüge vom Kabuler Flughafen brach ich in ein neues Leben auf, als Geflüchtete in Deutschland.
Sechs Monate danach traf ich eine Entscheidung, die mich in den Augen einiger meiner Landsleute zur Heldin machte und für andere zu einer Apologetin: Ich kehrte nach Afghanistan zurück, entschlossen, den Taliban in die Augen zu schauen. Manche fragten mich, wie das geschah und warum. Im Grunde war es einfach: Ich bin trotz allem noch immer afghanische Staatsbürgerin. Ich kehrte, wie jeder andere auch, an Bord eines Flugzeugs zurück. Physisch und emotional allerdings war es schwierig. In den Monaten nach ihrer Machtübernahme hatten die Taliban mehrere Aktivistinnen verhaftet und eine Vielzahl an neuen Vorschriften erlassen, die die Freiheit von Frauen beschneiden. Ich befürchtete, sofort festgenommen zu werden, wenn ich meinen Pass bei der Einreise vorzeigte, oder dass mich ein aufgestachelter junger Talib an einem der Checkpoints erkennen würde und seinen Zorn nicht zügeln könnte.
Um meine Sicherheit zu gewährleisten, garantierte mir die deutsche Regierung ihren Rückhalt, und ich erhielt eine Zusage der Taliban-Führung, dass mir nichts zustoßen würde, solange ich in Afghanistan war. Dafür wurde ich von anderen afghanischen Aktivisten beschuldigt, das neue Regime zu verharmlosen. Aber ich ging weder aus politischen Gründen noch ließ ich mich auf Gespräche oder Verhandlungen mit den Taliban ein. Ich wollte das humanitäre Projekt in Kabul besuchen, das ich kurz nach meinem Exil von Deutschland aus aufgebaut hatte, und die Frauen, die noch in Afghanistan waren, meiner Solidarität versichern. Was ich in meinem Land vorfand, in das ich, wie ich befürchtet hatte, nie wieder würde zurückkehren können, war weit komplizierter als die simplen Schwarz-Weiß-Narrative, die ihm übergestülpt werden.
Als ich von Mai 2018 bis Juni 2021 Bürgermeisterin von Wardak war, hätte ich niemals nach Changa reisen können, obwohl es, auf dem Papier, in meine Zuständigkeit fiel. Das Gebiet der Taliban begann nur gut eineinhalb Kilometer von meinem Büro in der Provinzhauptstadt Maidan Schar entfernt, und selbst wenn ich einem Hinterhalt auf der Straße entkommen wäre, hätten sie mich gewiss im Dorf verhaftet. Während meiner Amtszeit musste ich dabei zusehen, wie die Taliban die staatliche Kontrolle über Wardak aushöhlten, bis die Kämpfe sich schließlich in die Stadt selbst verlagerten und ich gezwungen war, den Amtssitz nach Kabul zu verlegen. Doch jetzt, da das gesamte Land in die Hände der Taliban gefallen war, konnte ich mich frei bewegen und wurde von den Dorfältesten willkommen geheißen. An einem kühlen Morgen, der erste Sonnenschein des Frühlings schmolz den Schnee von den Bergspitzen, verteilte ich Hilfspakete und sprach mit den Dorfbewohnern über ihre wirtschaftlichen Probleme. Die Dorfältesten luden mich zu einem Empfang in den Versammlungsraum Changas ein – zum ersten Mal saßen sie mit einer Frau zusammen und diskutierten über Lokalpolitik. In dem kleinen Raum unter der weißen, an die Wand gepinnten Flagge der Taliban zusammengedrängt erklärten sie mir, warum sie froh waren, dass die alte Regierung weg war.
»Jetzt ist kein Krieg mehr, kein Blutvergießen«, sagte einer, dessen Turban weiß wie Schnee glänzte.
»Die Hilfen gingen bislang an Menschen, die mit den Warlords und Mächtigen zusammenarbeiteten. Immerhin kommt jetzt ein Teil davon bei denen an, die sie wirklich brauchen.«
Eine halbe Stunde lang unterhielt ich mich mit den Männern, die nur wenige Monate zuvor meinen Tod bejubelt hätten. Ich fühlte weder Kränkung noch Wut. Die Gründe dafür sind schwer zu erklären. Die Attentatsversuche, die in meiner Zeit als Bürgermeisterin auf mich verübt wurden, galten nicht meiner Person. Sie richteten sich gegen das, was ich für sie repräsentierte: eine korrupte Regierung, die nichts für die Menschen Afghanistans getan hatte, und eine Spielart der Frauenbewegung, die in Dörfern wie Changa als etwas vom Ausland Auferlegtes betrachtet wird. Für die Taliban wäre meine Ermordung ein Triumph gewesen, damit hätten sie der Regierung in Kabul gezeigt, dass sie an Orten wie Wardak noch immer das Sagen hatten. Doch jetzt, da die Taliban gesiegt hatten, gab es für sie keinen Grund mehr, mich zu töten. Im Gegenteil, ihnen war besser gedient, wenn sie mich beschützten. Verzweifelt um internationale Anerkennung und die damit einhergehende finanzielle Unterstützung bemüht, befanden sich die Taliban im Februar 2022 inmitten einer PR-Kampagne, um die Welt glauben zu machen, dass sie eine ganz andere Truppe wären als die, die in den 1990er-Jahren in Afghanistan geherrscht, Fernsehen und Musik verboten und Frauen zu laufenden Schatten in blauen Burkas degradiert hatte.
Die meiste Zeit meines Treffens mit den Dorfältesten hatte ich das Wort. Die Männer, die der Meinung ihrer Frauen, Schwestern oder Töchter größtenteils niemals Beachtung schenkten, lauschten mir in gebannter Stille. In der Öffentlichkeit zu sprechen fiel mir schon immer leicht: Selbst wenn ich todmüde bin, kann ich für einen Interviewpartner oder ein Publikum einen Schalter umlegen. Diese Fähigkeit begann ich als Mädchen zu trainieren, als ich ihre Wirksamkeit begriff; sie war mir auf glanzvollen Konferenzen mit führenden Politikern der Welt ebenso nützlich wie bei Terminen mit ungebildeten afghanischen Männern in bescheidenen Lehmhütten.
»Ich bitte nicht darum, ich fordere euch dazu auf, eure Töchter zur Schule gehen zu lassen. Wenn die Schule hier als Highschool wiederaufgebaut wird, müsst ihr ihnen erlauben, sie bis zur zwölften Klasse zu besuchen«, sagte ich.
»Wenn ihr euch aus diesem Elend befreien wollt, dann sorgt für die Bildung eurer Kinder, vor allem für die eurer Töchter. Wenn ihr in euren Sohn investiert, wird er euch Geld bringen. Aber wenn ihr in die Bildung eurer Tochter investiert, wird sie für die Bildung ihrer Kinder sorgen und dann für die ihrer Enkel. Wenn ihr eine Frau bildet, rettet ihr damit zehn Generationen.«
Die Männer – Analphabeten, aber weise – nickten bedächtig und dankten mir am Ende überschwänglich für meinen Besuch. Einer nach dem anderen schüttelten sie meine Hand und verließen den Raum. Sie alle hofften, ich könnte etwas in Changa verändern, sie freuten sich, dass eine Politikerin, selbst eine ehemalige, die beschwerliche Reise zu ihrem Dorf auf sich genommen hatte. Sie waren alle beeindruckt von mir und von dem Weg, für den ich mich entschieden hatte. Dennoch, egal, welchen von ihnen man gefragt hätte, ob er sich wünschte, seine Tochter würde etwas Ähnliches tun, die Antwort wäre immer die gleiche gewesen: Natürlich nicht. Wir sind in Afghanistan.
***
Die Frauen Changas wollten über Kinder reden: vor allem wollten sie erzählen, wie viele jede von ihnen hatte. An einem Ort, an dem es Frauen kaum erlaubt ist, das Haus zu verlassen, an dem nur wenige gebildet sind und selbst die, die Bildung genossen haben, selten über die Grundschule hinausgekommen sind, besteht die einzige Möglichkeit einer Frau, sich Respekt zu verschaffen, in der Anzahl der Kinder, die sie zur Welt bringt. Mahdia wusste ihr Alter nicht, sie konnte es nur raten. Nachdem sie mit dreizehn geheiratet und seitdem jedes Jahr ein Kind geboren hatte – sechzehn der zwanzig Kinder hatten überlebt –, schätzte sie sich auf Mitte dreißig. Sie sah auffallend gut aus mit ihrer glatten dunklen Haut über hohen Wangenknochen und einem Funkeln in ihren jungen Augen, das von dem Rot ihres verzierten Kopftuchs und ihrer traditionellen Tätowierung betont wurde, einem blauen Punkt, der ihre Stirn zierte und der manchen Afghanen dazu dient, den bösen Blick abzuwehren. Sie fühle sich gesegnet, sagte sie zu mir.
»So ist unser Leben nun einmal«, antwortete Mahdia, als ich sie fragte, wie sie sich mit einem solchen Dasein abfinden könne. »Wir haben nie etwas anderes gesehen als das hier. So ist es nun einmal.«
Es brach mir das Herz, diese Worte von meiner Landsfrau zu hören. Ich war nicht aus politischen Gründen hergekommen, nicht um die Werbetrommel für mich zu rühren, sondern um herauszufinden, was es von meinem Land noch zu retten gab, jetzt, da die Taliban wieder an der Macht waren. Mithilfe meiner humanitären Stiftung, der Assistance and Promotion for Afghan Women (Verein zur Unterstützung und Förderung der Frauen Afghanistans), hatte ich ein Schulungszentrum für Frauen und eine Geburtsklinik in Kabul eröffnet. Aber ich wusste, dass ich hier, an Orten wie Changa, die Möglichkeit hatte, echte Veränderungen anzustoßen. Ich wandte mich an die jüngeren, unverheirateten Frauen und bat sie, den Raum zu verlassen. Ich wollte offen mit den Frauen reden, wusste aber auch, dass die älteren es mir nicht danken würden, wenn ich Tabuthemen vor ihren Töchtern zur Sprache brachte. Als wir allein waren, begann ich über ihr Recht und ihre Verantwortung zu sprechen, die Anzahl ihrer Familienmitglieder zu begrenzen.
»Ein, zwei, drei Kinder zu haben ist normal«, sagte ich. »Aber mit jedem Kind, das ihr zur Welt bringt, verliert ihr an Kraft. Vielleicht sogar ein paar Lebensjahre. Und wenn euer Kind eine Tochter ist, wird euer Mann eines Tages nach Hause kommen und verkünden, er habe für sie einen Mann zum Heiraten gefunden. Und wie ihr selbst wird auch sie kein Mitspracherecht dabei haben.«
Wenn das Leben für die Männer Changas hart war, so war es für die Frauen geradezu unerbittlich. Die meisten Männer verbaten es ihren Frauen, zu männlichen Ärzten zu gehen, selbst wenn sie in den Wehen lagen und ihr Leben in Gefahr war. Sogar wenn sie es erlaubten, hätte ein Arzttermin eine stundenlange Fahrt hinten auf einem Motorrad über holprige Bergpfade bedeutet, da nur wenige Menschen ein Auto besaßen. Es gab nur eine Handvoll Frauen im Land, die so gebildet waren, dass sie sich als medizinische Fachkräfte hätten qualifizieren können. Die meisten Babys werden zu Hause geboren, dennoch ist die Geburtenrate in Afghanistan eine der höchsten der Welt, wobei die Männer üblicherweise entscheiden, wie viele Kinder ihre Frauen bekommen sollen. Wie in vielen islamischen Ländern werden Kinder als Zeichen männlicher Potenz betrachtet und sind ihr ganzer Stolz – je mehr Kinder ein Mann zeugen kann, desto besser. Tatsächlich haben Schwangerschaft und Geburt in den letzten vierzig Jahren mehr Frauen und Kindern in Afghanistan das Leben gekostet als Kugeln und Bomben dies je vermochten. Etwa eine von zehn Frauen und eines von zwanzig Kindern sterben bei der Geburt.
Doch in konservativen Gesellschaften kann sich Wandel nur schrittweise, über Generationen hinweg vollziehen.
»Hört zu«, sagte ich zu den Frauen. »Meine Mutter hatte acht Kinder. Aber ich werde nicht mehr als zwei bekommen. Und die werden sich zu dem Thema ihre eigenen Gedanken machen.«
Ich erzählte ihnen, wie schwer es meine Familie hatte, als ich ein Kind war, dass wir abends manchmal nichts zum Kochen hatten als trockenen Reis. Ich erzählte, wie sich die Situation meiner Familie verändert hatte, als meine Mutter wieder arbeiten konnte, wie uns das aus unserem Überlebensmodus befreit hatte und wir uns eine bessere Zukunft vorstellen konnten. Ich erzählte ihnen, wie mein Vater getötet worden war und von den Kämpfen, die wir jetzt als Flüchtlinge durchstanden. Als sie begriffen, dass ich nicht einfach eine reiche Frau war, die eine Ausbildung im Ausland genossen hatte und jetzt zurückkehrte, um den Afghanen zu sagen, wie sie zu leben hatten, begannen sie, mir zu vertrauen. Nach und nach öffneten sich die Frauen und ließen von der Schutzbehauptung ab, sie seien mit allem zufrieden, was ihnen das Leben in Changa bot. Am Ende unserer Unterhaltung rollten Tränen über Mahdias Gesicht.
Am nächsten Morgen, bevor ich mich wieder nach Kabul aufmachte, frühstückte ich mit den Frauen und ihren Töchtern. Wir saßen an den Rändern des Raums, die mir am Abend zuvor so karg und kalt erschienen waren, jetzt standen kleine Teller mit Marmelade, Eiern und Käse am Boden. Die Morgensonne schien durchs Fenster und ließ die schneebedeckten Berge draußen erstrahlen. Es war ein freudiges, redseliges Mahl. Die Frauen wünschten mir alles Gute für meine Ehe und sagten, sie würden dafür beten, dass ich bald wieder nach Changa zurückkehrte.
»Wir sind so stolz auf dich, so glücklich, dass du hier bist«, sagte eine zu mir. »Ich wünsche mir, dass meine Tochter es einmal so weit bringt wie du.«
Selbst wenn ich nur die Meinung dieser einen Frau geändert hatte, hatte sich meine lange Reise nach Changa gelohnt.
Kapitel 1
Würde man meine Mutter, meine Großmutter und mich in einer Reihe aufstellen, alle im Profil, könnte man die Blutsverwandtschaft auf Anhieb erkennen. Wir alle haben die gleiche Adlernase, die unsere Silhouetten dominiert. Viele Frauen in Asien entscheiden sich für eine Schönheitsoperation, um eine solche Nase zu verändern, lassen sie zu einem Stummelchen verkleinern, das von anderen markanten Gesichtsmerkmalen in den Schatten gestellt wird. Ich habe nie verstanden, warum sie sich so etwas antun, dieses Streben nach einer verwestlichten Form von Weiblichkeit. Für mich ist dieser Zug, der mir von meiner Ahnenreihe mütterlicherseits vererbt wurde, ein Zeichen unserer Stärke.
Um zu erklären, wie ich zu einer afghanischen Frau wurde, die sich gegen ihre Gesellschaft zur Wehr setzt, muss ich ganz am Anfang beginnen. Die Tragödie Afghanistans hat meine gesamte Familiengeschichte geprägt. Die Traumata wurden mir über die DNA weitergegeben.
Meine Mutter Karima war drei, als ihr Vater von einer der Mudschahedin-Milizen ermordet wurde, die Afghanistan zerstückelten. Wir schreiben das Jahr 1980, das Jahr, nachdem die Sowjetarmee einmarschiert war und die Mudschahedin bereits entschieden hatten, dass die Ethnie wichtiger war als das Land oder der Glaube. Sie spalteten sich in ethnische Gruppen: Paschtunen, Hazara, Tadschiken, Usbeken. Der größere Teil des afghanischen Flickenteppichs bekämpfte sich gegenseitig, jede Gruppe von einem Mann angeführt, der in den kriegerischen Wirren seine Chance witterte. Gulbuddin Hekmatyar, Anführer der Paschtunen, war einer von denen, die ihre barbarischen Taten im Namen der Religion begingen. Sein erster Handlanger war Zerdad Faryadi, ein Gewaltmensch, der seinen Spitznamen von einem seiner Bodyguards erhielt, dem der Ruf vorauseilte, Kannibalismus zu praktizieren. Der Wächter war als »Der Hund« bekannt und Faryadi als »Der große Hund«. Ihr zentrales Augenmerk lag auf der nach Pakistan führenden Grenze bei Dschalalabad, die zur zentralen Fluchtroute für Tausende von Menschen geworden war, überwiegend Liberale und Intellektuelle, die versuchten, sich vor dem eskalierenden Blutvergießen in Sicherheit zu bringen. Faryadi und sein Hund überwachten den Checkpoint und pressten denen, die gehen wollten, Geld ab.
Allerdings begingen alle ethnischen Gruppierungen Gräueltaten – es gab keine Guten, nur Schlimme und Schlimmere. Anführer der Tadschiken war Ahmed Schah Massud, »der Löwe von Pandschir«, der sieben Sowjetoffensiven in seinen Gebieten im Norden Afghanistans abwehrte und zwei Tage vor den Attentaten auf die Twin Tower 2001 von den Taliban ermordet werden sollte. Später nahmen die Hazara Abdul Ali Mazari gefangen, folterten und töteten ihn und warfen seinen Leichnam aus einem Hubschrauber. Die Usbeken hatten Abdul Raschid Dostum, berühmt-berüchtigt wegen seines aufwändigen Lebensstils, zu dem ein kugelsicherer Cadillac zählte, und seiner Kriegsverbrechen. Die Milizionäre, trunken von ihrer plötzlichen Macht, durchstreiften nachts die Straßen der Dörfer auf der Suche nach Mädchen zum Vergewaltigen. Es gab da ein blutiges Schauermärchen, das man sich in Kundus erzählte, der nördlichen Provinz, in der meine Mutter ihre frühen Lebensjahre verbrachte. Es handelt von einer Frau, die das Pech hatte, zwischen die Fronten zweier sich bekriegender Konfliktparteien zu geraten. Angeblich drangen die Kämpfer in ihr Haus ein, als sie ihren kleinen Sohn stillte, schnitten ihr die Brüste ab und töteten das Baby. Eine bevorzugte Methode der Exekution war der »Raqs Morda« – der Totentanz. Dabei schneiden die Mörder ihren Opfern den Kopf ab, werfen ihn in einen Trog mit kochendem Öl und lachen, wenn der kopflose Körper am Boden zuckt.
Mein Großvater mütterlicherseits, Abdul Rahman Osmani, war der Direktor einer Schule in Kundus. Die Schule, an der Jungen und Mädchen unterrichtet wurden, öffnete ihre Pforten in der kurzen Phase, als die sozialistische Regierung Frauenrechte zu einem ihrer zentralen Anliegen machte. In Kabul besuchten barhäuptige Frauen Seite an Seite mit Männern Kurse an der Universität; einige der Frauen trugen Minirock, wenn sie, die Arme voller Bücher, zum Seminarraum liefen. Doch sie blieben Ausnahmeerscheinungen. Auf den Straßen Kabuls starrten empörte Männer auf sie und ihre unverblümten Emanzipationsversuche, während andere Frauen weiter Burkas trugen. Die Mehrheit der Bevölkerung war nach wie vor zutiefst konservativ, und in den Dörfern gingen Frauen noch immer in Schleier und lange Mäntel gehüllt ihrem Alltag nach. Doch zumindest zeichnete sich der Beginn eines Wandels ab.
Nach der Invasion behielten die von der Sowjetunion unterstützte Regierung und die Armee die Kontrolle über Kabul, die religiösen Ideologen aber herrschten schon bald über die ländlichen Gebiete. Mit ihrem Aufstieg wurden alle noch so kleinen, für die Frauen erzielten Errungenschaften wieder zunichtegemacht. Nach Ansicht der Mudschahedin war es eine Sünde, Mädchen zu unterrichten – das allein war das Verbrechen meines Großvaters. Jahrelang hatte er seine schöne Stimme dem Gebetsruf geliehen, der fünf Mal täglich aus der örtlichen Moschee erklang. Dennoch, die Warlords, die sogenannten heiligen Krieger, verfolgten ihn. Tadschikische Milizionäre nahmen ihn fest und hielten ihn in Schir Chan Bandar gefangen, in einem feuchtkalten Gefängnis am Pandsch, der die Grenze zwischen Afghanistan und Tadschikistan markiert. Nach vierzig Tagen führten sie ihn in die Berge des Distrikts Khwaja Ghar, wo sie ihn mit Seilen an einen anderen Gefangenen fesselten und beide mit nur einer Kugel erschossen. Dann warfen sie ihre Leichen in den nahe gelegenen Fluss, wo mein Großvater nach wie vor liegt. Der älteste Bruder meiner Mutter war erst sieben Jahre alt, zu jung, die sterblichen Überreste seines Vaters aus dem Fluss zu bergen. Es gab niemanden, bei dem meine Großmutter mit ihrem Fall hätte vorstellig werden können – die Warlords machten das Gesetz. Kurz darauf zog meine Großmutter, im Alter von siebenundzwanzig zur Witwe geworden, mit ihren sechs Kindern nach Kabul.
Sie mietete ein kleines Haus in Deh Dana, einem Bezirk weit im Süden der Stadt ganz in der Nähe des neoklassischen Darul-Aman-Palasts, umgeben vom Berg Sher Darwaza und den Ruinen der antiken Stadtmauern Kabuls. Der Name bedeutet »Ort der Gebildeten«, doch in den 1980er-Jahren verwandelte sich die Mittelklassegegend in einen Slum. Flüchtlinge strömten in das Viertel, als die Warlords ihren Einfluss im ländlichen Raum verstärkten, und verwandelten die vornehme Hauptstadt in ein wüstes, überbevölkertes Chaos. Dabei wuchsen in dem urbanen Hinterland eingeschworene Gemeinschaften zusammen. Die Neuankömmlinge suchten sich die Stadteile aus, in denen sich bereits andere aus ihrer Provinz niedergelassen hatten, und schufen so unvollkommene Kopien ihrer Dörfer inmitten der Stadt. Später, in den 1990er-Jahren, als die Taliban kamen, verließen die meisten der alteingesessen, wohlhabenderen Bewohner Kabuls ihre Häuser in den reichen Innenstadtvierteln. Viele von ihnen emigrierten nach Europa oder in die Vereinigten Staaten. Die Ärmeren jedoch, die, die nach Kabul eingewandert waren, blieben.
Eigentlich hätten die afghanischen Sitten vorgeschrieben, dass meine Großmutter einen der Brüder ihres toten Ehemanns heiratete und die geringere Stellung als Zweitfrau im Tausch für ökonomische Sicherheit akzeptierte. Sie aber entschied sich für den beschwerlicheren Weg und nahm eine Stelle in einer Fabrik an, um ihre Kinder als alleinerziehende Mutter durchzubringen. Es war das erste Mal, dass sie außerhalb des Hauses arbeitete. Die Ehefrau des Schuldirektors, eine angesehene Frau in ihrem Dorf, war nun nichts weiter als ein Flüchtling unter Hundertausenden in der rauen Großstadt. In meinem Land darf man das, was man hat, nie als gegeben hinnehmen. Morgen schon kann alles weg sein.
***
Familiengeschichten kennen Gutes und Schlechtes, ein Auf und Ab wie die Gezeiten. Manchmal wendet sich etwas zum Besseren, während alles andere im Niedergang begriffen ist. Als die Sowjetunion zusammenbrach und die Berliner Mauer fiel, wurde Kabul zu einem der ersten Opfer der Nachwirkungen des Kalten Krieges. Die Sowjetarmee zog sich 1989 aus Afghanistan zurück – eine weitere gedemütigte Großmacht, die jedoch eine gebeutelte Gesellschaft und ein Land, das weitgehend in Trümmern lag, zurückließ. In Kabul aber fühlte sich der Krieg immer noch weit weg an. Meine Mutter besuchte die Schule in der Hauptstadt, und nach dem Unterricht holte sie sich die Hausschlüssel bei meiner Großmutter in der Kleiderfabrik ab, in der sie Uniformen für die afghanische Armee nähte.
Meine Mutter fiel 1991 als Erstes den Schwestern meines Vaters auf, damals war sie vierzehn Jahre alt. Meine Tanten arbeiteten ebenfalls in der Fabrik und hatten ihre eigene Fluchtgeschichte. Meine Großeltern väterlicherseits hatten früher in seltenem Luxus gelebt. Mein Großvater, Faramoz Ghafari, arbeitete für ein deutsches Unternehmen in einem Entwicklungsprojekt in der Provinz Herat. Er war außerdem ein angesehener Anführer in seinem Dorf und ein äußerst wohlhabender Mann. Die Familie lebte in einer dreistöckigen Villa auf dem Land hinter verzierten Eisentoren. Meine Großmutter, Bibi Rabia, lebte wie eine Königin mit mehr als vierzig afghanischen Seidenteppichen, die ihr Haus schmückten, handbestickten Schuhen und Schatzkisten voller Silber- und Goldschmuck mit kostbaren Steinen. Doch auch sie konnte ihr Geld und ihren Status nicht vor der um sich greifenden Gewalt und vor Unheil schützen. Mein Vater war eines von neun Kindern, wobei meine Großmutter noch einige mehr geboren hatte, die jedoch tot zur Welt kamen oder kurz nach der Geburt starben. Als Krieg und Extremismus sich ausbreiteten, begannen die Mullahs vor Ort, sich gegen die Ghafaris zu wenden: Einer der Brüder meines Vaters, Abdul Sami, war Mitglied der Khalq-Partei, dem gleichen linken, von den Sowjets unterstützten Block, dem auch Mohammed Dschan aus Changa beigetreten war. Er war der Meinung, diese Partei hätte die besten Pläne für Afghanistan, sie würde das Land modernisieren und sich vor allem für die Bildung von Mädchen einsetzen. Doch in den Augen der Mullahs machte ihn das zum Ungläubigen. Die Familie fing an, das Haus seltener zu verlassen, und blieb lieber hinter ihren Toren, während sich draußen alles so stark veränderte, dass es kaum wiederzuerkennen war. Mein Onkel Abdul Sami wurde in einem Hinterhalt der Mudschahedin getötet, die ihn zur Warnung mit einer Hand aus dem Boden ragend begruben. Es funktionierte. Die Familie meines Vaters verließ ihr zunehmend feindselig gesinntes Dorf, den Ort, an dem sie einst so respektiert gewesen war. Sie gingen nach Kabul, flohen derart überstürzt, dass sie nichts von ihren Kostbarkeiten mitnehmen konnten. Ein paar der Kinder waren barfuß, als sie loszogen, mein Vater gerade einmal elf Jahre alt. Sie kamen Mitte der 1980er-Jahre in der Hauptstadt an, und während die Brüder, die alt genug waren, in die Armee eintraten, gingen die fünf Schwestern außer Haus zur Arbeit.
In der Fabrik bemerkten sie, dass etwas an meiner Mutter anders war, dass sie mehr war als nur eine dunkelhaarige Schönheit. Der frühe Verlust ihres Vaters hatte eine innere Widerstandskraft in ihr reifen lassen und die Angewohnheit, ihre Ängste für sich zu behalten. Sie wusste einfach nicht, wie sie diesen Mann, an den sie sich nicht erinnern konnte und der doch essenzieller Teil ihres Lebens war, betrauern sollte. Da sie nicht in die Erinnerungen ihrer Mutter einstimmen konnte, füllte sie die leeren Seiten stattdessen mit den Bildern von ein paar wenigen Fotos und erschuf sich so in ihrer Vorstellung ihre eigene Version ihres Vaters. Um diesen Mann konnte sie in ihrem Inneren trauern. Auch heute noch fällt es ihr schwer, ihre Gefühle zu zeigen.
Mein Vater, Abdul Wasi, war fasziniert, als seine Schwestern von diesem rätselhaften Mädchen sprachen. Er war damals siebenundzwanzig, dreizehn Jahre älter als meine Mutter, und seinen Brüdern in die Nationalarmee gefolgt. Er fuhr einen Jeep, ein Zeichen von Prestige in Kabul. Früher einmal war er gutaussehend gewesen, mit vollem, glänzenden Haar und einem stattlichen Schnauzer. Unglücklicherweise lagen seine besten Tage jedoch hinter ihm. Ein paar Jahre zuvor war er an einem Kampf gegen die Mudschahedin in der Provinz Farah in der Nähe der iranischen Grenze beteiligt gewesen, und sein Humvee hatte eine Panne mitten in der Dascht-e Reg Rawan, einer tödlichen Wüste. Die Dschihadisten umzingelten die Soldaten, die ihnen inmitten der leeren Mondlandschaft in ihrem Humvee ausgeliefert waren. Sie steckten fest und verrichteten alles im Inneren des Fahrzeugs, von den Mahlzeiten bis zum Toilettengang. Die Temperaturen stiegen auf fünfzig Grad am Tag. Jedes Mal, wenn einer seinen Kopf aus dem Fahrzeug streckte, schoss einer der Mudschahedin aufs Geratewohl. Erst nach zwei Wochen erreichte sie Verstärkung aus Kabul, aus siebenhundert Meilen Entfernung über erbarmungsloses Gelände. Zu diesem Zeitpunkt waren die Haare meines Vaters ausgefallen. Als sie nachwuchsen, waren sie spröde und hatten einen hellen Braunton.
Einige der wohlhabenden afghanischen Familien hätten vielleicht auf meine Mutter herabgeschaut, sie als armes Mädchen mit geringen Aufstiegschancen betrachtet. Für die Familie meines Vaters war jedoch klar, dass die äußeren Umstände nicht ihren Charakter spiegelten. Auch wenn sie noch ein Kind war, als mein Großvater ermordet wurde, trug sie etwas von seiner Würde in sich. Sie ging weiterhin zur Schule, trotz der Nöte ihrer Familie und obwohl der Krieg immer näher an Kabul heranrückte. Tatsächlich kostete es die Familie meines Vaters sechs Monate, um meine Großmutter davon zu überzeugen, ihrer Tochter die Erlaubnis zur Heirat zu geben. Am Ende ging mein Großvater väterlicherseits mitsamt dem heiligen Koran selbst zum Haus meiner Großmutter und bat sie, nicht Nein zu sagen. Meine Mutter und mein Vater wurden zwei Jahre später, im Jahr 1993, getraut, als in Kabul Kämpfe tobten.
Vor dem Hintergrund des Krieges war die Hochzeit meiner Eltern ein seltener Anlass zur Freude und verhältnismäßiger Opulenz, ein kurzer Moment, in dem sich die Ghafaris wieder so fühlen konnten, als wären sie noch immer die reichen, angesehenen Bürger von damals in Herat. Das Fest wurde in einem der beiden Trauungssäle der Stadt abgehalten und ein Hochzeitsfilmer angeheuert, der alles auf VHS festhielt.
Als Kinder sahen wir uns das Video mit leise gestelltem Ton an, da die Taliban Fernsehen mittlerweile verboten hatten. Mein Bruder Wasil und ich saßen auf dem Boden, während unser Vater den Fernseher hinter dem Schrank hervorholte und die Kabel einsteckte. Im Dunklen, bei zugezogenen Vorhängen, erleuchtete das Flimmern des Bildschirms unsere Gesichter. Die Fremdheit der Bilder zog uns in seinen Bann: das dick aufgetragene Make-up meiner Mutter, die Live-Musik und der Hochzeitssänger, und wenn das Video zu Ende war, bettelten wir darum, dass er es zurückspulte, damit wir es erneut anschauen konnten. Als die Taliban Afghanistan zurück ins Mittelalter stießen, schien es, als kämen die Szenen aus dem Video aus der Zukunft, nicht der Vergangenheit.
***
Meine Mutter war sechzehn, als sie meinen Vater heiratete, und ging weiter zur Schule. Jeden Tag brachte er sie auf dem Gepäckträger seines Fahrrads zum Schultor, bis ein Jahr später ich geboren wurde. Mein Vater nannte mich immer Sartadschak, so wie die kleinen grauen Vögel, die über den Hausdächern Kabuls entlanggleiten. Er erzählte mir immer, er habe dafür gebetet, sein erstes Kind möge ein Mädchen sein, und dass ich die Antwort auf seine Gebete gewesen sei. Ich bin nicht sicher, ob ich vermitteln kann, wie ungewöhnlich es ist, einen afghanischen Vater zu haben, der einen Kosenamen wie diesen benutzt und mit einer solchen Zuneigung zu seiner Tochter spricht.
Ich mag das Profil meiner Mutter geerbt haben, aber wenn ich mich jemandem frontal zuwende, sieht man, dass ich ganz der Vater bin. Meine Mutter und Großmutter haben beide ein breites Gesicht, meines ist schmal und kantig. Auf einem Foto aus meiner Kindheit, auf dem ich mich in die Mulde an der Schulter meines Vaters schmiege, es wurde aufgenommen, als ich sechs oder sieben Jahre alt war, kann man bereits erkennen, dass die Konturen unserer Wangenknochen identisch sind. Auch mein Naturell verdanke ich ihm: Ich habe nichts von der stoischen Ruhe meiner Mutter. Ich spreche die Wahrheit aus, ohne lange zu fackeln. Ich bin aufbrausend, meine Wut bahnt sich über den Tag verteilt in kurzen Ausbrüchen ihren Weg, doch sie verraucht schnell wieder. Wenn ich alles für mich behalten würde, würde ich wie ein defekter Dampfkochtopf irgendwann explodieren.
Noch vor meiner Zeugung, ja sogar bevor er meine Mutter überhaupt getroffen hatte, hatte mein Vater mir mein erstes Spielzeug gekauft: einen orangefarbenen Teddybären, den er aus der Sowjetunion mitgebracht hatte. Er war in den späten 1980er-Jahren auf eine Ausbildungsmission dorthin entsandt worden, in den letzten Jahren, bevor Moskau seine Armee aus Afghanistan abzog. Als er ihn mir kurz nach meiner Geburt schenkte, stand die Armee, der er diente, nicht länger unter der Knute der Sowjets.
Ohne Schutzherren begann die kommunistische Regierung schon bald zu bröckeln, und die Mudschahedin witterten Blut. Sie zogen sich um die Stadt zusammen, die Streitkräfte Massuds und Dostums aus dem Norden kommend und die von Hekmatyar aus dem Süden. Es waren die Männer Massuds, mehrere Zehntausend, die im April 1992 mithilfe aufständischer Regierungstruppen als Erste in Kabul eindrangen. Präsident Nadschibullah, der seiner Brutalität wegen »Der Ochse« genannt wurde, floh, und Massud stellte eine aus unterschiedlichen Mudschahedin-Gruppierungen sowie Mitgliedern des vorherigen Regimes bestehende Regierungskoalition zusammen. Auch die Armee schwor Massud ihre Treue.
Innerhalb weniger Tage brachen zwischen den verschiedenen Gruppierungen auf den Straßen Kabuls Kämpfe aus. Hekmatyar stationierte seine Streitkräfte in den Bergen Chahar Asyabs, die über den südlichen Teilen der Stadt aufragen, und feuerte einen endlosen Strom von Raketen auf die unter ihnen liegenden Bezirke. Das brachte ihm den Spitznamen »Rocketyar« ein – »Freund der Raketen«. Im Norden bediente sich auch Dostum, der Anführer der Usbeken, dieser Taktik und positionierte seine Artillerie in den dort gelegenen Bergen. Im Frühling 1994, meine Mutter war gerade mit mir schwanger, fügte Hekmatyar der Liste der Übel, die Kabul zu erdulden hatte, den Hunger hinzu. Er verweigerte den Nahrungsmittelkonvois der UN den Zugang durch das Stadttor, das er kontrollierte, dies zusätzlich zur fehlenden Strom- und Wasserversorgung sowie den zerbombten Krankenhäusern und Schulen.
Die Wohnbezirke der Oberschicht im Norden und Westen Kabuls, von ihren Bewohnern bereits größtenteils verlassen, wurden bei den Kämpfen zwischen den Mudschahedin in Schutt und Asche gelegt. Der Darul-Aman-Palast wurde so lange unter Beschuss genommen, bis seine Ruine wie eine zerbrochene Zahnprothese aussah. Meine Eltern ernährten sich damals fast ausschließlich von Gemüse, wobei meine Mutter bei den mageren Mahlzeiten Vorrang vor meinem Vater hatte, damit ich in ihrem Bauch ausreichend versorgt war. Im September 1994 brachte mich meine Mutter zu Hause zur Welt, der Lärm von Schüssen und Mörsergranaten hallte im Hintergrund. Es gab keine Hebammen, die hätten helfen können, nur ihre weiblichen Angehörigen und ihre Schwiegereltern. Das mag wie ein unheilvoller Start ins Leben klingen, doch ich selbst schätze mich glücklich. Ich wurde in einer der finstersten Zeiten meines Landes geboren, und doch überlebten sowohl meine Mutter als auch ich.
Auch wenn Massud unter den Mudschahedin-Anführern als der toleranteste galt, waren seine Männer zum größten Teil Analphabeten und bei ihrer Auslegung des Islam streng. Die Sprecherin der Abendnachrichten im Fernsehen, die zuvor unbedeckt aufgetreten war, verhüllte die Haare nun mit einem Tuch. Die Minirock tragenden Studentinnen auf den Straßen gehörten schon lange der Vergangenheit an; fast alle Frauen trugen inzwischen einen Tschador, ein weiter, aus einem Stück Stoff bestehender Umhang, der vom Scheitel bis zum Boden alles bedeckt. Früher einmal hatte es im alten Teil der Stadt eine Straße voller Läden gegeben, die Second-Hand-Kleidung aus dem Westen verkauften, doch sie schlossen, als die Nachfrage nach Bluejeans und Highheels einbrach – welchen Sinn hätten sie noch gehabt, jetzt, da man sie nirgendwo zeigen konnte? Außerhalb Kabuls war die Situation sogar noch schlimmer. Im Süden Afghanistans, in der Gegend von Kandahar, übernahm eine spezielle Gruppierung der Mudschahedin die Herrschaft über ein sich immer stärker ausbreitendes Gebiet: die Taliban.
Ihre Kämpfer – »die Schüler«, wie das Wort »Talib« übersetzt werden kann – waren Schützlinge des Mudschahedin-Kommandeurs Mullah Omar, der zwar nur wenige Erfolge auf dem Schlachtfeld in Afghanistan vorweisen konnte, aber begriff, dass die Generation junger Afghanen, die jetzt in Flüchtlingslagern in Pakistan aufwuchs, perfekte Rekruten für seine Sache abgeben würde. In Pakistans Koranschulen, den Madrassas, die ihnen eine kostenlose Schulbildung ermöglichten (und für die Familien daher oft die einzige Option waren), wurden die Schüler an eine extreme, unerbittliche Lesart des Islams herangeführt, die Gewalt und Tod im Namen des Dschihad glorifizierte. Ihr Leben und das ihrer Familien lag in Trümmern, und sie waren voller Zorn auf die gottlosen Invasoren, die sie aus ihrem Heimatland vertrieben hatten. Mullah Omar überzeugte sie davon, dass die anderen Mudschahedin-Gruppierungen keinen Deut besser wären als die Sowjetsoldaten, dass sie den Drogenhandel und die Korruption weiter vorantrieben. Anfang der 1990er-Jahre, als Massud, Hekmatyar und Dostum sich im Ringen um die Macht in der Hauptstadt verloren, marschierten im Rest des Landes die Taliban ein.
Vier Jahre lang wütete der Bürgerkrieg zwischen Massud und den andern Mudschahedin-Gruppierungen in der Stadt, bis im September 1996, wenige Tage vor meinem zweiten Geburtstag, Mullah Omars Taliban in Kabul einmarschierten. Sie nahmen den ehemaligen Präsidenten Mohammed Nadschibullah, der im UN-Hauptquartier seine Flucht nach Indien vorbereitete, gefangen, ermordeten ihn und stellten seinen kastrierten Leichnam neben dem seines Bruders an den Verkehrsmasten auf dem zentral gelegenen Aryana Square zur Schau, direkt vor dem Präsidentenpalast, in dem er zuvor regiert hatte. Dort blieben sie zwei Tage lang hängen, eine Warnung an all jene, denen es in den Sinn kommen könnte, sich der neuen Ordnung zu widersetzen. Nur wenige taten es. Die Taliban erklärten Afghanistan zum islamischen Emirat, das einer strengen Auslegung des Rechts der Scharia unterlag. Die Mudschahedin und ihre Gefolgsmänner hatten sich aufgeführt, wie sie wollten, als sie die Stadt unter ihrer Kontrolle hatten: Sie entführten Mädchen, um sie unter Zwang zu verheiraten, plünderten Häuser und Geschäfte und töteten ihre Gegner ohne Furcht vor Vergeltung. Die Taliban versprachen, der Gesetzlosigkeit ein Ende zu setzen; ihre strengen, auf der Scharia beruhenden Vorschriften bedeuteten, dass Dieben die Hände abgeschnitten wurden und Ehebrecher mit dem Leben bezahlten. Einen Teenager, den man des Diebstahls von Altmetall bezichtigte, führte man an einer Art Pranger durch die Straßen, sein Gesicht mit Ruß geschwärzt. Die geschlagenen, von Massud angeführten Mudschahedin zogen sich ins Pandschir-Tal zurück, seinen Zufluchtsort in den Bergen nördlich von Kabul.
In den drei Monaten, nach denen die Taliban die Kontrolle über Kabul übernommen hatten, flohen weitere fünfzigtausend Menschen aus der Stadt. Wir blieben, da wir keine bessere Alternative hatten. In Kabul hatten wir immerhin ein Zuhause, wohingegen wir anderswo von Verwandten oder Wohltätigkeitsorganisationen abhängig gewesen wären. Regierungsbeamte wie mein Vater mussten weiterhin jeden Tag zur Arbeit gehen, obwohl es nichts mehr für sie zu tun gab. Immerhin bekam er nach wie vor sein Gehalt. Das Leben unter den Taliban war körperlich weniger gefährlich als während des Bürgerkriegs, versank aber infolge der Unmengen an kleinlichen Vorschriften, die sie erlassen hatten, schon bald in vollkommener Trostlosigkeit. Vögel durften nicht mehr als Haustiere gehalten werden, und so wurden ihre Käfige geöffnet und Hunderte Kanarienvögel und Beos flogen in die Wildnis. Da sie in Gefangenschaft aufgewachsen waren, konnten sie nicht für sich selbst sorgen, und als der Winter hereinbrach, waren die Straßen rasch von leuchtend gelben Vogelleichen übersät. Kartenspiele und Schach, denen man unterstellte, sie würden zum Glücksspiel animieren, wurden verboten, ebenso Fußball, der als unislamisch galt. Drachenfliegen, ein beliebtes Hobby, wurde geächtet, ebenso Papiertüten, damit ja bloß keine einzige Seite des Korans schließlich als solche wiederverwendet wurde. Für Frauen waren die Regeln noch strenger. Meine Mutter durfte nicht länger das Haus verlassen, es sei denn, sie war von Kopf bis Fuß in eine Burka gehüllt, die nur einen kleinen bestickten Schlitz zum Durchspähen hatte, und selbst dann nur, wenn sie von meinem Vater oder einem ihrer Brüder begleitet wurde. Fernsehen, Tanzen und jede Art der Musik, außer islamischen Gesängen, wurden untersagt. Mein Vater versteckte unser Fernsehgerät, und die abgewickelten Bänder der Videokassetten, die die Taliban beschlagnahmt hatten, flatterten von Kabuls Laternenmasten, was auf mich, aus meiner kindlichen Sicht, fröhlich wirkte. Männer wurden gezwungen, sich Bärte wachsen zu lassen und fünf Mal am Tag in die Moschee zu gehen. Die islamische Religionspolizei verhängte gegen jeden Strafen – Auspeitschungen, Steinigungen und Verstümmelungen –, der für nicht konform befunden wurde. Für Ehebruch, das Trinken von Alkohol und Mord konnte die Todesstrafe verhängt werden.
Das Leben gewöhnlicher afghanischer Männer bestand unter dem neuen Regime nur noch aus Arbeit, Zuhause und Moschee. Für die Mehrzahl der Frauen waren Arbeit und Moschee nicht Teil der Gleichung. Für die Mädchen gab es keine Schule mehr, ganz zu schweigen von der Universität – die viertausend Frauen, die an der Universität Kabul studiert hatten, wurden nach Hause beordert. Frauen war es erlaubt zu arbeiten, aber nur, wenn sie einen Beruf im medizinischen Bereich hatten, da es männlichen Ärzten verboten war, Frauen zu behandeln. Von Mädchen wurde erwartet, ab dem Alter von zehn eine Burka zu tragen.
Meine Eltern schirmten uns von der Politik ab. Ich erinnere mich noch daran, dass wir alle zusammen mit Verwandten in einem Viertel namens Makroyan lebten, einem geometrischen Labyrinth aus von den Sowjets erbauten Wohnblocks im Osten Kabuls, in dem die Bewohner ihre Wäsche an Leinen aufhängten, die zwischen ihren Fenstern und dürren Bäumen gespannt waren . Die einst grünen öffentlichen Plätze des Viertels waren inzwischen zu inoffiziellen Friedhöfen geworden, auf denen die während des Bürgerkriegs getöteten Bewohner lagen. Die Gräber waren hastig markiert worden, manchmal nur mit ein paar Steinen, die die Ruhestätte eines geliebten Angehörigen kenntlich machten. Wenige Monate nach der Machtergreifung der Taliban hielt die Hyperinflation Einzug auf den Nahrungsmittelmärkten. Die Armut in Kabul war derart gravierend, dass Kinder menschliche Knochen ausgruben, um sie an Händler zu verkaufen, die sie nach Pakistan exportierten, wo sie kleingemahlen und Hühnerfutter beigemischt wurden. Als die Wohnblocks in den 1960