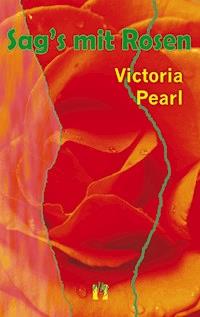Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: el!es-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine große, schweigsame Frau mit graublauen Augen - eine Taxifahrerin, die sie in einer fremden Stadt zum Hotel fährt - beeindruckt Olivia tief. In heißen Träumen wünscht sie sich in ihre Arme, aber es scheint aussichtslos, sie wiederzusehen, denn Olivia kennt nicht einmal ihren Namen. Dafür tauchen andere Frauen in Olivias Leben auf, die sie nicht trösten können. Wird die geheimnisvolle Fremde einmal aus ihren Träumen auferstehen und in Fleisch und Blut zu ihr kommen? Das Rätsel scheint unlösbar, doch eine Frau gibt nicht auf - auch, wenn sich immer neue Schwierigkeiten ergeben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victoria Pearl
ZÄRTLICHE HÄNDE
Roman
Originalausgabe: © 2002 ebook-Edition: © 2013édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-067-7
Coverfoto:
1.
»Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht. Das notwendigste Werk ist stets die Liebe.« Dies sagte einst ein berühmter Mann.
Ich bin weder berühmt noch männlich, und trotzdem ist dieser Ausspruch für mich zu einer Art Lebensmotto geworden. Als Mediatorin, die zwischen oftmals sehr kontroversen Positionen vermitteln muss, halte ich diese Sätze für sehr weise, als Mensch jedoch, der die meiste Zeit seines Arbeitslebens damit verbringt, von einer Stadt in die andere zu reisen, von einem Hotel ins andere und von einem Betrieb zum anderen, gehen sie mir manchmal ziemlich auf die Nerven.
Eben jetzt, kaum in der neuen Stadt angekommen, finde ich an dieser Stunde gar nichts wichtig, und der Mensch, der mir gegenübersteht, ist ein unsympathischer, nach Schweiß riechender Bahnangestellter, der mir erklärt, wo sich der nächste Taxistand befindet – als ob ich das nicht selber herausfinden könnte! Was die Liebe betrifft: nun, darüber sage ich besser nichts, sonst werde ich ungerecht.
Zu meiner trüben Stimmung passend regnet es in Strömen, als ich die Unterführung verlasse. Glücklicherweise stehen vier Taxen bereit. Der Fahrer des ersten Wagens dreht sich ostentativ zu seinem Kollegen um und lässt mich mit meinem Trolley stehen. Da steigt der Fahrer des zweiten Taxis aus. Er hat die Szene offenbar beobachtet, schüttelt den Kopf und kommt auf mich zu. Er ist ziemlich groß, Moment, es ist eine Sie, stelle ich erstaunt fest. Sie ist also ziemlich groß, kräftig – oder sollte ich sagen: athletisch gebaut?
Sie nickt mir zu, greift nach dem Koffer, hebt ihn mühelos hoch und trägt ihn zum Taxi. Während die Chauffeuse das Gepäckstück in die unergründlichen Tiefen des Kofferraums verschwinden lässt, setze ich mich auf die Rückbank des Wagens. Er ist glücklicherweise gut geheizt, denn draußen ist es winterlich kalt, und es regnet.
Der Kofferraumdeckel schlägt zu, die Fahrerin umkreist den Wagen, da erblickt sie mich. Sie zuckt mit den Schultern, offenbar ist sie es gewohnt, ihren Gästen die Tür aufzuhalten – und zwar auf der Beifahrerseite. Ich finde es aber wesentlich angenehmer, hinten zu sitzen, da ist mehr Platz, und ich muss mich mit dem Taxifahrer auch nicht allzu lange über nichtssagende Dinge unterhalten.
Die Fahrerin gleitet schräg hinter das Steuer – sie kann sich nicht einfach hinsetzen, dafür ist sie zu groß. Sie dreht sich zu mir um und fragt höflich: »Wohin möchten Sie gefahren werden?«
»Hotel Adler«, antworte ich knapp.
Sie startet den Motor, drückt auf den Knopf der Taxiuhr, legt den Gang ein, schert aus der Reihe und fädelt sich, nach einem Dutzend absichernder Blicke nach hinten, links und rechts in den langsam fließenden Verkehr ein.
Ich lehne mich entspannt in das weiche Polster zurück. Das leise Brummen des Motors wirkt einschläfernd. Ich döse vor mich hin, denn als erfahrene Taxikundin weiß ich, dass spätestens bei der nächsten roten Ampel ein ruckartiges Bremsen, ein ungeduldiges Knurren vom Vordersitz oder das Aufheulen des gequälten Getriebes mich wieder wecken wird.
Nichts dergleichen geschieht. Wir fahren zügig durch die verkehrsreichen Straßen, halten, starten, werden schneller, dann wieder langsamer, ohne dass auch nur ein einziges Mal eine Bremse quietscht oder der Motor stottert.
Etwas perplex beobachte ich die Chauffeuse. Ihre linke Hand liegt locker auf dem Lenkrad, die rechte auf dem Schaltknüppel. Sie sitzt entspannt am Steuer, lässt ihre Augen in kurzen Abständen über die Spiegel huschen und blickt dann wieder konzentriert auf die Fahrbahn. Sobald ein anderer Verkehrsteilnehmer sie schneidet, runzelt sie die Stirn.
Wunderbar, denke ich zufrieden, hier bleibe ich. Unwillkürlich löst sich ein tiefer Seufzer aus meiner Kehle.
Sie blickt in den Rückspiegel. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
»Ja, ja, alles klar. Ich . . .« Den Satz beende ich nicht, denn schließlich muss ich einer Taxifahrerin nichts erklären.
Ihre blauen Augen fixieren mich noch immer im Rückspiegel. Sie sind seltsam intensiv, fast schon hypnotisch.
Die Chauffeuse wendet ihre Aufmerksamkeit wieder der Straße zu. Fast hätte ich wieder geseufzt. Diesmal aber aus Erleichterung darüber, dass sie nicht fragt, was mit mir los sei oder ob sie mir helfen könne, und dass sie nicht versucht, die ungewohnt stille Fahrt durch ein oberflächliches Gespräch zu stören.
»Das Hotel Adler«, sagt sie schließlich leise.
Sie hält an, steigt aus, öffnet mir die Tür, geht nach hinten und hievt meinen Trolley aus dem Kofferraum. Ich zahle, frage mich, ob das Trinkgeld nicht etwas hoch ausgefallen ist, und gehe langsam und sehr zufrieden ins Hotel, das mich für die ganze Woche beherbergen wird.
Für heute reicht es mit Reisen, denke ich. Essen werde ich im Hotel, danach werde ich noch ein wenig arbeiten, mich mit den Problemen der Marketingfirma vertraut machen, die ich ab morgen zu betreuen habe, und früh zu Bett gehen.
Wie lange die Taxifahrerin wohl noch unterwegs ist? frage ich mich plötzlich. Hoffentlich hat sie eine Ausbildung in Selbstverteidigung, denn schließlich ist ihr Job nicht ganz ungefährlich. Aber weshalb überlege ich mir das überhaupt? Ich bin wohl ziemlich übermüdet, und der Stress des letzten Wochenendes ist auch nicht spurlos an mir vorübergegangen.
Meine Gedanken kehren zu Iris zurück. Sie hatte immer mehrere Affären gleichzeitig, doch das wusste ich, als ich sie kennenlernte, und es hat mich nicht daran gehindert, eine weitere Bettgeschichte in ihrer Sammlung zu werden.
Iris meinte, ich sei ihre Hauptfrau, die anderen dienten ihr als Abwechslung und um ihr die Zeit zu verkürzen, bis ich von meinen Aufträgen wieder zurück sei. Ich wollte keine feste Beziehung mit ihr, der Sex reichte voll und ganz, schließlich bin ich erwachsen und weiß, dass Liebe und guter Sex nicht unbedingt zusammengehören. Als sie mir aber am vergangenen Samstag eröffnete, unsere Affäre sei zu Ende, war ich dennoch vor den Kopf gestoßen.
»Warum so plötzlich?« fragte ich.
»Olivia, es stimmt nicht mehr für mich.«
Ich hätte beinahe laut gelacht. Wie fühlst du dich? Spürst du mich? Stimmt’s für dich? Solche Fragen stelle ich zugegebenermaßen manchmal auch. Doch ich stelle sie meinen Kunden oder Klienten. Sie aber war meine Geliebte und erklärte mir allen Ernstes, es stimme nicht mehr für sie – als ob ich daraus einen wirklichen Grund für ihre Entscheidung erkennen könnte!
Über meinen Beruf als Vermittlerin hatte sich Iris immer lustig gemacht. Sie meinte, das Psychogesülze diene nur der schnellen Geldvermehrung und helfe vielleicht noch dem Finanzamt, aber bestimmt nicht den zerstrittenen Paaren, Geschäftspartnern oder all den anderen, die meine Firma konsultierten. Und nun verwendete ausgerechnet sie eine Formulierung, die mir zuwider ist, die ich zu umgehen suche.
Selbstverständlich gab ich mich damit nicht zufrieden. Ich kenne die Kniffs, um jemanden zum Reden zu bringen, auch bei Iris funktionierten sie, und ich erfuhr, dass ihre Haupt-Hauptfrau ihr ein Ultimatum gestellt hatte: entweder beiderseits viele Affären oder eine feste Zweierbeziehung. Sie hatte sich für die Beziehung entschieden, und als ich das hörte, wurde mir klar, dass Iris nicht allen Frauen gegenüber ehrlich gewesen war.
Nun habe ich also keine Affäre, von einer Beziehung ganz zu schweigen. Vielleicht ist es besser so, ich bin zu meinem Leidwesen monogam veranlagt, doch ich werde mich bestimmt ziemlich einsam fühlen in meinem Bett, wenn ich nicht ab und zu eine heiße Nacht mit einer Frau haben kann, die mir die Wartezeit versüßt und meine Phantasie beflügelt.
Wer Hotelbetten kennt, kann vielleicht nachvollziehen, wie angenehm diese erste Nacht für mich ist. Zwar liege ich schon seit drei Stunden unter der warmen Decke, doch ich finde keinen Schlaf. Ich wälze mich von einer Seite auf die andere, schlummere kurz ein, erwache wieder, weil mich ungewohnte Geräusche stören. Ich träume wirres Zeug von entgleisenden Schnellzügen, von Geiselnahmen im Flugzeug, von Taxis, die am Hotel vorbeifahren und nie ans Ziel kommen.
Verschwitzt und mit rasendem Puls knipse ich morgens um vier die Nachttischlampe an. Es hat einfach keinen Wert, die erste Nacht im Hotel wirklich schlafen zu wollen, sage ich mir, ich weiß es doch. Also zappe ich mich durch die 35 Fernsehkanäle, die entweder ein Testbild anbieten oder für irgendwelche Sexseiten im Internet werben. Der einzige Sender, der etwas anderes bringt, trägt auch nicht dazu bei, dass ich mich beruhige, denn Horrorfilme wirken auf mich nicht eben einschläfernd. Ich schalte die Kiste aus, beginne Schäfchen zu zählen, und bei 3712 tauche ich endlich ab.
Logisch, dass ich am anderen Morgen erschlagen und völlig zerknautscht erwache. Die kalte Dusche, die ich mir verordne, belebt mich ein wenig, den Rest muss starker Kaffee erledigen. An der Rezeption verlange ich nach einem Taxi, und für einen kurzen Moment hege ich die verrückte Hoffnung, es käme dasselbe, das mich gestern hergefahren hat, natürlich mit derselben Chauffeuse.
Aber wann habe ich schon Glück? Der Taxifahrer, der mich zur Marketingfirma bringen soll, hat wohl ebenso schlecht geschlafen wie ich. Er flucht auf der ganzen Strecke in die Innenstadt über die idiotischen Autofahrer, die Tussis, die keine Ahnung haben, wo sich das Gaspedal befindet, die Fußgänger, die den Nerv haben, genau dann einen Zebrastreifen zu überqueren, wenn ein Taxi angefahren kommt, über das Wetter, obwohl es gar nicht regnet, über die Fußballmannschaft, die schon wieder verloren hat. Er findet noch andere Dinge, über die er sich lautstark ärgert, aber ich schalte meine Ohren auf Durchzug.
Mein erster Arbeitstag mit den Marketingfachleuten verläuft sehr erfreulich. Aus verschiedenen Einzelgesprächen suche ich die wunden Punkte herauszufiltern. Die Menschen hier sind anfangs ziemlich zugeknöpft, denn sie haben unbewusst Angst, ich würde ihren Chefs weitermelden, was sie mir anvertrauen. Meist schaffe ich es aber binnen einer Viertelstunde, das Eis zu brechen, denn ich werte nicht, ich höre nur zu.
Das letzte Gespräch habe ich nachmittags mit einer Dorothea Bischof. Sie betritt das kleine Zimmer, das man mir zur Verfügung gestellt hat, und schließt die Tür mit so viel Nachdruck, dass die kleine Milchglasscheibe besorgniserregend zittert.
»Also«, beginnt Doro, wie ich sie in Gedanken nenne, »was muss ich Ihnen erzählen?« Sie setzt sich unaufgefordert auf einen der freien Stühle. Ihre Haltung soll wohl Präsenz und Selbstbewusstsein ausstrahlen, doch auf mich wirkt sie äußerst verkrampft und unsicher. Ich frage mich, was diese zierliche Brünette zu verbergen versucht.
»Sie müssen mir nichts erzählen, wenn Sie nicht wollen«, sage ich ruhig. »Ich wurde gerufen, um mir ein Bild über die Zusammenarbeit in dieser Firma zu machen. Vielleicht finden wir alle miteinander Ansatzpunkte, um die innerbetriebliche Kommunikation zu verbessern, falls es nötig sein sollte.«
Meine Worte sind mit Bedacht gewählt, denn ich weiß, dass hier sehr viel verändert werden muss. Mediatoren werden ohnehin erst dann gerufen, wenn die Situation schon sehr verfahren ist.
Doro schnaubt verächtlich. »Zusammenarbeit? Was ist das?« fragt sie mit provozierendem Blick.
Das habe ich heute schon öfter erlebt. Ich gehe nicht darauf ein, sondern will von ihr wissen, welches ihr Aufgabenbereich ist, wie sie den Arbeitstag verbringt, welche Tätigkeit sie schätzt und so weiter.
Allmählich taut Frau Bischof auf. Ich notiere mir »sehr kommunikativ«, höre ihr zu, beobachte, wie sie ihre Haltung ändert, sich zurücklehnt, den Kopf dreht, wenn sie auf etwas Unangenehmes zu sprechen kommt, ihn zurückwirft, wenn sie lacht, wie sie die Hände ineinander verhakt, wenn sie unvorsichtig etwas von sich preisgibt.
In mir steigt plötzlich ein Gedanke auf. »Und was sagt Ihre Freundin zu dieser Situation?« frage ich sie in einem Tonfall, als hätte ich mich nach der Wettervorhersage erkundigt.
»Sie findet es eine Frechheit, wie man hier mit uns umgeht«, antwortet Doro ohne zu überlegen. Dann errötet sie.
Ich erkenne, dass am liebsten aus dem Zimmer stürzen würde – oder aus dem Fenster. Ganz sicher bin ich nicht. »Doch Ihre Freundin versteht, weshalb Sie Ihren Job trotzdem lieben?« hake ich nach, ehe sie etwas sagen kann. »Meine nämlich bringt dies Verständnis für mich nicht auf«, ergänze ich und bemerke erst hinterher, dass ich die grammatische Zeit falsch gewählt habe.
Doros Gesicht, sehr hübsch übrigens, mit haselnussbraunen Augen und einem markanten Kinn, entspannt sich. Es lächelt gar für den Bruchteil einer Sekunde. Das reicht uns beiden, um zu wissen, dass wir nicht mehr flunkern müssen.
Endlich kann ich die Tür von außen schließen. Es war ein sehr intensiver Arbeitstag, all diese Menschen, die mit ihren Geschichten in das Zimmer kommen, sie so erzählen, wie sie sich aus ihrer Perspektive zugetragen haben, den größeren, unangenehmeren Teil aber verschweigen. Und alle nehmen mich unter die Lupe, bilden sich ein Urteil, fragen sich, ob sie mir vertrauen sollen oder nicht.
Ich überlege, ob ich zu Fuß ins Hotel zurückkehren soll, doch die lange Strecke schreckt mich ab. Ich kenne mich auch nicht sonderlich gut aus in dieser Stadt und müsste der Hauptverkehrsader folgen, was mir nicht behagt. Es bleibt mir keine andere Wahl, als wieder ein Taxi zu rufen.
Wenige Minuten später hält der Wagen vor dem Haupteingang des Hochhauses. Der Chauffeur steigt aus und geht zur hinteren Tür. Moment mal – es ist meine Chauffeuse! Wow! Ich freue mich, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, warum.
Sie hält mir die Tür auf, nickt mir zu. Fast meine ich die Andeutung eines Lächelns auf ihrem Gesicht zu erkennen. Gegen meinen Willen schlägt mein Herz etwas schneller, nur ein kleines bisschen, aber das reicht, um mich zu beunruhigen.
»Hotel Adler?« fragt sie. Ihre blauen Augen fixieren mich und bannen meinen Blick im Rückspiegel.
Ich nicke, doch dann korrigiere ich mich schnell. »Erst einmal würde ich gern noch ein paar Schritte zu Fuß gehen.« Mir wird plötzlich bewusst, dass ich mit dieser Frau bisher kaum zwei Sätze gesprochen habe. »Ich kenne mich allerdings nicht aus in dieser Stadt und weiß nicht, wo man hier in der Nähe am besten frische Luft tanken kann.«
Die Taxifahrerin lässt meine Augen los. Sie dreht sich zu mir um und schaut mich nachdenklich an.
So dicht habe ich ihr Gesicht noch nicht vor mir gesehen, vor allem nicht von vorn. Auf den ersten Blick entdecke ich nichts Besonderes, abgesehen von ihren vollen Lippen, dem kleinen Leberfleck auf der rechten Wange, den feinen Fältchen um die blauen Augen, die einen Graustich aufweisen, und der rundlichen Kopfform. Gut, das ist doch mehr als ich gedacht habe.
»Ich kann Sie zum Park am Fluss fahren.«
Ich bemühe mich, meine Gedanken zu sammeln. Weshalb will sie zum Fluss?
Ach so, ich wollte ja spazierengehen, und an Flüssen spaziert es sich gut. Ich nicke und lasse mich in das Polster zurücksinken. Ich weiß, dass ich eine ausnahmsweise angenehme Taxifahrt vor mir habe.
Nach gut zehn Minuten hält der Wagen auf einem Parkplatz, der an eine ausgedehnte Grünanlage grenzt. Die Fahrerin stellt den Motor ab und stoppt die tickende Taxiuhr.
Schade, denke ich, jetzt muss ich mit einem anderen Taxi zum Hotel zurückfahren. Ich greife nach der Tasche, in der ich meinen Laptop und die Unterlagen habe, die ich heute noch auswerten muss.
Die Taxifahrerin hält offensichtlich viel von guten Manieren. Sie öffnet mir die Tür und wartet, bis ich ausgestiegen bin. Doch statt mir den Fahrpreis zu nennen, den ich auf der Uhr abgelesen habe, blickt sie auf meine voluminöse Tasche und schüttelt den Kopf. »Lassen Sie das ruhig im Auto. Oder möchten Sie lieber mit einem anderen Taxi ins Hotel?«
»Wie? Ich verstehe nicht ganz.«
Mehr noch, ich verstehe gar nichts. Sie hat bestimmt Besseres zu tun als hier auf eine gestresste Karrierefrau zu warten, die in einem plötzlichen Anfall von Naturverbundenheit am Ufer eines Gewässers zu wandeln gedenkt.
»Wenn Sie nichts dagegen haben, mache ich eine kurze Pause und bringe Sie dann zum Hotel«, sagt sie, als wäre ein solcher Vorschlag in Taxifahrerkreisen üblich.
Ich schüttle verwirrt den Kopf, lege aber die Tasche wieder auf den Rücksitz. Dann wende ich mich dem Park zu. Nach ein paar Schritten stelle ich fest, dass die Chauffeuse noch immer beim Taxi steht und keine Anstalten macht, mir zu folgen. »Kommen Sie mit?« frage ich. Wäre doch logisch, oder etwa nicht?
»Nur, wenn es Sie nicht stört«, erwidert sie zurückhaltend.
Mein Gott, ist die jetzt kompliziert, anständig oder einfach nur blöd? »Ich bitte Sie darum«, antworte ich lächelnd.
Ich bin im Begriff, mit einer wildfremden Frau, einer Taxifahrerin, einen unter anderen Umständen möglicherweise romantischen Abendspaziergang am Fluss zu machen. Ich weiß weder ihren Namen noch ihr Alter. Ich weiß noch nicht einmal, ob Taxifahren ihr Beruf ist oder nur ein Teilzeitjob. Und über ihr Inneres weiß ich erst recht nichts.
Mit ihren langen Beinen hat sie mich längst eingeholt. Sie geht schweigend neben mir, blickt abwesend auf das träge fließende Wasser und scheint mich völlig vergessen zu haben. Das schätze ich gar nicht. »Haben Sie eigentlich eine Ausbildung in Selbstverteidigung?« frage ich.
Sie blickt mich überrascht an. »Ja«, antwortet sie. Weiter nichts.
»Und haben Sie sich schon einmal verteidigen müssen?« bohre ich weiter. Sie weckt meine Neugier, ohne dass ich einen Grund dafür nennen könnte. Irgend etwas hat sie, das mich reizt, mehr über sie zu erfahren.
»Bisher bin ich ohne ausgekommen«, erwidert sie – und verfällt wieder in Schweigen.
Was will ich eigentlich von ihr, frage ich mich. Offensichtlich gehört sie nicht zu den Menschen, die über sich sprechen, die überhaupt sprechen, ohne gefragt zu werden. Vielleicht ist es diese Verschwiegenheit, die mich zur nächsten Frage treibt. »Wie lange fahren Sie schon Taxi?«
»Fünf Jahre.«
Toll, das war nicht mal ein ganzer Satz. »Und wie sieht Ihr Arbeitstag aus?« frage ich und bleibe stehen.
Sie dreht sich nach mir um. In ihren Augen erkenne ich Erstaunen, sehe, dass sie die Antwort abwägt, sich wohl überlegt, was ich im Schilde führen könnte. Wenn ich das nur selber wüsste.
Sie atmet tief durch. »Je nachdem. Wir haben drei Schichten zu jeweils acht Stunden. Die erste dauert von Mitternacht bis morgens um acht, dann von acht bis vier Uhr nachmittags, anschließend kommt die Spätschicht bis Mitternacht.«
Erschöpfend, absolut klar und völlig unantastbar. »Und welches ist Ihre bevorzugte Schicht?« frage ich weiter. Ich kann nicht heraus aus meiner Haut.
»Hören Sie, ich möchte nicht unhöflich sein, doch ich muss mir täglich acht Stunden die Sorgen und den Ärger vieler Kunden anhören. Wenn ich Pause mache, entspanne ich mich gern ein wenig.«
Autsch, das hat getroffen. Mitten ins Schwarze. Selber schuld, tadle ich mich. Jetzt ist sie verärgert, und du hast sie so weit gebracht. Asche auf mein Haupt! Ich hebe den Blick, will eben zu einer Entschuldigung ansetzen, da sehe ich ihre Augen. Das gibt’s doch gar nicht, denke ich überrascht. Sie lächelt mich an! Das heißt, nur die Augen lächeln, ihr Gesicht bleibt völlig unbewegt. Ich gebe ihr Lächeln zurück und gehe weiter. Ich werde mich hüten, auch nur ein Wort zu sagen, nehme ich mir vor.
Nach einer großzügig bemessenen Viertelstunde meint sie: »Wir sollten umkehren, sonst fährt mein Taxi von alleine davon.«
Ich stutze. Der Wagen hat mit Sicherheit keine Fernsteuerung. Aber diese Frau scheint einen seltsamen Humor zu haben.
Sie lächelt schief und sagt: »Die Pause dauert eine halbe Stunde. Sie ist um, wenn wir wieder beim Auto sind.«
Nachdem mich die Chauffeuse vor dem Hotel abgesetzt hat, sehe ich ihr fast wehmütig hinterher. Sie berührt mich, nein, sie rührt mich, diese große Frau, die kaum spricht, mich nur manchmal, ganz flüchtig ansieht, mit ihren blaugrauen Augen, in denen ich ihre Gedanken lesen könnte, wenn ich nur das nötige Vorwissen oder Feingefühl hätte.
Während ich warte, bis mein Laptop das Arbeitsprogramm startet, rufe ich mir ihr Gesicht in Erinnerung. Weshalb will sie nicht, dass ich etwas über sie erfahre? Warum verrät sie mir nicht einmal ihren Namen? Und doch hat sie mich heute angelächelt, sogar zweimal!
Ich beginne meine Notizen zu überarbeiten, in den Computer einzugeben und sie zu ordnen. Es erfüllt mich immer wieder mit Erstaunen, wie manche Menschen sich selbst sehen und ihre Mitmenschen beurteilen. Wäre die Taxifahrerin eine der Befragten von heute, ich wüsste nicht, was ich von ihr denken sollte. Ich kann sie nicht einschätzen. Ich bemerke, dass sie mir nicht aus dem Sinn geht, ich sehe sie vor mir, ohne dass ich sie rufen müsste. Aber ich kenne sie nicht, so wenig wie sie mich kennt, denn ich habe ihr nichts über mich erzählt.
Wahrscheinlich interessiert sie sich nicht für ihre Kundinnen oder Kunden. Ich bin für sie nichts Außergewöhnliches, eben nur eine unter vielen – dazu noch eine, die dumme Fragen stellt. Ich werde aus ihrem Gedächtnis verschwunden sein, sobald sie mich zum letzten Mal von einem Ort zum anderen befördert und die Tür zugeschlagen hat.
2.
Um mein Seelenleben steht es gar nicht gut. Ich liege wieder einmal im Bett und kann nicht schlafen. Üblicherweise fordert die zweite Nacht im selben Hotelzimmer meine arithmetischen Fähigkeiten nicht mehr heraus, doch heute schaffen es selbst die bewährten Schafe nicht, mich in den Schlaf zu kuscheln.
In Gedanken gehe ich das Programm für den nächsten Tag durch. Ich werde wieder mit dem Taxi in die Innenstadt fahren. Wer wird hinter dem Steuer sitzen? Eine große dunkelblonde Frau mit blaugrauen Augen?
Ich wünschte, sie wäre hier. Wir müssten ja nicht reden, es gibt so viele schöne Dinge, die wir zusammen machen könnten.
In meinem Kopf schrillt die Alarmglocke in den höchsten Tönen. Was überlege ich mir da? Die Taxifahrerin in meinem Bett? Bin ich noch zu retten? Obwohl, meine Vorstellung erfüllt mich mit Wärme, ich spüre, wie mein Gesicht zu lächeln beginnt.
Ich würde sie streicheln, mit meinen Fingern über ihre Stirn fahren, über ihre Wangen, ihre Lippen und ihren Hals. Ich möchte ihre geraden, starken Schultern mit meinen Händen erspüren, die Muskeln auf ihrem Rücken nachzeichnen, die samtene Haut ihres Bauches fühlen und dann ganz langsam nach oben gleiten. Ob ihre Brust in meiner Hand Platz findet?
Meine Brüste hätten gewiss Platz in den Händen der Taxifahrerin, denn ihre Hände sind groß, fallen jedoch nicht auf, wenn sie vor einem steht. Sie passen zu ihrer Statur. Erst wenn man diese Hände genau betrachtet, fällt einem auf, dass sie wirklich groß und fest sind, die Finger lang, schlank und trotzdem stark. Ihre Hände zeigen, dass sie zupacken können, doch ich glaube, sie können auch sehr, sehr sanft und zärtlich streicheln. Das würde zum zurückhaltenden, ruhigen Wesen der Taxifahrerin passen. Ich habe diese Hände heute auf dem Nachhauseweg eingehend studiert, da mir nichts in den Sinn gekommen ist, worüber ich mit dieser Frau hätte sprechen können. Sie erscheint mir wie eine Auster.
Ich wünschte, sie wäre hier, denn ich hasse Phantasien, die niemals Wirklichkeit werden.
Übernächtigt und nicht besonders gut gelaunt gehorche ich dem Weckruf des Telefons und verlasse das Bett. Ich bin spät dran, deshalb besteht mein Frühstück nur aus zwei Tassen Kaffee. Die Kantine der Marketingfirma führt bestimmt ein reichhaltiges Sortiment an Sandwiches, beruhige ich meinen rebellierenden Magen und stürze hinaus, wo das Taxi bereits wartet. Keine Chauffeuse öffnet mir die Tür, alles ist so wie immer. Geschäftsmäßig und unbedeutend.
Mein Tag verläuft ohne nennenswerte Vorkommnisse. Statt Einzelgespräche zu führen moderiere ich in Kleingruppen, was ziemlich anstrengend ist, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben große Mühe, sich an die Grundregeln einer fairen Diskussion zu halten. Schließlich gelingt es mir aber doch, die heiklen Themen auf den Punkt zu bringen. Am nächsten Tag werden wir die verschiedenen Lösungsvorschläge ausarbeiten, um danach zu überprüfen, ob sie durchgeführt werden können.
Doro, der auch heute mein besonderes Augenmerk gilt, hält sich in der Gruppe sehr zurück. Ihre haselnussbraunen Augen sagen mir jedoch, dass sie innerlich kocht. Ich hoffe, sie bekommt ihre Emotionen in den Griff. Ich weiß nicht, ob es an unserem kleinen Gespräch von gestern liegt, dass sie meine Moderation nicht torpediert. Ich glaube, ursprünglich hatte sie es vor.
Endlich kann ich die Unterlagen zusammenräumen, der Papierstapel ist beträchtlich angewachsen. Ich ziehe mich in mein kleines Büro zurück, denn hier kann ich mich besser konzentrieren. Im Hotel scheint mir die Taxifahrerin näher zu sein, und das hemmt mich bei der Arbeit.
Es ist schon fast neun Uhr, als ich mit der Nachbereitung fertig bin und den Verlauf des nächsten Tages geplant habe. Jetzt möchte ich irgendwo etwas essen gehen, am liebsten mit jemandem zusammen. Aber da ich niemanden kenne, werde ich wohl allein im Restaurant sitzen müssen, seufze ich und mache mich auf dem Weg zum Fahrstuhl.
»Moment, warten Sie, ich komme mit«, ruft eine Stimme hinter mir.
Ich halte den Lift offen, drehe mich um und sehe, wie Doro im Laufschritt durch den Gang eilt. Sie versucht zu lächeln, doch es gelingt ihr nicht, denn sie ist außer Atem. Nicht besonders sportlich, denke ich.
»So spät noch in der Firma?« frage ich neutral.
»Ach, wissen Sie, diese ganze Sache mit der Zusammenarbeit mag ja gut und recht sein, doch die täglichen Aufgaben müssen trotzdem erledigt werden«, sagt sie und fährt sich durch ihr brünettes Haar. Dann lacht sie und sieht mich mit abschätzendem Blick an. »Wieso siezen wir uns überhaupt?«
Bitte nicht, flehe ich in Gedanken. Ich schätze es nicht, wenn mir ein Du aufgedrängt wird, aus welchen Gründen auch immer.
»Schließlich gehören wir doch zur selben Familie«, fährt sie unbeirrt fort, »und Familien müssen zusammenhalten.«
Leider kann man sich die Familienmitglieder nicht aussuchen, ergänze ich stumm.
»Doro«, stellt sie sich vor.
Gegen meinen Willen muss ich lächeln. »Olivia«, sage ich.
Sie habe großen Appetit, teilt sie mir mit, und sie kenne ein kleines italienisches Lokal, das bis Mitternacht warme Mahlzeiten serviere. Mein Magen jubelt, und ich gestehe mir, dass ich lieber mit ihr zusammen als allein etwas essen möchte.
Ich bestelle Spaghetti und gönne mir ein Glas Rotwein. Doro schließt sich meiner Wahl an. Während wir warten, plaudert sie über die Firma, die Stadt und ihre verflossenen Liebschaften. Erst als die Teller vor uns stehen, schweigt sie, doch nur so lange, bis sie keine einzige Nudel mehr finden kann. Sie nippt an ihrem Glas und nimmt den Faden wieder auf. »Meine jetzige Freundin ist ein bisschen speziell. Sie spielt in einer Band«, erklärt sie stolz, »so haben wir uns vor einem Jahr auch kennengelernt – ich meine, nach einem Konzert. Sie ist wirklich gut, hat ja auch Musik studiert.«
»Ihr wohnt zusammen?«, frage ich und weiß, dass ich mich jetzt auf eine Ebene begebe, die ich als Mediatorin nicht betreten dürfte. Streng genommen ist auch dieses Essen gegen die Regel. Ist Lesbischsein ebenfalls gegen die Regel? fragt ein leises Stimmchen hämisch.
»Nein, das will Barbara nicht. Sie meint, dazu würden wir uns noch zu wenig kennen. Sie ist in allem, was sie tut, absolut. Und wenn sie sich nicht tausendprozentig sicher ist, dann wird’s nichts. Aber ich mag sie wirklich. Sagte ich schon, dass sie etwas Besonderes ist?«
Nur meine Erziehung hindert mich daran, die Augen zu verdrehen und gequält zu seufzen. Verliebte sind eine harte, fast unerträgliche Prüfung für ihre Mitmenschen. Natürlich muss Barbara etwas Besonderes sein, sonst wäre eine Frau wie Doro, die offenbar eine ziemlich hohe Meinung von sich hat, nicht mir ihr zusammen.
Doro trinkt noch einen Schluck Wein, es ist der letzte, und sie lehnt sich entspannt zurück. »Im Vertrauen«, sagt sie.
Achtung, jetzt wird’s heikel, denke ich.
»Ich bin mir nicht sicher«, fährt sie fort, »ob wir wirklich zusammengehören. Barbara hat schon recht, wenn sie meint, wir seien sehr verschieden. Aber sie ist halt so wahnsinnig zärtlich. Sie ist echt eine Sensation im Bett, was man ihr überhaupt nicht zutraut, wenn man sie das erste Mal sieht.«
Meine düstersten Vorahnungen wurden soeben übertroffen. Doro ist ein Plappermaul und nimmt wohl an, ich würde ihre Eröffnungen mit Applaus belohnen. Nichts da. Ich finde es nicht angebracht, mit jemandem, den man kaum kennt, über das Intimleben zu reden, vor allem nicht, wenn die dritte Person nicht anwesend ist. Familie hin oder her, Doro wird mir immer unsympathischer, je länger ich sie reden höre.
Sie seufzt, und da ich ihr nicht antworte, sieht sie sich genötigt, mir noch weitere Einblicke in ihre Partnerschaft zu gewähren. »Vielleicht geht das zwischen uns auch schon bald auseinander. Ich liebe Frauen, vor allem liebe ich die Abwechslung. Barbara aber ist eine Perfektionistin, für sie gibt es nur entweder ganz oder gar nicht. Etwas dazwischen ist für sie undenkbar. Sie gäbe mir den Laufpass, wüsste sie, dass ich neben ihr Affären habe.«
Das schlägt dem Fass den Boden aus. Sie weiß, dass ihre Barbara einen Seitensprung nicht ertragen würde – und dennoch hat sie Affären? In mir steigt Mitgefühl für ihre Freundin auf. Ob ich sie warnen soll, überlege ich. Doch ich kenne Barbara ja gar nicht. Es geht mich überhaupt nichts an.
Der Abend endet ziemlich trocken. Ich sage, morgen hätte ich einen sehr anstrengenden Tag vor mir, was ja auch stimmt, und verabschiede mich von Doro. Wäre sie eine andere Frau, eine dunkelblonde mit blaugrauen Augen, hätte ich ihre Einladung, noch um die Häuser zu ziehen, ganz bestimmt angenommen.
»Aber morgen kommst du mit?», fragt Doro vor der Tür, als ich auf das Taxi warte. »Dann geben Fire & Smoke ein Konzert.«
»Fire & Smoke?« frage ich irritiert zurück.
»Das ist die Band, in der Barbara mitspielt. Bei der Gelegenheit kannst du sie kennenlernen.«
»Und welche Art Musik erwartet mich da?« frage ich, denn ich kenne keine Band namens Fire & Smoke.
»Country und Blues«, sagt Doro, dreht sich auf dem Absatz um, winkt mir zum Abschied und verschwindet um die nächste Ecke, ehe ich ihr erklären kann, dass ich Blues nicht mag und Country schon gar nicht. Für einen Moment bin ich versucht, ihr hinterherzueilen, doch da kommt bereits das Taxi angefahren. Und wieder öffnet mir keine Chauffeuse die Tür.
3.
Mit diesem Hotelbett stimmt etwas nicht. Nun liege ich schon die dritte Nacht wach, obwohl ich mich ziemlich ausgepowert fühle.
Ich lasse mir den Abend mit Doro noch einmal durch den Kopf gehen. Nein, denke ich, sie wäre keine Freundin für mich, selbst für eine Affäre wäre sie nicht geeignet. Ich schätze Quasselstrippen nicht sonderlich, und ich glaube, dass sie mit den Einzelheiten aus ihrem Privatleben auch in einer Bar nicht hinter dem Berg halten würde. Nur in der Firma gibt sie sich zugeknöpft, ist single oder hat sich nach eigenen Angaben gerade verliebt oder getrennt. Sie spielt ein gefährliches Spiel mit ihrer Barbara.
Aber immerhin kann sie spielen, ganz im Gegensatz zu mir. Ich muss mich damit begnügen, in eine Taxifahrerin verliebt zu sein, von der ich weniger als gar nichts weiß. Ich seufze schicksalsgeprüft und suhle mich in Selbstmitleid.
Wenn ich jedoch die Augen schließe, dauert es tatsächlich nicht lange, und ich sehe das rundliche Gesicht vor mir, die prüfenden, hypnotischen blaugrauen Augen, den kleinen Leberfleck, über den ich so gerne mit meinen Fingern fahren würde. Die Lippen, die ich mit meinen berühren möchte. Gewiss sind sie ganz weich und sanft.
Ich möchte ihre Hände auf mir spüren, ihre Finger, wie sie die Konturen meines Mundes nachziehen, wie sie über meinen Hals fahren, meine Brüste berühren, zum Schwellen bringen.
In meinem Bauch schlagen bereits die Schmetterlinge mit ihren Flügeln, setzen zum Fliegen an. Ein sehnsüchtiges Ziehen breitet sich in meinem Körper aus, erwärmt mich und wird dann so stark, dass ich Decke zur Seite schlagen muss.
Ihre Hände streichen über meine Schenkel bis hinab zu den Knien. Als sie auf den Innenseiten wieder nach oben gleiten, beginnen meine Beine zu zittern. Vor meinen geschlossenen Lidern tanzen graublaue Farbflecke, fangen an zu leuchten, zu strahlen. Eine Hand fährt zwischen meinen Beinen hindurch, ich zucke zusammen.
Dass mich die Vorstellung von ihren Händen auf meinem Körper dermaßen erregen könnte, überrascht mich nun doch. Ich nehme mir nicht die Zeit, dieses Phänomen psychologisch zu ergründen, denn ich stehe unter Hochspannung. Freud hätte wahrscheinlich einiges dazu sagen können. Aber ich würde es gar nicht hören wollen. Die Schmetterlinge haben sich auf seltsame Weise in Flammen verwandelt, und dies Feuer in mir kann und will ich nicht kontrollieren oder eindämmen.
Ich halte ihr Gesicht vor meinem inneren Auge fest, während ich meine Hand wieder und wieder zwischen meinen Beinen hindurchgleiten lasse. Ich halte es nicht mehr aus. Mit einem Finger fahre ich zwischen die nassen Lippen, dringe leicht in die warme Höhle ein und reize dann die Klit. Ich will langsam sein, denn ich möchte ihr Gesicht nicht verlieren. Ich stelle mir ihr Lächeln vor und fühle, wie die Wärme in mir ansteigt. Meine Hand wird schneller, meine Finger streichen über den empfindlichen, geschwollenen Muskel, berühren ihn hart. Ich will ihren Namen flüstern, schreien – doch ich kenne ihn nicht. Ich gerate außer mich, die graublauen Augen lösen sich auf, in einem Feuerwerk, das mir den Atem nimmt.
»Wer bist du?« höre ich mich murmeln, im nächsten Augenblick verschwindet sie im Nebel, der mich in einen traumlosen Schlaf hinübergleiten lässt.
Doro wirft mir einen verschwörerischen Blick zu, als ich sie nachmittags in der Kantine treffe. Sie sitzt mit einigen Kollegen aus ihrer Abteilung beim Kaffee und beteiligt sich intensiv an den Fachsimpeleien.
Ich nehme meine Tasse und setze mich zum Betriebsleiter, der gleichzeitig mein Auftraggeber ist. Er will hören, was ich bis jetzt herausbekommen und bereits ausgewertet habe. Unser informelles Gespräch, währenddessen ich keine Namen, sondern nur Fakten nenne, verläuft zufriedenstellend. Schließlich möchte er wissen, was die letzten beide Tage bringen werden. Delikat, denke ich. Bis jetzt waren es die Angestellten, die gefordert wurden, nun kommt die Chefetage dran, und da habe ich einige wunde Punkte lokalisiert.
Herr Heiniger bemüht sich, locker und gefasst zu wirken, während ich ihm referiere, was ich mir für ihn und die übrigen Vorgesetzten zurechtgelegt habe. Mir fällt auf, dass sein Gesicht um so blasser wird, je länger und detaillierter ich meine Arbeitsweise schildere und erläutere. Auch seine sonst so eloquenten Zwischenbemerkungen und Antworten bleiben aus. Ich bin auf dem richtigen Weg.
Das Seminar, Herr Heiniger bestand darauf, die Gruppensitzung in der Chefetage so zu nennen, dauert fast bis zehn Uhr abends, und danach gehe ich in mein Büro. Die Auswertung bereitet mir diesmal etwas Kopfzerbrechen, denn die hohen Herren tarnen sich gern mit vordergründiger Kommunikationsbereitschaft, wollen sich jedoch im Grunde überhaupt nicht in die Karten sehen lassen.
Es ist nach elf, als ich endlich ins Hotel zurückfahren will. Das Taxi ist schon da, ich setze mich wie üblich nach hinten und schließe die Tür. Der Typ dreht sich kaugummikauend um und will wissen, wo er die Dame absetzen dürfe. In diesem Moment fällt mir ein Blatt auf, das neben mir liegt. »Fire & Smoke in Concert« heißt es da in großen Buchstaben.
»Kennen Sie diese Band?« frage ich den Fahrer und hebe den Werbezettel hoch.
Er nickt. »Die treten heute Abend auf.«
»Wie lange spielen die denn?«
»Sie beginnen in der Regel erst nach neun, dafür sind sie um Mitternacht noch ziemlich fit«, sagt er so stolz, dass man meinen könnte, er sei der Manager dieser Band. »Wenn Sie Zeit haben, dann sollten Sie sich das Konzert nicht entgehen lassen. Country, Blues und Rock vom Feinsten. Und Mary, die Leadsängerin, ist allererste Sahne. Sie sieht nicht nur toll aus, sie kann auch singen. Aber wie! So was hört man nicht alle Tage«, schwärmt er.
»Fahren Sie mich bitte hin«, sage ich an der nächsten Straßenecke.
Weshalb tue ich mir das an? Ich stehe wirklich ganz und gar nicht auf Country. Blues ginge ja noch, der würde zumindest zu meiner momentanen Stimmung passen, immerhin habe ich die Taxifahrerin seit zwei Tagen nur noch in meiner Phantasie gesehen. Aber Country im Stile von »Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an« oder »I bin a bayrisches Cowgirl« liegt mir nicht im entferntesten. Trotzdem bin ich auf dem Weg zu einem Country-Konzert, wahrscheinlich treibt mich nur die Neugierde. Doro hat sie geweckt, mit ihrem Geplapper über Barbara. Was das wohl für eine ist? Ich würde diese Barbara gern aus der Nähe sehen, das gebe ich zu.
Das Taxi hält vor einem unscheinbaren Altbau. Der Fahrer berichtet, dass der Keller zu einer alternativen Kneipe ausgebaut worden sei und gern als Auftrittsort genutzt werde, denn seine Größe sei gerade richtig für Bands, die zu bekannt seien für kleinere Läden, aber zu unbekannt für größere Hallen. Auch für Fire & Smoke sei dieser Keller gerade richtig.
Gut, denke ich, dann wird sich der Eintritt ja auch im Rahmen halten, und steige aus dem Taxi. Etwas mulmig ist mir schon zumute, als ich die Treppe zur schweren Eisentür hinabsteige. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt.
Leider kann ich den Laden nicht unbemerkt betreten, denn an der Tür fehlt die Klinke. Stattdessen werde ich durch einen blutroten Schriftzug aufgefordert, die Klingel – Pfeil nach unten – zu benützen. Ich überlege nicht lange, drücke auf den Knopf und warte. Etwas bang frage ich mich, ob ich überhaupt am richtigen Ort bin. Kein Ton dringt an mein Ohr. Ich komme mir vor, als wäre ich in eine Falle hineingetappt, und will mich eben wieder der rettenden Treppe zuwenden, als sich die Tür endlich knarrend öffnet.
»Hallo, nur herein in die gute Stube!«
Eine Frau tritt aus dem Halbdunkel hervor. Sie ist noch länger und noch breiter als meine Taxifahrerin, und sie lässt ihren Blick prüfend über meine Erscheinung gleiten. »Du bist wohl nicht von hier«, sagt sie dem Anflug eines Lächelns.
Ich schüttle den Kopf. Was soll ich tun? Bleiben? Die Flucht ergreifen? Zu spät! Die Hünin hält die Tür weit offen, tritt noch einen Schritt auf mich zu und schiebt mich in einen schummrig beleuchteten Gang. Dort höre ich dumpfe Rhythmen. Sie scheinen vom anderen Ende des Kellers zu kommen.
»Du weißt, wer heute spielt?« fragt die Türsteherin hinter mir.
»Fire & Smoke«, gebe ich unsicher zurück. Was, wenn ich wirklich am falschen Ort gelandet bin? Ich denke lieber nicht darüber nach, sonst rutscht mir mein Herz, das mittlerweile in der linken Kniekehle angekommen ist, noch ganz in den Schuh.
»Ich frage nur, weil du gar nicht so aussiehst wie eine, die auf Country steht«, sagt die Hünin.
»Oh. Ist das ein Problem? Ich meine, dass ich keine passenden Klamotten trage«
»Nein, nein«, lacht sie, »hier gibt es keine Kleidervorschriften. Ich war nur leicht irritiert. Kommt selten vor, dass Leute wie du sich in diesen Keller verirren.«
Ich nicke gnädig. Allmählich finde ich zu meiner Selbstsicherheit zurück. Allzu schlimm wird es nicht werden, rede ich mir ein, während wir durch einen langen Gang eilen. Links und rechts sehe ich viele Türen, bis wir vor einer stehenbleiben, die wieder mit einem blutroten Schriftzug versehen ist. Meine Wegweiserin öffnet mir einer formvollendeten Verbeugung und bittet mich einzutreten.
Ich werde mit Applaus empfangen. Ich bin verwirrt, merke jedoch einen Sekundenbruchteil später, dass das Klatschen nicht mir gilt, sondern den Musikerinnen und Musikern, die sich artig verneigen und dann im Halbdunkel verschwinden. Weil es auf der Bühne nichts mehr zu sehen gibt, drehe ich mich nach der Türsteherin um, doch sie ist verschwunden. Sie hat mich verlassen, jammert ein kleines Stimmchen in mir, jetzt bin ich ganz allein!
»Hey, du bist ja doch noch gekommen!« Doro steht plötzlich neben mir, zieht mich, ohne eine Antwort abzuwarten, hinter sich her zu einem Tisch nahe der Bühne und deutet auf einen Stuhl.
Dankbar setze ich mich hin und mustere das schwach erleuchtete Kellergewölbe mit seinen anscheinend wahllos verstreuten Tischen und Stühlen, die nicht zusammenpassen. Auch das Publikum ist bunt gemischt. Ob sie alle keinen Eintritt gezahlt haben? denke ich und will Doro fragen, aber sie ist bereits wieder weg. Ich lasse meinen Blick zwischen den vielen Menschen in Karohemden, Cowboystiefeln und Lederjacken umherwandern und erkenne weiter hinten eine Bar und dann auch Doro, wie sie sich zur Theke hindurchschlängelt. Trotz des Gedränges der Besucher, von denen die meisten mit einem Stehplatz vorliebnehmen müssen, ist sie schon bald wieder da und stellt ein Glas vor mich hin. Ich hasse Bier, denke ich, doch ich kann es ihr nicht abschlagen.
Doro kennt sich hier bestens aus. Während leise Countrymusik aus den Boxen klingt, erklärt sie mir, wer dies Lokal betreibt, wer hier auftritt und wie man zu einem guten Tisch kommt. »Die Band macht nur eine Viertelstunde Pause, dann sind sie wieder voll da«, sagt sie und nimmt einen Schluck aus ihrem Glas.
»Und deine Freundin?«, frage ich. «Kommt die nicht an deinen Tisch?»
»Nein, wo denkst du hin? Erstens sind wir hier nicht unter uns«, sie zwinkert mir verschwörerisch zu, »und zweitens habe ich dir doch gesagt, dass sie ein absoluter Typ ist. Wenn sie Musik macht, lässt sie sich durch gar nichts ablenken. Sie sieht noch nicht mal, ob ich da bin oder nicht. Erst wenn die Anlage abgebaut ist, taucht sie wieder auf.«
Oh, herrje, das wird eine lange Nacht werden, denke ich, während die Hintergrundmusik verstummt und die Spots auf der Bühne angehen. Eine Stimme aus dem Off kündigt den zweiten Set der offenbar sehr beliebten Gruppe Fire & Smoke an.
Zuerst betritt ein Bär von einem Mann die Bühne und setzt sich hinter das Schlagzeug. Ihm folgt ein blondgelockter Engel, der kaum trocken ist hinter den Ohren, und greift sich den E-Bass. Eine etwas über zwanzig Jahre alte Frau mit blonden Strähnen im schwarzen Haar stöpselt ihre E-Gitarre in ihren Verstärker, ein bärtiger Typ setzt sich an die Keyboards, im Hintergrund stimmt ein großer und schlanker jüngerer Mann seine Akustikgitarre.
Die ersten Takte, ziemlich schnell und rockig, füllen bereits den Raum, als die Sängerin auf der Bühne erscheint. Mit einer anmutigen Kopfbewegung wirft sie ihr langes braunes Haar über die Schultern zurück und richtet das Mikrofon. Aha, denke ich, alles klar. Da nur zwei Frauen auf der Bühne stehen und die Sängerin Mary heißt, muss die schwarzblonde E-Gitarristin Doros Freundin Barbara sein.
Doro stößt mir unsanft in die Rippen. »Gleich hörst du sie richtig gut, gleich kommt ihr Solo.«
Es beginnt mit perlenden Gitarrenklängen, die sich anders anhören als erwartet. Irritiert betrachte ich die Schwarzblonde. Sie spielt nur rhythmische Akkorde, weiter nichts, und der Spot ist nicht auf sie gerichtet, sondern auf die andere Gitarristin – es muss ja eine Frau sein, sonst hieße sie wohl kaum Barbara.