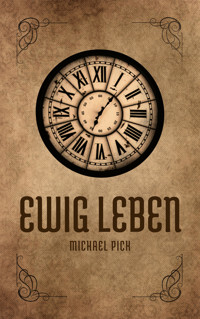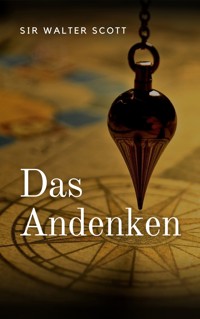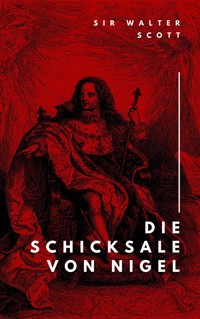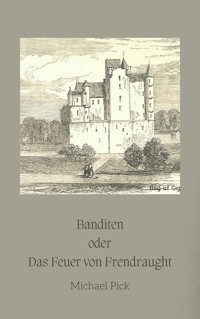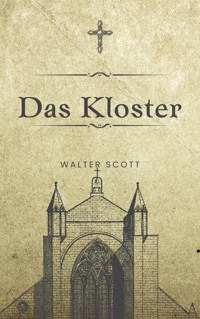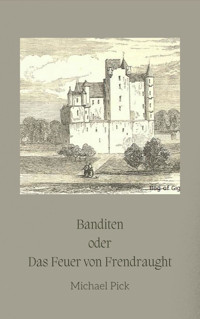Zauber einer Träne
Michael Pick
Copyright © 2013 Michael Pick
All rights reservedThe characters and events portrayed in this book are fictitious. Any similarity to real persons, living or dead, is coincidental and not intended by the author.No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher.CopyrightMichael PickImkenrade 15g23898
[email protected]Zauber einer Träne
Michael Pick
I
Vom sternenbehangenen Himmel hing schräg ein voller Mond. In seinem Licht krümmte sich die Hochbrücke über den schwarz gähnenden Mühlenteich. Eine Gruppe Wildenten zog auf dem Weg ins Schilf Kreise auf das Wasser, die leise gegen das Ufer klopften. Jammernd fuhr der Wind um die Ecken. In der Luft hing der Geruch nach kalter Müdigkeit.
Aus der Ferne wimmerte ein Zug heran. Je näher er kam, umso mehr verschwand die Sehnsucht in seinem Ton. Schnaufend donnerte der Personenzug aus Bad Kleinen vorbei, der kurz vor Mitternacht im Wismarer Bahnhof eintreffen sollte. Sein Pendant in die entgegen gesetzte Richtung dampfte gewiss schon vor Ungeduld. Eine schwarze Katze strich um meine Hosenbeine und schnurrte für einen Blick. Dafür hatte ich jetzt keine Zeit.
Ich war hinter Diana her.
Das Mädchen bog von der Rostocker Straße in den Platten Kamp. Ihr Tempo war nicht besonders schnell, aber sie zögerte an keiner Stelle. Im Abstand von fünfzig Schritten folgte ich ihr, darauf bedacht, jegliches Geräusch zu vermeiden und mich im Schatten der Gebäude zu bewegen. Die Nacht war empfindlich kalt. Ich raffte die Jacke enger und grub die Hände in die Hosentaschen.
Zum hundertsten Mal nannte ich mich einen Narren. Ich war drauf und dran umzukehren, nach Hause zu gehen, alle Gedanken an Diana zu einer Papierkugel zu knüllen und in den größten Kamin der Welt zu werfen und anzuzünden.
An einer freien Stelle an der Straße blieb Diana stehen. Sie drehte sich im Kreis, als suche sie etwas oder jemanden. Ich drückte mich hinter einen Mauervorsprung, hielt die Luft an und beobachtete, wie sie schnurstracks auf ein Haus zulief, das wie ein zu groß geratener Pils abseits der Häuserreihe aus einem Grasgürtel hinter den Bahngleisen wuchs.
Von dem Gebäude waren nur noch die Ecken und zwei Wände übrig geblieben. Das Dach war fast vollständig eingestürzt. Die Tür hing allein an der oberen Angel und wippte knarrend, als der Wind durch die Ruine pfiff. Als wäre ein Riese durch das Gras gewatet und hätte einen großen Happen aus dem Gebäude gebissen.
Das Gras wuchs hier kniehoch. Ich konnte mich gut darin verbergen. Allerdings nicht das miese Gefühl, das mich in meinem Bauch piesackte. Was würde Diana von mir denken, wenn sie wüsste, dass ich heimlich hinter ihr her schlich?
Schritte drangen an mein Ohr. Runde, tiefe Klänge, wie sie von schweren Stiefeln herrühren konnten. Sie näherten sich aus der anderen Richtung der Straße, dort, wo sich ächzend alte rotzieglige Industriehallen aneinander drängten.
Der Schatten eines Menschen schälte sich aus der Nacht. Ich zog den Kopf zwischen die Schultern und linste vorsichtig an den Mauersteinen vorbei. Meine Hände wurden feucht.
Der Schatten gehörte zu einem Jungen, der in den Lichtkreis der Straßenlaterne trat. Der dämmrige Schein spiegelte sich auf seiner schwarzen Lederjacke wider, die sich über seine breiten Schultern spannte. Sein Gang war federnd und gleichzeitig wiegend, als könne nichts auf der Welt ihm etwas anhaben. Zuerst dachte ich, er wäre um das Kinn ungewaschen, aber dann erkannte ich, dass dort ein Bart gewachsen war. Ein schwarzer, dichter Bart. Aus dem letzteren schloss ich, dass er mindestens zwei Jahre älter als ich sein musste. Unwillkürlich tastete ich nach dem blonden Flaum, der mein Kinn säumte.
Die Geräusche seiner Schritte hallten durch den Platten Kamp. Noch zehn Meter und er würde mich passieren. Der Andere müsste blind sein, wenn er mich nicht entdecken würde. Mein Verstand kramte nach einer glaubhaften Erklärung. Nur noch fünf Schritte und ich erkannte, spürte fast, wie seine Hand meinen Nacken packte. Vielleicht konnte es helfen, wenn ich die Augen schloss. Wenn ich ihn nicht sah, sah er mich vielleicht auch nicht.
Plötzlich verstummten die Geräusche der Stiefel. War der andere stehen geblieben, weil er meine Nähe spürte? Ich hatte Angst aber ich war auch neugierig, was dort vor sich ging. Ich ließ mich zu einem Blinzeln hinreißen.
Der Lichtkreis, durch den der Fremde eben noch gelaufen war, lag unberührt auf der Straße. Ich traute meinen Sinnen nicht. Vielleicht gaukelte mir mein überstrapazierter Verstand etwas vor.
Der Junge war verschwunden.
Ein unterdrückter Schrei schwirrte durch die Nacht. So unwirklich mir der Ton vorkam, ich erkannte die Stimme sofort. Ich sprang auf die Straße.
Diana wartete im Eingang der Ruine. Weit leuchtete im Mondlicht die weiße Strickjacke, die sie über das rote knielange Kleid geworfen hatte. Ein großer Schatten sprang auf sie zu. Statt fort zu laufen, breitete sie die Arme aus. Plötzlich erkannte ich, wo der Junge geblieben war und weshalb Diana geschrien hatte.
Ich stand mitten auf der Straße und mein Herz brannte, während der fremde Junge in Dianas Armen lag und sie küsste. Alle Geräusche starben in diesem Augenblick; der Wind fiel mit einem Seufzer zu Boden. Allein der Mond hielt sich am Himmel und blickte wütend auf die Erde.
Und ich? Ich war unfähig, mich zu bewegen. Ohnmächtig und schockgefroren. Mein Herz hörte auf zu schlagen. Ich stand unter der Laterne und glotzte zu der Ruine. Piranhas fraßen sich durch meinen Bauch, kopfgroße Feldsteine quetschten meine Brust, dass ich glaubte, ersticken zu müssen.
Ich stolperte zwei Schritte auf Diana und den Jungen zu, meine Hände ballten sich spontan und unbewusst zu Fäusten. Dann verhielt ich, Schweiß lief über meine Stirn. Ich konnte doch unmöglich auf der Straße stehen bleiben und den beiden beim Küssen zusehen. Ich fühlte, das war der perfekte Zeitpunkt, um zu verschwinden.
Stattdessen stöhnte ich laut auf. Vermutlich, weil mein Körper und mein Verstand in dieser Frage unterschiedlicher Ansicht waren. Das Geräusch, das ich verursacht hatte, blieb nicht ungehört.
„Hey!“, riefen Diana und der Fremde wie aus einem Munde.
Ich verzichtete auf einen Gruß.
Blitzschnell warf ich die Kapuze meiner Jacke über den Kopf. Scheinbar funktionierte mein Körper gehorsamer, solange Diana sich nicht von jemand anderem küssen ließ.
„Niemand darf erfahren, dass wir uns getroffen haben“, ich hörte Dianas Stimme so deutlich, als stände sie neben mir.
Die Gesichter der beiden hoben sich prägnant vom dunklen Hintergrund ab. Bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, stürmte der Junge auf mich zu. Er sprang kräftig und weit, das kniehohe Gras behinderte ihn kaum. Die Muskeln in seinem Gesicht waren angespannt – das machte mir Angst.
Die Furcht gab meinen Beinen unter Umgebung des Gehirns das Zeichen wegzulaufen. Keinen Augenblick zu spät, um einen Vorsprung von zehn Metern zu retten. Nach den ersten Schritten merkte ich, wie verschlafen meine Muskeln reagierten. Wie gelähmt. Die Angst kroch hinauf in meinen Hals und schnürte mir die Kehle zu. Als ob mir so etwas jetzt helfen könnte.
Hinter mir hörte ich nichts mehr, stattdessen brach sich der Verfolger auf meiner linken Seite einen Weg. Seine Sprünge durch das Gras brachten ihn genauso schnell voran, wie meine bemitleidenswerten Versuche auf dem trockenen Asphalt. Mehr noch: Ich hatte das Gefühl, er spielte mit mir, wartete auf einen geeigneten Augenblick, um sich auf mich zu werfen.
Ich musste etwas unternehmen oder ich war verloren. Etwas, womit er nicht rechnete, etwas, das mir genügend Vorsprung verschaffte, um unerkannt von hier zu verschwinden.
Das Straßenkreuz Rostocker Straße und Platter Kamp tauchte vor mir auf. Ich konnte fast spüren, wie der Fremde sich auf diesen Augenblick vorbereitete. Hier plante ich, seinen Angriff zu erwarten.
Vom Bahnhof nahte der Gegenzug. Unter den Stahlrädern knackten die Schwellen.
Ich hatte einen Schlachtplan.
Mitten im Lauf schlug ich einen Haken. Ich wettete darauf, dass mein Verfolger mit einer solchen Aktion gerechnet hatte. Aber sicher nicht damit, dass ich in seine Richtung ausbrechen würde. Mein Herz schlug bis unter die Zunge. Ich lief geradewegs auf ihn zu. Selten hatte ich einen dämlicheren Gesichtsausdruck als den seinen in diesem Moment gesehen. Ich schloss die Augen und betete, dass mein Vorhaben gelingen würde.
Dann zog ich den Kopf ein und drehte die rechte Schulter nach vorne, dass sie zum Rammbock wurde. Der Aufprall riss ihn von den Beinen. Bis er sich wieder aufgerappelt hatte, besaß ich einen Vorsprung von zwölf Metern.
Der Zug näherte sich schnell. Die Scheinwerfer der Lokomotive tasteten sich wie die Augen einer Katze durch die Nacht. Der Rhythmus seiner Räder pochte wie mein Herz.
Der schwerste Teil meines Planes stand noch bevor. Der Zug fuhr schon bedeutend schneller, als ich berechnet hatte. Ich änderte die Richtung, was mich schräg zurück zur Ruine führte.
Hinter mir vernahm ich den schnaufenden Atem des Jungen. Die Angst kehrte zurück und saß mir im Nacken, peitschte meine müden Muskeln. Ich konnte die Gleise fast berühren, die Lokomotive ratterte drei, vier Meter hinter mir. Es war unglaublich laut. Ich glaubte nicht, dass es jemand schaffen könnte – schon gar nicht ich.
Der Sprung über das Gleis dauerte exakt zweikommasieben Sekunden. In diesen zweikommasieben Sekunden hörte der Globus auf, sich zu drehen; in diesen zweikommasieben Sekunden winkte mir der Mond und in diesen zweikommasieben Sekunden fiel mein Herz auf das Gleisschotter. Der linke Poller der Lok schrammte eine Handbreit an meinem Po vorbei.
Der Schotter auf der anderen Seite fing meine Landung hart auf. An den Handballen und an den Knien schürfte ich mir die Haut blutig. Der Luftwirbel des Zuges zerrte an meinem Körper. Aber ich hatte es geschafft.
Vor mir, vom Mond sonderlich grell bestrahlt, erhob sich die Ruine, in dessen Eingang Diana und der Junge sich geküsst hatten. Bevor der Zug vollends an mir vorüber war, schleppte ich mich in das Gebäude.
Ich musste begreifen: Eine offene Flucht war sinnlos. An Schnelligkeit und Ausdauer konnte ich mit meinem Widersacher nicht mithalten.
Vom Mond fielen Lichtstrahlen klar und eigentümlich abgegrenzt in die Ruine. Doch blieb mir keine Zeit, dies zu bewundern. Das Ende des Zuges nahte. Und der Zug war die einzige Barriere zwischen meinem Verfolger und mir.
Der Mondschein erhellte den einzigen Raum darin, als wäre er ein Scheinwerfer. Ziegelsteine und Dachpfannen, größtenteils zerbrochen, bedeckten den Boden. Es knirschte unter meinen Schuhen. Unheimlich laut, wie es mir vorkam. Die hinteren Wandreste, die von der Straße nicht einsehbar gewesen waren, waren noch abgetragener als jene auf der gegenüberliegenden Seite. Sie ragten in einer Höhe, die gerade noch meiner Größe entsprach.
In der ganzen Ruine bot sich nicht ein geeignetes Versteck. Ernüchternd. Mein schöner Plan hatte mich in eine Falle geführt. Wie ein Reh, das von einer Meute Hunde in die Enge getrieben war, blieb ich stehen und lauschte in die Nacht. Ohne Ausweg.
In diesem Augenblick stieß etwas Hartes gegen meine Leiste, dass ich vornüber kippte. Im Fallen drehte ich mich nach hinten, griff mit meinen Armen in die Luft, um einen Halt zu finden. Ich bekam etwas Rundes, Längliches zu fassen. An dem anderen Ende des Gegenstandes bewegte sich etwas.
Was auch immer es war, es bremste meinen Sturz nicht; im Gegenteil: Es stürzte über mich. Weiche Haare fielen in mein Gesicht. Ich roch die betörende Nähe eines weiblichen Körpers.
„Julian?“
Das war Dianas Stimme.
Dann wurde mir schwarz vor Augen.
II
Der Mond beleuchtete mein Lager. Sein Licht war genau so intensiv, wie es mir kurz vor meinem Sturz aufgefallen war.
---ENDE DER LESEPROBE---