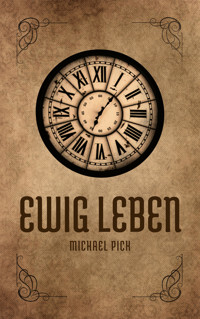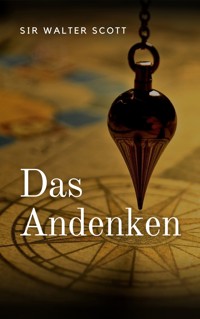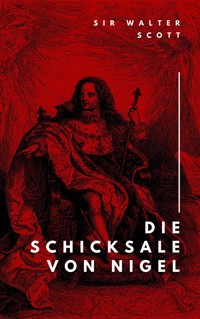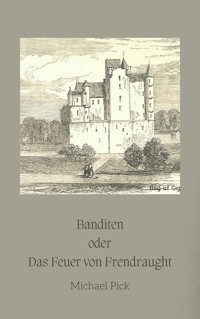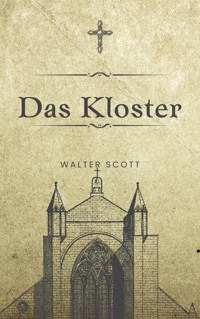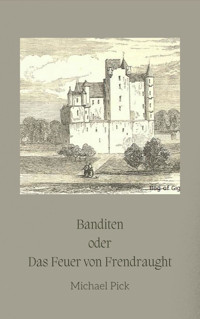SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zum ersten Mal alle Science-Fiction-Werke von Michael Pick in einem Buch. Zur Sammlung zählen die Romane "Ewig Leben", "Newropa", "Anima Migratio", das Drehbuch zu "Anima Migratio" und die Kurzgeschichte "Sirius". Science Fiction in all seinen Facetten auf mehr als 400 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Science-Fiction
Gesammelte Werke
Michael Pick
Copyright © 2024 Michael Pick
All rights reservedThe characters and events portrayed in this book are fictitious. Any similarity to real persons, living or dead, is coincidental and not intended by the author.No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher.CopyrightMichael PickImkenrade 15g23898 [email protected]
Science-Fiction
Gesammelte Werke
Michael Pick
Ewig Leben
Michael Pick
Primo
In jenem Herbst reiften auf dem Strand der Hebrideninsel Runa seltsame Früchte.
Ein Auto, ein französisches Fabrikat, parkte lässig auf den Kieseln. Dem Fahrzeug gefiel es, auf dem Dach zu liegen. Zuweilen schlug eine Windböe auf eines der Hinterräder und drehte es zum Spiel. Die Tür auf der Fahrerseite war aus den Angeln gerissen und zeichnete mit der unteren Kante, einzig noch an einem schwarzen Gummiband an der Karosserie hängend, eine rechtwinklige Spur in den Sand. Über den Strand marodierten ein Dutzend Sturmmöwen. Ihre Schreie prallten gegen das Kliff und verloren sich über dem Meer.
Zwei Schritte vom Wagen entfernt ruhte ein Mann auf dem Bauch. Arme und Beine streckte er weit vom Körper, als forme er da Vincis Proportionsstudie nach. Zuweilen schlugen ihm Wellen über den Kopf, zausten in seinen Haaren, manchmal nässten sie knapp seine Stirn. Der grobe Wind fuhr steif unter den Anzug, beulte das cordbraune Jackett aus, als hätte der Mann einen Buckel.
Zwischen dem Menschen und dem Wagen lag ein opalblauer Diplomatenkoffer. Die Breitseiten aufgeklappt wie die Schalen einer verdorbenen Auster. Auf dem brackigen Wasser, das sich im Koffer gesammelt hatte, trieb eine blaue Brotschatulle.
I
Am Abend zupften Cirruswolken über den Himmel wie zerzauste Wattebäuschen. Arktische Temperaturen über Grönland und ein verzweifelt später Sommereinfall auf den Azoren waren zu den Geburtshelfern einer ausgeprägten atlantischen Schlechtwetterfront geraten. Dieses Tiefdruckgebiet entfachte einen Orkan, der die Insel Runa, knapp fünfundzwanzig Kilometer vor dem schottischen Festland gelegen, für einige Stunden fest mit seinen Pranken umklammerte.
Mit Eintreffen der Kaltfront konvertierte der Landregen, der kurz zuvor eingesetzt hatte, zu einem dunkelgrauen Vorhang aus schweren Regentropfen. Pfiffen über die grasbewachsenen Hügel des Eilandes.
Über die aufgewühlte Landschaft hasteten die Kegel zweier Scheinwerfer. Im Rückspiegel des Autos blinkte die rote Flugsicherungsbeleuchtung über der Silhouette des Skytowers, Sitz der Firma LifeandAge, wie das Feuer eines Leuchtturmes.
Der Wagen, ein etwa fünf Jahre altes, französisches Modell, folgte der Straße nach Süden. Hinter dem Steuer beugte sich ein Mann weit nach vorne, dass seine Stirn gegen die angelaufene Frontscheibe stieß. Über sein melonenrundes Gesicht perlten unablässig Schweißtropfen und verliefen anschließend im Halsteil seines Rollkragenpullovers.
Die Lüftung dröhnte auf der höchsten Stufe. Ohne Unterbrechung pumpte sie fiebrig-heiße Luft in den Innenraum des Wagens. Ein beißender Geruch nach Schweiß und finnischer Fichte kroch aus den Polstern der Sitze.
Der Fahrer schaltete hektisch in den dritten Gang und ignorierte die Beschwerde des Getriebes. Der Sturm verschluckte mit seinem schauerlichen Gewimmer das Motorengeheul und trommelte pausenlos Regentropfen gegen das Fahrzeug.
Mit beiden Händen packte der Mann das Lenkrad. Wenn er glaubte, eine besonders gefährliche Stelle überwunden zu haben, wischte er den Schweiß auf seinen Händen am Hosenstoff ab. Mit aufgerissenen Augen suchte er das Chaos außerhalb der Scheiben zu durchleuchten.
Straßen sollten rot oder gelb gefärbt sein, dachte er.
Wie Nebelschwaden jagten Böen Regentropfen waagerecht durch das Licht der Scheinwerfer. Der Mann am Steuer vermochte keine fünf Meter weit zu sehen.
Drei Minuten bis zum Fähranleger. Nur drei Minuten; einhundertachtzig Sekunden, eintausendachthundert Wimpernschläge. Die Kurve noch und den Hügel hinab. Das sollte dir Mut machen, dachte er. Doch die Falten auf seiner Stirn glätteten sich nicht. Die grünen Pupillen flackerten nervös.
Sein Blick fiel auf die Uhr in der Fahrzeugarmatur. Ziffern und Zeiger leuchteten schwachblau.
In fünf Minuten legt die Fähre ab.
Der Mann drückte das Gaspedal nach unten. Hinter der nächsten Linkskurve würde er die Steuerbord-Positionslichter der „Isadora“ sehen können.
Du musst es schaffen, ermunterte er sich, du musst.
Wie ein Albtraum tauchte der Monitor eines Computers vor seinen Augen auf. Eine simple Textdatei. Zwei Sätze. Zwei mittellange Sätze hatten ausgereicht, um seinen Verdacht zu bestätigen. Irgendwie hatte er nach all den Monaten der Suche etwas Anspruchsvolleres erwartet.
Selbst in seiner Vorstellung hatte er sich nicht die Grausamkeit ausmalen können, diese Menschenverachtung, die, wenn er daran dachte, in seiner Seele wütete wie ein leckes Glas Salzsäure. Der Abscheu unterdrückte sogar die Befriedigung, das Rätsel und die Geheimnisse gelöst zu haben.
Vor genau zwei Stunden hatte er das letzte Puzzleteil gefunden, den Beweis einer Ungeheuerlichkeit. Er spürte, wie die Erkenntnis von einer große Furcht begleitet wurde. Eine Furcht, die sich in sein Gesicht eingrub und seine Kehle zusammendrückte.
Du musst rechtzeitig zur Fähre gelangen. Die Öffentlichkeit muss diese Information erfahren.
Sein Blick fiel auf die schwarze Aktentasche, in der sich neben der blauen Frühstücksbox, die Khadiras zarte Finger hineingelegt hatte, die gesammelten Ergebnisse seiner Recherchen, festgehalten auf einem USB-Stick, befanden.
In letzter Sekunde wich er einem Verkehrsschild aus, das der Sturm aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geworfen hatte. Am Rand der Scheinwerfer tauchten Schatten aus der Nacht auf. Rote Lichter blinkten unvermittelt auf der Straße, wie auf dem Landeplatz eines außerterristischen Raumschiffhafen.
Mit voller Kraft trat er auf das Bremspedal, die roten Leuchten erwiesen sich im Scheinwerferlicht als Barken, die eine schräge Linie quer über die Fahrbahn zogen.
Der Fahrer erkannte, dass er nicht rechtzeitig vor der Absperrung stoppen konnte und wich instinktiv nach rechts, der Barkenlinie folgend, aus. Der Wagen setzte über den Straßenrand und kam, fünf Meter weiter, in einem flachen Entwässerungsgraben, zum Stehen.
Als der Mann feststellte, dass das Fahrzeug nicht mehr rollte, atmete er langsam ein und aus und lehnte die Stirn gegen die obere Rundung des Lenkrades.
Zwei Meter weiter und du wärst die Klippen hinunter gestürzt. Glück gehabt. Wie nur kamen die verdammten Barken auf die Straße?
Plötzlich hörte er unter dem Fahrzeug ein hässliches Geräusch, als rutschte Metall über Metall. Auf der Beifahrerseite stieß etwas unsanft gegen die Tür und das Geräusch unter dem Fahrzeugboden verstummte so unerwartet wie es aufgetaucht war. Dem Mann traten beinahe die Glaskörper aus den Augenhöhlen, doch es gelang ihm nicht, das Dunkel außerhalb des Wagens zu durchdringen. Er erinnerte sich an die Schatten, die er am Straßenrand zu sehen geglaubt hatte. Kalter Schweiß lief über seine Haut.
Ein bisher unbekanntes Gefühl panischer Angst überwältigte ihn. Er atmete kurz und flach, sein Puls schwirrte. Verschwinde! war sein einziger Gedanke. Verschwinde!
Er zog am Hebel, um die Tür zu öffnen. Sie ließ sich einen daumenbreiten Spalt aufstoßen; dann klemmte sie. Irgendetwas blockierte die Tür von außen, als hätte jemand einen Findling davor gerollt.
Verdammt!
Sein Herz pochte wild und chaotisch. Verzweifelt warf er sich mit der Schulter gegen die Fahrertür; versuchte es wieder und wieder. Die Luft ging ihm aus und er japste wie ein Fisch.
Beißendes Motorengeheul drängte sich durch den Spalt, aber es kam nicht von seinem Wagen. Eine Dieselwolke trieb Tränen in seine Augen und fraß den Sauerstoff; sein Auto war Benziner. Wieder diese schleifenden Geräusche unter dem Wagen. Das Fahrzeug zitterte. Der Mann warf sich mit der blassen Schulter gegen die Tür, stemmte den Rücken an den filzverkleideten Wulst unterhalb der Scheibe und drückte mit angezogenen Beinen gegen die Mittelkonsole.
Der kleine Spalt zwischen Tür und Rahmen blieb die einzige Verbindung zur Außenwelt. In dem Konzert der aufgewühlten Natur vermeinte er ein menschliches Lachen zu hören – vollkommen irre und bar jeder Vernunft.
Es ging rasend schnell. Der Wagen stieg einen halben Meter in die Luft, das Fahrzeug bewegte sich in Richtung Beifahrertür, drehte einen Halbkreis nach rechts.
Durch die Frontscheibe sah der Mann die Lichter des Skytowers. Wie ein Geist im schwarzen Umhang ragte das Gebäude aus der Nacht und starrte zu ihm herüber.
Es ist zu spät.
Instinktiv stemmte er sich mit aus Verzweiflung geborener Kraft gegen die Tür, wollte nicht wahrhaben, was sein Verstand längst begriffen zu haben schien. Zu seiner Überraschung sprang die Tür auf. Es war nicht die Zeit zum Jubeln. Sein einziger Gedanke lautete: Raus hier! Allem zum Trotz: dem Sturm, seiner Angst. Raus hier!
Sein Fuß stieß ins Leere, als hätte der Orkan ganz Runa fortgetragen. Eisiges Grauen jagte ihm über den Rücken. Gischt zischte unter ihm um schwarze Klippen, weißgekrönte Wogen warfen sich auf den grau schimmernden Strand.
Er befand sich fünf Stockwerke, zwanzig Meter, über dem Meer. Der Wagen ächzte, als fühlte auch er Angst. Dann kippte das Fahrzeug zur Seite.
Endlich verstand der Mann, dass sein Tod beschlossene Sache war.
II
Atlantische Wellen warfen sich unter großem Getöse gegen die Felsklippe. Weißschäumende Kronen sprangen auf den Stein, höhlten, tauchten ab und nahmen kurze Zeit später einen neuen Anlauf.
Augustus Mooney kam nicht umhin, die Unermüdlichkeit zu bewundern, mit der die Wellen gegen das Gestein anrannten. Mit dem Optikum, das sein linkes Auge ersetzte, maß er wieder und wieder Geschwindigkeit und Kraft der Wogen.
Famos.
Ein Regiment tiefhängender grauschwarzer Wolken unterstützte den Angriff aus der Luft. Mooney hörte die Regentropfen gegen die Fenster auftreffen; getrieben vom Westwind, der fauchte und wütete, als wäre das Ende der Welt gekommen.
Oder der Anfang einer neuen Welt, dachte Mooney und dämmte das Licht, bis die Nacht auch im Konferenzsaal des Skytowers angekommen war.
„Eliahs“, sprach er in den Kommunikator, gleichzeitig Sender und Empfänger, der in seinem linken Handballen implantiert war und an ein silbernes Omega erinnerte.
„Meister?“, die Antwort kam unmittelbar und klar.
„Die Zeit ist gekommen. Schalte die Teilnehmer auf mein Zeichen zu.“
„Ja, Meister.“
Augustus Mooney warf einen letzten Blick auf das Schlachtfeld zu seinen Füßen. Der Natur kam sehr gut ohne den Schnickschnack von Liebe und Vergebung aus. Angst war das Gefühl, auf das es ankam und das alles antrieb. Unerbittlich zählte sie die Verweilzeit einer jeden Kreatur herunter – doch er, Augustus Mooney, war auf dem Weg, sämtliche Gesetze dieser Welt zu brechen und seine eigenen Regeln zu erschaffen.
Mooney kontrollierte den Konferenzraum. Die Örtlichkeit erstreckte sich über die gesamte zweiundzwanzigste Etage des Skytowers. Das Neonlicht schimmerte gedämmt durch den Raum, sodass die Möbel im Zimmer mit einer düsteren Patina belegt schienen. Das weißlackierte Metall des Konferenztisches kroch schemenhaft aus der Dunkelheit hervor. Mooney zog einen viereckigen handtellergroßen Spiegel aus der Anzugtasche. Das Licht reichte nicht, um sein Antlitz auszuleuchten.
„Zuerst der Duke, Eliahs.“
Sofort öffnete sich surrend eine halbmeterlange quadratische Platte auf dem Tisch. Aus der Öffnung stieg langsam ein silberfarbener Monitor empor und richtete sich zum Standort des Hausherren aus. Zwei Augenblicke lang beherrschte das Summen der Elektromotoren den Raum.
Auf dem Bildschirm leuchtete ein weißer Punkt auf, vergrößerte sich strahlenförmig und allmählich schälte sich ein schemenhaft dargestellter schwarzer Kopf auf hellgrauem Hintergrund heraus.
„Euer Durchlaucht. Ich freue mich, dass Ihr wieder mein Gast seid.“
„Ich überhaupt nicht, Mooney, ich überhaupt nicht“, dröhnte eine künstlich verzerrte Stimme aus den Monitorlautsprechern. „Um ehrlich zu sein, Mooney, ich bin das Thema bald überdrüssig. Möglich, dass sich die Angelegenheit überhaupt und demnächst auf natürliche Weise regelt. Ohne Euer Mittel werde ich älter und älter. Und nach älter kommt, wie Ihr korrekt vermutet, der Tod.“
Über Mooneys Gesicht huschte ein Schatten, ohne dass sein Gegenüber es bemerken konnte.
„Ein Grund mehr, heute und mit einem gewagten Gebot das Medikament zu ersteigern.“
„Natürlich. Aus Euch spricht der Geschäftsmann und ich bin ohne Zweifel ein ideales Opfer. Gott weiß es, ich auch, Ihr am besten. Ihr manipuliert mich mit meiner Angst vor dem Tod.“
Mooneys Miene wurde um einige Grade kälter.
„Nun, Durchlaucht, Ihr wisst um die Bedingungen. Eliahs, Nummer zwei.“
„Ja, Meister.“
Ein weiterer Monitor fuhr aus dem Konferenztisch, präsentierte das stilisierte Konterfei eines Mannes und schwenkte in Mooneys Richtung.
„Guten Abend. Für die heutige Auktion habe ich Ihnen die Nummer zwei zugeteilt.“
„Sind Sie verrückt geworden? Nummer zwei? Hören Sie, Mooney, Sie schlitzohriger ...“, hier schien es, als überlegte der Sprecher ob eines passenden Schimpfwortes, besann sich aber offensichtlich eines anderen, „... merken Sie sich: für mich existiert keine Zahl Zwei.“
Bevor Mooney etwas darauf antworten konnte, sprach der Duke of Sandringham: „Hallo, Nummer Zwo, hier spricht die Nummer Eins. Offensichtlich hat unser Freund Mooney äußerst weitsichtigen Geschmack, was die Vergabe gewisser Reihenfolgen betrifft. Doch zu Eurer Hoffnung, es gibt für Euer Problem eine Lösung, wie der gute Mooney sicher ebenfalls vorschlagen wollte. Überlasst mir heute das vermaledeite Medikament und Ihr werdet beim nächsten Mal garantiert die Nummer Eins.“
„Meine Herren oder Damen! Es hat keinen Sinn, sich abzusprechen. Nummer Zwei: die Reihenfolge, mit der ich die Teilnehmer zuschalte, ist willkürlich gewählt und trifft weder eine Aussage meiner Wertschätzung noch zum vermuteten Auktionsergebnis.“
„Bedauerlich“, warf Nummer Eins ein, „alles, was im Leben zählt, ist Geld. Richtig, Mooney? Wir drehen uns im Kreis.“
Dieses Mal huschte ein Lächeln über das Gesicht des Geschäftsmannes, ohne dass es die Anspannung fortwischen konnte, die auf ihm lag.
„Eliahs, Nummer Drei.“
Die Stille, die nach Augustus Mooneys Order folgte, wurde durch das neuerliche Summen von Elektromotoren abgelöst. Auf dem grauen Hintergrund des Monitors erschien eine Kopfsilhouette, der Mooney die entsprechende Zahl zuteilte.
„Hallo Nummer drei! Nach Aussage unseres Gastgebers hat Ihre Nummer heute keine Aussicht auf Erfolg. Es wäre besser, Sie verzichten von vornherein“, meldete sich Nummer Zwei.
„Ist das wahr?“, selbst die verzerrte Computerstimme konnte den besorgten Unterton nicht überspielen.
„Natürlich nicht“, Mooney klang nicht verärgert, eher amüsiert. „Nummer Zwei scheint in ausgelassener Stimmung zu sein. Beunruhigen Sie sich nicht, Nummer Drei, es entscheidet allein ...“
„... Geld“, Nummer Eins und Zwei im Chor.
„Vielleicht ist es genau das, was mich beunruhigt“, ließ die Drei verlauten.
„Nummer Vier, Eliahs.“
Mooney hatte es eilig.
Während der Monitor hochfuhr, erklärte Augustus Mooney den anderen Teilnehmern, dass Nummer Vier der letzte und neu in der heutigen Runde war.
„Was, Mooney? Kann es möglich sein? Finden Sie keine Kunden mehr?“, Nummer Zwei lachte kantig.
„Lassen Sie das ruhig meine Sorge sein“, Augustus Mooney flüsterte beinahe aber an dem Ton konnte man sich schneiden.
„Darauf können Sie Gift nehmen, wenn`s beliebt. Je weniger Mitstreiter, umso besser für mich und meinen Geldbeutel. Auch ich kann rechnen, Mooney.“
Augustus Mooney trat einen Schritt näher an die Monitore. Das gedämmte Neonlicht zeichnete den Kreis seiner Reichweite, sodass der Gastgeber zur Hälfte in düsteres Licht getaucht war und zugleich von Schwärze und Geheimnis umgeben blieb.
„Meine Damen, meine Herren! Im Namen der Firma LifeandAge heiße ich sie herzlich willkommen zur diesmonatigen Auktion. Die meisten von ihnen wissen bereits, welches Wunder, welche Gabe sie ersteigern können. Es handelt sich um nicht weniger als den Wunsch, nein, DEN größten Wunsch der Menschheit. Jenes, was in den Augen der ganzen Welt unbezahlbar ist“, der Moderator setzte eine Pause, um seine Worte wirken zu lassen, „drei Dinge: Erstens, sie bekommen von mir die Möglichkeit, diesen Zugang zum Paradies zu besitzen. Zweitens, für sie ist es bezahlbar. Drittens, sie gehören danach einem exklusiven Klub von einer neuen Spezie Mensch an. Der- oder diejenige von ihnen, der oder die heute auf dieser Auktion das höchste Gebot abgibt und den Betrag innerhalb einer Stunde auf eines meiner Konten transferiert, erhält das Medikament für ...“, Mooney hielt die Luft an, als lausche er seiner eigenen Stimme, „... EWIGES LEBEN.“
Das Schweigen verursachte eine Pause, als wartete jeder auf die Reaktion von Nummer Vier.
„Dann ist es also wahr?“
„Allerdings, Nummer Vier. Ich garantiere Ihnen, dass Sie ab dem Zeitpunkt der Einnahme einer Tablette Nonagerie körperlich keine Sekunde altern werden.“
„Wie funktioniert das? Ich meine, kaum zu glauben, dass Sie ein solches Mittel gefunden haben wollen. Ich habe noch nie in den Medien davon gehört.“
„Das letztere wird auch so bleiben. Andernfalls wäre es mir kaum möglich, einem exklusiven Kreis, wie dieser einer ist, Nonagerie anbieten zu können. Zur Zusammensetzung und Wirkungsweise kein Wort. Vertrauen sie mir. Das Mittel besitzt keine Nebenwirkungen. Es ist, nun, sagen wir, einfach famos.“
„Kaum zu glauben“, aus Nummer Viers Stimme war noch immer deutliche Skepsis herauszuhören.
„Ich zwinge Niemanden, mir zu glauben oder mitzubieten. Es ist allein Ihre Entscheidung.“
Augustus Mooney ließ Madame Frederike Lafayette, die sich hinter Nummer Vier verbarg, eine Bedenkminute, bevor er die Auktion fortsetzte.
„Da Nummer Vier zum ersten Mal an unserer Runde teilnimmt, erkläre ich die Modalitäten: Auf dem Gerät vor ihnen finden sie Nummerntasten. Bitte geben sie ihr Gebot in Britischen Pfund ein. Das Minimalgebot lautet eine Million Pfund. Sobald alle einen Betrag eingetippt haben, werde ich die Entscheidung bekannt geben. Die oder der Höchstbietende erhält den Zuschlag. Sollten zwei oder mehrere ein gleichhohes Gebot abgegeben haben, besteht einmalig die Möglichkeit zu erhöhen. Noch Fragen?“
Es meldete sich Niemand.
„Dann gebe ich die Gebote frei. Meine Damen und Herren, bitte.“
Auf den Monitoren, unter den schematisierten Köpfen, erschien ein rechtwinkliges Display, das als Platzhalter für die erwarteten Zahlen rote waagerechte Striche aufwies. Augustus Mooney war versucht, die Augen zu schließen, die Innenfläche seiner rechten Hand wurde feucht und er war froh, dass sein anderer Arm aus einer Prothese bestand.
Nummer Zwei war der erste, der seinen Preis eingegeben hatte und Mooney atmete zufrieden auf. Das Gebot übertraf seine Minimalerwartungen. Die Haltung des Gastgebers entspannte sich, das Warten fiel ihm plötzlich ungleich leichter. Nummer Vier war die letzte, die einen Betrag bestätigte.
„Meine Damen, meine Herren! Nichts geht mehr, wie es so schön heißt. Wir haben einen Gewinner. Es ist: Nummer Vier. Nummer Eins bis Nummer Drei, bis zum nächsten Monat. Eliahs.“
Ein dreifaches Summen erklang und die Monitore der unterlegenen Bieter verschwanden unter die Tischplatte.
„Madame, meinen Glückwunsch. Sie haben sich heute einen Traum erfüllt, der nur wenigen auf dieser Welt beschieden sein wird, ja, den einige nicht zu träumen wagen, so abwegig würde er ihnen erscheinen. Wenn ich hinzufügen darf: zu einem Preis, der niemals den Gegenwert dessen erreichen kann, was ich Ihnen dafür schenken werde. Ich erläutere Ihnen jetzt das weitere Verfahren.“
Mooney konnte sich sicher sein, dass Madame Lafayette jedes Wort von seinen Lippen lesen würde.
III
Marcus bog in einem akkuraten Viertelkreis von der Burnsroad und parkte den himmelblauen Ford Kuga auf dem Besucherparkplatz. Die Straße zwischen ihm und seiner Wohnung gähnte gelangweilt. Liisa war schon zu Hause, das zweisitzige Cabrio stand auf dem Parkplatz vor der Haustür.
Marcus hätte ihren Wagen auch ohne Nummernschild an der Delle an der rechten Heckseite erkannt. Sie passte genau zu der Rundung des Laternenpfahls auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Liisa hatte den Ärger fortgelacht und war dennoch ein bisschen erleichtert gewesen, als die Laterne am Abend des Zusammenstoßes ein mattes Licht auf die Burnsroad warf.
Liisa verstand es ausgezeichnet, Probleme wie einen Luftballon zu behandeln. Drohte er zu platzen, ließ sie die Luft raus. Ganz einfach.
„Wurde Zeit, dass Sie nach Hause kommen, Violess!“
Die helle Haustür der Nachbarin zur Linken, mit dem Bullauge in der Mitte, war lediglich angelehnt gewesen und jetzt hüpfte eine hexenähnliche Gestalt auf den Gehweg.
„Mrs. Krustschow“, Marcus nickte seiner Nachbarin Krustschow flüchtig zu und wünschte sich einen Umhang, der ihn unsichtbar machen konnte.
„Ich habe auf Sie gewartet“, umstandslos zwängte sich die dralle Mittfünfzigerin zwischen Marcus und seine Haustür.
Obgleich die Frau nicht größer als eineinhalb Meter maß, kratzte die Spitze ihrer roten Haarpracht, hochgesteckt wie der Turm von Pisa, an Marcus Kinn, wenn sie so dicht vor ihm stand. Natalia Krustschow arbeitete als Essensausgeberin in der Kantine von LifeandAge und war unverheiratet, unverlobt und unverliebt. Ein gleichmäßiger Duft von Kartoffelwasser und Jägersoße umgab sie. Ihr Anblick erinnerte Marcus an einen feisten, kurz vor der Pensionierung stehenden, Stier.
„Hat meine Frau etwas angestellt?“, erkundigte sich Marcus mit einem verbindlichen Lächeln.
Mrs. Krustschow blickte ihn an, als hätte er sie gefragt, ob der Mond auf die Erde gefallen wäre.
„Ihre Frau? Mitnichten“, über ihren ausladenden Busen und den Bauch, die übergangslos ineinander liefen, spannte sich eine rote Wachstuchschürze mit handgroßen, weißblühenden Gänseblümchen, die jetzt vor Aufregung zitterten.
„Nein“, Mrs. Krustschow stemmte die Arme in die Hüften, „es geht mir um das hier!“
Mit dem rechten Fuß beschrieb sie einen Kreis in die Luft. Marcus kratzte sich am Kopf. Offenbar hatte Mrs. Krustschow es auf ihn abgesehen. Verzweifelt blickte er sich um.
„Ich verstehe nicht.“
„So? Dachte ich mir schon“, brummelte die Nachbarin und kniff die Augen zusammen, „kommen Sie mal näher mit ihren Seh- und Riechorganen.“
Ohne weitere Umstände packte sie seinen Arm und zerrte Marcus zu dem Vorgarten vor dem Reihenhaus.
„Hätte ich mir denken müssen. Mein Fehler. Männer und Beschränktheit sind eineiige Zwillinge. Und jetzt?“
Mrs. Krustschow breitete die Arme aus und deutete vage in Richtung Haus.
„Fangen wir bescheiden an. Was fällt Ihnen auf?“
Da gibt es einiges, dachte Marcus, aber sicher nichts, was die alte Vettel von mir hören will. Er fühlte Schweißtropfen auf seiner Stirn und kam sich vor, wie bei seiner Examensprüfung. Reiß dich zusammen, Marcus, reiß dich bloß zusammen, sonst reißt sie dir die Augen aus dem Kopf und zerquetscht sie unter ihren Hauspantoffeln.
Er ließ den Blick über das Haus gleiten, das in vier Partien aufgeteilt war. Die linke Endreihenhauswohnung bewohnte ein älteres Ehepaar, das ganz für sich lebte. Die Glücklichen. Marcus kannte weder ihre Namen, noch konnte er sich an ein Gesicht oder einen Ausdruck von ihnen erinnern. Es folgte Mrs. Krustschow, Liisa und er. Das andere Ende beschloss Graham Goodwillie. Mir fällt nur auf, dass wir zwischen den schrecklichsten Nachbarn der Welt leben.
„Na?“, Mrs. Krustschow wippte auf einem Bein. „Macht irgendetwas Piep?“
„Puh. Das war ein langer Tag heute“, Marcus blies die Backen auf. „Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie anspielen.“
Mrs. Krustschow beugte sich vornüber, dass ihre Haare den Boden streiften, breitete die Arme aus und verharrte in dieser Stellung wie ein Skispringer, der den richtigen Punkt zum Absprung suchte. Als sie sich aufrichtete, schimmerte der Kopf wenigstens so rot wie ihre Haare. Sie deutete, ein wenig resignierend, wie es Marcus schien, auf ein Dutzend Brennnesseln, eine Kolonie Rhododendron und Weidenröschen, die sich in Marcus und Liisas Vorgarten, vornehmlich selbständig, angesiedelt hatten. Marcus musste anerkennen, im Vergleich zu den anderen Vorgärten nahm sich ihr Stückchen Erde in etwa wie ein Dschungel zum städtischen Kurpark aus.
„Zugegeben ...“
„... zugegeben reicht nicht. Sie müssen etwas dagegen tun. Das Zeug ...“, hier wedelte sie mit den Armen wie eine Windmühle, „schauen Sie sich dies hier an!“
Mrs. Krustschow zerrte Marcus auf ihre Seite des Vorgartens und präsentierte ihm ein Pflänzlein mit pelzigen Blättern, dessen Namen er nicht im Entferntesten erahnte.
„Das da ist von Ihrem Unkrauthaufen ausgebüchst und unter meinen geliebten, gepflegten Rasen gekrochen. Es hat ihn untergraben und ist auf meinem Grün wie ein Maulwurfshügel explodiert. Ein Hort stinkenden schleimigen Eiters. Verstehen Sie mich jetzt?“
Mit jedem Wort wurde Mrs. Krustschow lauter.
„Das tut mir leid“, stammelte Marcus und steuerte in Richtung Hauseingang.
„Das tut mir leid“, äffte sie ihn nach. „Worte, nichts als Worte, Violess“, ihre Stimmlage blieb auf Gipfelniveau, es gab keine Steigerung mehr. „Wissen Sie, was Ihre Frau mir zur Antwort gab, als ich sie heute darauf ansprach?“
Wahrheitsgemäß zuckte Marcus mit den Schultern. Liisas Antworten waren nie vorhersehbar. Hinter seinem Rücken spürte er wie jemand stehenblieb. Aus den Augenwinkeln erkannte er ein junges Pärchen, das seinen geröteten Nacken neugierig betrachtete. Sensationslüsterne Aasgeier, angelockt durch den Krawall einer Oberhexe. Marcus spürte, wie seine Handflächen nass wurden, er trippelte auf der Stelle.
„Ich werde meine Frau sofort befragen“, Marcus schummelte sich an der überraschten Mrs. Krustschow vorbei.
Er öffnete die Tür und zog sie hinter sich zu, bevor die Nachbarin etwas dagegen sagen konnte. Als die Haustür hinter ihm ins Schloss fiel, lehnte er sich rücklings an die Wand im Flur und seufzte.
IV
In der Wohnung war es ruhig, was mehr als ungewöhnlich war, wenn Liisa zu Hause war. Üblicherweise beschallten Radio oder Fernseher sämtliche Räume. Ich bin zu Hause, wo es laut ist, war einer von Liisas Lieblingssprüchen. Sie fühlte sich erst glücklich, wenn Alexander Pumkins Drums den Laminat unter ihren Füßen zum Beben brachte. Angeborene Hörstörungen.
Marcus tauschte die schwarzen Lackschuhe gegen grünrote Filzsandalen, hängte seinen Mantel an den Kleiderständer, der ihn an einen bleichen, toten Baum erinnerte. Liisa hatte ihn von einer Vortragsreise aus Manchester mitgebracht. Noch heute erinnerte Marcus sich an das verdutzte Gesicht von Mrs. Krustschow, als Liisa ihn von den Sitzen ihres Cabrios zerrte und mit der Miene eines erfolgreichen Kunsthändlers an ihr vorbei ins Haus schleifte.
Die Uhr im Wohnzimmer zeigte Viertel vor Fünf. Marcus schloss die Augen und atmete tief durch. Eines wurde es mit Liisa gewiss nicht: langweilig.
In der letzten Zeit kam es öfter vor, dass er sich über sie ärgerte. Es war ihm, als wäre seine Frau ein Hort von Ärgernissen. Zum Beispiel, das die Terrassentür offen stand. Von der Wohnküche führte eine Glastür auf eine kleine Steinterrasse, die in einem ungepflegten Rasenstück überging. Ein Trampelpfad begrenzte das kleine Grundstück.
„Liisa?“, rief Marcus in die Stille.
Typisch Liisa, sie riecht es, wenn man sie zur Verantwortung ziehen will. Der Vorgarten war ihre Zuständigkeit. Marcus lächelte bitter, als er sich erinnerte, ihr vorgeschlagen zu haben, Rasen zu säen, wie die anderen auch. Liisa hatte die Luft hinausgestoßen, dass ihre Oberlippe wie Espenlaub zitterte.
„Kommt nicht in Frage. Ich bin niemals wie die anderen.“
Marcus klangen ihre Worte noch in den Ohren.
„Du bist so kreativ wie ein Felsen. Lass mich nur machen.“
Das hatte er jetzt davon, wobei es genau das Ende war, das er vorhergesehen hatte.
„Liisa?“
In der Wohnung blieb es still. Seine Mutter hätte sich in solchen Augenblicken vor dem Spiegel in den Flur gestellt, die Fäuste in die Hüfte gestemmt und sich angeschrien, bis alle Wut aus ihr geflossen war. Es war nicht das erste Mal, dass Liisa es ihm überließ, eine Angelegenheit in Ordnung zu bringen.
„Liisa?“, er ahnte bereits, dass auch auf diesen Ruf keine Antwort erfolgen würde.
Die Abendsonne tauchte die Wohnküche in mediterrane Tomatensoße. Neben der Edelstahlspüle lungerte ein halbvoller tiefer Teller. Hühnersuppe, schätzte Marcus und verzog die Mundwinkel. Wenigstens abwaschen hätte sie können.
„Liisa?“, auf dem Weg in das obere Stockwerk kam Marcus der Gedanke, dass Liisa vielleicht mit einem Liebhaber im Ehebett lag. Die Idee war nicht hartnäckig, verflüchtigte sich und Marcus schalt sich einen Narren. Dennoch flatterte sein Herz, als er vor der Schlafzimmertür stehen blieb.
Aber das Bett war unberührt, wie er es am Morgen verlassen hatte und starrte ihn vorwurfvoll an. Liisa war nicht zu Hause.
Marcus schlenderte in die Küche und legte einen Filter in die Kaffeemaschine. Liisa musste zu Hause sein. Ihr Auto stand vor der Tür. Ausgeschlossen, dass sich seine Frau mehr als zehn Meter ohne ein Fahrzeug fort bewegte.
Sorgfältig zählte er fünf Löffel Kaffeepulver ab und füllte den Wassertank, bis die Markierung die Wasseroberfläche bedeckte. Marcus schaltete die Maschine ein und betrachtete nachdenklich den Suppenteller.
Ihr könnte etwas zugestoßen sein.
Die Idee nistete sich wie ein Kuckuck in seinen Verstand ein.
Ihr wird nichts zugestoßen sein. Nicht hier. Nicht seiner Liisa.
Gurgelnd stürzte das Wasser in das Kaffeepulver. Marcus tastete mit dem kleinen Finger in den Rest der Suppe in dem Teller. Sie war noch warm. Lauwarm.
Marcus Gedanken überschlugen sich. Er stellte die leere Tasse auf die Arbeitsplatte.
Wie eine Filmsequenz tauchte die Szene mit seinem Freund Robert vor Marcus Augen auf. Der Tag von Liisas Hochzeit.
„Hast du ein Glück, Marcus“, hatte ihm Robert kurz vor der Trauung zugeraunt.
„Was meinst du?“
„Deine Liisa ist ein Wahnsinnsweib. Was die für ein niedliches Gesicht hat und gleichzeitig den perfekten Körper einer Frau. Wenn ich mit Liisa irgendwo alleine wäre, könnte ich für nichts garantieren.“
Marcus hasste das dreieckige Grinsen auf Roberts Gesicht. Und noch mehr die Andeutungen, die hinter seinen Worten steckten.
„Untersteh dich, auch nur daran zu denken“, hatte er ihm damals zugeflüstert.
Robert grinste anzüglich und zog sich zurück, aber Marcus musste ihm im Stillen Recht geben. Liisa war eine aufregende Verschmelzung aus jugendlich naivem Gesichtsausdruck und dem Körper einer Frau.
Wenn Marcus sich nur vorstellte, dass ein Fremder seine Liisa beobachtet hatte. Ihren sinnlichen Gang, die ausufernde Gestik, mit der sie ihre Worte begleitete, gleich ob in einem Zwiegespräch oder während einer Vorlesung an der Universität.
Vielleicht war der Kerl – diese Bestie, Marcus hatte den Täter fest vor Augen, - ihr hierher gefolgt, hatte abgepasst, als seine Frau mit der Suppe beschäftigt war und dann ...
Marcus schüttelte sich. Er kämpfte gegen eine aufsteigende Panik an. Immerhin beruhigte ihn ein Umstand. Es gab keine Anzeichen dafür, dass jemand gewaltsam in das Haus eingedrungen war. Er musste sogar lächeln, wenn er daran dachte, dass ein Fremder ungesehen an Mrs. Krustschow vorbei wollte.
Vielleicht hatte Liisa ihren Entführer gekannt und ihm arglos die Tür geöffnet. Marcus wurde übel vor Sorge. Bleib ruhig!, sagte er sich. Es gab keine andere Wahl: er nahm das schnurlose Telefon aus der Halterung und wählte drei Ziffern.
„Hallo? Mein Name ist Marcus Violess. Bitte kommen Sie schnell. Meine Frau ist entführt worden. Vermutlich.“
V
Nach dem Sturm schwirrte die Luft vor Klarheit. Durch die gläserne Westseite des Skytowers drang Tageslicht ungehindert in den Raum. Reste der Wolkendecke dümpelten verstreut am Himmel; sie malten weiße Tupfer auf das kräftige, frische Blau.
Augustus Mooney blickte von seinem Ankleideraum im dreiundzwanzigsten Stockwerk auf den Atlantischen Ozean, der heute kaum merklich in Bewegung war.
„Eliahs!“
Ein Mann von etwa dreißig Jahren näherte sich aus dem hinteren Bereich des Zimmers und trat mit leicht gesenktem Kopf hinter Augustus Mooney.
„Meister.“
Seine Stimme klang sanft wie die eines Predigers. Er trug das schwarze Haar kurz geschnitten, dazu einen tadellos sitzenden Frack, einen gestärkten Hemdkragen, der ihm den Hals wundscheuerte, und eine schwarze Fliege.
„Meine Kleider.“
„Welche Farbkombination wünscht Ihr heute zu tragen?“
Mooney wand den Blick nicht vom Ozean.
„Eliahs, was ist dein Lebenswunsch?“
Mooneys Leibdiener zupfte an seinen Ohrläppchen. Eliahs mochte keine offenen Fragen.
„Ich verstehe nicht.“
Augustus Mooney trat einen Schritt näher an die Fensterscheibe, sodass ihn nur das bruchsichere Glas vom Abgrund trennte.
„Es muss doch etwas geben, das du, selbst für den Preis deines Lebens, zu besitzen wünschst. Etwas, das deinen Geist immerdar ausfüllt und sich in deine Träume stiehlt. Eine Famosität. Vielleicht eine Fähigkeit? Leugne nicht. Jeder Mensch trägt einen solchen Samen in sich.“
Eliahs zog fragend die Augenbrauen hoch. Auf seiner Stirn lagen Falten und Mooney hörte ihn die Luft scharf einziehen.
„Mein einziger Wunsch ist, Euch treu und gut zu dienen, Meister.“
Mooney knöpfte das weißseidene Schlafoberteil auf. Die Hornknöpfe ritzten seine Haut.
„Erzähl mir keine Märchen, Eliahs. Wie steht es mit Geld?“
„Ihr seid sehr großzügig. Ich kann mich nicht beklagen. Wäre Rot-Schwarz Euch als Farbe für den Tag angenehm?“
Mooney streifte den Oberkörper frei. Nicht zum ersten Mal betrachtete Eliahs den Körper seines Gebieters. Eine braune fingerbreite Naht trennte auf ihrem Weg vom Hals bis unter den Bauchnabel die rechte und die linke Seite, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Eliahs hatte lernen müssen, den Ekel zu verdrängen. Jahrelang kamen ihm nachts die Bilder von Mooneys missgestaltetem Körper, manchmal übergab es sich.
Im Licht der aufgehenden Sonne strahlte der Metallüberzug auf Augustus Mooneys linker Seite wie die Rüstung eines Ritters. Tausend Mal hatte Eliahs sich gefragt, wie Mooneys Eltern es fertiggebracht hatten, ihren Sohn in einen Cyborg zu verwandeln. Auf der rechten Seite Sehnen, Muskeln und Fleisch. Links dagegen die Mechanik und Elektronik eines Roboters.
„Ich hasse schwarz, Eliahs, schwarz ist die Farbe des Todes. Aber rot ist gut. Weiße Hose, weißes Hemd ... das mit den Rüschen am Brustrevers. Dazu eine fleischfarbene Fliege und das gleichfarbige Jackett. Hurtig, Eliahs, der Tag ist nicht zum Maulaffen feilhalten geboren.“
Eliahs huschte zum Kleiderschrank, der links und rechts in die Wände des schlauchförmigen Zimmers eingearbeitet war. Drei Minuten später tauchte Mooneys Leibdiener auf und hielt in seinen Händen die gewünschten Kleidungsstücke.
„Meister?“
Augustus Mooney wirkte unwirsch, als er sich seinem Diener zuwandte.
„Du redest viel heute Morgen.“
Eliahs kniff die Lippen zusammen und reichte seinem Herrn nacheinander Hose und Hemd. Die wachen Augen und die zittrigen Finger zeigten, dass Eliahs etwas auf dem Herzen lag.
„Zum Teufel, Eliahs, wo bist du heute mit deinen Gedanken?“
Mooney hatte das Hemd und die Hose übergestreift und wartete auf die Fliege und das Jackett, die Eliahs in seinen Händen hielt.
„Verzeiht, Meister. Seid Ihr zufrieden gewesen mit dem Ergebnis der gestrigen Versteigerung?“
Eliahs hielt Mooney die Fliege vor. Sein Herr grunzte wie ein Schwein vor einem Teller Erbsensuppe und Speck.
„Wenn jede Auktion mit einem solchen Ergebnis endet, kann ich nach zehn Versteigerungen aufhören.“
Eliahs war dieses Mal aufmerksamer und reichte Mooney im richtigen Augenblick das Jackett.
„Dann hätte ich genügend Geld, um ein Leben ohne Ende genießen zu können.“ Mooneys rechtes Auge leuchtete, während das andere stumpf blieb. „Unter solchen Umständen bekommt der Begriff lebenslänglich eine völlig andere Bedeutung.“
„Ihr wollt das Mittel wirklich selbst einnehmen?“
Bei der Frage horchte Mooney auf. Der Geschäftsmann war sich plötzlich sicher, in Eliahs Stimme eine unberührte Saite aufklingen gehört zu haben.
„Ist es das, was du dir wünschst, Eliahs? Ewiges Leben?“
Eliahs senkte den Kopf und gab keinen Ton von sich. Sein Herr blieb unbeeindruckt.
„Sprich! Willst du das Mittel für dich? Dünkst du dich auf einer Stufe mit mir?“
Eliahs ließ sich von dem halb vertraulichen Ton seines Meisters nicht täuschen. Oft genug hatte er erleben müssen, wie solche Stimmungen und Launen von einer Sekunde auf die andere in das Gegenteil umschlugen.
„Es würde mir niemals einfallen, etwas anderes von Euch zu erbitten, als Eure Zuneigung, Herr.“
Eliahs verneigte sich.
„So wie mein Vater Eurem Vater bedingungslos diente, will ich Euch dienen und ich werde es tun, solange Ihr es wünscht und meine Kräfte es zulassen.“
Mooney warf einen prüfenden Blick in Eliahs Gesicht. Dann winkte er ab.
„Schweig von meinen Eltern, Eliahs. Ich mag es nicht hören.“
Mooney wandte sich abrupt von seinem Diener ab. Über seine rechte, menschliche Gesichtshälfte lief plötzlich ein Krampf. Die Muskeln verhärteten sich und verzerrten die sonst so kühlen Züge zu einer groteskenhaften Fratze. Der Geschäftsmann schrie gellend auf.
Zuerst vermutete Eliahs, es wäre Wut oder die Erinnerung an seine Eltern, die den Schrei ausgelöst hatte. Dem Diener war nicht wohl in seiner Haut. Mooneys fratzenhafte Visage bereitete ihm Angst - auf der einen Seite jene unbewegte, beherrschte, künstliche Erscheinung und die andere Hälfte ein kochender Kessel vollgestopft mit Emotionen und Schmerzen.
Als wären sie nicht von seinem Verstand, drängten Töne aus Mooneys Mund, schrill und geheimnisvoll wie der Schrei eines Adlers. Die rechte, menschliche Hälfte in Mooneys Körper krümmte sich vor Schmerz und glühenden Stichen, während die andere in Metall gegossen, fast unbeteiligt, ausharrte. Es war eine Art moderner Quasimodo, der vor Eliahs geboren wurde, ein Halb-Frankenstein und alle antrainierte Beherrschung verhinderte nicht, dass dem Diener ein Ton des Abscheus entwich.
„Massi ... massi ... massiere mich!“
Die Worte schossen wie heiße Luft aus einem Dampfkessel. Es gab in diesem Augenblick nichts Schrecklicheres für Eliahs, als das er gezwungen war, seinen Meister zu berühren. Der Diener schloss die Augen und tastete vorsichtig nach der rechten Körperseite von Mooney. Unter seinen Fingerkuppen fühlte Eliahs, wie die Muskeln seines Herrn entspannten. Dermaßen ermutigt, begann er zu kneten und spürte, wie die Zuckungen an Intensität verloren, wie sich die Kraft und Wut in Mooneys Herz zurückzog.
Eliahs öffnete die Augen. Augustus Mooney stieß die Hände seines Dieners von sich.
„Du ekelst dich vor mir.“
In Mooneys Stimme schwang eine Spur Gekränktheit mit. Eliahs beeilte sich, das Gegenteil zu versichern.
„Nein, Meister. Es war nur ein Moment der Schwäche. Ein dummer Fehler.“
Augustus Mooney fuhr herum.
„Leugne es nicht. Ich habe den Abscheu in deinen Augen gesehen“, Mooney drehte sich dem Fenster zu. „Was soll ich machen? Du hast recht. Ich bin ein Monster. Ein Monster, geschaffen von seinen Eltern. Ein Frankenstein des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Ein Fluch. Ich erinnere mich, wie ich als Kind den Ausdruck in den Augen der Menschen gehasst habe. Ekel vor Augustus Mooney.“
Eliahs berührte den Arm seines Herrn.
„Nicht, Herr. Ihr seid ...“
„Schweig! Ich weiß es und zum Teufel, du weißt es auch. Aber ich besitze etwas, das die Welt ihren Atem anhalten lassen wird. Ich besitze die Lösung zu einem Geheimnis, welches meinen Eltern ihr Leben lang verwehrt gewesen war. ICH, ICH, ICH habe es und SIE nicht. SIE werden es niemals besitzen.“
Mooney richtete sich auf und breitete die Arme aus. So stand er vor dem Fenster, als wollte er den Morgen samt Ozean umarmen.
„Verschwinde jetzt aus meinen Augen, Eliahs. Ich dulde es nicht, wenn jemand in meiner Gegenwart die Beherrschung verliert.“
„Es wird nicht wieder vorkommen, Meister. Ich verspreche es Euch.“
Augustus Mooney dachte einen Augenblick nach.
„Es ist gut. Ich glaube dir – um deines Vaters wegen, der immer ein guter Diener meiner Familie gewesen war.“
Eliahs hielt das Jackett hoch, damit Mooney in die Ärmel schlüpfen konnte. Der Diener bewunderte aufs Neue, wie geschickt Mooney mit seiner Prothese hantieren konnte.
„Hast du dich um das Problem mit diesem Mitarbeiter gekümmert – wie war noch sein Name?“
„Röder.“
„Richtig, Röder. Ein dämlicher Name, findest du nicht auch?“
Eliahs, da sein Herr nun vollständig angekleidet war, verschränkte die Arme auf dem Rücken.
„Das Problem wurde auf die Weise gelöst, wie Ihr es angeordnet habt.“
Mooney lauschte dem Klang der Worte seines Dieners. Irgendetwas kam ihm dabei sonderbar vor.
„Du bist nicht damit einverstanden gewesen.“
Eliahs verbeugte sich.
„Verzeiht, Meister. Meine Meinung ist so flüchtig wie der Flügelschlag eines Kolibris. Euren Befehlen wurde Folge geleistet. Ohne eine Sekunde des Zögerns.“
Mooney kniff das rechte Auge zu. Es kam Eliahs vor, als lese sein Meister mit dem Optikum in seinem Gesicht und in seinen Gedanken. Unter dieser Prüfung fiel es ihm besonders schwer, eine gleichgültige Miene zu behalten.
„Eliahs“, Mooneys Stimme wurde plötzlich fromm und milde wie ein Lamm zu Ostern, „ich kenne dich, seitdem ich lebe. Du kannst kein Blut sehen. Das wird immer dein Fehler sein.“
Eliahs wollte aufbegehren, aber Mooney hielt ihn mit einer Handbewegung zurück.
„Es ist die Wahrheit, Eliahs. Doch lass dir gesagt sein, du wirst mit dieser Einstellung keinen Erfolg haben.“
Mooneys Leibdiener war es gewohnt, seinem Meister in allen Angelegenheiten Recht zu geben und nickte zum Einverständnis mit dem Kopf.
„Sind alle Spuren beseitigt? Hast du Röders Dateien gelöscht, konnte eine Information den Skytower verlassen?“
„Ich habe alles persönlich überprüft.“
„Das ist auch erforderlich, Eliahs. Lerne: Verlasse dich nur auf dich selbst.“
„Ja, Meister. Benötigt Ihr mich noch?“
Augustus Mooney näherte sich dem Fenster und winkte seinen Diener fort.
Du kannst dich nur auf dich selbst verlassen. Eliahs ist mir treu aber zu weich; das war schon der Fehler seines Vaters. Und mein Vater?
Mooney lachte bitter.
„Der Teufel habe ihn selig.“
VI
Für Marcus verrann die Zeit, als wären die Körner einer Sanduhr zu Golfbällen mutiert. Fiebrige Schüttelanfälle rasten über seinen Körper, Schweiß zog einen Film über seine Handinnenflächen. Er wagte nicht vor die Tür zu gehen, aus Angst, Mrs. Krustschow konnte dort patrouillieren und ihm unangenehme Fragen stellen.
Marcus öffnete das Kippfenster im Badezimmer einen fingerbreiten Spalt. Von hier aus vermochte er die Straße vor seinem Haus einzusehen.
Drei Minuten und fünfundvierzig Sekunden nachdem er den Notruf abgesetzt hatte, bog ein blauweiß lackierter Austin Martin von der Fraserstreet in die Burnsroad ein. Gelbe waagerechte Streifen klebten seit letzter Woche am Wagen, Marcus hatte es im städtischen Anzeiger gelesen. Mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit, hatte es in der Überschrift geheißen.
Der Austin parkte ordnungsgemäß vor dem Bürgersteig. Marcus stürmte aus dem Bad, die Treppe hinab, riss die Tür auf und winkte den Polizisten zu.
„Sie warten hier!“, Kommissar Mairat sah aus, als hätte man ihn in die Uniform gebügelt.
An keiner Stelle wagte der marineblauen Stoff Falten zu werfen. Das Gesicht frisch in einer Kastenbrotform gebacken. Unnatürlich braun und kantig – unter Kommissar Mairats Kollegen war es eine geläufige Ahnung, dass seine zweite Heimat ein Fitnessstudio mit Anschluss an ein Solarium war.
Der Kommissar stieg aus dem Wagen und verschaffte sich einen Überblick. Er zückte einen schwarzen Notizblock aus seiner Gesäßtasche, nicht größer als eine Zigarettenschachtel, und kritzelte mit einem Bleistift darin herum.
Marcus hielt geradewegs auf ihn zu.
„Gut, dass sie ...“
Der Kommissar unterbrach ihn mit erhobener Hand. Marcus hörte in seinem Rücken trippelnde Schritte. Natürlich konnte Mrs. Krustschow ein Ereignis wie einen Polizeiwagen vor ihrem Haus niemals übersehen, noch würde sie es unkommentiert belassen.
Marcus hatte es schon von weitem bemerkt: den Polizisten umgab eine düstere Aura. Vielleicht lag es an den pechschwarzen, dichten Haaren. Obgleich er sorgfältig rasiert schien, lagen um Kinn und Oberlippe dunkle Schatten. Nach dem Aussehen würde Marcus auf einen Italiener tippen.
„Wer sind Sie?“
Der Kommissar zeigte mit dem Bleistift links an Marcus vorbei. Es gab ein Geräusch, als versuchte jemand die Hacken seiner Filzpantoffel zusammenknallen.
„Natalia Krustschow. Ich wohne hier. Wenn ich so sagen darf, ich habe ein Auge ...“
„Haben SIE mich gerufen?“
„Äh, nein. Aber es wurde Zeit ...“
„Dann muss ich Sie bitten, sich in Ihrer Wohnung aufzuhalten, bis ich zu Ihnen komme. Es könnte sein, dass ich Ihr Wissen um das Leben in diesem Haus auf die Probe stellen muss.“
Marcus klatschte innerlich Beifall. Mit dem letzten Satz dürfte der Kommissar Krustschows Herz erobert haben. Er empfand große Verehrung für Menschen, die mit solchen Kreaturen, wie Mrs. Krustschow, gewaltfrei umgehen konnten. Jetzt erst bemerkte Marcus, dass der Ordnungshüter schwarze Augen und eine knorrige, kantige Nase hatte.
„Guten Tag“, der Polizist reichte Marcus die Hand, „ich bin Kommissar Mairat. Ich nehme an, Sie sind Marcus Violess.“
„Woher wissen Sie das?“
Der Kommissar kniff das linke Auge zusammen.
„Wir haben einen Notruf aus der Burnsroad Nummer Neunundzwanzig von einem gewissen Marcus Violess erhalten. Sie kamen gerade aus jener Wohnung und sahen blass und verstört aus. Übrigens nur solange, bis Ihre Nachbarin erschien, da wandelte sich Ihr Ausdruck in verärgert bis peinlich berührt.“
Der Kommissar klappte das Notizbuch zu.
„Treffend beobachtet“, stammelte Marcus.
„Wir sollten jetzt in Ihre Wohnung gehen. Ich möchte die Spuren sichern und einige Antworten von Ihnen.“
Die letzten Worte waren keineswegs drohend gesprochen, doch Marcus fühlte einen Stich in seinem Herzen. Die ganze Zeit über fragte er sich, ob er Liisas Entführung hätte verhindern können. Dieser Kommissar Mairat schien Gedanken lesen zu können; jedenfalls ein Mann, der nicht nur auf seine Frage eine Antwort zu geben wusste.
Keine fünf Meter neben ihnen klebte ein roter Haarbusch nebst Kopf an der Wand von Burnsroad Siebenzwanzig zu Burnsroad Neunundzwanzig und mühte sich, jedes Wort der Unterhaltung aufzuschnappen.
VII
Der Kommissar bat Marcus an der Eingangstür zu warten. Er zückte das schwarze Notizbuch und nahm die Eindrücke der Wohnung auf. Marcus fühlte sich in der Gesellschaft eines Wünschelrutengängers, der nach verborgenen Energieströmungen im Haus suchte. Als Mathematiker bevorzugte er eine rationale, logische Vorgehensweise bei der Lösung von Problemen. Den Kommissar vermochte er diesbezüglich nicht einzuschätzen.
„Mr. Violess, wie lange sind Sie und Ihre Frau verheiratet?“
„Zwei Jahre und vier Monate“, kam es wie aus der Pistole geschossen.
Das genaue Wissen um Jubiläen war ein Rat seines Vaters. Präge dir die Daten deiner Frau wie Geburtstag, Hochzeitstag, Tag des ersten Kennenlernens, Verlobungsdatum und wie lange du verheiratet bist, fest ein. Du wirst bald erkennen, wie segensreich eine solche Vorgehensweise ist. Und zwar potenzial steigend mit fortschreitendem Alter.
„Kam es in dieser Zeit vor, dass Ihre Frau, nun sagen wir, sich gelegentlich nach ein wenig Freiheit sehnte?“
Marcus richtete sich auf. Hatte er sich verhört? Wollte der Polizist etwa andeuten, Liisa wäre freiwillig, sozusagen vor ihm, geflohen?
„Hatten sie Streit?“
DAS ging jetzt entschieden zu weit.
„Wie steht es mit Ihnen? Sind Sie verheiratet?“
Die Antwort des Kommissars kam schnell.
„Nein. Zum Glück.“
Der Polizist lächelte matt. Marcus zuckte resignierend mit den Schultern. Seine Argumentationskette war gleich am Anfang gerissen.
„Natürlich haben wir uns manchmal gestritten. Ich meine, das ist doch normal zwischen zwei Menschen“, Marcus liftete die Augenbrauen und breitete die Arme aus. Was weiß der schon von Liisa und mir?
Kommissar Mairat verzog keine Miene.
„Kein Grund sich aufzuregen. Reine Routinefragen.“
Er schlenderte zur Wohnküche und betrachtete den Suppenteller neben der Spüle.
„Der war noch warm als ich nach Hause kam“, erklärte Marcus, der dem Polizisten wie ein Schatten gefolgt war.
Wann will der Typ endlich anfangen, nach Liisa zu suchen?
Der Kommissar betrachtete den jungen Mann nachdenklich. Dem Polizisten waren etliche Fälle bekannt, in denen Ehefrauen vor einem unbefriedigenden Alltag oder untreuen, versoffenen oder unhygienischen, kurz unbefriedigenden Ehemännern Reißaus genommen hatten. In besonders schweren Umständen vereinigten die Gatten alle drei Attribute auf sich. Allerdings sprachen in diesem Fall die Indizien und dieses lammfromme, besorgte Exemplar neben ihm nicht für seine anfängliche Vermutung.
Die Unwegbarkeiten des weiblichen Charakters war einer der Gründe, warum Mairat nie geheiratet hatte. Sein bullenhaftes Aussehen, der durchtrainierte Körper zog bestimmte Frauen an wie grelles Licht an einem Sommerabend Mücken. Kommissar Mairat aber war mit seiner Arbeit verheiratet und daneben gab es keinen Platz. Zur Ehrenrettung beider Geschlechter musste er zugeben, dass in seiner Statistik mindestens genauso viele entflohene Ehemänner auftauchten.
„Ihre Frau heißt Liisa Violess. Sie ist um die dreißig Jahre alt, kurze, schwarze Haare, zierliches, fast mädchenhaftes Gesicht, sportliche Figur, etwa einen Meter fünfundsechzig groß.“
Der Kommissar sah an Marcus geöffnetem Mund, dass er mit seinen Vermutungen richtig lag.
„Ihre Frau ist temperamentvoll, besitzt Humor und ...“
„Woher wissen Sie das alles über Liisa?“, Marcus war nicht überrascht, er war geschockt. „Haben Sie sie beobachten lassen? Steckt die Polizei hinter ihrer Entführung? Sagen Sie mir, was hier vor sich geht!“
Marcus fühlte sich wie eine Maus in einer Rattenfalle. Kommissar Mairat lächelte schwach.
„Ich habe Ihre Frau noch nie gesehen. Aber in Ihrer Wohnung gibt es genügend Hinweise.“
Er zeigte auf das Foto im metallenen Rahmen auf der Wohnzimmeranrichte, auf dem Liisa und Marcus während der Flitterwochen am Strand von Miamar, Havanna, zu sehen waren. Ein Ganzkörperfoto, Liisa trug einen schwarzen Bikini. Ein sehr privates Foto, wie Marcus fand.
„Die Wohnung ist nicht übermäßig aufgeräumt“, mit einem Seitenblick auf Marcus, ergänzte der Polizist, „Das lässt darauf schließen, das andere Angelegenheiten eine höhere Priorität besitzen als übermäßige Hausarbeit.“
Marcus kam sich wie eine volle Regentonne vor, in die fortwährend Wasser gekippt wurde. Was bildete sich dieser Kerl ein? Nur weil er Polizist ist, denkt er, kann er die Lebensweise von Menschen kritisieren? Marcus spürte die Steifheit, die sich in seinen Körper einschlich.
„Wann haben Sie mit Ihrer Frau zuletzt gesprochen? Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?“
Der Ton des Kommissars blieb unbeirrt sachlich und knapp. Marcus überlegte und spielte dabei mit seinem Ehering.
„Heute Morgen, kurz nach sieben Uhr bin ich zur Arbeit gefahren. Liisa musste erst später, eine Stunde, glaube ich, zur Universität. Sie hatte heute Vorlesungen. Sie lehrt an der Universität auf Skye. Mathematik. Wir haben uns während des Studiums kennen gelernt. Meistens ist sie spätestens gegen Fünfzehn Uhr zu Hause. Wir telefonieren selten miteinander wenn wir arbeiten. Nur in Notfällen. Heute war keiner. Jedenfalls ...“
„Verstehe“, der Kommissar kritzelte ein paar Worte in sein Notizbuch und sah keineswegs so aus, als hätte er auch nur die Hälfte der Worte geglaubt. Zu gerne hätte Marcus gewusst, was der andere schrieb.
„Gut, Mr. Violess. Ich habe vorerst alle Fakten, die ich für den Fahndungsaufruf nach Ihrer Frau benötige. Ich werde alles Weitere veranlassen. Sergeant Mackennzie wird bei Ihnen bleiben, für den Fall, dass es sich um eine Entführung handelt und die Entführer mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Soweit – so klar?“
Der Kommissar wartete die Antwort nicht ab und stelzte in großen Schritten zur Wohnungstür. Marcus folgte ihm benommen, ohne eine Ahnung zu haben, ob es richtig war, was er machte oder nicht. Irgendwie kam es ihm schrecklich wenig vor, was er selber dazu beitrug, um die Suche nach Liisa zu forcieren.
Oder steckte etwas anderes dahinter?
„Sie glauben mir doch, oder?“ Marcus zupfte den Kommissar am Ärmel.
„Es wäre nicht das erste Mal, dass sich eine Vermisstenmeldung als unbegründet herausstellen würde. Vielleicht holt Ihre Frau Zigaretten vom Automaten um die Ecke.“
„Wie kommen Sie ...“, die Wut in Marcus verschluckte alle weiteren Worte. „Meine Frau raucht nicht.“
„Routine, alles Routine. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden Ihre Frau finden. Schließlich ist das hier Runa und nicht Glasgow oder Edinburgh.“
Marcus war nicht nach Lachen. Er begleitete den Polizisten zur Haustür. Der Kommissar bat ihn, hier auf Sergeant Mackennzie zu warten.
VIII
Sergeant Mackennzie drehte am Frequenzknopf des Autoradios, um den Sender einzustellen, den sein Chef, Kommissar Mairat, gewöhnlich zu hören pflegte, als er endlich den Tumult rund um den Wagen bemerkte. Etwa zwanzig Personen hatten sich vor dem Reihenhaus in der Burnsroad versammelt. Die Anführerin schien eine kleine, dralle Endfünfzigerin zu sein, die ihr hexenrotes Haar zu einem schiefen Turm drapiert hatte.
Die eindeutige Anweisung seines Chefs lautete, im Wagen auf ihn zu warten, bis Mairat die Untersuchung beendet hatte. Auf der anderen Seite konnte sich Mackennzie sehr gut vorstellen, dass Kommissar Mairat angesichts des Menschensauflaufs nicht begeistert sein würde. Gleich von welcher Seite der Polizist es betrachtete: Sergeant Mackennzie saß in der Falle.
Verließ der Sergeant den Wagen, um die Menschentraube zu zerstreuen, handelte er gegen den ausdrücklichen Befehl seines unmittelbaren Vorgesetzten. Blieb er aber sitzen und tat nichts, was ihm im Übrigen am liebsten war, lief er Gefahr, sich zornige Blicke und einen altstimmigen, kurzatmigen Ranzer von Mairat einzufangen. Die Entscheidung wurde Mackennzie abgenommen, als die Tür zur Wohnung des Ehepaares Violess, Burnsroad Neunundzwanzig, aufgestoßen wurde.
Der Kommissar warf einen missmutigen Blick auf den Auflauf. Den Sergeanten übersah Mairat absichtlich. Hätte nie geglaubt, dass ich mich an Unfähigkeit gewöhnen würde.
„Mrs. Krustschow!“, Mairats Stimme bellte über die Vorgärten. „Mrs. Krustschow, stellen Sie sich mal bei mir ein!“
Auch wenn man Natalia Krustschow eine gewisse Selbstbehauptung nie verleugnen durfte, in diesem Augenblick waren ihr leicht gebeugter Kopf und der schlurfende, zögerliche Gang sichere Indizien dafür, dass der Kommissar sie fest im Griff hatte.
„Hatte ich Ihnen nicht empfohlen, in Ihrem Haus auf mich zu warten?“
Auf diese schneidend wie ein Frühlingswind vorgetragenen Worte wusste Natalia Krustschow keine andere Antwort, als ihren Kopf zu senken, bis ihr Blick die sorgfältig polierten Schuhe des Polizisten traf. Anstelle einer Strafrede legte der Kommissar seinen Arm um ihre Schultern.
„Trotz allem, und Sie haben mich durch Ihre Mittäterschaft an diesem Auflauf sehr enttäuscht, setze ich noch immer großes Vertrauen in Sie.“
Es hörte sich an, als spräche der große, vierkantige Mann mit einer Drittklässlerin.
„Ich bin sicher, Ihre Überzeugungskraft wird diesen Mob innerhalb einer Minute zerstreuen.“
Bei den letzten Worten streckte sich die kleine, rote Frau in Mairats Armen. Bevor sie jedoch die Anweisung ausführen konnte, hielt der Kommissar Mrs. Krustschow am Ärmel zurück. Sein Blick ging gerade an ihr vorbei.
„Mr. Violess, wenn mich nicht alles täuscht, steht Ihre Frau dort drüben unter den Leuten.“
Marcus, dem es gar nicht in den Sinn gekommen war, sich die Schaulustigen näher zu betrachten, erkannte Liisa sofort. Neben ihr stand der graue Graham Goodwillie und lächelte blöd.
IX
„Meister?“
Augustus Mooney runzelte die Stirn. Zwischen elf und dreizehn Uhr war es Tabu, ihn zu stören. Eliahs wusste das besser, als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Es musste ein außergewöhnlich wichtiger Grund sein, der seinen Leibdiener veranlasste, den Unmut seines Meisters auf sich zu nehmen.
„Eliahs, ich hätte nicht übel Lust, dich heute zu siebenteilen, mindestens vierteilen. Was zum Teufel kann so wichtig sein, dass du mich in meiner heiligen Zeit belästigst? Ist deinem Erbsenhirn entfallen, wie wichtig mit diese Stunden des Tages sind?“
Die Falten auf Mooneys Stirn erodierten zu Schluchten.
„Verzeiht, Meister. Es ist meine Schuld.“
„Natürlich ist es deine Schuld“, Mooney war keineswegs durch das Eingeständnis seines Dieners besänftigt, „über deine Strafe reden wir später. Und eine Strafe muss es geben.“
„Ja, Meister. Dr. Leith Goodwillie will Euch unbedingt und unaufschiebbar sprechen. Er drohte mir, als ich ihm mitteilte, welch unglückliche Stunde er für seinen Besuch gewählt hatte, mit Konsequenzen, die Euch empfindlich treffen würden, wie er es selbst ausdrückte.“
„Er wagt es mir zu drohen? Dieser Wurm“, obgleich Mooney geringschätzig die Mundwinkel verzog, konnte er eine gewisse Sorge nicht verbergen.
„Sage ihm, ich werde ihn in einer Viertelstunde empfangen.“
„Im Konferenzraum?“
Mooney überlegte einen Moment, schien geneigt, Eliahs Vorschlag zuzustimmen, entschied sich jedoch anders.
„Nein. Ich will ihn in deinem Büro sehen.“
Während Mooney die linke Körperhälfte von der Auflade- und Diagnosestation trennte, rief er sich ins Gedächtnis, was er gegen Dr. Goodwillie in der Hand hatte. Er erinnerte sich an eine Kolumne über den Arzt, die erst kürzlich im Runa Observer erschienen war. Eine Leuchte der Gesellschaft hatte der Reporter tituliert. Ein Wohltäter und Stütze der Menschheit.
Geschwafel! Wo viel Licht war gab es viel Schatten.
Doch eines war sich Augustus Mooney bewusst: Dr. Leith Goodwillie war momentan der Schlüssel zu seinen Unternehmungen.
Dieser Umstand bereitete dem Geschäftsmann keine geringe Sorge. Das Prinzip, das ihm sein verhasster Vater beigebracht hatte, war, sich zu keiner Zeit in die Hände eines anderen zu begeben. Auf diese Weise wurde man abhängig und erpressbar. Von dem Augenblick an, von dem Mooney erkannt hatte, dass Dr. Goodwillie einen solch bedeutenden Platz in seinen Plänen einnehmen musste, hatte er dafür gesorgt, diesen Mann in seine Gewalt zu bekommen.
Wo viel Licht ist, fällt oft ein sehr langer Schatten.
Unbestritten hatte Dr. Goodwillie das kleine Krankenhaus von Skye zu unerwarteten Weltruhm geführt. Die Forschungen auf dem Gebiet der genetischen Krebsheilung hatte es zum führenden Institut in dieser Frage befördert. Allerdings waren diese Forschungen zu einem sehr großen Anteil allein durch eine großzügige finanzielle Unterstützung von LifeandAge möglich.
Anfangs stand Leith Goodwillie den Angeboten von Augustus Mooney misstrauisch gegenüber. Doch Goodwillie war ehrgeizig – auf eine naive, humanistische Art, wie Mooney schnell herausgefunden hatte. Auch wenn Dr. Goodwillie sich nicht auf der Gehaltsliste von LifeandAge befand, wie es zwei Drittel der Ärzte und Schwestern vom Krankenhaus auf Skye taten, so waren seine Forschungen ohne Mooneys jährliche Finanzspritzen nicht möglich.
Augustus Mooney lächelte. Ich wäre ein Narr, wenn ich mich auf eine Versicherung alleine verlassen hätte. Mooney kleidete sich rasch an.
Vom Aufladezimmer begab er sich in den Flur. Dieser war in einem milden Lind gehalten und in der Form eines Hexagons geschnitten. Die nächste Tür zur Rechten führte in das Arbeitszimmer.
Dieser Raum war Augustus Mooneys Lieblingsort. Das Zimmer ähnelte einem gleichschenkligen Dreieck, in dessen Nichtbasiswinkel die Tür ihren Platz fand. Auch wenn jeder Architekt deswegen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hatte, dieses Zimmer war fensterlos geblieben. Wände, Decke und Fußboden war in einem jungfräulichen Weiß gehalten, dass in den Augen schmerzte und an frisch gefallenen Schnee erinnerte. Das Mobiliar, das aus einem deckenhohen Schrank, Schreibtisch und Bürostuhl bestand, unterschied sich kaum von den Wänden, da es die gleiche Tönung zeigte.
Als Mooney den Raum betrat, hätte der Betrachter aus der Ferne nur seinen Kopf, gleichsam schwebend auf einer roten Fliege und einem gleichfarbigen Jackett ausmachen können.
Die Lüftung erfolgte durch einige handlange Schlitze in der Decke. Der Schrank, der sich über die gesamte rechte Wandseite erstreckte, verbarg seinen Inhalt hinter verschiebbaren Metallplatten. Ein gewaltiger Schreibtisch, in der Form einer Erdnuss, und ein Drehstuhl, in der Art einer ausgehöhlten Walnuss, vervollständigten die Einrichtung.
Der einzige Gegenstand, der keinen Zweck zu erfüllen schien, war eine mannshohe Skulptur, die mit ihren bleichen, spinnenbeinförmigen Ausläufern einem toten Baum ähnelte. Auf diesen Gegenstand steuerte Mooney zu, packte einen der Zweige und knickte ihn.
Auf der anderen Seite des Zimmers setzten Elektromotoren an gleichzeitig zu summen, der Mittelteil des Wandregals bewegte sich scheinbar schwebend in den Raum. Nach einem halben Meter stoppte das Regal; es ruckelte einmal und schwenkte mit der rechten Flanke nach links, sodass ein schwarzer, zwei Meter breiter, Durchlass zum Vorschein kam.
Mit langen, raumgreifenden Schritten durchmaß Mooney das Zimmer und drückte mit dem rechten Zeigefinger auf eine daumenbreite Scheibe, in dessen metallischer Oberfläche sich millimetertiefe Riefen befanden. Beim Tastendruck unterlegte rotes Licht die Scheibe und wenige Sekunden später leuchtete sie grün.
Mooney nahm es grunzend zur Kenntnis und ließ die Taste los. Innerhalb von zwei Sekunden öffnete sich eine Schiebetür und gab einen rechteckigen Käfig mit quadratischer Grundfläche frei. Augustus Mooney begab sich in die Kabine. Die Seitenlängen maßen nicht mehr als zwei Meter. Alle Wände, auch Boden und Decke, waren mit Spiegeln verkleidet. Aber Mooney hatte keine Augen, weder für die Kabine noch für sich, noch für irgendetwas anderes.
Rechts von der Schiebetür befanden sich in einer senkrechten Reihe vierundzwanzig silberne Knöpfe, auf denen die Zahlen eins bis dreiundzwanzig und auf dem untersten der Buchstabe P aufgedruckt waren. Augustus Mooney drückte den Knopf mit der Nummer zwanzig. Die Schiebetür schob sich vor die Kabine und der Fahrstuhl surrte ein Stockwerk nach unten.
X
Kommissar Mairat hatte Marcus scharf unter Beobachtung. Wie war seine Reaktion auf die Entdeckung, dass seine vermisste Frau quietschfidel vor ihrer Wohnung auftauchte? Noch dazu in Begleitung eines Mannes.
Auf die erste, überraschende Freude mischte sich schnell Unwillen in Marcus Gesicht. Genau in dem Moment, Mairat hatte es exakt verfolgt, als des Ehemanns Blick auf den Begleiter seiner Frau fiel.
Auf der Seite der Frau war von Missvergnügen nicht die Rede. Sie kam mit einem seltsamen Leuchten in den Augen auf ihren Mann zugesprungen. Wenn der Kommissar nicht im Dienst gewesen wäre, hätte er sich keine Mühe gegeben, ein anerkennendes Pfeifen zu unterdrücken. Das Foto in Violess Wohnung wurde ihr nicht gerecht und hatte ihre Schönheit untertrieben. Der Kommissar suchte nach einem passenden Wort für das Gesicht, aber es wollte ihm nichts einfallen. Jedes Detail darin war leicht unterproportioniert im Verhältnis zum übrigen Körper, wirkte zerbrechlich und dadurch schützenswert. Als hätte man einer ausgewachsenen Frau das Gesicht einer Fünfzehnjährigen aufgesetzt. Das blonde, schulterlange Haar wippte ungebunden bei jedem ihrer Schritte. Im Stillen empfahl der Kommissar Marcus, gut auf diese Frau Acht zu geben.
„Was ist denn hier los?“
Liisa lachte über das ganze Gesicht.
„Schatz, hast du etwas ausgefressen?“
Sie umarmte ihren sprachlosen Ehemann, der einen Schritt vor der Haustür erstarrt war. Liisa legte Marcus die Hände auf die Schultern und streckte die Arme.
„... etwas ausgefressen?“, stammelte Marcus.
Der Kommissar räusperte sich.
„Nun, Mr. Violess, ich denke, die Akte kann ich hier schließen. Soweit – so klar.“
Er legte zwei Finger zum Gruß an die Stirn und eilte mit langen Schritten zum Polizeiwagen.
„Sag schon. Was hat das alles hier zu bedeuten?“, Liisas Lachen wurde keine Spur nachdenklicher.
In Marcus stieg eine Riesenwut vom Bauch bis in den Mundraum.
„Wo kommst du her?“, stieß er hinaus.
Liisa zuckte zurück. Die Freude in ihrem Gesicht löste sich auf wie Zucker im Regen. Der Polizeiwagen raste die Burnsroad hinab und bog nach rechts zum King George Place ein. Der Menschenauflauf hatte sich trotz des Verschwindens der Polizei nicht aufgelöst und wartete gespannt auf den Ausgang der Angelegenheit.
„Wärst du so freundlich, mit mir ins Haus zu gehen?“, zischte Marcus.
Für einen Augenblick war Liisa baff. Für diese Art der Begrüßung war sie nicht gerüstet gewesen.
„Keineswegs“, gab sie Marcus zur Antwort.
Um ihrem Wort Nachdruck zu verleihen, reihte sie sich in den Kreis der Passanten ein; Schulter an Schulter mit Graham Goodwillie.
„Ich bitte dich ernsthaft, mit mir jetzt ins Haus zu kommen. Ich möchte unsere Angelegenheiten nicht auf der Straße besprechen“, mit einem Seitenblick auf die neugierige Meute auf dem Bürgersteig, „oder vom Observer drucken lassen.“
Liisa versenkte demonstrativ ihre Hände in den Hosentaschen ihrer Jeans.
„Warum nicht? Bisher hast du nicht sonderlich zurückgehalten, was die Öffentlichkeit betrifft.“
Marcus biss sich auf die Unterlippe. Die Sorge um Liisa war lange schon in Ärger gekippt und je länger er im Mittelpunkt des Geschehens stand, umso wütender wurde er.
„Ich habe die Polizei gerufen, weil ich dachte, du wärest entführt worden.“
Mrs Krustschow und ihrer Horde standen die Münder offen. Aber nicht für lange. Lautes Gelächter schallte über die Burnsroad und Liisa war die Lauteste.
„Gut. Wie du willst“, schrie Marcus und stürzte ins Haus.
XI
Der Fahrstuhl stoppte im zwanzigsten Stockwerk des Skytowers. Die Schiebetür schnellte schnurrend zur Seite. Eliahs erwartete seinen Meister bereits.
„Was ist das denn?“, Mooney Schrei jagte seinem Diener einen Schauer über den Rücken.
Was meinte er?
Mooney steuerte mit kleinen schnellen Schritten auf ein Gebilde von halbmanneshoher Größe zu.
„Oh“, entfuhr es Eliahs, als erkannte, worauf sein Meister hinauswollte.
„Der ist wirklich echt“, Mooney wandte sich mit verzerrtem Gesicht ab. „Schaff es hinaus! Sofort!“