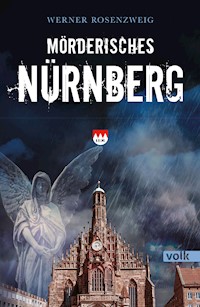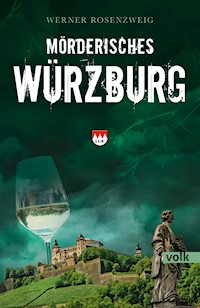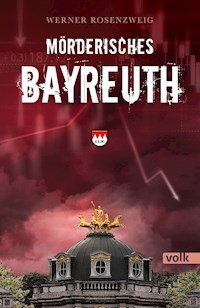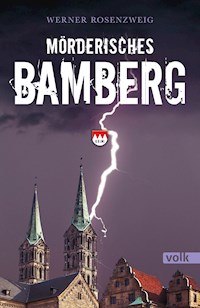Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Amol gschdochn is halbdod.« Der Satz stammt aus dem Mund von Kunigunde Holzmann. Frankens Karpfenland, der liebliche Aichgrund wird durch Hyalomma-Zecken bedroht, eine Zeckenart, die es in diesen Breitengraden gar nicht geben dürfte. In Erlangen wird ein Obdachloser, der von den kleinen Krabblern gestochen wurde, durch das Krim-Kongo-Fieber hinweggerafft. Die Ermittlungen der Gesundheitsbehörden laufen ins Leere. Wochen später erleidet in der kleinen fränkischen Gemeinde Röttenbach, ein bis dahin kerngesunder Bürger, überraschend das gleiche Schicksal. Kunigunde Holzmann und Margarethe Bauer, die beiden kriminalistisch begabten Witwen, glauben nicht an den Zeckenzauber. Wie recht sie haben: Ein perfider Mörder treibt mit den kleinen Blutsaugern sein Unwesen. Er lässt morden. Schließlich geht es um viel Geld. Die beiden Witwen benötigen viel Geduld und Bauernschläue, bis sie dem Täter auf die Schliche kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZECKENALARM IM KARPFENLAND
Werner Rosenzweig
ZECKENALARM IM KARPFENLAND
Zweider Röttenbacher Griminalroman -Frängisch gred, dengd und gmachd-
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2013
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Handlung und Personen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen
wären rein zufällig und unbeabsichtigt.
Copyright (2013) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Lektorat: Barbara Lösel, www.wortvergnügen.de
ISBN 9783954888030
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
PROLOG
Erlangen, Bohlenplatz, Mittwoch, 27. Juni 2012
Röttenbach, Kirchgasse, Donnerstag, 28. Juni 2012
Erlangen, Staatsstraße 2240, Sonntag, 1. Juli 2012
Röttenbach, Kirchgasse, Montag 2. Juli 2012, Tag der Franken
Erlangen, Bohlenplatz, Freitag, 6. Juli 2012
Eine Woche später, Staatsstraße 2240, unter der Brücke über dem Rhein-Main-Donau-Kanal, Freitag, 13. Juli 2012
Mordkommission der Stadt Erlangen, am späten Nachmittag des gleichen Tages
Röttenbach, Fischküche Fuchs, Sonntag, 15. Juli 2012
Frühmorgens am Bahnhof Erlangen, Montag, 16. Juli 2012
Am gleichen Tag im Haus des Mörders
Adelsdorf, Ortsteil Neuhaus, auf dem Bierkeller der Familie Wirth, Freitag 20. Juli 2012
In der Wohnung des Mörders, Sonntag, 29. Juli 2012
Röttenbach, im Haus von Kunni Holzmann, Samstag 4. August 2012
Auf der Bundesstraße 470, Mittwoch, 15. August 2012
Röttenbach, Gaststätte Fuchs, Freitag 17. August 2012
Röttenbach, am Tag nach der Geburtstagsfeier, Samstag, 18. August 2012
Rothenburg ob der Tauber, Mittwoch 22. August 2012
Füssen, Donnerstag 23. August 2012
Röttenbach, Freitag, 24. August 2012
Röttenbach, Samstag, 25. August 2012
Röttenbach, in Kunigunde Holzmanns Küche, Sonntag 26. August 2012
Pathologie der Uni-Klinik Erlangen, Dienstag, 28. August 2012
Röttenbach, in der Turnhalle der Grundschule, Donnerstag, 30. August 2012
Bad Windsheim, Fränkisches Freilandmuseum, Freitag, 31. August, 2012
Röhrach, Gaststätte Jägerheim, Sonntag, 2. September 2012
Erlangen, Schallershofer Straße, Dienstag, 4. September 2012
Röttenbach, Donnerstag, 6. September 2012
Erlangen, Amt für Kinder, Jugend und Familie, Freitag, 7. September 2012
In der Wohnung des Mörders, Samstag, 8. September 2012
Röttenbacher Friedhof, Montag 10. September 2012
Röttenbach, Gaststätte Fuchs, Sonntag 16. September 2012
Röttenbacher Kirchweih, Freitag, 21. September 2012
Röttenbach, Martin-Luther-Weg, Montag, 24. September 2012
Röttenbach, Mittwoch, 26. September 2012
Röttenbach, Gemeindeverwaltung, Montag 1. Oktober 2012
Röttenbach, Martin-Luther-Weg, Dienstag, 2. Oktober 2012
Röttenbach, Donnerstag, 04. Oktober 2012
Röttenbach, Gemeindeverwaltung, Freitag, 5. Oktober 2012
Dechsendorfer Weiher, frühmorgens, Samstag 6. Oktober 2012
Erlangen, Hofmannstraße, Montag, 8. Oktober 2012
Erlangen, Kommissariat der Kripo, Dienstag 9. Oktober 2012
Röttenbach, Mittwoch, 10. Oktober 2012
Erlangen, Kommissariat der Kripo, Donnerstag, 11. Oktober 2012
Röttenbach, Samstag, 13. Oktober 2012
Röttenbach, Sonntag, 14. Oktober 2012
Erlangen, Kommissariat der Kripo, Montag, 15. Oktober 2012
Röttenbach, am gleichen Tag
Im Hause des Mörders, Donnerstag, 18. Oktober 2012
Erlangen, Kommissariat der Kripo, Freitag 19. Oktober 2012
Erlangen, Kommissariat der Kripo, Montag, 22. Oktober 2012
Röttenbach, Donnerstag, 25. Oktober 2012
Röttenbach, katholische Kirche St. Mauritius, Freitag, 26. Oktober 2012
Röttenbach, Gaststätte Fuchs, Samstag, 3.11.2012
Nachwort
Von Werner Rosenzweig sind bisher folgenden Bücher erschienen:
Röttenbacher KarpfenliedText: Günther Sapper
Wer will mal gute Karpfen essen,
muss auf Röttenbach im Aischtalgrund.
Des werd er niemals mehr vergessen,
denn schmecken tuns und sen a gsund.
Refrain: Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
am bestn wenn mers selber essn tut.
Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
wenn mers in Röttenbach essn tut.
Im Frühjahr wenn sie voll die Weiher,
do setzmer nei die Fisch die klan,
und hoffn, dass sie holt ka Reiher,
und auch kein böser Kormoran.
Refrain: Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
am bestn wenn mers selber essn tut.
Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
wenn mers in Röttenbach essn tut.
Und is der Sommer gut rumganga,
dann is im Herbst endlich soweit,
mitn Fischn tut mer dann ofanga,
und es beginnt die Karpfenzeit.
Refrain: Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
am bestn wenn mers selber essn tut.
Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
wenn mers in Röttenbach essn tut.
Bei die Monat mit an „r“ im Noma,
do was dann jeder hierzuland,
die Karpfenzeit tut jetzt ofanga,
und alle sind schon do drauf gspannt.
Refrain: Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
am bestn wenn mers selber essn tut.
Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
wenn mers in Röttenbach essn tut.
Der ane will die Karpfen backn,
der andere wills lieber blau,
des muss a jeder selber wissn,
wies ihm am besten schmeckt genau.
Refrain: Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
am bestn wenn mers selber essn tut.
Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
wenn mers in Röttenbach essn tut.
Dann gibt sies anu mit viel Pfeffer,
in Scheibn oder als Filet,
des Ingreisch is a toller Treffer,
und Salot, der passt dazu ganz schee.
Refrain: Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
am bestn wenn mers selber essn tut.
Denn die Karpfen sen gud,
ja die Karpfen sen gud,
wenn mers in Röttenbach essn tut.
PROLOG
Das grässliche, furchterregende Monster war tot. Daran bestand kein Zweifel. Da war kein Zucken mehr in der Bestie, nicht das geringste Lebenszeichen. Ihr mächtiger, blutgefüllter Hinterleib war von einer kolossalen Kraft regelrecht zerquetscht worden. Eine rote, breiige Masse war das Einzige, was davon übrig blieb. Dennoch, es herrschte immer noch Leben in ihm. Ein total quirliges Leben, voller mysteriöser Aktivitäten. Abertausende tödlicher Nairoviren tummelten sich in einem wilden Durcheinander in dem blutigen Brei der zerquetschten Kreatur. Sie waren immer noch in der Lage Tod und Schrecken zu verbreiten und in den Körper eines gesunden Lebewesens einzudringen, um es mit dem gefährlichen Krim-Kongo-Fieber zu infizieren. Der Kontakt mit einer winzigen offenen Wunde würde bereits genügen.
Der Kopf der toten Kreatur war trotz der heftigen Attacke nahezu unverletzt geblieben. Die Mundwerkzeuge dieser Bestie waren bestens dafür geschaffen, die Haut ihrer Opfer auf äußerst brutale Weise aufzureißen. Im Vergleich dazu sahen die rasiermesserscharfen Zähne des Weißen Hais aus wie die Milchzähne eines zweijährigen Kindes. Die Gnathosoma, der Mundbereich der Bestie, war ein wirksames Instrument, um die unermessliche Blutgier der Kreatur zu stillen. Da standen, links und rechts des Kopfes, die beiden keulenartigen Pedipalpen hervor. Sie dienten dem Ungeheuer zum Ertasten ihrer bedauernswerten Opfer. Aus der Mitte ragte der gewaltige Stechrüssel, das sogenannte, zungenförmige Hypostom, welcher an seinem Ende mit einer Vielzahl grässlich spitziger Widerhaken besetzt war. Er war links und rechts von zwei Kieferklauen eingerahmt, die an ihren Enden mit rasiermesserscharfen Zähnen bestückt waren. Ihre Aufgabe war es, nachdem sich die Kreatur an ihr Opfer gekrallt hatte, die Haut der Beute zu durchdringen, um den mächtigen Stechrüssel ungehindert in die offene Wunde zu stoßen und sich an dem warmen Blut zu laben.
Der Mann rückte von seinem Elektronen-Mikroskop ab. Ein teuflisches Lächeln zuckte um seine Mundwinkel. Er hatte genug gesehen. Er war höchst zufrieden. Genüsslich hatte er in den letzten zehn Minuten den zerquetschten Hinterleib der Hyalomma-Zecke durch sein Mikroskop betrachtet. Doch nicht der übel zugerichtete Körper der toten Zecke war es, der seine ungeteilte Aufmerksamkeit erregte. Den winzigen, tödlichen Nairoviren, welche immer noch in dem blutigen Brei herumzuckten, galt sein Interesse. Er konnte sie eindeutig ausmachen. Sie sahen aus, wie kleine, stachelige, heranreifende Früchte des Kastanienbaumes. Selbst die Farbe passte: Winzige, verlässliche, grüne Killer, welche das häufig tödlich verlaufende Krim-Kongo-Fieber auslösen.
Sein siebentägiger Ausflug in die Nähe von Antalya hatte sich gelohnt. Als er im Mai 2012 vom plötzlichen Tod der vier Landarbeiter und des türkischen Hirten las und die Hintergründe ihres überraschend schnellen Ablebens begriff, buchte er ad hoc eine einwöchige Pauschalreise nach Belek, an der Küste der türkischen Riviera, und wurde, wie fünfzehn andere fränkische Pauschalreisende, in dem All-Inclusive-Ferienressort Limak Arkadia einquartiert. Während die anderen Feriengäste in der darauf folgenden Woche den Strand, die Poolanlagen und die anderen Annehmlichkeiten der Ferienanlage genossen und sich in der Sonne aalten, mietete der Mann für die ganze Woche einen Wagen und unternahm Tagesausflüge in das Landesinnere. Er hatte Interessen ganz anderer Natur. Am dritten Tag besuchte er das Gebiet rund um die Stadt Elmali, in welchem sich die vier Landarbeiter und der Hirte mit den Nairoviren infiziert hatten und in Folge dessen an ihren inneren Blutungen verstorben waren. Sie waren von Hyalomma-Zecken gestochen worden, welche die tödlichen Krim-Kongo-Fieber-Viren in sich trugen. So jedenfalls berichtete im Mai die internationale Presse. Nun, am dritten Tag nach seiner Ankunft, stand er trotz der Mittagshitze mit hochgeschlossener Kleidung mitten in einem ansteigenden Olivenhain, dessen Grund und Boden mit kargen Grasbüscheln bewachsen war. Zwischen den Bäumen graste eine Herde hungriger Schafe, welche auf dem ausgetrockneten steinigen Hang auch noch das letzte Grün gierig in sich hineinfraßen. Der Mann wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Die Sonne stach mit voller Kraft. Vor ihm stieg der mächtige, 3086 Meter hohe Kizlar Sivrisi Tepesi des West-Taurus-Gebirges an. In der Ferne glitzerte das sonnenbeschiene, tiefblaue Wasser der türkischen Riviera am Horizont. Doch die Naturschönheiten interessierten den Mann nicht. Er war im Moment zu aufgeregt, um die herrliche Landschaft zu genießen. Adrenalin durchströmte seine Blutbahnen wie ein schnell dahin fließender Gebirgsbach. Vor ihm, am Ende eines langen Grashalms, saß eine Hyalomma-Zecke. Sie hatte die beiden Vorderbeine weit von sich gestreckt, um sich jederzeit an einem der vorbei kommenden Schafe festzuklammern. Der Mann griff aufgeregt in seine Umhängetasche und holte ein kleines Schraubglas hervor. Vorsichtig streifte er die Zecke in das Glas. Es sollte nicht die Einzige bleiben, welche er an diesem Tag einsammelte. Nun musste sich nur noch bestätigen, dass die winzigen Insekten auch tatsächlich die tödlichen Viren in sich trugen, welche sie von den weidenden, infizierten Huftieren aufgenommen hatten. Die anschließenden Tests, welche er mit seiner mitgebrachten Ausrüstung in den nächsten beiden Tagen auf seinem Hotelzimmer durchführte, ergaben, dass er fündig geworden war. Er hatte die Nairoviren entdeckt. Die kleinen Zecken, welche er im Schweiße seines Angesichtes eingesammelt hatte, waren voll davon. Er hatte einen Glückstreffer gelandet. Verwunderlich, dass die Hyalomma-Zecken bereits bis in das Gebiet um Antalya vorgedrungen waren. Normalerweise kamen sie in viel südlicher gelegenen Regionen vor. Aber, wie die sogenannten Experten in den Medien ausführten, der fortschreitende Klimawechsel bestätigte auch an solchen Beispielen seine Auswirkungen. Ihm war das egal. Ganz im Gegenteil, er hatte gefunden, was er suchte. Nun konnte er seinen perfiden Plan in die Tat umsetzen: mordende Zecken. Für seine Verbrechen, die er seit langem plante, musste er sich die eigenen Hände nicht mehr schmutzig machen. Er hatte vor, morden zu lassen. Wie einfach und bequem! Seine kleinen, blutgierigen Freunde würden das für ihn übernehmen. Das perfekte Verbrechen. Dennoch, alles musste noch bis ins kleinste Detail vorbereitet werden. Er hatte Zeit. Bloß nichts übers Knie brechen. Die Zeit lief ihm nicht davon. Er würde erst einen Test durchführen. Einen Probe-Mord sozusagen. Ein wichtiger Test, und ein nützlicher zugleich. Das erste Opfer hatte er längst ausgesucht. Er kicherte diabolisch vor sich hin. Alles würde klappen. Davon war er überzeugt. Er würde sich zuerst von der tödlichen Wirkung der kleinen, stacheligen, grünen Killerviren überzeugen, bevor es zur eigentlichen Sache ging. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Er war sehr zuversichtlich, dass alles so kommen würde, wie er sich das vorstellte. Das Schöne war, es gab noch kein wirksames Gegenmittel gegen die kleinen Killerviren. Die Medizin war noch nicht so weit. Herrlich!
Gedankenvoll betrachtete er das riesige, zweckentfremdete Aquarium, welches auf einem Sideboard seines Arbeitszimmers stand. Er hatte den Boden mit Blumenerde aufgefüllt und eine Mini-Wiese angesät, welche er regelmäßig goss. Gelbe Butterblumen blühten in dem Gefäß. Selbst der Sauerampfer gedieh. Die klimatischen Verhältnisse in dem Glasgefäß sollten immer schön feucht-warm sein. Das gefiel seinen blutgierigen Lieblingen. Er konzentrierte seinen Blick auf die Grashalme. Dort saßen sie, seine infizierten kleinen Killer mit den rot-gelb geringelten Beinen, und vermehrten sich fleißig. Einige von ihnen hatten einen dicken Hinterleib, vollgesogen mit Meerschweinchenblut.
Geistesabwesend griff er in einen Käfig, der auf dem Fensterbrett stand. Darin züchtete er die kleinen, possierlichen Nager, welche vorübergehend als Nahrungsquelle für seine blutgierigen Minimonster herhalten mussten. Er griff sich eines der Tiere. Es hatte ein wunderschönes, zotteliges braun-weißes Fell und sah ihn mit seinen dunklen Knopfaugen ängstlich an. Dann hob er den Deckel, welchen er über das Aquarium gelegt hatte, kurz an und setzte das Meerschweinchen auf der kleinen Wiese aus. Seine kleinen Zecken hatten stets einen unbändigen Blutdurst. Es sollte ihnen gut gehen. „Vermehrt euch! Ich habe noch Großes mit euch vor!“, raunte er ihnen leise zu, bevor er das Aquarium wieder abdeckte.
Erlangen, Bohlenplatz, Mittwoch, 27. Juni 2012
Kuno Seitz saß auf einer Bank und sah den flanierenden Fußgängern nach. Mütter mit Kinderwägen, die ihren Schützlingen in der Babysprache liebevoll zuredeten. Geschäftsleute, die schnellen Schrittes über den Platz hasteten, ihre Mobiltelefone ständig am Ohr, und mit ihren Gesprächspartnern offensichtlich Wichtiges zu bereden hatten. Glaubten sie jedenfalls. Dann waren da noch die Schülergruppen, welche sich lautstark darüber unterhielten, wie hoch Deutschland Italien im EM-Fußball-Halbfinale schlagen würde, sowie die Rentner, die gemächlichen Schrittes vor seiner Bank dahin schlurften, einige einen Rollator vor sich her schiebend oder zumindest auf einen Stock gestützt.
Es war etwas windig. Das Wetter wusste nicht so recht, was es wollte. Mal war es wolkig und bedeckt, wenige Minuten später strahlte die Sonne von einem blauen Himmel. Für die nächsten Tage waren Temperaturen um die dreißig Grad vorhergesagt.
Kuno Seitz biss herzhaft in seinen Apfel, den er sich als Nachtisch aufgehoben hatte. Vor zwanzig Minuten war er noch in der Raumerstraße 9, ganz in der Nähe vom Bohlenplatz, angestanden. Dort, wo die Erlanger Tafel jeden Mittwoch Essen an hilfsbedürftige Menschen und an die Obdachlosen dieser Stadt ausgibt. Innerhalb weniger Jahre war er ganz, ganz tief gesunken. Alles was er heute noch besaß, passte in einen ausrangierten Einkaufswagen. Das ramponierte Gefährt stand neben ihm, seitlich an der Bank abgestellt. Niemand beachtete ihn. Gelegentliche, neugierige Blicke huschten schnell wieder weg, wenn er den Beobachtern ins Gesicht sah. Kein Wunder, bei seinem ungepflegten Erscheinungsbild. Mit seinen achtunddreißig Jahren war er bereits erstaunlich schnell ergraut. Seine langen, fettigen Haare klebten an seinem Kopf und aus seinem mit einem wirren Vollbart umrahmten Gesicht stierte ein unstetes, eisgraues Augenpaar, welches beidseitig über einer rot geäderten Hakennase tief in den Augenhöhlen lag. Sein Mund war breit, von zwei wulstigen Lippen dominiert. Alles in allem hinterließ er nicht gerade einen vertrauenserweckenden Eindruck. So manches Kind, welches von seiner Mama an der Hand geführt wurde, drehte sich zu ihm um, deutete mit dem Finger auf ihn und klärte seine Mutter auf: „Schau Mama, böser Onkel!“ „Psst! So was sagt man nicht“, oder „Komm jetzt, man zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute!“, waren häufig die peinlich berührten Antworten.
Er verstand die Kinder. Er brauchte sich nur selbst zu betrachten. Alleine seine Kleidung hinterließ einen schäbigen Eindruck. Sein jägergrünes Jackett – sein einziges –, welches er winters wie sommers trug, war abgetragen und mit dunklen Rotweinflecken besprenkelt. Die Ärmel waren an den Ellenbogen abgewetzt, und die drei Knopflöcher waren ausgerissen. Egal, Knöpfe waren sowieso längst nicht mehr dran. Das gelbe Baumwollhemd, welches er trug, war seit Monaten nicht mehr gewaschen worden und stank nach seinen Körperausdünstungen. An den Knien seiner schwarzen Jeans klafften taubeneigroße Löcher, und die Zähne des einzigen Reißverschlusses waren zur Hälfte nicht mehr existent. Die Sohlen seiner Sportschuhe mit den drei Riemen schließlich, welche er aus einem Mülleimer gezogen hatte, waren durchgelaufen, und wann immer es regnete, bekam er nasse Füße.
Nachdem er seinen Apfel ratzebutz aufgegessen hatte, stierte er vor sich hin und dachte – wie so oft in letzter Zeit – über sein bisheriges Leben nach. Alles war so schnell gegangen. Der Absturz kam wie aus heiterem Himmel. Er hatte eine glückliche Jugend verbracht. Seine Eltern, Georg und Doris Seitz, kümmerten sich rührend um ihn. Sie lasen ihm jeden Wunsch von den Augen ab, halfen ihm während der Schulzeit beim Lernen und hatten großes Verständnis, wenn er mal eine Dummheit begangen hatte. Kurzum, sie waren immer für ihn da. Kaum hatte er am Albert-Schweitzer-Gymnasium ein gutes Abitur abgelegt und gerade mit seinem Jura-Studium begonnen, erlitt er den ersten schweren Schicksalsschlag. Im Jahr 1994 kamen seine Eltern nicht mehr von einem Urlaub in Tirol zurück. Ein Lkw war bei heftigem Regen in der Nähe der österreichischen Ortschaft Schwaz auf dieGegenfahrbahn geraten. Seine Eltern hatten nicht die geringste Chance. Ungebremst rasten sie mit ihrem Mini-Van in den schweren Lastzug. Vater und Mutter waren sofort tot. In ihrem Testament hinterließen sie ihm nicht nur das kleine Einfamilienhaus in der Schallershofer Straße, ganz in der Nähe des Freibads West, sondern auch eine höchst merkwürdige Überraschung. In einem handgeschriebenen, herzzerreißenden Brief klärten sie ihn darüber auf, dass er gar nicht ihr leiblicher Sohn sei, sondern dass sie ihn im Alter von sechs Monaten adoptiert hätten, da sie selbst keine Kinder bekommen konnten. Noch im Tod warben sie um sein Verständnis, dass sie ihm niemals darüber berichtet hatten, und baten ihn, auch jetzt, nachdem er die Wahrheit erfahren hatte, keine Nachforschungen nach seinen wirklichen Eltern anzustellen. Seine leibliche Mutter war gerade mal siebzehn Jahre alt, als sie ihn geboren hatte, schrieben sie und versuchten in weiteren detaillierten Erläuterungen, deren damalige Lebenssituation und ihre Gründe für die Weggabe des Kindes nachträglich zu entschuldigen. Einen Hinweis auf seine leibliche Mutter gaben sie ihm nicht. Selbst seine Abstammungsurkunde fehlte in dem Familienbuch, welches sie ihm. So lieb sie sich auch immer um ihn gekümmert hatten, so ärgerte er sich doch im Nachhinein über ihre Heimlichtuerei und ihr Fehlverhalten ihm gegenüber.
Kaum dass er seine Adoptiveltern unter die Erde gebracht hatte, brach er sein Jura-Studium ab. Er musste Geld verdienen. Es war absehbar, wann das bescheidene Barvermögen, welches sie ihm vererbten, aufgebraucht sein würde. Doch er war ehrgeizig. Er würde es schaffen. Noch im gleichen Jahr, er war gerade zwanzig, begann er bei Siemens eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Seine interne Firmenabschlussprüfung schaffte er mit einer glatten Eins und wurde sofort in den Kreis der förderungswürdigen Jungkaufleute aufgenommen. Während seiner Ausbildungszeit lernte er Lisa Probst kennen, ebenfalls eine Auszubildende, ein Ausbildungsjahr nach ihm. Die beiden jungen Leute verliebten sich ineinander, schworen sich ewige Treue und Liebe und traten 1997 vor den Traualtar. Die ersten drei Ehejahre waren ein einziger Traum, bis Jens geboren wurde. Zwei Jahre später, im Jahr 2002, kam Töchterchen Tina zur Welt. Während ihr Ehemann im Laufe der Jahre eine steile Firmenkarriere hinlegte, kümmerte sich Lisa Seitz um den Haushalt und die Erziehung der gemeinsamen Kinder. Kuno kam immer später nach Hause, und immer öfter und immer länger war er auf Dienstreisen. Bald fiel Lisa die Decke auf den Kopf. Sie fühlte sich ungerecht behandelt. Es war niemals ihr Lebensziel gewesen, die Rolle einer Putzfrau einzunehmen, drei Mal am Tag Kinderwindeln zu wechseln, zu waschen, zu bügeln und stets ein warmes Essen auf dem Herd zu haben, wenn der Herr des Hauses sich gnädigerweise bequemte, spät am Abend zu Hause zu erscheinen, und nach dem gemeinsamen, wortkargen Abendessen zu gähnen begann. Langsam erlosch die große, gegenseitige Liebe. Immer öfter und in immer kürzeren Abständen zankten sich die Eheleute. Als im Jahr 2007 gegen den Arbeitgeber von Kuno Seitz schwere Vorwürfe wegen gezielter, weltweiter Korruption erhoben und entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden, geriet auch er in die Mühlräder der Justiz. Die von der neuen Firmenleitung beauftragten, investigierenden amerikanischen Anwälte wiesen ihm anhand eines Berges von seiner Festplatte kopierter Dokumente gezielte Bestechung südamerikanischer Politiker nach. Die Sachlage war eindeutig. Kuno Seitz, der glaubte, sich stets zu mehr als einhundert Prozent für die Interessen seines Arbeitgebers eingesetzt zu haben, gab alle Verfehlungen zu. Siemens kündigte ihm. Die Justiz leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Mit drei Jahren Haft auf Bewährung kam er noch glimpflich davon. Am schwersten wog für ihn jedoch, dass seine Frau die Scheidung einreichte. Es folgte ein kurzer, aber erbarmungslos geführter Rosenkrieg. Im Jahr 2010 stand er mittellos auf der Straße, ohne Aussicht darauf, jemals wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Die Geldstrafe, welche ihm das Gericht auferlegt hatte, und die Konsequenzen der Scheidung fraßen alle seine Vermögenswerte auf. Wie oft dachte er seitdem daran, seinem Leben ein Ende zu setzen. Doch je länger und intensiver er darüber nachdachte, desto schneller verließ ihn der Mut, diesen Schritt auch tatsächlich zu vollziehen. Er führte nunmehr ein Leben, welches nur noch im Suff zu ertragen war. In seiner trostlosen und ausweglosen Situation dachte er häufiger darüber nach, wer wohl seine leibliche Mutter sein könnte. Lebte sie noch? Wo lebte sie? Wie ging es ihr heute? Dachte sie noch manchmal an ihren Sohn, den sie im Säuglingsalter in fremde Hände gab? Wenn sie damals siebzehn war, musste sie heute fünfundfünfzig sein. Kein Alter! Vielleicht suchte sie nach ihm und hatte ihren Schritt von damals längst bereut? Sollte er sich vielleicht doch auf die Suche nach ihr begeben? Doch wo sollte er beginnen? Was, wenn er sie finden würde? Er, ein Obdachloser! Er verwarf den Gedanken immer wieder.
„Ist hier noch ein Platz frei?“ Ein adrett gekleideter Mann, deutlich jünger als er, blickte durch seine modische schwarze Hornbrille freundlich auf ihn herab. „Wenn Sie meine Erscheinung nicht stört. Bitte schön!“ „Ein komisches Wetter heute“, kommentierte der Ankömmling, ohne auf die indirekte Frage einzugehen. Stattdessen bot er Kuno eine Marlboro an. Mit seinen schmutzigen Fingernägeln fingerte der Obdachlose in der Zigarettenschachtel herum. „Danke, sehr freundlich.“ Dann rauchten die beiden schweigsam ihre Glimmstängel. Nach einer halben Stunde und einer zweiten Zigarette begann Kuno Seitz, dem Fremden die Geschichte seines Lebens zu erzählen.
Röttenbach, Kirchgasse, Donnerstag, 28. Juni 2012
Kunigunde Holzmann und Margarethe Bauer, die beiden fränkelnden Röttenbacher Urgesteine und langjährigen Busenfreundinnen saßen in Kunnis Küche und beratschlagten, wie sie ihre bevorstehenden achtzigsten Geburtstage ordentlich feiern sollten. „Do lass mer scho an grachn“, meinte die Retta im Brustton der Überzeugung, „su ald wird ka Sau.“ Dritte im Bunde war Theresa Fuchs, die rüstige Nachbarin aus der Lindenstraße, und zwei Jahre jünger als die beiden angehenden Jubilare. Genau wie Kunni und Retta war auch die Fuchsn Deres bereits langjährige Witwe. Doch im Unterschied zu den beiden Geburtstagskindern hatte sie noch direkte Familienbeziehungen ersten Grades im Dorf. Ihr Sohn Bruno und seine Frau Julia, ebenso eine gebürtige Röttenbacherin, wohnten drüben, im Neubaugebiet „Bucher Weg“. Julia war zwar schon einmal verheiratet gewesen, mit einem Amerikaner, und hatte in der Nähe von Dallas gelebt, doch drei Jahre nach ihrer Eheschließung und nur ein Jahr nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Michael schlug das Schicksal unbarmherzig zu: John Hausman, ihr erster Mann, verstarb überraschend an Krebs. Glücklicherweise war John Hausman kein armer Mann, sondern ein sehr erfolgreicher Immobilienmakler. Er hinterließ seiner Frau Sachwerte wie das gemeinsame Haus, zwei Autos, ein ansprechend wertvolles Aktienpaket sowie ein Barvermögen von knapp über drei Millionen US-Dollar. Als gemachte Partie kehrte Julia Hausman, geborene Sapper mit ihrem Söhnchen Michael 1983 wieder in ihre fränkische Heimat Röttenbach zurück. Sechs Jahre später, im September 1989, heiratete sie Bruno Fuchs, Theresas Sohn. Die Ehe blieb kinderlos. Nachdem viele Jahre später Julias Sohn Michael im Alter von fünfundzwanzig Jahren in der Sandstraße einen eigenen Hausstand gründete, bauten sich die beiden Eheleute im Neubaugebiet „Bucher Weg“ ein neues, schmuckes Einfamilienhäuschen. Geld war ja genug da. Julia und Bruno führten eine gute Ehe. Die Kritik, dass sie zu viel rauche, musste sich Julia allerdings immer wieder von ihrem Mann gefallen lassen.
Die Fuchsn Deres hatte als gute Nachbarin der Holzmanns Kunni und der Bauers Retta angeboten, ihnen bei der Organisation ihrer bevorstehenden Geburtstagsfeierlichkeiten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sie wusste, dass die Kunni Probleme mit ihren Knien hatte und immer öfter auf ihren Rollator angewiesen war. Wie oft hatte sie ihr schon geraten, etwas abzunehmen. Bei einer Körpergröße von nur einem Meter neunundfünfzig waren fünfundachtzig Kilogramm Lebendgewicht einfach zu viel. Kein Wunder, dass die Pfunde auf die maroden Gelenke drückten. „Edz lass mi doch endlich in Ruh mid deine schdändichn Radschläch“, bekam sie immer wieder von der Kunni zur Antwort, „du waßd doch, dassi gern viel und gud ess! Mier schmeggds hald! Wie solln iech do abnehma?“
Die Retta war das Gegenteil von Kunni Holzmann. Rank und schlank war sie und lief ausdauernd wie ein Mercedes Diesel. Aber ihr machte die Gicht in ihren Fingergelenken immer mehr zu schaffen. Das feinste Gehör hatten zudem beide nicht mehr. Ein Hörgerät wollten sie aber auch nicht tragen. „Dees is doch was fier alde Leid“, pflegten sie zu behaupten, „nix fier uns junge Hubfer!“
Nun saßen sie in Kunnis Küche, jede eine geöffnete Flasche „Storchenbier“ von der Brauerei Sauer vor sich. Biergläser brauchten sie nicht. Sie tranken aus der Flasche. Die Zeiger der Wanduhr krochen langsam, aber beständig auf zwanzig Uhr zu, und die drei Witwen waren gerade mit einem späten, deftigen Abendessen zu Gange. Auf einer riesigen Platte waren roter und weißer Presssack, geräucherte Leberwurst, Obatzter, grobe Mettwurst, aufgeschnittener Leberkäse, geräucherter Schinken und eine knoblauchhaltige Stadtwurst angerichtet. In einem kleinen Suppenteller lagen dünn geschnittene, kräftig gesalzene Rettichscheiben, und das frisch geschnittene Bauernbrot von Peters Backstube duftete verführerisch. Deutsche Markenbutter, ein Glas Gewürzgurken und aufgeschnittene Tomaten aus dem eigenen Garten rundeten das verlockende Essensangebot ab. Kunigunde Holzmann hatte den Hals der Bierflasche mit geschlossenen Augen an ihre Lippen angesetzt und entließ den Gerstensaft gluckernd und genießerisch in ihre Kehle. „Aah, dud dees gud! Es gibd doch nix ieber an gscheidn Schlugg frischs Sauer Bier, wemmer durschdich is“, kommentierte sie, nachdem sie die Flasche wieder auf den Tisch zurückgestellt hatte. „Also Maadli, wos is edz? Wu schdemmer denn in unserer Blanung?“, wollte sie wissen. „Lang zu, Deres, der Bressagg is vom Baumüller. Ganz frisch. Habbi heid erschd kaffd. Soller der an Senfd dazu hulln, odder mogsd lieber an Sahnemeerreddich? Schmeggd aa gud!“
„Na, Kunni, dangschee, iech kann auf der Nachd nemmer suviel essn. Bekummd mer ned. Lichd mer bloß im Moogn. Abber– weilsd scho fragsd – iech hab mer dengd, dees Kugnbaggn iebernehm iech. Do brauchd iehr eich scho nemmer mid zu belasdn. Habd eh gnuch um die Ohrn. Und Eikaafn kanni aa. Blabds denn edz beim sibbzehndn Augusd? Eiere große Feier? Wieviel Leid habd der denn ieberhabds eigloodn?“
„No, du gfällsd mer, Deres!“, antwortete die Kunni. „Die Fuchsn Werdschafd habbi scho vor ieber an Joahr reserviern lassen! Die zwaa Wirdsschduubn und dees Nebenzimmer. Gschlossne Gsellschafd! Die Retta had am fuchzehndn Augusd Geburdsdooch, dees waßd ja, und iech zwaa Dooch schbäder. Do hammer uns dengd, dass mer gor nemmer lang rummachn und gleich am sibbzehndn feiern. Dees is a Freidooch. Do kenna die Leid am näxdn Dooch aa ausschloofn.“
„Wieviel werns denn sei? Wer kummd denn alles?“, hakte die Theresa nochmals nach.
„Dees wiss mer edz doch aa ned auswendich, wen mier alles eigladn hamm. Dees misserdn mier edz aa erschd nochschaua“, meldete sich nun die Retta zu Wort, nachdem sie ebenfalls einen kräftigen Schluck Bier genommen hatte und leicht rülpste. „Jedenfalls kumma su umera hunerdfufzich Leid, die meisdn aus Röttenbach, abber aa a boar Auswärdiche sen dabei. Danzd werd aa. Der Gerald Harter machd Mussigg im Nebenzimmer. Der had scho lang zugsachd, dasser kummd!“
„Jessasla, do musser mer ja exdra was Neis zum Oziehchn kaafn“, meinte die Fuchsn-Nachbarin. „Habd der dees Essn a scho bschdelld?“
„Naa, dees langd nu a Wochn vorher, had die Wirdin gmaand, abber deswegn hoggn mier edzerdla ja aa grood zamm“, kam die Kunni wieder zur Sache. „Wos maandn na iehr, was mer zum Essn bschdelln solldn?“
„Auf jedn Fall nix Ausländischs!“, schlug die Retta vor.
„Do gebber der scho rechd, Redda“, bestärkte sie die Theresa Fuchs, „do solled iehr scho bei der deidschen Kichn bleibn.“
„Dees habbi eigendli ned damid gmaand“, widersprach ihr die Retta. „Fier miech is a rheinischer Sauerbradn mid Rosina in der Soß aa was Ausländischs! Iech deng mier solledn scho ehra in unserer Gegend bleibm mid der Auswahl vo dem Essn. Was maansd no du Kunni? Sogsd goar nix mehr!“
„Dees hängd ja aa a weng vom Wedder ab, maan iech. Wenns draußen dreißg Grad had, waßi aa ned, ob mer a Schäuferla schmeggn däd. Iech schlooch vor, wir dreffn a edwas breidere Auswahl. A Wochn vor der Feier, wenn mier wissen wie dees Wedder wern soll, legn mier uns endgüldich fest. Was maandnd iehr?“
„Allmächd!“, Retta sah auf die Uhr und schoss hoch, wie von der Tarantel gestochen. „Is heid ned der achdazwanzigsde Juni?“
„Und was is am achdazwanzigsdn Juni?“, riefen die beiden anderen im Chor.
Retta schlug sich auf die Stirn, „No, heid schbieln doch die Deidschn gegen die Schbagheddifresser im Halbfinale! Wer gwinnd kummd ins Endschbiel gegen die Schbanier! In zehn Minuddn gehds los!“
„Kunni sah ebenfalls zur Uhr. „Schnell“, würgte sie auf ihrem Bauernbrot kauend hervor, „räumer ab! Redda, schdell die Wurschdbladdn, die Budder und dees Gurgnglas in Kiehlschrank nei! Deres, schald scho amol den Fernseher ei. Wer will nu a Bier?“
„Iech!“
„Iech aa!“
„Redda, die Deidschlandschminke is aa im Kiehlschrank. Brings mied ins Wohnzimmer! Iech hul schnell nu die Deidschlandfohna ausm Keller. Bin glei widder da.“
Punkt zwanzig Uhr fünfundvierzig saßen die drei Witwen auf dem Sofa. Jede hatte zwei breite, schwarz-rot-goldene Streifen auf den Backen. Kunni schwang die Deutschlandflagge gefährlich nahe an der Wohnzimmerlampe vorbei. Retta trötete auf einer Vuvuzela, welche die Kunni noch im Keller gefunden hatte. Die Theresa war mit einer Trillerpfeife ausgestattet worden. Als die deutsche Nationalhymne erklang, sangen alle drei aus voller Kehle: à „Einichkeid-und-Rechd-und-Frei-heid-für-das-deudsche-Va-hader-land-danach-lassd-uns-alle-schdre-heben-briederlich-mid-He-herz-und-Hand …“
„Warum singa der deidsche Necher, der deidsche Dirg und der deidsche Bollagg ned mied?“, erboste sich die Kunni.
„Die dädi gor ned aufschdelln“, gab ihr die Retta recht. „Wolln Deidsche sei und singa dees Deidschlanlied ned mied! Is a Schand! Wenn iech der Joogi Löf wär, dena däd iech abber schee die Meinung geign. Suwas geberds bei mier ned! Dees is doch a wergli a Schand, und die ganze Weld schaud zu.“
Als der französiche Schiedsrichter wenige Minuten später das Spiel anpfiff, wurde Kunnis Wohnzimmer zum Tollhaus. „Renn, renn, renn“, schrie Retta, als Özil den Ball nach vorne passte. „Schieß, schieß, schieß“, rief die Kunni, als der vorgestürmte Hummels versuchte, die Kugel im gegnerischen Tor unterzubringen.
„Wer isn der idaljenische Necher, dem des Sauergraud ausm Kubf wächst?“, wollte Theresa Fuchs wissen.
„Dees is doch der idaljenische Middlschdürmer, der Ballodelli, kennsdn du denn den ned?“, fragte die Retta verwundert.
„Ballodelli? Ballodelli? Is dees ned a Nudlsordn?“, bezweifelte Theresa Rettas Sachkenntnis.
Das Spiel wogte hin und her. Es stand immer noch 0:0. Bis zur zwanzigsten Minute. Die Nudelsorte Balotelli verarschte Mats Hummels, nahm einen zielgenau geschlagenen Pass mit dem Kopf auf und köpfte trotz Sauerkraut den Ball wuchtig in Manuel Neuers Tor. 1:0 für Italien!
„Bschieß!, Bschieß! Dees Sauerkraut woar im Abseids! Warum bfeifdn der französische Debb ned, had der Domadn auf die Augn?“, rief die Kunni entsetzt.
„Na Kunni, des woar scho a regulärs Door. Die deidsche Abwehr had hald amol widder gschloofn. Da had der Löf meisdens sei Broblem“, kommentierte die Retta. „Warum er den Bodolsgi, die Flaschn, scho widder aufgschdelld had, verschdeh iech abber aa ned. Der dorgld doch auf dem Bladz rum, wie a Bsuffner. Und jedesmol, wenner den Ball ned drifft odder drieber haud, lachdder aa nu wie a Eichhernla wenns blidzd.“
„Na ja“, warf die Theresa ein, „wu kummdern aa scho her? Aus Boln und aus Köln! A bolnischer Breiß, kwasi. Dees kann ja nix wern!“
Die drei Fußballsachverständigen ließen sich – trotz des 1:0 für Italien – in ihrer Begeisterung nicht bremsen. Sie tröteten, trillerten und schwenkten die deutsche Fahne. Dann kam die sechsunddreißigste Minute, als sich das „Sauerkraut“, alias „italienische Nudelsorte“, einen von Riccardo Montolivio geschlagenen Pass erlief und das Leder knallhart linkerhand knapp unter die Latte einhämmerte. 2:0 für Italien! Die Nudelsorte war mächtig stolz über seinen zweiten Torerfolg. So stolz, dass er sein blaues Trikot auszog und den Zuschauern seinen nackten, muskulösen Oberkörper zeigte. „Ich war es“, wollte er damit sagen. „Ich habe die Deutschen aus dem Wettbewerb geschossen. Ich bin der Größte.“ Er stand da, wie ein wild glotzender Gorilla, der sich gleich auf die Brust trommeln würde. Das unterließ er dann doch, als der Schiedsrichter auf seiner Pfeife trällerte und ihm die gelbe Karte zeigte.
„Oh weh, des hul mer nemmer ei!“, klagte die Retta. „Scho widder su a Scheiß-Idaljenschbiel!“
„Schald mer hald den Fernseher aus?“, schlug die Theresa vor. „Hogg mer uns widder in die Kichn und beradn mer weider ieber die Essensauswahl vo eirer Geburdsdagsfeier. Unser Bier kemmer in der Kichn aa dringn.“
„Iech hab scho gor kan richdign Durschd mehr“, kommentierte die Kunni Theresas Vorschlag. „Mier is ganz schlechd.“ Die deutsche Fahne hatte sie in die Ecke hinters Sofa gestellt.
„Der schwarze Schbagheddi had mer mei ganze Schdimmung verdorbn“, lammentierte auch die Retta herum. „Gscheid sollns gecher Schbanien eigeh, die Iddagger!“ Dann schaltete sie das Fernsehgerät aus. „Kummd, gemmer widder in die Kichn, red mer a weng drieber was im Dorf Neis gibd. Iech hab gherd, der Müllers Hanna iehr Ingried soll schwanger sei.“
„Dees arme Kind“, hakte die Kunni ein, „dees werd doch ned gor vo dem Berser sei, mid dem der Hanna iehr Madla in der ledzdn Zeid rumzuugn is?“
„Dees kann scho sei“, merkte die Theresa an, „den habbi scho lang nemmer gsehgn. Der is beschdimmd nach Affganisdaan abghaud, wieer dees midgrichd had. Der had ja ausgschaud mid seim Zoddlbard. Vor dem hasd ja richdich Angsd grichd!“
„Vielleichd isser ja a Dalibaan“, gab auch die Retta noch ihren Senf dazu. „Waß mers?“ Das 2:1 der deutschen Nationalmannschaft bekamen die drei Witwen gar nicht mehr mit. Sie unterhielten sich über ledige Schwangere, die Seitensprünge des verheirateten Nachbarn gleich gegenüber, über die Bemühungen einiger Röttenbacher Bürger, im Dorf einen Ableger der Partei Freies Franken zu gründen, und darüber, wer sich nächstes Jahr als Kandidat für die Bürgermeisterwahl aufstellen lassen würde. „No der Ludwich, der Ludwich machd doch widder dees Renna“, gab sich die Kunni überzeugt. „Da beißd doch die Maus kann Fadn ab.“
Erlangen, Staatsstraße 2240, Sonntag, 1. Juli 2012
Kuno Seitz hatte sich mit seinem neuen Bekannten vom Bohlenplatz unter der Brücke, welche sich in Richtung des Ortsteils Dechsendorf über den Rhein-Main-Donau-Kanal spannte, für einundzwanzig Uhr verabredet. Während sich ganz Fußball-Deutschland das EM-Finale Spanien gegen Italien ansah, wollten die beiden ihr Gespräch vom Bohlenplatz fortsetzen.
„Du musst wissen, ich bin kirchlich engagiert“, hatte ihm Till Stemmann erklärt, „und ich möchte mich zukünftig gerne um die Obdachlosen dieser Stadt kümmern. Ich denke, ich kann ihnen helfen, wieder in die normale Gesellschaft zurückzufinden. Dazu muss und will ich aber verstehen, wie sie leben, was sie für Sorgen haben und welche Lösungen sich daraus für jeden Einzelnen anbieten. Du, zum Beispiel, hast Abitur und einen qualifizierten Berufsabschluss. Solche Leute werden heute gesucht. Die Wirtschaft boomt.“ So sprach er auf der Bank am Bohlenplatz. Zudem hatte er versprochen, ausreichend Getränke und Zigaretten mitzubringen. Kuno Seitz kam die unerwartete, neue Bekanntschaft gerade recht. Erstens hatte er die Brücke für diese Nacht sowieso als Schlafplatz auserkoren. Schwere Sommergewitter mit heftigen Regenschauern waren angesagt. Zweitens war er nicht allein und konnte mal wieder ein anregendes Gespräch führen, und drittens schließlich sprach es sich leichter und freier, wenn auch für den nötigen Alkoholkonsum gesorgt war. Kuno Seitz freute sich auf das Gespräch. Eine willkommene Abwechslung in seinem tristen Dasein. Die Kirchenglocken in Alterlangen läuteten gerade acht Uhr abends, als er mit seinem ramponierten Einkaufswagen die Schallershofer Straße entlang schlurfte. Er hoffte einen Blick auf sein ehemaliges Zuhause zu erhaschen. Vielleicht waren Jens und Tina gerade im Garten. Nur ein kurzer, verstohlener Blick, und er wäre schon zufrieden gewesen. Der Richter hatte ihm im Scheidungsurteil jeglichen weiteren Kontakt mit seiner Familie verboten. Er musste vorsichtig sein. Seine Ex würde keine Gelegenheit auslassen, ihn beim geringsten Anlass ans Bein zu pinkeln. Zu groß war bei ihr die Enttäuschung über die zerrüttete Ehe und sein kriminelles Verhalten in der Korruptionsaffäre, welches der Familie nur zusätzliche Schande einbrachte. Verstohlen blickte er über die Straße. Nichts. Das Haus lag ruhig und verlassen da. Enttäuscht und stöhnend machte er sich weiter auf den Weg zur Brücke. Noch eine halbe Stunde, dann müsste er sein Ziel erreicht haben. Sein Einkaufswagen ratterte quietschend über die Unebenheiten des Gehsteigs. Die wenigen Fußgänger, denen er begegnete, sahen mitleidlos durch ihn hindurch. Als wäre er gar nicht existent. Eine wandelnde, übel riechende Luftblase. Nach weiteren zwanzig Minuten hatte er die Kreuzung Möhrendorfer Weg/St. Johann erreicht. Die Brücke war nur noch drei Steinwürfe entfernt. Er war früh genug dran. Till Stemmann würde nicht vor vierzig Minuten eintreffen. Wenn er überhaupt kam und sich das Ganze nicht doch noch anders überlegt hatte!
•
Till Stemmann war gekommen, und er hatte ausreichend Wodka mitgebracht. Er selbst dürfe keinen Alkohol trinken, erklärte er. Ärztliche Anweisung! Zu schlechte Leberwerte! Schade. Kuno Seitz trank ungern alleine. Wenn sich dies aber nicht vermeiden ließ, na dann eben doch! Bevor er auf seinen Fingernägeln herumkaute und der Wodka schlecht wurde, würde er sich nicht zweimal bitten lassen. Er schaffte auch alleine die eine oder andere Flasche. Gierig griff er nach der Marlboro-Box und riss sie auf. Es tat gut, den beißenden Rauch in den Lungenflügeln zu verspüren.
Die Zeit verging wie im Flug. Aus der Ferne schlugen die Glocken bereits dreiundzwanzig Uhr. Kuno Seitz hielt bereits die zweite Wodka-Flasche in den Händen. Sie war noch halb voll, oder sollte er besser sagen „halb leer“? Die erste Flasche musste irgendwie undicht gewesen sein. Lange hielt sie jedenfalls nicht. Längst hatte er sie mit einem kräftigen, ausholenden Wurf platschend im dunklen Wasser des Rhein-Main-Donau-Kanals entsorgt.
„… und so kam es, dass ich plötzlich mittellos und ohne Freunde auf der Straße stand.“ Kuno Seitz stierte mit trüben Blicken auf die ebenso trübe Wasseroberfläche des Wasserlaufs. Till Stemmann war ein aufmerksamer wie auch interessierter Zuhörer. Er sprach kein einziges Wort, er hörte nur zu. „Freunde, sogenannte Freunde“, hörte er den Obdachlosen mit lallender Stimme fortfahren, „wenn du sie brauchst, sind sie nicht da. Eine Welt voller Schein und Trug. Das habe ich gelernt.“ Wieder öffnete er die Flasche, setzte sie an seine Lippen und nahm drei kräftige, gurgelnde Schlucke. „Nur wenn sie selbst was brauchen, sind sie deine Freunde.“ Er rülpste. Der Geschmack des Wodkas stieg ihm in die Kehle. „‚Kuno kannst du mir hier helfen, Kuno kannst du mich da unterstützen?’ Ich Idiot habe an das Gute im Menschen geglaubt. Habe mir den Arsch aufgerissen. Habe nie nein gesagt, wenn sie mich um etwas baten. Scheiße! Verdammte Scheiße! Ja Kuno, da hast du ganz schön versagt, hast geglaubt du besitzt etwas Menschenkenntnis. Nichts von dem. Hast ganz schön in die Scheiße gegriffen!“ Wieder gurgelte der Wodka durch seine Kehle. „Aber du, Till, du bist ein wahrer Freund. Du hörst dir meine verdammte Geschichte an, sagst nichts, hörst nur zu und spendierst mir obendrein noch meine flüssigen Seelentröster. Du bist ein guter Mensch. Pass auf dich auf, kann ich dir nur raten, such dir deine Freunde mit Bedacht aus, und vor allem: Lass die Finger von den Weibern. Du kannst sie ruhig ordentlich bumsen, aber trau niemals ihren schönen, verführerischen Worten. Wenn es darauf ankommt, nehmen sie dich aus wie eine Weihnachtsgans. Glaub mir, du kennst ja nun meine Geschichte.“ Der restliche Wodka verschwand geräuschvoll in Kuno Seitz‘ Kehle. „Ich, … ich kann nicht mehr. Bin müde und … außerdem besoffen. Stockbesoffen! Ich leg mich hin.Muss schlafen … Bleib ruhig hier sitzen, … wenn du willst!“