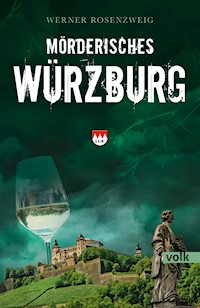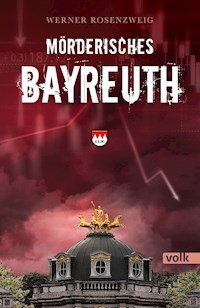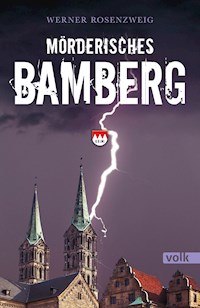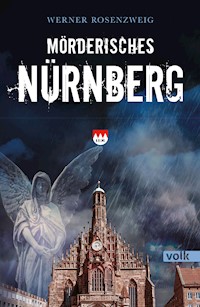
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Volk Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mörderisches Franken
- Sprache: Deutsch
Kurz vor Weihnachten auf der B4 zwischen Erlangen und Nürnberg: Plötzlicher Eisregen, ein schlimmer Unfall, zwei Leichen im demolierten Krankenwagen der Malteser – doch nicht beide Toten sind auch Opfer des Crashs. Kommissar Tobias Bellinghausen und seine Kollegin Sandra Knobloch von der Kripo Nürnberg haben sich kaum mit dem seltsamen Fall angefreundet, da gibt es einen grausigen Fund auf dem St.-Rochus-Friedhof: Ein jüngst Verstorbener liegt nicht allein in seinem Sarg! Soll auf diese Art ein Mord vertuscht, eine Leiche entsorgt werden? Und was hat das auffallende Tattoo mit den religiösen Symbolen auf dem Rücken des Unfallfahrers zu bedeuten? Kenntnisreich und gespickt mit viel Lokalkolorit führt Werner Rosenzweig sein sympathisches Ermittler-Duo tief in die Vergangenheit der Freien Reichsstadt Nürnberg und scheut dabei auch nicht vor den dunklen Kapiteln in der Geschichte der Frankenmetropole zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MÖRDERISCHES
NÜRNBERG
Werner Rosenzweig
MÖRDERISCHES
NÜRNBERG
EIN FRANKEN-KRIMI
Volk Verlag München
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/ abrufbar.
© 2021 by Volk Verlag München
Neumarkter Straße 23; 81673 München
Tel. 089 / 420 79 69 80; Fax: 089 / 420 79 69 86
Druck: cpi books, Leck
Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
ISBN 978-3-86222-399-2 (Print)ISBN 978-3-86222-413-5 (Epub)ISBN 978-3-86222-414-2 (Mobi)
www.volkverlag.de
Prolog
Man schrieb das Jahr 1565. Kein Wölkchen stand am Himmel. Die dicke, fette Sonne glänzte über der kleinen Insel und alles um sie herum erstrahlte in einem hell durchfluteten Knallblau. Draußen vor der Stadt Birgu brach sich das Licht auf den sanft schaukelnden Wellen des Mittelmeers und fügten sie zu einem einzigartigen, glitzernden Gemälde zusammen. Der Sommer war endgültig zurückgekehrt und nur der immerwährende Wind hier oben auf Fort St. Angelo linderte die anstürmende Hitze.
Johannes Reiter von Kernburg verfolgte die Flugkünste der schreienden Möwen über dem Großen Hafen der alten Fischerstadt. In wenigen Tagen würde es hier nach Pulverdampf, Blut und Tod riechen und tausende Menschen würden ihr Leben lassen müssen. Von den Geschossen der Geschütze zerfetzt, von Schwertern zerhackt, von Lanzen durchbohrt. Vielleicht würde auch er den Tod erleiden. Am 18. September, vor vier Tagen, als sich die Frühnebel über dem östlichen Mittelmeer lichteten, war die Kriegsflotte von Sultan Süleyman I. in der Ferne aufgetaucht. Breitgefächert verwehrten die Segel der rund 180 Kriegsschiffe die Sicht auf den weiten Horizont. Wie ein undurchdringlicher Wall wirkten sie, wie eine bewegliche Mauer aus Segeltuch, die sich langsam und vorsichtig der Insel näherte. Sie führten hunderte von Geschützen mit sich, rund 40.000 Soldaten waren an Bord.
Doch die Türken kamen nicht unerwartet. Kleine, schnelle und wendige Galeeren des Johanniterordens waren ihnen gefolgt. Sie begleiteten den Feind seit Süleymans Armada im April vom Goldenen Horn ausgelaufen war. Jean Parrisot de La Valette, Großmeister der Ordensgemeinschaft, hatte schon zu einem früheren Zeitpunkt mit einem Angriff gerechnet. Zu oft hatten seine Galeeren den Osmanen schmerzhafte Stiche zugefügt, wenn sie das ein oder andere türkische Handels- oder Versorgungsschiff überfielen und plünderten. Johannes wusste, wovon der Großmeister sprach, hatte er doch selbst fast zwei Jahre an solchen Überfällen teilgenommen.
„Solange die Johanniter auf Malta sitzen, sind unsere Versorgungswege im westlichen Mittelmeer ständig bedroht“, beklagten sich Süleymans Berater. Süleyman I., er wurde auch Süleyman der Prächtige genannt, Sultan der Osmanen, war für die meisten seiner Untertanen gottähnlich, allmächtig und Allahs Stellvertreter auf Erden. Er war der Herr der Herren dieser Welt, König der Gläubigen und Ungläubigen und Schatten des Allmächtigen. Er hatte in den bisherigen über vierzig Jahren seiner Regierung ein Osmanisches Reich erschaffen, welches vor den Toren Wiens begann und bis zum Persischen Golf reichte. Seine Schiffe überquerten den Atlantik und den Indischen Ozean. Nun war er 70 Jahre alt, aber noch genauso tatendurstig und kriegstrunken wie Mitte zwanzig, als er Sultan geworden war. Wollte er sein Reich und die eroberten Gebiete erhalten, musste er dem Ritterorden auf Malta, geostrategisch günstig zwischen Sizilien und Tunesien gelegen, endlich eine deutliche Lektion erteilen. Zu sehr störten sie seine Nachschubwege über See.
Johannes Reiter von Kernburg sah hinüber auf die nahe Landzunge von Berg Sciberras, an dessen seeseitigem Ende das Fort St. Elmo lag. Im Vergleich zu St. Angelo war es deutlich schwächer bewehrt und es hatte einen großen strategischen Nachteil: Es lag auf Seehöhe. Wer den Berg Sciberras beherrschte, konnte hinabsehen, direkt in das Fort hinein, und er konnte mit Geschützen von oben in die Befestigungsanlage hineinfeuern. Ob das Fort dem ersten Ansturm der türkischen Truppen standhalten konnte? Johannes Reiter von Kernburg machte sich ernsthafte Sorgen. Doch das war noch nicht alles. Würde auch die Hauptstadt Mdina einem Angriff widerstehen können? Nur wenige Verteidiger waren zurückgeblieben. Der Großteil der Militärmacht des Johanniterordens war hier, an drei Stellen des Großen Hafens, konzentriert worden. So hatte es der Großmeister des Ordens angeordnet. Fort St. Elmo schien Johannes das schwächste Glied in der Verteidigungskette zu sein. Fort St. Angelo auf Birgu und Fort St. Michael auf der Halbinsel der Stadt Senglea, im südwestlichen Teil des Großen Hafens gelegen, fast parallel zu Birgu, schienen deutlich wehrhafter zu sein. Kein Wunder, sie waren ständig ausgebaut worden, seit der römisch-deutsche Kaiser Karl V. Malta und die Nachbarinsel Gozo sowie Tripolis 1530 an den Orden übertragen hatte und diesem finanzielle Hilfe für den Ausbau der Befestigungsanlagen zukommen ließ.
Kundschafter berichteten inzwischen, dass die türkischen Hauptstreitkräfte in der Bucht von Marsaxlokk, im Südosten der Insel, an Land gegangen seien. Und gleich hatten sie sich auf den Weg nach Norden gemacht und schafften ihre Geschütze und Truppen in die Marsa-Ebene, wo sie ihr Lager und Hauptquartier einrichteten. Die würden sich aber noch wundern. Vorausschauend hatte Großmeister Jean Parrisot de La Valette die Brunnen der Gegend mit Krankheitserregern verseuchen lassen. Sollten sie sich doch die Seele aus dem Leib scheißen und dabei verrecken, wenn ihnen die Ruhr in ihre Därme fuhr.
Circa 40.000 Osmanen standen gegen rund 17.000 Malteser. Wie sollte das gutgehen? Es wurde Zeit, einen Brief an seinen Bruder, Heinrich Reiter den Älteren von Kernburg, zu Papier zu bringen. Vielleicht der letzte Brief, den er schreiben würde. Darin würde er seinem Bruder Heinrich, Ratsherr, Nürnberger Kriegshauptmann und Diplomat, seinen letzten Willen mitteilen, sein Vermächtnis übermitteln und Abschied nehmen. Hoffentlich würde er die Zeit dazu noch haben. In wenigen Tagen, vielleicht schon in wenigen Stunden würde das gottlose Pack der Türken seinen Angriff beginnen. „Herr im Himmel, erbarme dich unser. Gib uns die Kraft, dir zu Ehren unsere Feinde zu besiegen“, so betete er.
Auf der B4 kurz vor Nürnberg
Maximilian Faber, 24 Jahre alt, Medizinstudent im achten Semester und ehrenamtlicher Fahrer des Malteser Rettungsdienstes, war gerade auf der Bundesstraße 4 zwischen Erlangen und Nürnberg unterwegs. Den weiß-roten Krankentransportwagen, Typ KTW VW T5 mit Notfallausrüstung, hatte er sich am Nachmittag vom Malteser Rettungsdienst Nürnberg in der Hafenstraße 49 im Stadtteil Eibach ausgeborgt. Als ehrenamtlicher Rettungssanitäter hatte er jederzeit Zugang zum Fuhrpark in der Hafenstraße. In Eibach hatte ihn niemand gefragt, wozu er sich die Fahrzeugschlüssel für den KTW vom Wandboard schnappte. An diesem Dienstagspätnachmittag stand kein Krankentransport mehr an. Das hatte er überprüft. Das Fahrzeug wurde heute nicht mehr gebraucht. Der Fuhrparkleiter kannte Maximilian und hatte schon oft weggesehen, wenn der junge Mann sich einen KTW für nicht-dienstliche Zwecke ausgeliehen hatte. Das war zwar offiziell nicht gestattet, aber er wusste, dass Max, wie er ihn nannte, in seiner Freizeit alten und gebrechlichen Menschen sowie Obdachlosen seine persönliche Hilfe zukommen ließ. Das konnten Behördengänge sein, die er für sie übernahm, oder er versorgte sie mit Essbarem von diversen Tafeln, welche den jungen Mann als den „Roten Engel“ bezeichneten. Max hatte ein gutes Herz. Da konnte man schon mal die Vorschriften ignorieren und ein Auge zudrücken. Was Max machte, hatte Hand und Fuß. Er galt als zuverlässig und hoch motiviert, Menschen in Not zu helfen. Man bräuchte mehr solch engagierte junge Leute wie ihn. So ließ ihn der Fuhrparkleiter, Herr Bodenstaff, auch dieses Mal stillschweigend gewähren. Äußerlich sah der junge Mann ja schon etwas gewöhnungsbedürftig aus mit seiner roten, wirren Haartracht, die ihm zottelig und lockig bis weit in den Nacken fiel. Ganz zu schweigen von dem lichten Kinnbart, den er mit Gummibändern zusammenhielt. Seine schlabberigen, weiten Hosen und die selbst gefärbten schrillen T-Shirts, die er meistens dazu trug, trugen dazu bei, diesen etwas ungewöhnlichen Eindruck zu vervollständigen. An diesem Tag war Maximilian Faber nicht für Alte oder Gebrechliche mit dem KTW VW T5 unterwegs. Das erste Mal nutzte er das Fahrzeug rein privat, oder besser gesagt für die Memorialstiftung „Heiliger Geist zu Malta“, deren Mitglied er war. Ein Geheimnis, von dem nur wenige Kenntnis hatten.
Seine Eltern waren gläubige Christen und nahmen ihn schon als Kind zu jedem sonntäglichen Gottesdienst in die Lorenzkirche mit. Max liebte Kirchen. Wow, was für ein spitzer Turm, hier in der Lorenzkirche. Er meinte damit das 20 Meter hohe Sakramentshäuschen, das Adam Kraft aus Vacher Sandstein geschaffen hatte. Es bestand aus mehreren Etagen und hatte tatsächlich die Form eines spitz zulaufenden Turms. Unten konnte man darum herumgehen, darüber lag die zweite Etage mit dem Hostienschrank. In der nächsten Ebene zeigte der Künstler das Letzte Abendmahl, darauf folgend Szenen aus dem Leidensweg Christi. Weiter oben sah man den gekreuzigten und den auferstandenen Jesus. Die Spitze schließlich war nach unten eingedreht und sollte die Erdverbundenheit Gottes zum Ausdruck bringen. Maximilian verstand das damals alles noch nicht, dazu war er noch viel zu klein. Auch der „Englische Gruß“ des Nürnberger Meisters Veit Stoß war für ihn noch ein Rätsel. Dabei hatte das Kunstwerk mit England nichts zu tun. Das „Englische“ im Namen ist von „Engel“ abgeleitet und das Werk zeigt den Erzengel Gabriel, wie er Maria verkündet, dass sie Gottes Sohn gebären wird. „Sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir“, heißt es in Lukas 1,28. Für Maximilian waren das alles noch böhmische Dörfer. Er sah nur diese Gestalt mit Flügeln, die in einen hölzernen Rosenkranz eingebunden war, neben ihm eine Frau in festlichem Gewand. Das beeindruckte ihn. Ein Mensch der fliegen konnte. Das wäre doch etwas.
Als Maximilian 10 Jahre alt war, zogen seine Eltern um in das Gemeindegebiet von St. Sebald, der Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Erst im Laufe der Zeit begriff der kleine Max, warum seine Eltern nie mit ihm zum Gottesdienst in die Frauenkirche gingen. Aber gerade an der Kirche „Unserer Lieben Frau“ am Hauptmarkt hatte er von Kind an einen Narren gefressen. Besonders gefiel ihm das „Männleinlaufen“ am Westgiebel, wenn um 12 Uhr am Mittag die Figuren der Kurfürsten zur Erinnerung an die Verabschiedung der Goldenen Bulle dreimal um Kaiser Karl IV. laufen, um ihm zu huldigen. Jedes Jahr verfolgte er inbrünstig die Eröffnung des Christkindlesmarktes, wenn das Christkind seinen Prolog auf der Empore der Frauenkirche am Markt sprach. Er kannte ihn auswendig. Immer wenn das Christkind vortrug, sprach er innerlich mit.
Ihr Herrn und Frau‘n, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen, am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und nicht morgen wieder plagt. Hört alle zu, was euch das Christkind sagt: In jedem Jahr, vier Wochen vor der Zeit, da man den Christbaum schmückt und sich aufs Feiern freut, ersteht auf diesem Platz, der Ahn hat‘s schon gekannt, was Ihr hier seht, Christkindlesmarkt genannt.
Dies Städtlein in der Stadt, aus Holz und Tuch gemacht, so flüchtig, wie es scheint, in seiner kurzen Pracht, ist doch von Ewigkeit. Mein Markt bleibt immer jung, solang es Nürnberg gibt und die Erinnerung.
Denn alt und jung zugleich ist Nürnbergs Angesicht, das viele Züge trägt. Ihr zählt sie alle nicht! Das ist der edle Platz. Doch ihm sind zugesellt Hochhäuser dieser Tags, Fabriken dieser Welt.
Die neue Stadt in Grün. Und doch bleibt‘s alle Zeit ihr Herrn und Frau‘n: das Nürnberg, das ihr seid. Am Saum des Jahres steht nun bald der Tag, an dem man selbst sich wünschen und andern schenken mag.
Doch leuchtet der Markt im Licht weit und breit, Schmuck, Kugeln und selige Weihnachtszeit, dann vergesst nicht, ihr Herrn und Frau‘n, und bedenkt, wer alles schon hat, der braucht nichts geschenkt.
Die Kinder der Welt und die armen Leut, die wissen am besten, was Schenken bedeut. Ihr Herrn und Frau‘n, die ihr einst Kinder wart, seid es heut wieder, freut euch in ihrer Art. Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein.
Wenn dann, wie manchmal in früheren Jahren, der Hauptmarkt mit seinen weihnachtlichen Buden auch noch in eine zarte Schneedecke gehüllt war, fühlte Max den vorweihnachtlichen Glanz regelrecht auf seiner Haut. Max war ein tief gläubiger Christ, der Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe als seine Lebensziele definiert hatte. Aber da gab es noch mehr: Maximilian Faber hatte sich ausgiebig mit der Geschichte der Kirche auseinandergesetzt, auch der vorreformatorischen Geschichte. Nicht alles gefiel ihm, was er da las. Besonders faszinierte ihn aber die Epoche der Kreuzzüge, als christliche Heere danach trachteten, die Muslime aus dem Heiligen Land zu vertreiben. Warum eigentlich? Das verstand er anfangs nicht. Je mehr er darüber las, desto weniger konnte er es verstehen. Er schämte sich geradezu der Gräueltaten seiner Vorfahren. Er hasste es, wenn ihn jemand fragte, ob der Islam zu Deutschland gehöre. Was für eine blödsinnige Frage. Ja, natürlich, es ging doch um die Menschen. Wenn die Menschen Not litten, wenn sie in ihrem Land mit dem Tod bedroht wurden oder in ihrer persönlichen Situation nicht mehr ein noch aus wussten? Dann musste man ihnen doch helfen. Deswegen war Max der Stiftung „Heiliger Geist zu Malta“ beigetreten. Ein Kommilitone hatte ihm davon erzählt. Gemeinnützigkeit, Barmherzigkeit und Hilfe für andere waren eh sein Ding.
Nun war Max im Nürnberger Umland unterwegs, um einen heiklen und nicht ganz risikolosen Auftrag auszuführen, den ihm ein hohes Mitglied der Stiftung aufgetragen hatte. Was er nicht verstand: Warum sollte der Auftrag geheim bleiben? Er fuhr in Erlangen die Nürnberger Straße entlang und dann weiter die B4 in Richtung Nürnberg. Er drückte auf das Gaspedal des Wagens und erreichte schnell die erlaubten 100 Stundenkilometer. Schnell wollte er die brisante Fracht, die er vor rund dreißig Minuten übernommen hatte, in die Klinik der Stiftung bringen. Mit Sorge blickte er zum dunklen, grauen Himmel empor, der einen Wetterwechsel ankündigte. Seit mehr als einer Woche lag eine trockene Kältewelle aus Russland über Nordbayern und brachte eiskalte Polarluft und böig schneidende Winde aus Osten mit sich. Der einzige Lichtblick war, dass das frostige Wetter der vergangenen Wochen nun durch wärmere Luft vertrieben werden sollte. So zumindest der aktuelle Wetterbericht. Noch hatte tagsüber die Wintersonne am tiefblauen Himmel über Franken geglänzt. Die Böden waren noch beinhart gefroren. Das sollte sich im Laufe des heutigen Tages ändern, hieß es. Die Wärme sollte aus der Sahara über das Mittelmeer kommen und die nächsten Tage anhalten. Weiße Weihnacht ade. Die Wetterfrösche prophezeiten gar Regen, der auf die gefrorenen Böden treffen sollte. Blitzeis war angesagt. Als er die Stadtgrenze von Erlangen verließ, türmten sich im Westen bereits dunkle Wolken zu mächtigen Gebirgen auf. Das Thermometer war in der letzten halben Stunde auf knapp über null Grad gestiegen. Kurz darauf, als er die Autobahnzufahrt Tennenlohe passierte, klopfte auch schon ein erstes Regentröpflein zaghaft an die Windschutzscheibe seines Rettungswagens. Draußen war es inzwischen dunkel geworden. Die Wintersonne der letzten Tage hatte sich tief im Westen hinter dem bedrohlichen Wolkenberg verborgen und einer breiigen Dunkelheit Platz gemacht. Inzwischen hatte Max Boxdorf erreicht und somit auch Nürnberger Stadtgebiet. Er wusste, hier fuhr er momentan zu schnell. Hier waren nur 70 Stundenkilometer erlaubt, doch er wollte diesen Auftrag so schnell wie möglich hinter sich bringen. Seine Ladung hinten im Kastenwagen lag ihm schwer im Magen. „Heiliger Geist zu Malta“ hin oder her, noch nie hatte er für die Stiftung einen solch heiklen Auftrag ausgeführt. Er hatte sich nur widerwillig breitschlagen lassen, eine tote junge Frau durch die Gegend zu schippern. Anke Silbermann. Sie war an einem Blinddarmdurchbruch gestorben. Jetzt bloß keine Polizeikontrolle. Dass der feine Sprühregen, der urplötzlich vom Himmel kam und eher einem Nebelschleier glich, sich nur deshalb nicht sofort auf seiner Windschutzscheibe zu Eis verfestigte, weil Max die Heizung eingestellt hatte, bemerkte er einen Herzschlag zu spät. Auf dem ausgekühlten Straßenbelag dagegen gefror das Nass von oben sofort zu Eis. Gefährliches Blitzeis! Hilflos und quietschend huschten die Scheibenwischer über eine dünne Eisschicht, die sich nun doch in Sekundenschnelle auf der Frontscheibe gebildet hatte – trotz eingeschalteter Heizung. Maximilian fluchte. Er spürte, dass sich das Fahrverhalten des KTWs verändert hatte. Irgendwie schwamm das Fahrzeug auf der Straße. Ihn erfasste Panik. Er nahm seinen Fuß vom Gaspedal. Auch die Sicht nach draußen hatte sich auf einen milchig-trüben Blick in die Dunkelheit reduziert. Wegen des Eises auf der Scheibe. Schnell stellte er die Heizung des Wagens auf volle Kanne und das Gebläse auf volles Rohr. Da schoss ein riesiger dunkler Schatten, von rechts aus der Bucher Hauptstraße kommend, auf die B4 heraus. Was war das denn? Das gab es doch nicht! Das dunkle Etwas musste doch Rot haben! Der Mercedes-Benz- Actros-33-Tonner kam aus dem Nichts und drehte sich mitten auf der Kreuzung der B4 wie ein Derwisch um seine eigene Achse. Dort kam er zum Stillstand. Ein riesiges Hindernis. Max bremste. Das letzte, was Maximilian Faber noch mitbekam, war die riesige weiße Schrift auf rotem Grund: Schöller! „Fahren die Lebkuchen aus oder Eis?“, ging es ihm in Sekundenbruchteilen durch den Kopf. „So eine blöde, belanglose Frage“, stellte er panisch fest, „das ist jetzt doch scheißegal“. Der Lkw kam immer näher. „Scheiß-Blitzeis“, war das letzte, was Max in seinem jungen Leben feststellte. Danach hatte er nur noch wenige Sekunden zu leben. Sein VW KTW stellte sich auf der spiegelglatten Teerdecke nun ebenfalls quer. Das Fahrzeug begann zu rotieren, drohte zu kippen, entzog sich der Kontrolle des Fahrers und schlitterte dann rutschend und drehend zwischen die Sattelzugmaschine und ihren Auflieger. Metall rieb sich kreischend an Metall, knickte ein, verformte sich, Glas splitterte und Maximilian Faber starb einen schnellen Tod. Das Führerhaus seines VWs war quasi nicht mehr existent. Als sich der Rauch legte, den der Aufprall verursacht hatte, hatte sich sein VW in die riesige Zugmaschine verkeilt. Die Wucht der Kollision hatte den Fahrersitz aus den Führungsschienen gerissen. Max Faber wurde angeschnallt nach vorne geschleudert. Überall waren Metallstreben geknickt und standen nun wie tödliche Lanzen in den ehemaligen Fahrerraum hinein. Seine Gehirnmasse vermischte sich mit Blut, als Körper und Kopf des jungen Mannes durch die Windschutzscheibe brachen. In seinem Hals steckte eine Metallstrebe. Auch hinten im Wagenkasten wurde alles durcheinandergeschleudert, was nicht niet- und nagelfest war. Nur die Gurte, welche den Leichnam der jungen Anke Silbermann festhielten, gaben keinen Zentimeter nach. Sie hielten. Max Fabers brisante Fracht hatte den Crash unbeschadet überstanden. Das hing allerdings vom Betrachtungsstandpunkt ab, denn die junge Frau war schon lange tot, als sie am Spätnachmittag von Max auf die Liege geschnallt worden war.
Zur gleichen Zeit am Nürnberger Flughafen
Der junge Polizeimeisteranwärter Heiko Kruse und sein Kollege Polizeimeister Bernd Schick von der Verkehrspolizeiinspektion in der Gustav-Adolf-Straße standen mit ihrem Audi-A4-Einsatzwagen am Nürnberger Flughafen, als der gefrierende Regen einsetzte und die Fahrbahnen und Gehsteige in wenigen Sekunden in gefährliche Rutschbahnen verwandelte. Die ahnungslosen Flugpassagiere, die schwungvoll aus der Ankunftshalle ins Freie traten, um sich um ein Taxi zu bemühen oder um den nächsten Aschenbecher aufzusuchen, purzelten reihenweise hin, als sie unbesorgt die tückischen Eisflächen betraten. Manche versuchten noch, an ihren Rollkoffern Halt zu finden, was aber nur wenigen gelang, da ihre Gepäckstücke dafür einfach nicht bestimmt waren. Viele der angekommenen Fluggäste zogen sich daraufhin wieder in das Flughafengebäude zurück, als sie das Chaos draußen sahen und warteten erst einmal ab. Einige wenige retteten sich, sich vorsichtig vorwärts tastend, in einen der nahen U-Bahnhöfe, um von dort unten den Nachhauseweg auf dem Schienenweg anzutreten. Heiko Kruse wollte gerade aussteigen, um einem alten Mütterchen über die Eisfläche zu helfen, als sich über Funk die Polizeieinsatzzentrale meldete: „Schwerer Verkehrsunfall auf der B4, Kreuzung Bucher- und Kraftshofer Hauptstraße“, knarzte es aus dem Bordlautsprecher. „Wer übernimmt?“
„Scheiße, auch das noch!“, fluchte Polizeimeister Bernd Schick, dann drückte er die Sprechtaste seines Funkgerätes. „Hier spricht Kuno 5, Polizeimeister Schick. Befinden uns am Flughafen. Wir übernehmen, kann aber etwas dauern, bis wir vor Ort sind. Die Straßen hier sind völlig vereist und spiegelglatt. „Schalt das Blaulicht ein und mach dich langsam vom Acker“, wies er seinen jungen Kollegen Kruse an, „du hast ja gehört. Schöne Scheiße. Aber Heiko, bitte fahr vorsichtig!“ Mit eingeschaltetem Blaulicht und heulendem Martinshorn schlich sich Kuno 5 mit annähernd 15 Stundenkilometern davon.
Für die wenigen Kilometer Wegstrecke bis zur Unfallstelle benötigten Heiko Kruse und Bernd Schick rund eine Stunde. Unterwegs herrschte Chaos pur. Etliche Pkws standen quer oder waren im Straßengraben gestrandet. Andere waren haufenweise aufeinander gerutscht. Fahrzeuge standen im Weg, ihre Fahrer besahen sich die Blechschäden. Heiko Kruse und Bernd Schick krochen mit rotierendem Blaulicht dahin. Der Rückstau in Richtung Nürnberg war endlos, stellten die beiden fest, als sie es auf der Marienbergstraße endlich bis zur Einfahrt auf die B4 geschafft hatten. Links von ihnen erstrahlte ein breites Band gleißender Autoscheinwerfer, welches sich vom Nürnberger Stadtrand bis hierher zog. Dichte Abgaswolken quollen aus hunderten stehenden Fahrzeugen in den dunklen Nachthimmel, aus welchem nun dicke Regentropfen zur Erde klatschten und noch immer auf dem kalten Boden zu Eis gefroren. Auch rechts von Kuno 5 glänzte eine Autoschlange. Auf dem Weg nach Erlangen hatte sich ein rotes Meer von Rücklichtern gebildet. Auch diese Blechlawine war zum Stillstand gekommen und lauerte begierig auf jede Vorwärtsbewegung. „Von wegen Rettungsgasse“, schimpfte Schick, griff sich das Mikro und schaltete den Lautsprecher ein. „Hier spricht die Polizei“, dröhnte es über die Autodächer der vor ihnen stehenden Fahrzeuge. „Sie behindern einen Noteinsatz.“ Blaulicht rotierte in der Nacht, begleitet vom klagenden Heulen des Martinshorns. „Bilden Sie unverzüglich eine Rettungsgasse!“, forderte die strenge blecherne Stimme von Polizeimeister Schick die vor ihnen stehenden Fahrer auf. Es dauerte, bis Bewegung in die Fahrzeuge kam. Über der Autoschlange knatterte im Tiefflug der Rettungshubschrauber Christoph 27 von der DRF Luftrettung hinweg, überflog den Stau in Richtung Erlangen und drehte zwei, drei Kilometer weiter vorne einen engen Kreis. Dann ging der Helikopter zur Landung nieder. Noch bevor die Rotoren des Drehflüglers zum Stillstand kamen, sprangen ein Notfallarzt und ein Rettungsassistent aus dem Fluggerät. Dr. Friedhelm Warter vom Klinikum Nürnberg versuchte, so gut und so schnell es ging, sich ein erstes Bild vom Unfallort zu verschaffen und entschied sich dann schnell für den lädierten Malteser Krankentransportwagen. „Sieh du im Führerhaus des Lkw nach“, rief er seinem Assistenten zu, bevor er sich selbst vorsichtig der Fahrerkabine des KTW näherte. Hier gab es nichts mehr zu retten. Das stellte er auf den ersten Blick fest, als er mit einer starken Taschenlampe in das Blech- und Stangenwirwarr des ehemaligen Führerhauses leuchtete. Der Fahrersitz im KTW musste durch die Wucht des Aufpralls aus seiner Verankerung gerissen worden sein. Der Fahrer hing zwar noch in seinem Gurt, doch sein Kopf war durch die Windschutzscheibe gebrochen und nur noch ein lebloser, blutiger Körperanhang voller Glasscherben. In seinem Hals steckte eine rot gefärbte Metallstange. Dr. Warter wandte sich mitfühlend ab und dem Kastenaufbau des KTW zu, der großflächig deformiert auf den Auflieger der Schöller-Zugmaschine gedonnert war. Dennoch, die rückwärtige Tür ließ sich problemlos öffnen. Der Arzt leuchtete mit seiner Taschenlampe hinein. Wie zu erwarten herrschte auch hier ein heilloses Chaos aus medizinischen Gerätschaften, welche durch den Aufprall aus ihren Halterungen gesprungen waren. Dann blieb der Lichtkegel seiner Stablampe auf der Pritsche im Kastenaufbau des KTWs hängen. Darauf war ein unversehrt aussehender menschlicher Körper geschnallt. Der Arzt räumte herumliegende Utensilien zur Seite und verschaffte sich Zugang zum Inneren des Durcheinanders. Der Strahl seiner Taschenlampe leuchtete in das junge Gesicht einer Frau, schätzungsweise um die Zwanzig. Genau wie der Fahrer war auch sie tot – jedoch ohne sichtbare äußere Verletzungen, wie er nach einer schnellen, oberflächlichen Untersuchung feststellte. Wenn ihn seine Erfahrungen nicht vollständig trogen, war die junge Frau schon vor länger als dreißig Stunden verstorben. Darauf wies zumindest der Zustand der Totenflecken auf ihrem Körper hin. Die Hypostase, das Absinken ihres Blutes, hatte bereits vor vielen Stunden begonnen. Die rotvioletten bis blaugrauen Totenflecken waren bereits stark ausgeprägt und ließen sich nicht mehr wegdrücken. Ihr Blut musste bereits stark eingedickt sein. „Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fall für die Rechtsmedizin und die Kripo“, ging es dem Arzt durch den Kopf. Was machte eine Leiche in einem KTW?
„Hallo, ist da jemand?“ Heiko Kruse und Bernd Schick waren endlich an der Unfallstelle angekommen. Das rotierende Blaulicht ihres Audi zeichnete gespenstische Lichtsignale in den regenträchtigen Himmel. Die beiden Piloten von Christoph 27 versuchten am Straßenrand den Helikopter notdürftig von seinen Vereisungen zu befreien. Dr. Warters Rettungsassistent hatte die Ankunft der beiden Polizeibeamten ebenfalls bemerkt und meldete sich laut aus dem Inneren des Führerhauses der Mercedes-Benz-Zugmaschine, wo er dem nur leicht verletzten Fahrer eine Beruhigungsspritze gesetzt hatte.
„Es war, als ob ich gar net bremst hätt“, jammerte der immer wieder. „Dabei hab ich fei scho bremst, weil die Ampl woar ja auf Rot, aber des hab ich bei dem Scheißregn zu spät gmerkt. Dann hab ich bremst. Der blede Lkw hat zuerst goar ned reagiert. Der is immer no weider gradaus gfahrn – einfach grutscht. Auf amol hat‘s mi dann dreht und dann hat‘s a scho an Schloch do. Was is‘n überhaupt bassiert?“
Auch Dr. Warter hatte die Rufe der beiden Verkehrspolizisten gehört. In beiden Richtungen der B4 standen noch immer endlos lange Autoschlangen. Ungeduldige Fahrer malträtierten ihre Hupen und fluchten vor sich hin.
„Polizeimeister Bernd Schick von der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg, mein Kollege Heiko Kruse“, stellte sich einer der Beamten vor, als der Notarzt aus dem Wrack des KTW gekrochen kam.
„Ich bin der Notarzt, Doktor Warter“, stellte er sich vor.
„Was können Sie uns sagen, Herr Doktor?“
„Der Fahrer des Malteser-KTW ist an der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Im Kastenwagen befindet sich eine weitere Leiche. Es handelt sich dabei um eine junge Frau. Sie ist bereits schon länger tot, schon vor dem Unfall. Ich frage mich, warum wird sie in einem Malteser-KTW transportiert und nicht in einem normalen Leichenwagen. Da scheint etwas nicht zu stimmen. Woran sie verstarb, ist in der Kürze der Zeit nicht feststellbar gewesen. Da muss der Rechtsmediziner ran. Es sieht zumindest nach einem Todesfall mit Fragezeichen aus. Hier scheint einiges klärungsbedürftig zu sein. Sie sollten Ihre Kollegen von der Mordkommission hinzuziehen. Ich habe da ein ganz komisches Bauchgefühl. Lassen Sie die beiden Toten in die Rechtsmedizin bringen. Vielleicht wollen Ihre Kollegen von der Kripo ja noch einen Blick auf die Tote werfen.“
„Machen wir“, antwortete Schick.
„Wenn mein Assistent mit dem Lkw-Fahrer fertig ist, machen wir uns wieder vom Acker. Der nächste Einsatz ruft. Heute geht es ja zu wie im Tollhaus.“
Am gleichen Abend in Ziegelstein und in Langwasser
Hauptkommissar Tobias Bellinghausen vom Kriminalfachdezernat 1 und Leiter der Mordkommission K11 am Jakobsplatz 5 war stinksauer. „So leid es mir tut, das ist Angelegenheit der Verkehrspolizei“, unterbrach er am Telefon seine Partnerin, Kommissarin Sandra Knobloch. „Wegen so einem Scheißunfall rufst du mich an“, warf er ihr erzürnt vor. Wir sind von der Mordkommission und außerdem schifft es draußen und es ist arschglatt!“
„Das weiß ich alles, Tobias“, entgegnete die Anruferin unbeeindruckt. „Jetzt hör mir doch erst einmal zu, ohne mich nach jedem Halbsatz zu unterbrechen. Meinst du, ich habe große Lust, bei diesem Scheißwetter meinen Arsch nach draußen zu bewegen? Eigentlich hatte ich vor, ein heißes Bad zu nehmen und mir anschließend in Ruhe die Nachrichten und einen Spielfilm anzusehen. Aber lassen wir das jetzt. Der fliegende Notarzt, der vor Ort an der Unfallstelle war, sprach davon, dass sich – neben dem tödlich verunglückten Fahrer – in dem schrottreifen Krankentransportwagen auch die Leiche einer Frau befand, die gar nicht an den Folgen des Unfalls verstarb.“
„Sondern?“, warf Bellinghausen ein.
„Sondern, sondern? Woher soll ich das wissen? Jedenfalls war sie schon Stunden oder Tage vorher tot, sagt der Arzt. Hast du gehört? Bevor sich der Unfall ereignete.“
„Ermordet?“
„Tobias, frag mich was Leichteres, ich bin keine Hellseherin. Wir müssen dorthin, dann wissen wir vielleicht mehr. Die Kollegen von der Verkehrspolizei sind da völlig überfordert.“
„So ein Mist, vier Tage vor Weihnachten“, klagte der Hauptkommissar.
„Ich könnte mir auch etwas Schöneres vorstellen“, bestätigte ihm seine Kollegin, „aber jammern hilft jetzt auch nichts. Was und wie machen wir es also?“
Bellinghausen überlegte. „Mit dem Auto macht es keinen Sinn“, bellte er in den Telefonhörer, „das dauert bei den Straßenverhältnissen viel zu lange, bis wir an der Unfallstelle sind. Wir nehmen die U-Bahn und treffen uns am Hauptbahnhof. Von dort fahren wir bis zur Station Nordwestring und dann weiter mit dem Taxi. Über die Käffer Letzendorf, Höfles und Buch kommen wir wahrscheinlich am schnellsten voran. Die B4 ist jedenfalls hoffnungslos dicht.“
„Na, dein Wort in Gottes Ohr. Wann treffen wir uns am Hauptbahnhof?“, wollte Sandra Knobloch noch wissen.
Tobias Bellinghausen sah auf seine Armbanduhr. „Bis zum nächsten U-Bahnhof Herrnhütte brauche ich fünf Minuten. Die nächste U-Bahn fährt dann zehn Minuten später ab. Sagen wir, in einer halben Stunde?“
„Okay, bis in einer halben Stunde. Könnte bei mir etwas knapp werden, aber das wirst du dann ja sehen. Und du bist dir sicher, dass die Taxen bei dem Sauwetter überhaupt noch fahren?“, zweifelte Sandra Knobloch.
*
Die Kommissarin wohnte im Stadtteil Langwasser, Tobi, wie sie ihren Kollegen im Kommissariat alle nannten, in Ziegelstein. Sie erinnerte sich: Vor ziemlich genau zwei Jahren, es war ebenfalls kurz vor Weihnachten, hatte sich Tobias geoutet. Keiner der Kollegen und Kolleginnen hatte bis dahin etwas von seiner Homosexualität bemerkt. Gut, es gab immer wieder diese ach so lustigen Bemerkungen wie: „Tobi, jetzt wird‘s aber langsam Zeit, jünger wirst auch du nicht mehr,“ oder „Mensch, Tobi, schau, da drüben läuft ein heißer Feger“. Natürlich fragte man sich hin und wieder, warum man Bellinghausen nie in weiblicher Begleitung sah. Warum er nie etwas von einer Freundin erwähnte. Er, ein durchaus gut aussehender Mann Mitte vierzig, schlank, sportliche Figur, 1,86 Meter groß, kantiges, männliches Gesicht, grüne Augen und mit attraktivem, südländisch-dunklen Teint. So ließe sich sein Äußeres knapp und präzise beschreiben. Akribisch pflegte er seinen kurz gehaltenen, dunklen Bürstenschnitt. Jedes einzelne Haar musste an seinem Platz liegen. Auch charakterlich war Tobi in Ordnung. Eigentlich kontaktfreudig, lacht gerne und besitzt eine äußerst positive, lebenslustige Aura. Aber wehe, er hat schlechte Laune, jemand widerspricht unsachgemäß oder ärgert ihn, dann kann Tobi zum Alptraum werden. Schade nur, dass er so ein schlechtes Personengedächtnis hat, für einen Kriminalbeamten ungewöhnlich. Vielleicht waren es diese Gegensätze an ihm, die bisher eine dauerhafte Bindung verhindert hatten. So dachten die meisten, die Tobi kannten. Umso mehr schlug es im K11 wie eine Bombe ein, als sich Hauptkommissar Tobias Bellinghausen während einer kleinen, internen Weihnachtsfeier mit den Worten erklärte: „Leute, Kollegen, Kolleginnen, wieder stehen wir kurz vor den Feiertagen bei einem Glas Glühwein zusammen, plaudern und unterhalten uns, dabei wissen wir so wenig voneinander. Ich zum Beispiel habe euch jahrelang etwas vorgespielt, beziehungsweise verheimlicht. Damit will ich nun Schluss machen. Diese Heimlichtuerei geht mir langsam auf den Sack. Es soll ein jeder wissen: Ich bin schwul.“ Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können, wenn sie denn gefallen wäre. Sandra Knobloch erinnerte sich noch gut an die Szene damals. Sie hatte als Erste die Fassung wiedergewonnen, war spontan auf ihren Kollegen und Chef zugegangen und hatte ihn fest umarmt. „Danke für deine Offenheit, no problem, Tobi“, hatte sie sich laut und von allen Anwesenden deutlich hörbar artikuliert, „hast du geglaubt, wir sind von vorgestern? Das ändert überhaupt nichts.“ Schlagartig verloren auch die anderen Kollegen und Kolleginnen ihre Lähmung und ein herzlicher, langanhaltender Applaus brandete auf.
Ihre U-Bahn fuhr in die Station Hauptbahnhof ein, die Bremsen der Waggons quietschten. Die U-Bahn stoppte mit einem Ruck. Die Kommissarin hatte Tobi schon draußen auf der Plattform entdeckt. Sie mussten beide in die U3 umsteigen.
Als sie wenig später an der Endstation Nordwestring ankamen, wartete ein Streifenwagen der Verkehrspolizei auf sie. Sandra Knobloch hatte sich nicht auf die Verfügbarkeit der lokalen Taxis verlassen wollen. Die waren zwar im Einsatz, aber alle unterwegs. Gegen 22 Uhr kamen Tobias Bellinghausen und Sandra Knobloch endlich an der Unfallstelle an und wurden von Polizeimeister Schick begrüßt. Er und Kruse hatten inzwischen Verstärkung erhalten. Ihre Kollegen und Kolleginnen leiteten den Verkehr in Richtung Buch oder Kraftshof um. Es war wieder Leben in die Blechlawinen gekommen. „Der Notarzt ist schon zum nächsten Einsatz weitergeflogen“, erklärte Schick, „der Leichnam des verunglückten KTW-Fahrers ist auf dem Weg in die Rechtsmedizin nach Erlangen. Die Leiche der jungen Frau befindet sich noch im Aufbau des demolierten Krankentransportwagens. Ich dachte mir, Sie wollen sie noch ansehen. Dabei könnte es sich um ein Mordopfer handeln, wenn ich den Notarzt richtig verstanden habe. Wenn Sie nun wollen, können wir.“
„Gut gemacht, deswegen sind wir extra hergekommen“, entgegnete der Hauptkommissar knapp. „Wenn Sie uns mal Ihren Handstrahler überlassen könnten? Auf geht‘s Sandra, sehen wir uns die Dame mal an!“
„Was soll mit dem KTW, beziehungsweise der Leiche geschehen, wenn Sie hier fertig sind?“, wollte Polizeimeister Schick wissen. „Der Notarzt meinte, wir sollen die Tote ebenfalls in die Rechtsmedizin nach Erlangen schaffen lassen. Kommt die SpuSi auch noch?“
„Das sagen wir Ihnen, wenn wir uns die Dame etwas näher angesehen haben“, erwiderte Knobloch. Dann näherten sie sich, vorsichtig vorwärts tastend, dem Kastenwagen. Nach einer Viertelstunde tauchten die beiden wieder aus dem zerstörten KTW auf. „Da drinnen schaut es ja wild aus, alles durcheinander“, meinte sie. „Es bringt nichts, wenn wir die SpuSi bei diesen Witterungsverhältnissen auch noch hierher rufen. Bitte veranlassen Sie, dass die Tote ebenfalls in die Rechtsmedizin überführt wird und der Unglückswagen soll auf das Gelände der Bereitschaftspolizei in der Kernburger Straße gebracht werden. Die SpuSi und die KTU werden sich morgen darum kümmern.“
„Verstanden. Ich werde alles veranlassen. Ein Scheißtag ist das heute.“
„Das können Sie laut sagen“, bestätigte Sandra. „Die Dokumente, die wir im Handschuhfach des KTW gefunden haben, nehmen wir mit.“
Rückschau: Kurz vor Weihnachten 1565 in der Kernburg
Heinrich Reiter der Ältere von Kernburg stellte die brennende Kerze näher an die Dokumente, die er heute erhalten hatte. Als er das Paket öffnete, flatterten zwei eng beschriebene Seiten auf den steinernen Fußboden. Dann griff er nochmal in den Umschlag und zog weitere, dick verschnürte und versiegelte Kuverts heraus. Mein Vermächtnis stand darauf, mit etwas wackeliger Handschrift geschrieben. Er hob die beiden Blätter vom Boden auf und betrachtete sie. Heinrich Reiter erkannte die verschnörkelte Handschrift seines Bruders. Er rückte nah an das Kerzenlicht heran und begann zu lesen. Im offenen Kamin knackten trockene Birkenholzscheite, an denen gierige Flammen züngelten und allmählich eine wohlige Wärme in der Stube verbreiteten. Der Brief war auf den 10. September datiert und stammte eindeutig von seinem Bruder Johannes. Draußen, hinter den vereisten Fenstern der Kernburg, tobte ein dichter Schneesturm. Eisiger Wind heulte um den Burgturm. Dicke Flocken wirbelten durch die Nacht, bevor sie sich tanzend fallen ließen und die Landschaft allmählich in ein weißes Kleid tauchten.
Hochehrwürdiger Bruder Heinrich,
die Schlacht ist geschlagen. Vor zwei Tagen sind die Türken wieder in See gestochen. Zumindest der Teil, der von ihnen übrigblieb. Wir haben mehr als die Hälfte von ihnen getötet und rund 10.000 der Gottlosen verwundet. Doch auch wir mussten kräftig Tribut zahlen. 10.000 von uns haben das Gemetzel nicht überlebt, 1.300 wurden schwer verwundet, so auch ich. Aber davon später. Wie von mir befürchtet haben die Osmanen zuerst Fort Elmo angegriffen. Dreißig Tage tobte der Kampf, bevor die Festung fiel. Von den ursprünglich 1.500 Verteidigern St. Elmos überlebten nur neun Ordensritter. Weil während der Kämpfe dort mehr als 8.000 türkische Soldaten ihr Leben lassen mussten, ließ Süleyman die neun zur Vergeltung hinrichten, ihre Leichen kreuzigen und sie über das Wasser zu uns nach Birgu und Senglea treiben. Im Gegenzug befahl unser Großmeister, türkische Gefangene zu enthaupten, und wir schossen mit unseren Geschützen ihre Köpfe hinüber auf das gefallene Fort St. Elmo, wo nun die gottlosen Türken saßen. Nach der Einnahme des Forts richteten die Osmanen ihre Kanonen auf unser Fort St. Angelo und begannen am 15. Juli den Sturmangriff auf unsere Bastion St. Michael. Doch wir haben es den Ungläubigen heimgezahlt und sie aus einer gut getarnten Batterie unterhalb von St. Angelo zusammengeschossen.
Meine ursprüngliche Sorge galt unserer Hauptstadt Mdina, die relativ ungeschützt im Hinterland zurückblieb. Das mussten auch die Türken mitbekommen haben. Mit 1.800 Soldaten erschienen sie vor den Mauern der Stadt. Unser Stadtkommandant, der von dem bevorstehenden Angriff rechtzeitig erfahren hatte, griff zu einer Kriegslist. Er kleidete die Alten und die Frauen der Stadt in Uniformen und stellte sie auf die Zinnen der mächtigen Mauern, als die Osmanen anrückten. Den Ungläubigen schickte er ein kurzes, heftiges Feuer entgegen, als sie in Reichweite gerieten. Die Türken waren so von der scheinbaren Wehrhaftigkeit der Stadt überrascht, dass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen.
Vom 2. bis zum 7. August versuchten dann die verteufelten Osmanen unsere Bastionen sturmreif zu schießen, doch wir schlugen alle ihre Angriffe tapfer und erfolgreich zurück. Während einer ihrer Attacken rund um den Großen Hafen rückte unsere Kavallerie aus, suchte ihr schlecht geschütztes Feldlager heim und tötete zahlreiche Verwundete und Kranke, bevor sie es in Brand steckten. Auch dass wir die Brunnen in der Masra-Ebene vergiftet hatten, zahlte sich aus. Viele Türken waren krank und kampfunfähig. Sie litten an blutig-schleimigen Durchfällen, Fieber und Schwäche und waren nicht fähig zu kämpfen.
Als wir am 28. August einen weiteren ihrer Großangriffe abwehren konnten und die Osmanen am gleichen Tag erfuhren, dass ein wichtiges ihrer Versorgungsschiffe auf dem Weg nach Malta von uns geentert worden war, war dies der Anfang vom Ende. Ihr Nachschub lag darnieder, ihre Truppen waren durch viele Kranke und Gefallene geschwächt und ein Entsatzheer gegen sie war von Sizilien aus unterwegs. Wir schöpften neue Hoffnung und waren gewillt, bis zum Tod zu kämpfen. Unser Großmeister ließ die Brücke zum Fort St. Angelo sprengen. „Es gibt kein Zurück, nur Sieg oder Tod“, rief er. Als die Türken am 8. September kopflos und geschlagen abzogen, waren wir gerade noch 600 des Kampfes fähige Verteidiger.