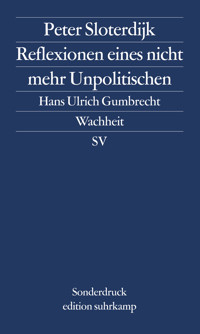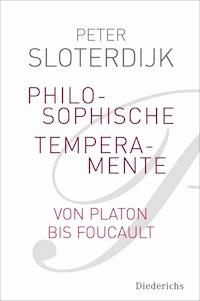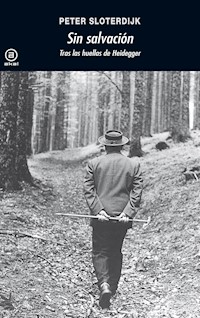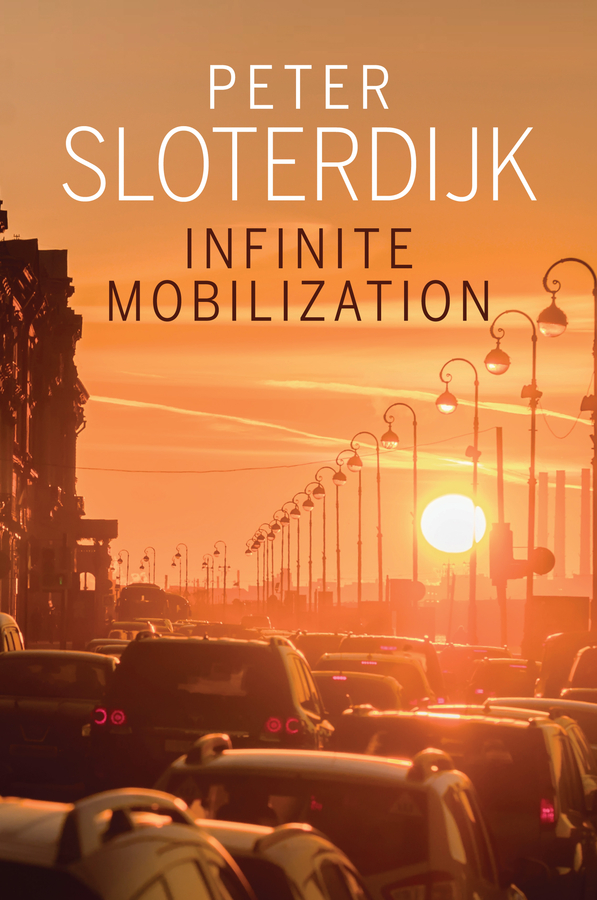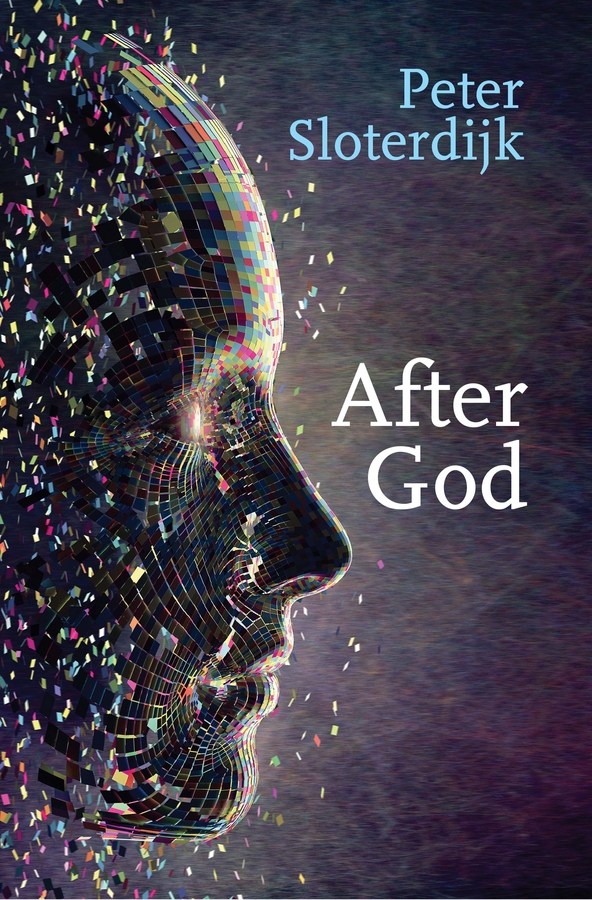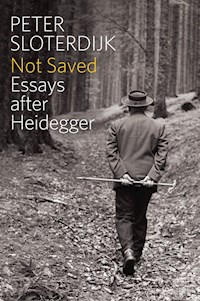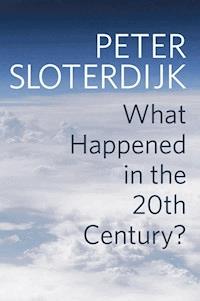11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Datierte Notizen
- Sprache: Deutsch
Über vier Jahrzehnte hinweg widmete sich Peter Sloterdijk Morgen für Morgen einem Tagebuch besonderen Typs: In linierten DIN A4 Heften hielt er handschriftlich fest, was ihm am vergangenen Tag aufgefallen war und was ihm bevorstand. Eine Veröffentlichung der Notate zog er nicht in Betracht. „Datierte Notizen“ entstanden durch dieses Schreiben-für-sich-selbst, eine melancholisch-fröhliche Zeitgenossenschaft zeigt sich in ihnen die Denktagebuch, intellektuelle Komödie und gesellschaftliche Tragödie auf einzigartige Weise miteinander verknüpfen. Peter Sloterdijk schrieb in den wie um ihrer selbst geführten Tagebüchern mit und gegen die Ereignisse, richtete seine Aufmerksamkeit auf die großen Zusammenhänge und die versteckten Details; zur frühen Stunde entstanden außergewöhnliche Kurzessays und ironische Aphorismen, bissige Kommentare und zurückhaltende Lobgesänge. Ende des Jahres 2011 entschloß sich der Tagebuchschreiber, seine Notizen öffentlich zu machen: Er nahm sich Heft 100 aus dem Jahre 2008 vor und transkribierte seine Niederschriften, Zeilen und Tage, bis zum Ende des Jahres 2010.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Der Philosoph, Kulturanthropologe und Zeitdiagnostiker macht zum ersten Mal seine Notizhefte zugänglich: lange und kurze Notate, Zeugnisse einer reflexiven, radikalen und sensiblen Zeitgenossenschaft.
Über vier Jahrzehnte hinweg widmete sich Peter Sloterdijk Morgen für Morgen einem Tagebuch besonderen Typs: In linierten DIN-A4-Heften hielt er handschriftlich fest, was ihm am vergangenen Tag aufgefallen war und was ihm bevorstand. Der Philosoph schreibt gegen die Ereignisse, richtet seine Aufmerksamkeit auf die großen Zusammenhänge und die versteckten Details; zur frühen Stunde entstanden außergewöhnliche Kurzessays und ironische Aphorismen, bissige Kommentare und zurückhaltende Lobgesänge.
Peter Sloterdijk
Zeilen und Tage
Notizen 2008-2011
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe
des suhrkamp taschenbuchs 4485
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung
nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Michels, Göllner, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-79840-9
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorbemerkung
Erstes Buch
Spuren ins Posthumien
Heft 100
8. Mai 2008 – 21. September 2008
Heft 101
21. September 2008 – 11. Februar 2009
Heft 102
11. Februar 2009 – 30. April 2009
Heft 103
1. Mai 2009 – 28. Juli 2009
Heft 104
30. Juli 2009 – 9. November 2009
Heft 105
10. November 2009 – 27. Februar 2012
Zweites Buch
Aus der besten Welt
Heft 106
28. Februar 2012 – 31. Mai 2010
Heft 107
1. Juni 2010 – 26. August 2010
Heft 108
27. August 2010 – 21. November 2010
Heft 109
22. November 2010 – 26. Januar 2011
Heft 110/111
26. Januar 2011 – 8. Mai 2011
Vorbemerkung
Es war an einem etwas hohlen Sonntag im Dezember 2011, als der Verfasser der hier präsentierten Notizhefte mit der Abschrift von einigen seiner Aufzeichnungen aus jüngerer Zeit begann. Diesem Augenblick waren Besuche beim Deutschen Literatur-Archiv in Marbach und Gespräche mit dem Lektor seines Verlages in Berlin vorangegangen, die ihn in die gleiche Richtung drängten: Aus beiden Gegenden war zu hören, es sei bizarr, wenn auch faszinierend, daß ein Autor seit vierzig Jahren nahezu täglich etwas in seine Hefte kritzelt und danach nie wieder darauf zurückkommt. Ob diese Sorglosigkeit nicht etwas fahrlässig sei? Müßte man sich um diese Notizen nicht besser kümmern?
Immerhin: Der Verfasser hatte die Hefte aufbewahrt, obschon ohne konkrete Idee, wie sie zu verwenden seien. Seit langem war ihm zumute gewesen, auf jedem dieser Hefte befände sich unsichtbar der Aufdruck: »Für später«. Ohne voneinander zu wissen, waren Ulrich Raulff und Raimund Fellinger sich einig, es müßte von jetzt an heißen: »Für demnächst«.
An besagtem Sonntag nahm der Autor ein Heft aus dem Regal, es trug die Nummer 104. Mit einer solchen Zahl sollte man nicht anfangen, das schien evident. Er ging vier Hefte zurück, blätterte im Band 100 hin und her, fand manches merkwürdig, manches amüsant, manches belanglos, manches peinlich. Probeweise fing er mit einer Transkription der ersten Seiten an. Schnell wurde ihm klar, er würde für eine Weile beschäftigt sein. Er entschied sich dafür, vom Merkwürdigen und vom Amüsanten mehr zu übernehmen als vom Peinlichen, das Belanglose auf sich beruhen zu lassen. Allerdings war er sich nicht sicher, ob er nicht ständig die Kategorien durcheinanderbrachte. Die Ergebnisse der möglichen und wirklichen Verwechslungen hat man auf den folgenden Seiten vor sich.
Die vorliegenden Notizen decken einen Zeitraum von drei Jahren ab. Da sie der Chronologie folgen, laufen sie schlicht am Gängelband der Chronistenehrlichkeit, geringfügige Umstellungen abgerechnet. Das Ausgelassene überwiegt das Beibehaltene etwa im Verhältnis drei zu eins. Da es sich um Aufzeichnungen aus der jüngeren Vergangenheit handelt, profitierte der Autor davon, daß ein gut Teil des Dargestellten noch im Gedächtnis lebendig war. Einzelne Notizen wurden bei der Abschrift erweitert und pointiert. Eine Haftung für stetige wortgenaue Abschriften aus den Vorlagen wird ausgeschlossen, die Echtheit des Stoffs aus vielen Tagen und Zeilen ist garantiert.
Angemerkt sei, daß in dem Berichtszeitraum vier Buchpublikationen des Autors erschienen, deren Entstehungsspuren in den Notizen hier und dort erkennbar sind, am deutlichsten in bezug auf das in den ersten Heften häufiger erwähnte Buch: Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, 2009. Von der Erarbeitung der übrigen Schriften Scheintod im Denken. Über Philosophie und Wissenschaft als Übung, 2010, Die nehmende Hand und die gebende Seite. Beiträge zu einer Debatte über die demokratische Neubegründung von Steuern, 2010, Streß und Freiheit, 2011, sind nur blasse Reflexe in die Aufzeichnungen eingegangen.
Hinsichtlich ihrer Gattungszugehörigkeit sind die folgenden Seiten nicht leicht zu klassifizieren. In formaler Sicht sind sie dem Genre der Cahiers verwandt, wie Paul Valéry sie praktizierte, sie meiden jedoch die nachträgliche Sortierung der Eintragungen nach Themengruppen, durch die Valérys Hefte bei all ihrem Glanz zuweilen den Charakter einer zeremoniellen und repetitiven Ideensammlung annehmen. Auch handelt es sich um keine Tagebücher im gewöhnlichen Sinn, geschweige denn um intime Journale oder carnets secrets. Ebensowenig treffen Begriffe wie »Denk-Tagebuch« oder »Arbeitsjournal« zu. Vielleicht kann man sich darauf einigen, sie als datierte Notizen zu betrachten – ein bisher wenig belegtes Genre. Daß in ihnen Valérys Idee der intellektuellen Komödie aufgenommen wird, ist nicht zu leugnen.
Die Aufzeichnungen gliedern sich in zwei »Bücher«, die unter vorsichtig programmatische Titel gestellt sind – »Titel«, die diesen Namen nicht wirklich verdienen, da sie bloß unmerkliche Tendenzen andeuten.
Das erste Buch heißt »Spuren ins Posthumien« – wobei das offensichtlich seltsame Wort »Posthumien« wie ein paläontologischer Epochenbegriff gelesen werden sollte, Ausdrücken wie »Moustérien«, »Aurignacien« oder »Magdalénien« vergleichbar. Er will zum Ausdruck bringen, was nicht mehr ganz jungen Menschen gelegentlich durch den Kopf geht: daß die eigene Endlichkeit nicht alles ist.1
Das zweite Buch erinnert mit seinem fast ebenso bizarren Titel »Aus der besten Welt« an das Leibnizsche Theorem, wonach die real existierende Welt – unter der Prämisse ihres Hervorgehens aus einem Ursprung, der nicht besser sein könnte – mit unumgänglicher Notwendigkeit als die beste aller möglichen Welten zu begreifen sei. Er wurde alles in allem ohne Ironie gewählt, obwohl er der Satire unfreiwillig nahekommt. Der Autor ist der Meinung, es gehe letztlich darum, die Leibnizsche Sicht der Dinge wie eine sich selbst wahrmachende Übertreibung zu unterstützen, ohne sich dadurch einschüchtern zu lassen, daß der Denker seit seiner Verspottung durch Voltaire und seinesgleichen oft als der Idiot der philosophischen Familie belächelt wird.
Der erwähnte Versuch des Autors, Peinliches und Belangloses in seinen Notizen auszulassen, stieß an eine prinzipielle Grenze, wenn Sätze oder Abschnitte wiederzugeben waren, in denen das Pronomen »ich« vorkommt. Tatsächlich gibt es in allem, was folgt, kaum eine Stelle, an der der Autor die Peinlichkeit des Ich-Sagens nicht mehr oder weniger deutlich verspürt. Er sieht ein, daß er diese Verlegenheit nicht nur aus grammatischen Gründen in Kauf nehmen mußte, sondern auch weil es zum Merkmal von »datierten Notizen« gehört, den Standortvorteil »Ich« geltend zu machen. Ob dieser nicht durch entsprechende Nachteile überwogen wird, kann hier unentschieden bleiben. Die Leser, die befürchten, man müsse sich jetzt auf eine Serie analoger Bücher des Autors gefaßt machen, mögen zur Kenntnis nehmen, daß ihre Sorge unbegründet ist. Weitere Editionen von Notizbüchern sind nicht vorgesehen.
Erstes Buch
Spuren ins Posthumien
Heft 100
8. Mai 2008 – 21. September 2008
8. Mai, Karlsruhe
Das intellektuelle Überleben in dieser Stadt hängt zu wesentlichen Teilen von den Tischgesprächen mit den Freunden ab. Fehlt auch nur einer über längere Zeit, spürt man den Entzug.
Boris berichtet gerade von einer jungen Russin, Dacha Jukowa, die als die amtierende Geliebte von Roman Abramowitsch gilt, dem russischen Mogul von Chelsea. Er lernte sie kürzlich in London kennen, als sie am Rande eines von ihm gegebenen Seminars seinen Rat suchte: Sie interessiere sich neuerdings, eigentlich aber immer schon, für Kunst und möchte sich besser »orientieren«; zu diesem Zweck habe sie sich einen Privatjet gekauft. Der werde sie, so ihre Annahme, der Kunst näher bringen, die unglücklicherweise so weit verstreut ist.
Man kann sich die Haltung von Boris in einem solchen Gespräch gut vorstellen. Er verzeiht der jungen Schönheit, daß sie bei der Wahl zwischen Geld und Geist die plausible Entscheidung getroffen hat. Er stellt es der Dame anheim, ihren Fehler eines Tages zu revidieren, und da sie heute auf ihn, den Philosophen, zukam, sieht er sie auf einem guten Weg.
Erneut rezitiert Bazon Brock während eines Treffens im Rektorat sein Doppel-Theorem: Lerne zu leiden, ohne zu klagen – und: lerne zu klagen, ohne zu leiden! Welche von den beiden Maximen er gerade befolgt, ist nicht ganz leicht zu entscheiden: Überwiegend lamentierend schien sein Bericht über einen Vorfall im Hause Burda in München vor drei Monaten: Damals habe Maria Furtwängler ihm zwei Minuten Redezeit für einen Geburtstagstoast auf ihren Gatten eingeräumt und sich dadurch den Unwillen unseres Karlsruher Emeritus Hans Belting zugezogen, denn dieser hatte darauf bestanden, Bazon, für ihn seit langem ein rotes Tuch, dürfe in seiner Gegenwart auf keinen Fall das Wort ergreifen, schon gar nicht unmittelbar vor ihm. Ehe mir klar wurde, ob Bazon nicht doch auf normale Weise gleichzeitig klagt und leidet, war er schon bei seinem nächsten Thema: Er führt einen a priori verlorenen und insofern erhabenen Kampf um die Ehrenrettung des Limbus bzw. der Vorhölle – deren leichtfertige Abschaffung durch den amtierenden Papst er befehdet. Wofür man die Vorhölle weiterhin so dringend braucht, war seinen Ausführungen nicht auf der Stelle zu entnehmen.
Post kommt von der Universität Warwick: man möchte die Kosten für die Übersetzung meiner Rede (Kultur ist eine Ordensregel – über Wittgensteins Sprachspiele als Formen des übenden Lebens) von dem (winzigen) Honorar des Gastes abziehen – und bittet um dessen Zustimmung. Solche Briefe kann man nur von Universitäten bekommen; Privatleute würden sich bemühen, ihre Mittellosigkeit vor Gästen zu verbergen. Die staatlichen Einrichtungen tragen ihre Blöße vor sich her und machen aus der Kümmerlichkeit einen aktenkundigen Zustand.
Nach Mitternacht auf arte ein Film über Benny Lévy, einen der Gründer der Gauche prolétarienne, der sich nach den Ereignissen des Mai 68 unter dem Einfluß von Levinas vom politischen Engagement lossagte, um sich ganz der »Zeitlosigkeit« des geistigen Studiums zu widmen – Plato und Talmud. Starb im Jahr 2000 in Jerusalem, enger Freund von Alain Finkielkraut und Bernard-Henry Lévy, trotz starker Gegensätze zu beiden. Der Film hatte eine unleugbare spirituelle Schwingung, als wollte er sagen: Jude ist jemand, der das Jüdischsein täglich übt. Was die Amateure für Glauben halten, ist aus der Sicht der Eingeweihten nichts anderes als das Ergebnis des ständigen Exerzitiums.
Von den Rheintöchtern ein Lebenszeichen vom Grund des Stroms. Im Traum, war es gestern oder vorgestern? schaue ich an mir hinunter; bemerke eine gewisse Überfunktion, begleitet von einer heftigen Genugtuung über das nackte Daß.
Lege für das Seminar morgen Fotokopien aus Augustinus und Levinas bereit.
9. Mai, Karlsruhe
Der ethische Primat des Morgens: dann entscheiden wir, ob wir das Programm wiederaufnehmen.
Das wäre der Moment, den Streik gegen den Tag auszurufen, gegen die Termine, gegen die Idee der Verpflichtung, ja, gegen den Beruf überhaupt. Bloß weil die Sonne schon scheint, wenn du wach wirst, mußt du nicht gleich in die vita activa losrennen. Bleib liegen, verzichte auch auf den Vorwand einer Krankheit. Es käme einfach darauf an, die Leinen zu kappen …
In dem gestrigen Film auf arte sah man einen Ausschnitt aus einer Rede von Levinas in Paris vor jüdischem Publikum. Darin hieß es einigermaßen pathetisch, Denken entstehe aus der Beziehung zwischen der Schrift und dem Kommentar, nicht aus der Reflexion über sich selbst. Die antiphilosophische Pointe war nicht zu überhören, ebensowenig ein Element von Bigotterie.
Was bleibt von dem schönen Plan zum Widerstand gegen die Pflicht? Vormittags von zehn bis eins das Seminar über die Ethik von Levinas, bis an die Grenze der Erschöpfung und darüber hinaus. Kraftfordernde Gespräche mit Yana und Kollegen folgen. Im Büro brauchen die Sekretärin und ich weitere Stunden, um dreißig, vierzig Vorgänge abzuwickeln, Briefe, Mails, Anfragen, hausinterne Entscheidungen, Einladungsabsagen. Auf einem solchen Posten kann ohne Abstumpfung nur überleben, wer für einen Vorgang im Durchschnitt nicht mehr als zwei, drei Minuten benötigt, obschon man jeden einzelnen zu einer Affaire von einer Stunde und manchen zu einem Tagesthema aufblasen könnte, bei einer Fehlerquote unter zwei Prozent.
Abends eine halbe Stunde auf dem Gartenstuhl in der späten Sonne. Was mir guttut, tue ich nicht, was mir schadet, tue ich.
Wer spricht von Heilung? Meistens genügt es, eine neue Sprache zu lernen – bis du in fließendem Therapeutisch über deine Beschwerden reden kannst.
10.-12. Mai, St. Blasien
Pfingsten im Südschwarzwald. Die abendlichen Wanderungen der Kühe am Waldrand oben in Althütte, stundenlang hin und her, scheinen automatische Vorgänge zu sein. Schaut man eine Weile zu, entsteht der Eindruck, die großen Tiere seien Suchende, die von ihrer Benommenheit durch die Grasfresserei loskommen wollen. Indem sie geduldig hintereinander hertrotten, folgen sie der Ahnung, irgendwo vor ihnen müsse es ins Offene gehen.
Höre einen faszinierenden Bericht von Pater Köster (in der Delp-Halle, die sonst als Sportstätte dient) über die jüngste Generalkongregation des Jesuitenordens in Rom und die Rituale, die bei der Wahl eines neuen Oberen einzuhalten sind. Die Entscheidung sei diesmal schon im 2.Wahlgang gefallen. Vor der Stimmabgabe mußte ein einstündiges Silentium gewahrt werden, damit jeder einzelne Wähler dem Heiligen Geist Gelegenheit böte, sein Votum zu lenken. Jede Art von »Wahlkampf« oder Propaganda für dieses Amt sei im Orden tabu. Es scheint, man arbeitet auf das Ideal der puren Medialität zu. Daß die traditionsgemäß als Selbstlosigkeit mißinterpretiert wird, steht auf einem anderen Blatt. Medien sind nicht selbstlos, sie verdienen mit an dem, was durch sie hindurchgeht, sei es subtil, sei es in handfesten Provisionen. Ungeeignet ist, wer sich selbst hörbar ins Gespräch bringt.
13. Mai, Paris
Abends im Innenhof des St. James & Albany, dem vormals etwas nobleren Hotel an der Rue de Rivoli, einem umgewidmeten klassizistischen Stadtschloß, an dem der selige Felix Krull, nachmals Graf de Venosta, seinen Aufstieg begann. Zuvor mit der Verlegerin im Benoît. Um in der fremden Stadt nicht wie ein Blatt im Wind zu sein, muß man immer dieselben Orte aufsuchen.
14. Mai, Paris
Zu Fuß über den Boulevard St. Germain für die obligate Tour durch die Buchhandlungen. Zuerst eine halbe Stunde bei L’écume des pages, dann zu La hune. Einige möglicherweise brauchbare Funde aufgetrieben, darunter ein neues kleineres Werk von Michel Serres über Schmutz und Eigentum, ebenso die lang vermißte Neuauflage von Bourseillers Buch über die Maoisten in Frankreich – ein Basisdokument zur Krankengeschichte der Generation nach 68.
Übernervöse Stunden am Nachmittag im Haus am Montmartre bei Maren, wo ich das Deplazierte solcher Reisen noch heftiger als sonst verspüre. Dieses falsche Hinausgehenmüssen in Augenblicken, in denen alles für den Rückzug spricht.
Der Abend war am Ende nichts als eine Variation über das Thema salaire de la peur – oder: Wie man es fertigbringt, im schlechtesten Moment eine halbwegs erträgliche Figur zu machen.
Am Schluß unseres Auftritts in dem großen Hörsaal der Sciences Po ließ Bruno Latour Fragen aus dem Publikum in einem Hut einsammeln, um auszulosen, welche beantwortet würden. Aus der Menge der zusammengefalteten Papiere griff er je eines heraus und las die Frage vor. Die dritte Frage lautete: Seit wann ist Ihr Friseur im Gefängnis? Ich hätte sagen sollen: Seit 1968, sieht man das nicht?
Zur selben Zeit war vorgesehen, daß Alain Finkielkraut, wie ich nachträglich erfahre, im selben Gebäude einen Vortrag über seine Sicht auf die Ereignisse vom Mai 1968 halten sollte – ein Thema, das von der Presse wegen des 40. Jahrestags stark ausgebeutet wird. Hier wie überall fressen die Jubiläen die Gegenwart auf. Ich erinnere mich, daß man während unserer Veranstaltung plötzlich Lärm auf den Korridoren gehört hatte. Später finde ich heraus, eine Gruppe von Studenten hatte Alain mit Sprechchören niedergebrüllt, so hartnäckig, daß er sein Referat nicht halten konnte. Trost bei solchen Zwischenfällen kommt aus dem Gedanken, daß jung sein heißt, viel Zeit haben, sich für die frühe Rechthaberei zu schämen (Sartre: Jugend, das Alter des Ressentiments). Ohne es zu wissen, trug ich zur Rehabilitation Finkielkrauts indirekt ein wenig bei, indem ich die neuen Protestierer im allgemeinen, die sich heute bemerkbar machen, nicht ganz ohne Sympathie als eine Gruppe von Frustrierten beschrieb, die es bedauern, die Göttin Geschichte nicht mehr persönlich kennengelernt zu haben.
Auch die Göttin ist tot, die für sinnvolle Zeitabläufe zuständig war. Wie der kosmische Kollege ist sie keines natürlichen Todes gestorben, sondern einem Attentat durch Geschichtsatheisten erlegen. Zu denen muß man Alain rechnen, da er wieder die Moral über die Geschichte stellt. Das verzeihen ihm die jungen Aktivisten nicht, die weiter gern im großen Drama leben möchten.
Das anschließende Abendessen in einem traditionsreich-mittelmäßigen Restaurant, gleich neben den Gebäuden der Sciences Po, gab Gelegenheit, erneut ein paar Worte mit Gilles Kepel und François Jullien zu wechseln. Kepel schenkt mir sein jüngstes Buch: Terreur et martyre. Relever le défi de civilisation, vor wenigen Wochen bei Flammarion erschienen. Er mokiert sich über eine patriarchalische Redewendung aus dem Mund von Bruno Latour, der bei Tisch gesagt hatte: Ich verheirate dann und dann dort und dort meine Tochter – als ob das Heiraten eine Sache sei, die vom Vater gesteuert wird. Bemerkenswert, daß einen Arabisten dieses römisch-vaterrechtliche Sprachspiel hellhörig macht. Seit Jahrzehnten habe er es nicht mehr gehört, meinte Kepel, daß ein Mann das Wort »verheiraten« als transitives Verbum gebraucht. Latour schaut ein wenig verstört drein – als wollte er sagen, es ist doch besser, die Tochter »pro-aktiv« aus der Hand zu geben, als sie von einem erigierten Angeber weggenommen zu bekommen. Kepel berichtet von vielversprechenden Debatten mit arabischen Intellektuellen auf Al Dschasira.
An solchen Tagen zitiert man bei sich alle zehn Minuten die Benn-Formel: jenseits von Sieg und Niederlage.
15. Mai, Karlsruhe
Experten rätseln noch, ob der Wirbelsturm dieser Tage im Sklavenstaat Birma, aus dem man kaum irgendwelche zuverlässigen Informationen erhält, 30000 oder 100000 Tote gefordert hat. Gleichzeitig schwere Erdbeben in China: mehrere Städte ausgelöscht. Hohe Zahlen an Todesopfern. Es ist die Erdgeschichte, die nicht zu Ende ist.
Individuen teilen die kosmischen Zeitalter anders ein als Geologen. Für uns beginnt alles mit der präexistentiellen Ewigkeit. In der geben wir den Dingen Zeit, sich zu entwickeln, damit etwas zu sehen ist, wenn wir kommen. Während wir noch nicht da sind, versinken die Farnwälder unter die Meere, und Reptilien lernen fliegen. Der opponierbare Daumen wird erfunden, dann stehen wir schon auf der Schwelle.
Auf die Epoche der ersten Ewigkeit folgt das Weltalter des Daseins: In dieser Zeit überzeugen wir uns vom Stand der Dinge. Wenn man anfangs meinte, man habe es mit einer stets identischen Natur zu tun, läßt später ein Eindruck von allgemeinem Gleiten sich nicht vermeiden. Zuletzt versteht man, der jetzige Mensch ist nur eine Episode in den Geschichten der Gene, der Silben, der Grundrisse von Häusern.
Die Daseinsära geht zügig in die zweite Ewigkeit über, die man auch das Posthumien nennen könnte. In dieser Phase überlassen wir die Dinge wieder ihrem Lauf, nachdem uns die kurze Inspektion überzeugt hat, daß die Existenz und das übrige nicht wirklich zusammenpassen.
Das Konzept des factum brutum drückt aus, daß es den Denkenden nicht gelingt, eine bestimmte Tatsache – etwa das eigene Dasein und die Existenz der Welt überhaupt – aus einsichtigen Prinzipien abzuleiten. Dieser Skandal – Unableitbarkeit – wird im modernen Denken mit dem Wort Faktizität markiert. Es ist ein Lieblingswort von enttäuschten Systematikern. Früher konnte man das Unableitbare in dem altehrwürdigen, obschon – wie Spinoza und Fichte wußten – absurden Begriff »Schöpfung« verstecken. Das brutum in facto kommt in seiner ganzen Roheit ans Licht, wenn man den Schöpfungsbegriff fallengelassen hat. Etwas hiervon scheint Emil Lask in seiner Studie Fichtes Idealismus und die Geschichte, 1902, gesehen zu haben. Daher: »Was wirklich ist, ist gerade nicht vernünftig.«
Lese einige Seiten in Michel Serres’ Buchs über Schmutz und Eigentum. Darin ist die Rede von pissenden Tigern, die ihr Terrain markieren, wobei ihr ätzender Urin wie eine Landesgrenze fungiert, und von Leuten, die in die Suppe spucken, um sie sich anzueignen – sprich, um sie für andere ungenießbar zu machen. Leider ist Serres’ Hauptargument, die Gleichsetzung von eigen (propre) und schmutzig (malpropre), nicht mehr als ein überzogener Kalauer. Serres rivalisiert, ohne es zu wissen, mit Proudhon, der Eigentum mit Diebstahl gleichgesetzt hatte; jetzt soll Eigentum Schmutz sein. Die Beschmutzung, wie wir sie empirisch beobachten, ist aber das Gegenteil der Aneignung, sie führt zur Preisgabe einer Sache, zur Schaffung eines Niemandsobjekts. Viel plausibler ist das Gegenteil: Wo Eigentum auftaucht, fängt die Reinigung an. Wer hat, der hegt und pflegt. Sobald ein Eigentümer fehlt, türmt sich der Müll.
Kepels neues Buch macht den Eindruck, als habe der Autor mit sämtlichen Terroristen des Nahen Ostens gezeltet. Nach langen Gesprächen mit ihnen ist er überzeugt, ihre Zeit sei abgelaufen. Nun kommt der Moment, sagt er, in dem man den Frieden in der Region durch eine mediterrane Wirtschaftsunion sichern müsse, groß genug, um eines Tages den Iran und die Golfstaaten einzuschließen. Sein Kennwort heißt: Mittelmeerische Renaissance. Ohne sie, versichert er, versinkt Europa in der Bedeutungslosigkeit. Nur ein Anknüpfen an der großen diplomatischen Tradition Europas – sprich Frankreichs – könne das völlige Scheitern der amerikanischen Gewaltpolitik in der Region kompensieren, und wenn es Jahrzehnte dauert, bis die ökonomische Einhegung des Nahen Ostens geglückt ist. Bemerkenswert, mit welchem Nachdruck Kepel die notwendige Anbindung des Iran an den europäischen Raum hervorkehrt. Ich lese seine Vorschläge vor allem als Anregung zu einer Fächerreform an französischen Hochschulen: Aus Romanistik und Orientalistik soll eine neue Hyperdisziplin werden.
Beifang an Wörtern:
Cyberbimbo
Dependence Day
Dschihadosphäre
Was die Franzosen an der aktuellen Pariser Fotoausstellung über die Jahre der Okkupation so sehr in Verlegenheit setzt: Sie macht die triviale Wahrheit sichtbar, daß auch diese Zeit »Lebensjahre« waren. Man sieht lachende Menschen, die in der ewigen Gegenwart verweilen. Gutgelaunte Frauen flirten mit den Besatzern. Wer macht sich die Mühe, ständig unter den Umständen zu leiden? Nur patriotische Fundamentalisten tun das, die nach der Befreiung den Ton angeben werden, unterstützt von den Profiteuren des Existentialismus.
17. Mai, Karlsruhe
In einem dem Ton nach freundlichen Brief von Ende März tadelt mich ein Dr. B. für meinen Gebrauch von Fremdwörtern und Fachausdrücken in Gottes Eifer. Zum Beispiel tun ihm Wendungen wie »Suprematismus« oder »mehrwertige Logik« in der Seele weh. Er redet, als hätte ich die einfachen Gläubigen verschreckt, die er nun ritterlich vertritt. Nichts ist so suspekt wie dieser Populismus der Gebildeten, die im Namen der anderen selber nicht verstehen.
Die USA, das seltsame Land, in dem sich Waffennarren wie Parteien organisieren. Die National Rifle Association soll 4,2 Millionen Mitglieder zählen. Zum Vergleich: im April 2008 hatte die SPD 533000 Mitglieder (im Jahr 1971 waren es noch eine Million), darunter 34% Rentner, 23% Beamte, 15% Angestellte, 8% Arbeiter(!), 5% Arbeitslose). Seit längerem habe ich das Gefühl, daß nichts so subversiv ist wie Zahlen.
Beruf: Opiniater
Facharzt für Erkrankungen des Meinungsapparats
Andrea Köhler liefert in der NZZ eine Übersicht über junge amerikanische Literatur. Deren Problem ist durchwegs die Überorchestrierung – zu viele Mittel für zu wenig Zweck.
Wo habe ich das aufgeschnappt? Das Wort »Elite« sei im 18. Jahrhundert durch Übernahme eines entsprechenden französischen Militärterminus im Deutschen aufgetaucht. Bei dem lateinischen Agrarschriftsteller Columella meint »eligere« noch das Entfernen von Steinen und Unkraut aus dem Acker. In diesem Fall ist das Gute das, was nach der Auslese des Störenden übrigbleibt. Die moderne Elite dagegen will selber das Gute sein, das glänzt, nachdem man das Zweitklassige beiseite gelassen hat.
Las auf der Heimfahrt von Paris gestern Alain Badious Pamphlet gegen Sarkozy (De quoi Sarkozy est-il le nom?).
Darin wird der Staatschef als ein Wiedergänger des Marschalls Pétain »entlarvt«. Man muß den konzeptlosen Hektiker Sarkozy nicht mögen, um das Absurde dieser Assoziation zu erkennen. Wenn es eine historische Analogie gibt, die Sarkozy von ferne trifft, dann ist es die mit Napoleon dem Kleinen – wie Victor Hugo den dritten Napoleon nannte. Dazu stimmt auch die Art und Weise, wie Louis Napoléon und Kaiserin Eugénie mit der Massenpresse ihrer Zeit im Bündnis waren – sie gaben dem Volk der Neugierigen eine Chance, imaginär an der Fête impériale teilzuhaben. Für die Affinität Sarkozys zu Napoleon III. spricht auch seine wenig bekannte, da diskret betriebene Initiative, die sterbliche Hülle des im britischen Exil verstorbenen zweiten Kaisers der Franzosen zu repatriieren – ein Projekt, das am Widerstand der Mönche von Farnborough, die seit 1888 über das umgebettete Grab des Kaisers wachen, scheiterte.
Doch so abwegig die Parallele zu Pétain auch ist, sie macht klar, der Jakobinismus überlebt in Frankreich bis heute, er überlebt nicht nur, er ist virulent, er steckt noch an. Die Lust an der Anklage treibt ihn voran wie in den Tagen der Wohlfahrtsausschüsse. In der Sache ist er ein moralisierender Militantismus, durch den eine Handvoll Auserwählter sich berufen weiß, gegen die verführte Menge und ihren verächtlichen Staat zu agieren. Erstaunlicherweise sagt Badiou: Der Faschismus ist ein positiver Elan, eine affirmative Kraft! (S. 19f.) Das klingt, als wollte er diesen Elan für die Linke reklamieren – wahrscheinlich macht die listige Vertauschung der radikalen Pole seine Attraktivität aus, die man auch hierzulande bei manchen klugen unruhigen Jungen bemerkt. Sie suchen den Guru und finden Mephisto. Dazu gehört, fast unvermeidlich: die Auslegung der »Situation« als Lage im Krieg. In diesem Punkt bleibt der Autor an das frühe 20. Jahrhundert fixiert. Anders als für Nolte, bei dem der europäische Bürgerkrieg 1945 endete, geht er für Badiou, hierin noch immer Maoist, als ewiger Krieg weiter.
Jeder Denker ist dann ein Warlord und alles Positive eine aktive Stellung im Kriegsgeschehen. Mit einiger Sorglosigkeit bindet Badiou die Auslegung der Wirklichkeit als Krieg an eine platonische Idee von Wahrheit: Der authentische Mann der Linken wäre demnach der Kreuzfahrer, der aufbricht, um das Wahre in das Wirkliche herüberzuzwingen – diesen Übergang beschwört das Zauberwort »Ereignis«, das den Schlüssel zu seinem System darstellt. Badious Verwerfung aller gemäßigten linken Programme ist so gesehen folgerichtig – sie gehen ja wirklich vom schäbigen Wirklichen aus und führen zu ihm zurück, im günstigsten Fall auf einer etwas höheren Stufe. Der Geist des ganz Neuen und Anderen bleibt dabei auf der Strecke. Bei ihm, dem aggressivsten Überlebenden von 1968, muß man also suchen, wenn man einen reinen Spätstalinismus, ergänzt durch einen unbußfertigen Maoismus, im Europa von heute finden will – so unglaublich das für zeitgenössische Ohren klingt. Aude Lancelin nannte ihn kürzlich – in einer Doppelbesprechung eines Buchs von mir und eines Buchs von ihm – treffend le der des ders, den Letzten der Letzten. Eine Formel aus den Ritterromanen.
Der Mann hat Charakter, er blickt auf die Belehrung durch das Experiment verächtlich herab. Die Zahl der Kommunismustoten übersteigt einhundertzwanzig Millionen? Kein Grund, sentimental zu werden. Eine Politik, die auf Wahrheit aus ist, behauptet er, kann nur die Form der unbedingten Setzung haben. So finden Lenin und Carl Schmitt zusammen. Dezision ist alles – den Rest besorgt das unbelehrbare Festhalten an der Anfangsthese. Dasselbe ging schon aus dem Paulus-Buch Badious (Saint Paul − la fondation de l’universalisme) hervor, in dem er vor ein paar Jahren seine Karten auf den Tisch legte: Es gibt keinen Gott, aber die Geste, ihn zu verkündigen, bleibt unentbehrlich für die wenigen, die es mit ihren juvenilen Postulaten ernst meinten. Die versprengten Kandidaten, die sich für diese rüde Wahrheitspolitik, den unbedingten Angriff, den abstrakten Universalismus ultrajakobinischen Stils entscheiden, bilden eine Gemeinde, die aus der Zukunft in die Gegenwart einwandert – wogegen der reale Staat von heute und die Gesellschaft, wie sie geht und steht, bloß Aggregate der Furcht und der Furcht vor der Furcht sind.
Warum Zeit verlieren mit solchem überspannten Gezeter? Vielleicht, weil auch in der politischen Theorie die Hysterie, noch durch ihre abstoßende Wirkung, anregender ist als das depressive Gemaule der Vernünftigen.
18. Mai, Birmingham
Ob die westlichen Maoisten von 1968, die bis zum Auftreten der Nouveaux Philosophes die Pariser Szene beherrschten, folgende Geschichte kannten? Der chinesische Romancier Yu Hua berichtet: Der Bürgermeister von Peking soll seinerzeit den Vorschlag gemacht haben, die Verbotene Stadt abzureißen und an ihrer Stelle Latrinen zu errichten. Volksscheißhäuser statt Palast-Esoterik. Diese Petition, die die Existenz eines Sino-Dadaismus dokumentiert, soll bis zu Mao Tse Tung vorgedrungen sein. Der ignorierte sie. Hätte er sie befolgt, hinge sein Portrait heute am Eingang zu einer Latrinenstadt am Platz des Himmlischen Friedens. Man erfährt hieraus etwas Wesentliches über den Geist der Mao-Zeit, der damals auch Westeuropa verseuchte: Es gibt einen Enthusiasmus der Profanierung, in dem die größte Gemeinheit eine Sekunde lang wie ein geistreicher Einfall wahrgenommen wird.
Noch mal zu Badiou: Sein wertvoller Gedanke ist die Schaffung eines schlechthin antidepressiven Prinzips. Er visiert einen transzendenten Punkt an, mit dem vor Augen die Zeit des Wartens auf das Unmögliche überstanden werden kann. Er formalisiert das messianische Motiv, indem er das, was nicht kommt, unerschütterlich als virtuell möglich und insofern kommend denkt. Damit macht er die Sektenlogik explizit – nicht eine christliche, sondern eine philosophische. Was ist die Sekte anderes als eine Versammlung von Somnambulen im Wartesaal zur Himmelfahrt?
Was die Rückkehr zum Primat der Politik und des Politischen bedeutet: Hochkonjunktur für Einseitigkeit, Wahnurteil, Wichtigtuerei, Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Man wird sich bald nach der entspannten Zeit der Marktideologie und der Neutralitätsillusion zurücksehnen. Die Hetzer nehmen wieder ihre Plätze ein, die Bombenwerfer arbeiten noch im Keller. Die Kritischen von gestern sind zu geschwächt, um Wirksames dagegen aufbieten zu können.
Badious Grobheit: Frei nach Freud nennt er Sarkozy einen Rattenmann, seine Parteigänger etikettiert er geradewegs als Ratten oder Rattenschwärme. Würde Sarkozy demnächst vergiftet aufgefunden, man könnte sich denken, wer das Rattenfutter ausgestreut hat.
Nach der Ankunft im Flughafen von Birmingham geht es mit unserem Gastgeber gleich los zu einer Fahrt übers Land, nachdem wir das Gepäck im Ramada Hotel von Coventry abgelegt haben.
Bemerke erstaunt, auch England, für mich seit je Novemberland, hat einen Frühling. Blühende Landschaften unter der Sonne, alte Kleinstädte in Ziegelbauweise und dunklem Stein, die bezeugen, daß die Region zur Shakespeare-Zeit zu den reichsten von Britannien zählte, voll von prächtigen Landhäusern, lichten Parks, diskreten Villen und feierlichen Luxushotels mit imperialen Namen. Eines heißt in ausgeruhter Vornehmheit einfach Lord of the Manors. Manche große Bäume stehen da wie vergessene Schatzkanzler. Man läßt sie in der Illusion, noch im Amt zu sein, und sie berufen die übrigen Gewächse in ihr Kabinett. Abends sind wir in einem ehemaligen Badehotel in Leamington, fast leer, das nach dem Versiegen der Quellen und dem Ausbleiben der Gäste in ein Resort neuen Stils umgewandelt werden soll.
19. Mai, Coventry
Rufe Ursula noch vom Hotel aus an, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren, was sichtlich gut aufgenommen wurde. Für diesmal war die berechtigte Furcht, einen vergeßlichen Bruder zu haben, wenn nicht widerlegt, so doch gemildert.
20. Mai, Warwick und Stratford upon Avon
Das Hauptereignis des Tages ist natürlich der Umzug aus dem beklemmenden Air-Condition-Gefängnis des Ramada-Turms von Coventry City – mit Ausblicken auf die Lokale an den kümmerlichen Straßen ringsum – in ein Club-Hotel auf dem Land namens Nailcote Hall, ganz in der Nähe des Campus, wo man sofort etwas vom Charme einer alten britischen Landresidenz spürt.
Die Durchsicht der englischen Übersetzung von Kultur ist eine Ordensregel – hier: culture is an obedience – kostet einen Vormittag Arbeit; es folgt ein offiziöses Mittagessen, organisiert von einem der Institute, die als Gastgeber auftreten. Wie an Universitäten üblich, plaziert man den sogenannten Höhepunkt, das groß angekündigte und stark besuchte »Streitgespräch« mit Jacques Rancière im Warwick Arts Center, auf den psychologischen Tiefpunkt des Tags, von 3 bis 5 pm, wenn die Vitalfunktionen im Keller sind.
Jeder der beiden Redner wurde von einem Präsentator eingeführt, Rancière vom Leiter des French Literature Departments, ich von Prof. Rogowski.
Irgendwie schaffe ich es, ohne Manuskript die These zu entwickeln, wonach Ästhetik in der Moderne eine Funktion in der sozialen Synthesis von Großgesellschaften wahrnimmt: Sie gibt Antworten auf die zwei basalen Fragen: Warum sollten besser wir keinen Bürgerkrieg mehr führen? − wozu die noble Lüge dienlich ist, die den Frieden zwischen Ungleichen ermöglicht. Fast alle Kunst ist Fortführung der noblen Lüge mit anderen Mitteln. Und auf die andere Grundfrage: Wie sorgen wir für emotionale Kohärenz in anonymen großen Kollektiven? Antwort: Im wesentlichen bewirken wir das durch synchrones nationweites Sichaufregen über aktuelle Themen und durch Lachen und Weinen in den täglichen Komödien und Tragödien, wie sie vom Zufallsgenerator des Lebens bereitgestellt werden.
Was Rancière vorbrachte, ließ sich bis zum Ende der Veranstaltung nicht so recht ermitteln, außer daß es um Inklusion und Exklusion ging. Er sprach sehr schnell und auf idiosynkratische Weise virtuos Englisch, jedoch mit einem so extremen Akzent und einem so exzessiven Gebrauch von Floskeln und Füllwörtern, bis zu fünfzehn you know und kind of pro Minute, daß guter Wille allein den Weg zum Verstehen nicht finden konnte. Im übrigen war evident, man erwartet hierzulande bei solchen Debatten keinen Dialog, sondern ist zufrieden, wenn es zu einem halbwegs effektvollen Schaureden zweier Kontrahenten kommt. Mehrere britische Kollegen gaben ihre Enttäuschung über Rancières Auftritt zu Protokoll: In ihren Augen hatte er die Gelegenheit nicht genutzt, live besser zu wirken als in seinen Schriften.
Am Abend in Stratford upon Avon ein hastiger Imbiß mit Fish and Chips, gefolgt von einer Aufführung des Merchant of Venice. Obwohl ich das Stück fast auswendig kenne, blieb es mir fremd, stimmungslos. Was die Schauspieler in ihrer juvenilen, übertrainierten Munterkeit von sich gaben, war für mich kaum als Shakespeares Englisch zu erkennen, es klang eher wie eine überdrehte Schüleraufführung. Natürlich war ich durch zu viel Ibuprofen verstimmt.
21. Mai, Coventry
Die Autoren des Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus waren sich dessen nicht bewußt, daß eine neue Mythologie fordern unweigerliche neue noble Lügen einführen bedeutet. Der Mythos enthält ja die Antwort des Zeitgeists auf die Fragen: Wie erklären wir den Unglücklichen ihre Lage? Und wie bringen wir die Frauen dazu, ruhigzuhalten?
Der »soziale Raum« ist voll von criminal intent. Soll dieser politisiert werden – das scheint Rancières Forderung zu sein, der an der Romantik des Ungesagten festhält in der Annahme, es solle irgendwann laut und revolutionär gesagt werden –, oder ist es besser, ihm Gelegenheiten zu bieten, sich massenkulturell abzureagieren? Was war das 20. Jahrhundert anderes als eine Versuchsanordnung über diese Alternative? Der Sieg der Massenkultur über die revolutionäre Gewalt enthält die bislang klarste Aussage zur Entscheidung, die auf diesem Feld zu treffen war.
Jetzt Stillschweigen bewahren über das Niveau der Küche in diesem Haus; lieber vom makellosen Grün des Rasens reden und von den überschwenglichen Rhododendronblüten.
Die englische Presse witzelt matt über das »Roman« Empire – das Reich des russischen Oligarchen. Einer der jüngeren Kollegen am Ort, Charles Turner, Sozialphilosoph, der meinen Wittgenstein-Vortrag übersetzt hatte, wünscht beim Champions-League-Finale in Moskau die Niederlage von Chelsea, weil er diese Nouveau-Riche-Mannschaft (sein Ausdruck) nicht ausstehen kann.
22. Mai, Warwick University
Die Vorlesung am Mittwoch – die Annual Lecture des Social Theory Centre – wurde gut aufgenommen, manche Hörer freuten sich offensichtlich, etwas über Wittgenstein in einem anderen Ton als hierzulande üblich zu vernehmen.
Der lange Donnerstag brachte acht oder neun Referate von britischen und amerikanischen Wissenschaftlern über Aspekte meiner Arbeit (z.B. Sloterdijk & Nietzsche, Philosophie als Literatur, Was ist Sphärologie? usw.). Wenn ich geglaubt hatte, dies würde für mich eine eher angenehme Übung in passiver Beiwohnung bei einem akademischen Ritual, sollte sich bald zeigen, daß das Gegenteil der Fall war. Das Ganze lief für mich darauf hinaus, ein doppeltes Pensum im Laufschritt bergauf zu schleppen, die Arbeit des genauen Zuhörens, schwierig genug, und die des Antwortens auf alle Präsentationen, den ganzen Tag lang, bis mir die englischen Sätze im Mund zerfielen. Manchmal ergab sich Gelegenheit, philosophische Reflexion in situ zu erleben, aus energetischer Sicht war es jedoch ein fürchterlicher Aderlaß. Von einigen Teilnehmern wie Ibrahim Kristal (Kalifornien) und Nigel Thrift (Vice-President von Warwick) kamen präzise Rückmeldungen – auch von dem polyglotten Ivan Soll, dem Nietzschespezialisten aus Madison, Wisconsin, der auf die Frage, wie viele Sprachen er denn spreche, antwortet: Ich kämpfe mit neun Sprachen, wirklich sprechen tue ich keine. Ich fand diese Replik tröstlich, da ich meine Kämpfe mit dem Englischen nach einigen Runden respektabler Gegenwehr am Ende durch technischen K.o. verlor.
24. Mai, Karlsruhe
Tony Judt gießt Öl ins Feuer, wenn er die israelische Politik seit 1967 als Ausdruck einer Adoleszenz-Neurose beschreibt: bewaffnet mit Bibel und Landkarte, schwärmt das Land von seiner uniqueness; es ist überzeugt: niemand versteht es; stets geht es davon aus, daß alle gegen Israel sind; es ist leicht beleidigt, führt ständig Gegenbeleidigungen im Munde und glaubt fest daran, es könne ohne Sanktionen tun, was es will – denn da es unsterblich ist, steht es über Kritik und Gesetz.
Irgendwo in einer Zeitung: Kritisches über den venezolanischen Petro-Sozialismus. Die Ölmilliarden fließen in einen machistischen Traum, von Staatschef Chavez inkarniert, der vormals die Armen des Landes mobilisiert hatte, ohne sich je ernsthaft zu bemühen, für seine Anhänger sinnvolle Erwerbsstrukturen zu schaffen. Das Öl erlaubt einen Klientelismus von links, Volksbestechung als Sozialismus-Surrogat. Das rechte Gegenstück hierzu bieten die Petrodiktaturen der Saudis und der nordafrikanischen Staaten. Von denen wird man eines Tages erfahren, daß sie die nichtsnutzigsten Zuhältersysteme der Geschichte waren.
Bei Vilém Flusser finde ich die schöne Notiz: Die Alteuropäer hätten weder Götter noch Staaten gehabt, sondern Amulette und Dörfer (Brief an Alex Bloch, S. 140). Dort steht auch Trauriges über den posthistorischen Verfall Englands und die Pracht der britischen Landschaften.
Schon im März 1981 nennt Flusser den Neo-Konservativen Podhoretz ein Symptom dafür, daß jetzt auch die jüdischen Intellektuellen in den USA faschistoid würden! Was man aus seinen Briefen an Bloch lernt, ist das Ausmaß, in dem das Leben des Autors seit seiner Rückkehr nach Europa auf Essayisten-Misere beruhte, kompensiert durch eine innere Unruhe, die sich in Reiselust übersetzte. Kaum ein Brief, in dem nicht von Konferenzen, von stetigen Orts- und Themenwechseln und vom Herumspringen im europäischen Tagungszirkus die Rede wäre.
Sehr bezeichnend für das Elend dieser Generation ist der jähe Bruch zwischen Flusser und Bloch nach 40jähriger Freundschaft. Beide trugen die Prägung durch den NS-Horror in sich und entwickelten in allem Diesbezüglichen eine bleibende Überhellhörigkeit. So ist es psychologisch nicht ganz unverständlich, wenn zuletzt die habitualisierte Faschismuswitterung in ihre Beziehung eindrang. Eines Tages wirft Bloch seinem Freund Flusser gewisse Affinitäten zum Nationalsozialismus vor, worauf dieser seinen Gast nur noch vor die Tür setzen kann. Man muß den Vorgang unter der Rubrik Exilantenwahn abspeichern. In dieser Abteilung des Archivs inventarisiert man die kleinen Katastrophen, die auf die große folgten.
Flusser berichtet: Wenn er, von Prag kommend, seinen deutschen Freunden erklärte, wie sehr er bei der Rückkehr in den Westen aufatmete, wurde er von ihnen der »Reaktion« bezichtigt: Damals schrieben wir das Jahr 1986. Dieselben Leute, die seinerzeit Flusser Vorwürfe machten, weil er die Zustände in Prag nicht vorbildlich fand, schlurfen noch heute, nahe an der Pension, durch die deutschen Hochschulkorridore und träumen von einer neuen Linken.
25. Mai, Karlsruhe
Vom Schweizer Tierschutz lernen: Dort dürfen künftig »gesellige Tiere« nicht mehr allein gehalten werden.
Heilige Anatomie: Das Herz Ludwigs IX. blieb auf Verlangen des Kreuzfahrerheeres 1270 in Nordafrika, wo es verschollen ist; die Eingeweide gelangten in die Kathedrale von Palermo; die Gebeine erreichten im Mai 1271 Paris, wo sie in der Königsabtei von St. Denis bestattet wurden. In der Kanonisationsbulle von Papst Bonifaz VIII. für Saint Louis aus dem Jahr 1297 taucht das Wort superhomo im nachantiken Europa zum ersten Mal auf – der Übermensch ist der in Teile zerlegte Kreuzfahrer-Monarch. In jedem seiner Teile ist die ganze Substanz gegenwärtig – so will es die rechtgläubige Lehre von der Reliquie.
Auf der Rundfahrt an den Rhein komme ich bei Rappenwört an einer Pferde-Messe unter offenem Himmel vorbei, wo schöne Tiere, Sportzubehör und Horse-Care-Artikel ausgestellt werden. An einem Stand las man: »Gebrauchte Hindernisse«. Sollte ich jemals Memoiren schreiben, dachte ich, werden sie so heißen.
26. Mai, Karlsruhe
Der Sommer kommt früh und heftig. Sofort sind auch die Anzeichen der altbekannten Vor-Geburtstags- und Hochsommernervenkrisen da.
Überall Tagungen, Konferenzen, Seminare. Der hilflose gute Wille lädt gern an langen Wochenenden auf die unzähligen umgewidmeten Schlösser und Klöster ein. Kein Tagungshotel im Land ist vor der Anreise der Fortbildungswilligen sicher. Überall referieren die Beratergockel vor dem besorgten Publikum und geben Anweisungen zum Umdenken. Sie laufen mit so hoch erhobenem Kopf durch die Gegend, als hätte jeder von ihnen den Club of Rome gegründet.
Lese für das nächste Philosophische Quartett das Buch von Ines Geipel, der ehemaligen DDR-Sprinterin: No limit! über den heute restlos vom Doping durchseuchten Sport. In diesen Tagen, meint sie, wird die Schwelle zum Gen-Doping überschritten, gegen das die Fahnder auf lange Zeit keine Mittel haben werden. Daneben Reinhold Messners Buch: Leben am Limit. Was er berichtet, kommt mir bekannt vor, ich hätte nur nie in die Arktis oder auf die Berge gehen müssen, um an die Grenzen zu gelangen. Extremist war ich auf meine Weise, unsichtbar, von innen und nur selten freiwillig.
Zum sogenannten Spiegelstadium: Depression ersetzt Repression. Seit die Leute wissen, wie sie aussehen, und sie wissen es noch nicht seit langem, werden Maßnahmen zur Eindämmung des Übermuts fast überflüssig. 2000 Jahre lang haben die Priester gegen die superbia gekämpft. Mit allen Mitteln haben sie versucht, in die Seele der Menschen hineinzuregieren – doch jetzt, nachdem alle sich im Spiegel gesehen haben, ist das nicht mehr nötig. Ein Über-Ich braucht es nicht mehr, sobald der Beobachter vom frühen Morgen an durch seinen Spiegel über seine Durchschnittlichkeit informiert wird.
27. Mai, Karlsruhe
Die Arbeit an Du mußt dein Leben ändern stagniert noch immer, aber nicht wegen der vielen Reisen und der äußeren Termine. Die Wahrheit ist, die Autorstimme will sich nicht zurückmelden. Im Grunde sind diese Tage eine Wartezeit, bis es mit dem unterbrochenen Buch vorangeht. Die Dinge liegen ja umgekehrt: All die äußeren Termine können nur stattfinden, weil der verschwundene Autor sich zu viel Zeit nimmt und mir unerbetenen Raum für Allotria gewährt.
Hin und wieder kommen Erinnerungsbilder aus den letzten Tagen zurück – etwa von den Kolonnaden an der Rue de Rivoli vor dem St. James & Albany, als habe dort etwas in der Luft gelegen, was im nachhinein wie ein Versprechen wirkt oder wie ein Anlaß zurückzukehren.
Niemand scheint sich heute an die Anfänge der Moderne zu erinnern, als die entscheidende Richtung des Fortschritts als Verringerung, Reduktion, Minimierung, Formalisierung bestimmt wurde; es war die große Zeit der logischen Österreicher. Damals ging es um eine reformatio mundi im antihabsburgischen Stil. Auch das Bauhaus von Weimar ging auf solche Ziele zu: Die Welt wird besser, indem wir weniger von allem machen, und das Wenige klar, deutlich und quintessentiell. Kurz darauf kamen die Leute von der Pumpstation an die Macht, die Fortschritt nur als Mehr denken konnten: mehr Lärm, mehr Masse, mehr Hybride.
31. Mai, Wolfsburg
Nach dem Gewitter am Vormittag wähle ich den früheren Zug, um schon gegen vier in Wolfsburg zu sein. Diesmal werfen die vielen Termine der kommenden Tage – das Quartett mit Messner und Geipel, der Abstecher nach Amsterdam, wo ich Rene während seiner Chemotherapie besuchen will, der Zwischenhalt in Berlin usw. – keinen Unruheschatten voraus, sie sehen aus wie Etappen, die sich mit ad-hoc-Energien bewältigen lassen, vorausgesetzt, die physischen Beschwerden werden nicht zu lästig.
Allmählich stellt sich die Grundthese für das lange dritte Kapitel des Übungsbuchs etwas deutlicher dar: Die Moderne sucht – meist unter dem Vorwand des Handelns – nach Verfahren zur Aneignung der existentiellen Passivität. Deswegen kommt der seit dem 14. Jahrhundert florierenden Mystik in den Städten eine so große Bedeutung zu. Mystik hat nichts mit Selbstauslöschung zu tun, wie die Leser von Büchern aus dem Diederichs Verlag glauben. Sie ist die Könnensform des leidenden Lebens, also die Übungsform der Passion. Der mittelalterliche Passionsort war das Kloster – die frühe Neuzeit führt das Leiden in die Werkstätten und an die Arbeitsplätze. Passion und Kompetenz werden eins. Das ist die Religion der Städte, aus der die Reformation hervorging. Simul iustus et peccator, das heißt auch: gleichzeitig Mystiker und Handwerker, zugleich Christenmensch und Unternehmer.
Damals wurde auch der moderne Schüler erfunden: das Kind als Mönch mit dem Schulranzen. Seit Neuzeit Schulzeit für alle bedeutet, ist die Passionspflicht in Form von allgemeiner Schulpflicht eingerichtet. Ein Rest von der demokratisch-mystischen Idee, die Passion für alle anzubieten, versteckt sich in der deutschen Bildungsvorstellung. Goethe: »Der nicht geschundene Mensch wird nicht erzogen.« Lenin war der perverse Erbe des neuzeitlichen Bildungsgedankens, als er aus der allgemeinen Nachahmung des Herrn den Terror für alle machte. Wie der gewöhnliche Christ eine Vorstufe zum Mystiker war, so der Genosse eine Vorstufe zum Kommunisten.
Daß der Mensch etwas ist, was überwunden werden muß, das ist keine wirre Idee von Nietzsche und Trotzki, ganz Europa ist seit dem mystischen 14. Jahrhundert ein Trainingslager zur Menschenüberwindung mit Hilfe von Mystik, Kunst und Pädagogik. Aber fast ebenso lange ist auch die Konterrevolution der Spießer im Gang, mit ihren Fasnachtsspielen, ihren Genrebildern, ihrem Glück im stillen Winkel und ihren Pauschalreisen.
Charles Péguy, zitiert von Mona Ozouf: »Wir können nicht oft genug wiederholen, daß die Angst, nicht genügend fortschrittlich zu erscheinen, aus den Franzosen Dummköpfe macht.«
Bei der Lektüre von Reinhold Messners autobiographischen Gesprächen lernt man, wie ein klassischer Kontraphobiker empfindet. Er läßt sich von seiner Angst sagen, was er zu tun hat, um sie in Schach zu halten – das führt geradewegs in die Extremsituationen. Da er an den Gefahren wächst, wird er ein erfolgreicher Therapeut in eigener Sache. Der sehr hohe Berg scheint für ihn der Inbegriff des gerade noch besiegbaren Widerstands zu sein. Daher verabscheut er den billigen Höhentourismus. Zum Gipfel soll nur kommen, wer eine innerlich notwendige Verabredung mit dem Äußersten hat. Am meisten berührt mich, was Messner über seine Nachtängste sagt. In diesen furchtbaren Ekstasen am Berg, verlassen, dunkel, eisig, aussichtslos, kommt es nur noch darauf an, bis zum Tagesanbruch durchzuhalten. Man sollte das Wort Brüderlichkeit reservieren für Menschen, die wissen, was das heißt.
2. Juni, Amsterdam
Das Quartett zu dem Sport-Thema »Übermenschen unter sich« schien dem Publikum und den Akteuren ziemlich gut geraten, zwischen Unterhaltung und Unterrichtung halbwegs ausbalanciert.
Ladies and Gentlemen, we already started our descent to Amsterdam Airport. Lerne aus dem KLM-Bordmagazin einiges über lichttherapeutische Behandlung von Winterdepressionen in nordeuropäischen Ländern, für die man neuerdings den Terminus Seasonal Affective Disorders (SAD) eingeführt hat. Solche Ausdrücke zeigen die Pathologisierung, Professionalisierung und Merkantilisierung des Umgangs mit normalen Phänomenen an. In Eindhoven soll demnächst der weltweit erste Master-Studiengang für lichttechnische SAD-Behandlung eingerichtet werden.
Nachmittags bei Rene auf dem neuen, modern ausgestatteten Hausboot, von dem die vormalige Seefahrtromantik von 1928 (aus diesem Jahr stammte das alte Schiff) ganz verschwunden ist. Connie Palmen sagt, dies sei jetzt die schönste Wohnung von Amsterdam. Rene ist von der Chemotherapie gezeichnet, doch im Gespräch präsent und heiter wie immer. Den ganzen Nachmittag verbringen wir auf der Terrasse mittschiffs bei Wein und Essen. Gegen neun Uhr abends geht ein Gewitter nieder, um elf bin ich zurück im Ambassade. Sogar an wärmeren Tagen erlischt das Straßenleben hier früh.
3. Juni, Amsterdam
Mittags im Sea Palace. Rene zitiert einen Satz von Konfuzius: »Mit siebzig konnte ich den Regungen meines Herzens folgen, ohne jemals eine Sünde zu begehen.« Später sah ich an der Centraal Station eine junge Frau, bei deren Anblick sich der Wunsch einstellte, siebzig zu sein, der Regung wegen. Für das übrige wäre vierzig die Obergrenze gewesen. Ich fragte mich nur, was mit dem weiblichen Selbstbewußtsein nicht stimmt, wenn ein Wesen mit einem derart evangelischen Gesicht ein solches Amok-Decolleté zeigt.
Das Rätsel des Bewußtseins versteckt sich in seinem Nebeneffekt-Charakter. Aller Wahrscheinlichkeit nach macht es in seiner heutigen Ausprägung nicht mehr als eine auf Dauer gestellte, inzwischen weitgehend funktionslose Extraleistung des Gehirns aus, für die man im Arsenal der vitalen Zwecke keine zureichenden Gründe findet. Ursprünglich war es wohl so etwas wie eine Kontroll-Lampe, die über dem Fluß der Wahrnehmungen wachte, allenfalls ein Monitor, dessen interner Beobachter zwischen Alarm und Nicht-Alarm entscheiden sollte. Es wurde chronisch und neigte zur selbstbezüglichen Überentwicklung, zumindest bei einigen sensibleren Exemplaren der Gattung, indes die Dumpferen damit kaum je Probleme hatten. Zuletzt schien es den Philosophen und den Meditierern das innere Licht zu sein, das alle meine wachen Zustände muß begleiten können. Was zeigt: Vor dem Luxus demissioniert die Frage nach dem Sinn.
Demnach wäre das Bewußtsein, das wir von unserem eigenen Dasein und unserem Eingetauchtsein in eine Umwelt haben, ein überinterpretiertes Überschußphänomen? Läßt man die Annahme gelten, springt die abgrundtiefe Ironie ins Auge, daß es gerade die ernsthaftesten Geister waren, die Asketen, die Wahrheitssucher, die Logiker, die dem luxurierenden Phänomen Bewußtsein die höchsten Leistungen aufbürden wollten – von der Vereinigung der Privatseele mit der Weltseele bis zur ästhetischen Rechtfertigung der Existenz.
Wie wäre es, wenn der adäquateste Gebrauch des rätselhaften Geschenks darin bestünde, es hinzunehmen und auf sich beruhen zu lassen? Nicht ganz. Ein wenig Betonung schadet nicht, sonst wäre diese leise Euphorie beim Blick aus dem Hotelfenster nicht möglich, wenn das grüne Wasser in der Gracht glitzert.
Finde bei Hermann Hesse die Formulierung: »das Wiederaufnehmen der ganzen Lebensmechanik«. (Der Kurgast, Werke Band 11, S. 59)
4. Juni, Karlsruhe
Er ist ein glücklicher Mensch? Das ändert nichts daran, daß er ein Reservist der Verzweiflung bleibt.
Ein neuer möglicher Straftatbestand: Aufreizung zur Magersucht. Ein solcher Paragraph würde erlauben, Moderatorinnen von Model-Shows hinter Gitter zu bringen. Hätte der Neoliberalismus Titten aus Zement, er sähe aus wie Heidi Klum.
5. Juni, Karlsruhe-Berlin
Noch einmal zum rechtlich einklagbaren Tatbestand der Aufreizung zur Magersucht: In Analogie dazu müßte man einen Paragraphen über Aufreizung zur Verfettung einführen, ebenso einen über Aufreizung zur Vulgarität. Ein Großteil des öffentlichen Lebens würde sträflich.
Ein Epigramm des Ausonius (4. Jahrhundert) beklagt, selbst auf Grabinschriften sei kein Verlaß mehr, da sie verwittern. Man wisse auch nicht, ob der Buchstabe M Marius, Marcus oder Metellus bedeutet. Dann taucht der enorme Satz auf: »Mors etiam saxis nominibusque venit.« Nie zuvor sind Steine und Namen in einem Atemzug genannt worden.
6. Juni, Berlin-Leipzig
Nebenberuf: Urinerzeuger
Zum Thema Urinerzeugung liefert der abgelaufene Tag eine bedenkliche Illustration. Die Ausgangsmaterie für das opus magnum bilden je zwei Magnum-Flaschen Léoville Las Cases und Mouton Rothschild, ich weiß nicht mehr, aus welchen Jahren. Die Szene spielt auf der Residenz von J. B. bei Leipzig mit Neo Rauch, Rosa Loy und einigen Freunden des Hausherrn. Chateau d’Yquem bildet den vorläufigen Abschluß, was beweist, daß der Gastgeber willens war, Niveau in allem zu demonstrieren. Im fortgeschrittenen Zustand sollten weitere Höchstgewächse aufgefahren werden. Dazu scharfe Geschütze, wie die These, wenn man wieder echte Eliten wolle, käme man um die Erschießung der Mittelmäßigen nicht herum. Eine gewisse Herrenabendstimmung ist nicht zu leugnen.
7. Juni, Wien
So wie es bald eine Kennzeichnungspflicht für Giftstoffe und versteckte Dickmacher in Nahrungsmitteln geben wird, sollte man eine Kennzeichnungspflicht für Inhalte von Meinungswaren einführen. Rote Punkte für Verhetzung, Verdummung und Aufgeilung, auf die Gefahr hin, daß Zeitungen und TV-Sendungen wie roter Regen auf uns fallen.
Abends im Fernsehen ein Film mit Slavoj Žižek. Darin hört man ihn die These aufstellen, das Über-Ich sei eine obszöne Instanz, die das Ich mit unerfüllbaren Forderungen verhöhnt. Implicite sagt er damit, jede Art von Vorbild sei eine Falle – was leider Unsinn ist, da das Fehlen des Vorbilds (ich nehme es hier als den engsten Verwandten des Über-Ich) zumeist die größere Qual bedeutet. Hört man Slavoj reden, möchte man Nietzsches Wort »Müßiggang ist aller Psychologie Anfang« zitieren, vielleicht sogar Kafkas ominöse Notiz: »Nie wieder Psychologie!«
Bezeichnend die Hauptszene des Films: Žižek steht in einem Motorboot – und jagt sein Gefährt übers Wasser. Dabei redet er wie besessen von seinen Themen, von Hitchcock bis Lacan – ein Kapitän Nemo, der sich ein U-Boot nicht mehr leisten kann.
Wahrscheinlich begeht Slavoj, wenn er sich in den Medien so sehr exponiert, denselben Fehler, dessen auch ich verdächtig bin. Aber anders als ich glaubt er, man könne tatsächlich die Autorschaft in der visuellen Dimension fortführen. Das ist pure Illusion. Der autor absconditus wird beschädigt, sobald der manifeste Verfasser sich in Bild-Medien zeigt. Es kommt darauf an, wieviel Selbstbanalisierung ein Autor überleben kann. Das wiederum hängt davon ab, ob er sich seiner Verankerung in seinem Werk sicher ist. Das Wesentliche hat verborgen zu bleiben und darf erst herauskommen, wenn es Literatur geworden ist. Ich denke immer öfter, Slavoj hat die Dosis überschritten. Er kann sich selbst nicht mehr von der Maske des Revolutions-Entertainers unterscheiden, unter der er seit einer Weile um die Welt zirkuliert. Wenn es so weitergeht, wird ihn die Maske überwuchern. In einer Hinsicht ist Slavojs Rolle jetzt schon klassisch: Er dokumentiert, zusammen mit Nanni Moretti, die Aufhebung der Psychoanalyse ins Kabarett.
9. Juni, Wien
Abends weiter die Vorlesung zu den Götterdämmerungen. Diesmal über Heinrich Heines Geständnisse. Der Fall Heine läßt erkennen, daß es Götterdämmerungen in der ersten Person gibt.
In den Spätnachrichten die Meldung, daß Peter Rühmkorf im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Wer war es, der mir erzählte, Rühmkorf sei ein Patenkind von Paul Tillich gewesen?
Schicke die redigierte Fassung des seinerzeit auf dem NZZ-Podium Ende April improvisierten Vortrags nach Zürich: Spielen mit dem, was mit uns spielt, mit dem das noble Feuilleton dem Einbruch des Sports Tribut zollt.
11. Juni, Wien
Abends in der Angewandten über Richard Wagners Götterdämmerung – mit Akzent auf dem Vorspiel der Nornen unter besonderer Beachtung von Brünhildes Liebestod auf Siegfrieds Scheiterhaufen, der den Brand Walhallas vorwegnimmt.
12. Juni, Wien
In der Schlußvorlesung am Stubenring rolle ich das Semesterthema noch einmal in größeren feuermythologischen Zusammenhängen auf, von der heraklitisch-stoischen Ekpyrosis bis zur indisch-germanischen Weltbrandmotivik.
Am Ende mußte Kant die Kosten für die Ausflüge in die Exzeßgeschichte tragen. In seiner Naivität hatte er geglaubt, man könne die religiösen Traditionen einfach sortieren – den Wahn ausscheiden und die Moral behalten. Der Meister von Königsberg hatte kein Organ für das Dritte, das sich in den sogenannten Religionen versteckte, den Überwirklichkeitselan, den Eros des Unmöglichen. Um mit dieser Dimension in Berührung zu kommen, hätte es für ihn genügt, einmal im Leben in eine Galerie zu gehen, in der die Meister der Renaissance zu sehen waren. Auch ein einziger Besuch in der Oper hätte bei ihm Wunder bewirken können. Kant zog es vor, es mit der wirklichen Kunst gar nicht erst zu versuchen. Er schrieb bedeutend über sie, ohne sie zu kennen.
Die großen Maler und Komponisten der Neuzeit hatten Visionen aus einem ganz anderen Jenseits vor Augen als der Geisterseher Swedenborg, gegen den sich Kant in seiner etwas mickrigen Abwehrschrift verwahrt hatte. Der mittelalterliche Ausgangspunkt für die Kunst war das Wunder, ihr modernes Ziel sollte das Wunderbare sein. Die ganze Kunstgeschichte steckt in dem Satz: Wo miraculum war, soll mirabile werden.
Paul Valéry: Ein Stück Musik ist ein Scheck, der auf die Talente künftiger Musiker ausgestellt wird.
»Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gern loswerden möchte.« (Goethe, Sämtliche Werke, Artemis Ausgabe, Band 9, S. 551)
13. Juni, Wien
Nachtrag zu den Begriffen Fatum, Moira, Schicksal, Verhängnis: Sie deuten schon bei den Alten auf höherstufige, scheinbar gesetzmäßige Abläufe hin, gegen welche selbst Götter machtlos sind. Das allgemeine Verhängnis macht, daß das Weltall am Ende im Feuerbrand untergeht.
Warum eigentlich? Solche Ausdrücke sind Grenzbegriffe, ohne reellen kognitiven Gehalt. Wie es kein Gesetz des Gesetzes gibt, so auch kein Schicksal des Schicksals. Jedes Verhängnis nimmt einen nur ihm allein zugehörigen Verlauf. Auch kündigt sich jede Katastrophe auf ihre eigene vertrackte Weise an, wobei die Vorzeichen nie in einem sinnvollen Verhältnis zum Umfang des kommenden Unheils stehen. Die Warnzeichen werden meistens erst nachträglich deutbar. Was man den Knoten des Schicksals nennt, meint die multifaktorielle Machart der großen Unglücke und Verfallsgeschichten. Ein Unglücksgrund kommt selten allein, und ein einzelner Faktor kann Schaden nur stiften, wenn er mit anderen kooperiert.
Im Oberseminar kommt die Debatte auf Otto Röslers Überlegungen zu den Risiken der CERN-Experimente, die 2009 beginnen sollen. Rösler führt aus, es sei nicht mit absoluter Gewißheit auszuschließen, daß sich bei den Teilchenkollisionen in dem Large Hadron Collider ein winziges Schwarzes Loch bildet, das nicht sofort (wie man allgemein erwartet) zerstrahlt, sondern sich irgendwie stabilisiert. Träte das ein, so würde es die typischen Eigenschaften eines solchen Objekts entwickeln, nämlich alle Materie um sich herum aufzufressen. Die Vorstellung ist in ihren Konsequenzen furchterregend, obschon die Idee eines Weltuntergangs durch physikalische Grundlagenforschung auch etwas Erhabenes besitzt. Das Schwarze Loch made in Swizzerland würde aufgrund seiner noch sehr kleinen, aber schon überdichten Masse im freien Fall zum Erdmittelpunkt hinuntersausen und von dort aus sein Werk verrichten – zur Enttäuschung derer, die meinten, aus Gründen der Fairness müßten Genf und Umgebung zuerst eingesaugt werden. Die Implosion beträfe alle Orte an der Peripherie des Planeten gleichzeitig und symmetrisch. Die Materie der Erde würde gerade mal ausreichen, um auf eine Kugel von der Größe einer Honigmelone zu schrumpfen.
Im Zusammenhang mit diesen Visionen tauchte unter den Teilnehmern des Seminars die Frage auf, ob es ein bürgerliches Widerstandsrecht in bezug auf Risiken von Forschung gibt. Wer den Eigenwillen des Wissenschaftsbetriebs kennt, wird an ein solches Recht nicht glauben, geschweige denn an seine Umsetzung. Wie sollte das geschehen? Können Bürger gegen Elementarteilchen auf die Straße gehen?
Schlechte Nachrichten von der Europa-Front: Die Iren haben beim Referendum über den Lissabon-Vertrag mit Nein votiert wie vor ihnen schon die Franzosen und die Holländer. Da sieht man einmal mehr, wie sehr die Völker auf der Baustelle Europa stören … Man möchte meinen, im irischen Nein komme ein verblüffender Zusatz an Undankbarkeit zum Tragen, da ja die Iren als die größten Nutznießer der EU gelten. Das Elend ist, daß die Neinsager überall so tun können, als hätten sie nur das vertrackte Vertragswerk von Lissabon abgelehnt, seien aber ansonsten die besten aller Europäer.
In Wahrheit liegt dem Nein alles mögliche zugrunde, auch Giftiges und Ungestehbares. In Frankreich war es seinerzeit besonders der zähe souveränistische Reflex gewesen, in Verbindung mit dem sehr verständlichen Wunsch, dem alten Staatskasper Chirac eins auszuwischen, zudem ein diffus populäres anti-europäisches Ressentiment. Der französische Nein-Cocktail von 2005 war komplizierter, als ein Leitartikel fassen kann – ein Gebräu aus landeseigenen Widerstandsmythen, anti-brüsseler Trotzgesten, germanophoben Reflexen, ironischen Elysée-Verhöhnungen, bedeutsam-philisterhaften Besserwissereien, konspirationsfrohen Internetaktionen, spätjakobinischem Negationseifer und anarchistischer Freude am Debakel – die Agitationen des Sozialisten Fabius nicht zu vergessen, der sich von der Nein-Welle ins Präsidentenamt tragen lassen wollte.
Wieso das Hören von großem Tenorgesang oft heilsame beflügelnde Wirkungen hervorruft? Vielleicht weil sich in ihm eine Freiheitserfahrung organisch überträgt. Die Männerstimme, die nach oben keine Grenze anerkennt, zeigt an, wie das Unmögliche ins Wirkliche übergeht. Heinrich Heine soll beim Hören von Rubinis Gesang geweint haben.
14. Juni, Wien
Geschichte ist für uns in erster Linie das Reich der Enttäuschungen. Das wollen die nicht einsehen, die heute affirmativ hinausposaunen: Die Geschichte geht weiter – als ob dies eine gute Nachricht wäre. In den letzten Jahren sind zwei Dutzend Anti-Fukuyama-Bücher erschienen (unter anderem von Ralf Dahrendorf und Joschka Fischer), fast alle von biederer Tendenz und ohne das geringste Gespür für die interessante Pointe der These vom Ende der Geschichte. Wer für die Konservierung der Geschichte plädiert, bekennt sich, ohne es zur Kenntnis zu nehmen, zu den kommenden Enttäuschungen – und zu den Illusionen, die ihnen vorausgehen. Die wichtigste Voraussetzung für den Fortgang der Geschichte ist seit jeher die nachwachsende Naivität der folgenden Generationen. Es ist der Anfängergeist, der die Dinge immer wieder von vorne startet. Die Jugend zerstört die Erfahrungen der Älteren durch ihre fatale Fähigkeit, bei Null zu beginnen. Sie entwertet die mühsam erworbenen Enttäuschungen, die doch das Beste waren, was die Alten besaßen. Die ungebrannten Kinder werfen die Weisheit der Eltern auf den Müll. Das einzige, was hoffen ließe, wäre eine Jugend, die durch Mißtrauen wettmacht, was ihr an Enttäuschung fehlt.
Mit dem Rad die größere Runde an der Donau bis Tulln und zurück. Bin rechtzeitig wieder zu Hause, um a) die Zahnschmerzen, die seit Monaten nie ganz verschwunden waren, wieder mit einer Dosis Ibu niederzukämpfen, b) mir ein Glas Burgenland-Roten zu genehmigen, c) das Spiel zwischen Spanien und Schweden anzusehen, d) speziell für Günther Netzer die Zeitmaschine neu erfinden zu wollen, damit er in seine Spielerzeit zurückreist statt zu kommentieren.
Was Fatalismus bedeutet, kann man beim Sport erleben – und nirgendwo so klar wie in der Unumkehrbarkeit der Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern. Im Deutschen hat man dafür das herrlich absurde Wort »Tatsachenentscheidung« erfunden, das passive Gegenstück zu Fichtes überdrehtem Begriff »Tathandlung«, der ein Vorbote des Hyperaktivitätssyndroms in der Philosophie war. In Wahrheit wird durch die irreversiblen Entscheidungen der Schiedsrichter eine religiöse, genauer eine ontologische Disposition angesprochen – die Bereitschaft zur Unterwerfung unter die Macht des Faktischen. Die Pointe dabei: Die Unterwerfung muß auch dann vollzogen werden, wenn du mit eigenen Augen gesehen hast, daß die Entscheidung falsch war. Das ist ohne die abstrakte Ehrfurcht vor der lenkenden Instanz nicht zu denken, erst recht nicht ohne die Dressur, sich protestlos unter Verfahren und Diktate zu beugen. (Man könnte über eine gemeinsame Wurzel von Rechtsprozeduren, Gottesurteilen und Spielregeln nachdenken.) Nur die Unterwerfung (»Kastration«) löst in den Menschen die »ontologische Reaktion« aus, sprich die Hinnahme eines Resultats, bei welcher der Gedanke an Revision nicht mehr aufkommt.