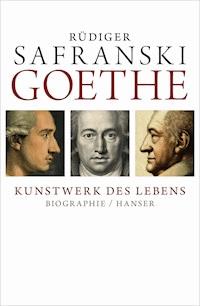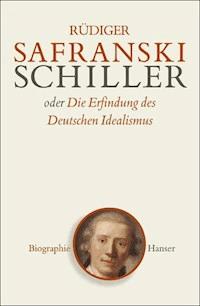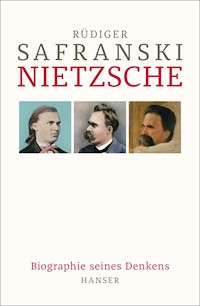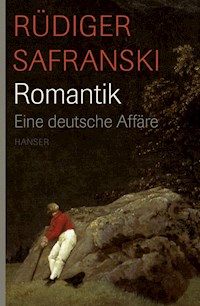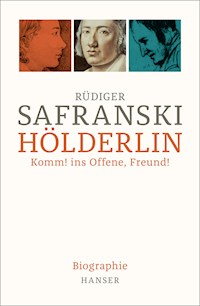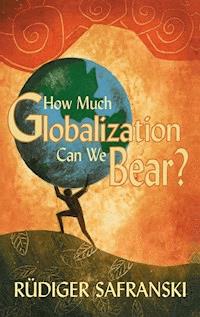Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch über das Leben: Was macht die Zeit mit uns? Und was machen wir aus ihr? Rüdiger Safranski ermutigt uns, den Reichtum der Zeiterfahrung zurückzugewinnen. Jenseits der Uhren, die uns ein objektives Zeitmaß vorgaukeln, erleben wir die Zeit ganz anders: In der Langeweile, bei der Hingabe, bei den Sorgen, beim Blick auf das Ende, streng gegliedert in der Musik und lose gefüllt beim Spiel. Und wieder anders im gesellschaftlichen Termingetriebe, in der beschleunigten Wirtschaftswelt, in den Medien, in der globalen Gleichzeitigkeit. Facettenreich beschreibt Safranski das Spannungsfeld zwischen Vergehen und Beharren und ermuntert uns, aufmerksam mit diesem wertvollen Gut umzugehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie: sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen«, so sagt es die Marschallin in Ho mannsthals ›Rosenkavalier‹. Jenseits der Uhren, die uns ein objektives Zeitmaß vorgaukeln, erleben wir die Zeit ganz anders: In der Langeweile, bei der Hingabe, bei den Sorgen, beim Blick auf das Ende, streng gegliedert in der Musik und lose gefüllt beim Spiel. Und wieder anders ist unsere Zeitwahrnehmung im gesellschaftlichen Termingetriebe, in der beschleunigten Wirtschaftswelt, in den Medien, in der Echtzeit- Kommunikation, in der globalen Gleichzeitigkeit.
Rüdiger Safranski fächert die Conditio humana vor uns auf und ermutigt uns, den Reichtum der Zeiterfahrung zurückzugewinnen: Facettenreich beschreibt er das Spannungsfeld zwischen Vergehen und Beharren und ermuntert uns, aufmerksam mit diesem wertvollen Gut umzugehen – damit nicht nur die Zeit mit uns etwas macht, sondern auch wir etwas aus ihr machen
Hanser E-Book
Rüdiger Safranski
Zeit
Was sie mit uns macht
und was wir aus ihr machen
Carl Hanser Verlag
für Hans-Peter Hempel
… dass ein Gespräch wir sind …
ISBN 978-3-446-25011-6
Alle Rechte vorbehalten
© 2015 Carl Hanser Verlag, München
Schutzumschlag:
Peter-Andreas Hassiepen, München
Bildmotiv: Harold Lloyd (1893–1971) in prekärer Lage an einem Uhrzeiger hängend. Szene aus dem Film ›Safety Last!‹ (1923).
© 2011 The Harold Lloyd Trust
Erscheint zeitgleich bei Random House
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Vorwort
Kapitel 1
Zeit der Langeweile
Vom Vorzug, sich langweilen zu können. Die Ereignisse gehen, die Zeit kommt. Unerträglichkeit der linearen Zeit. Das Warten. Godot. Kultur als Zeitvertreib. Ein dünner Ereignisvorhang lässt ins Nichts der Zeit blicken. Der metaphysische Tinnitus. Romantische Erkundungen der Langeweile. Die drei Akte des Dramas Langeweile. Wenn nichts geht, muss man sich selbst auf den Weg machen. Freiheit und Anfangen. Die Zeit zeitigen.
Kapitel 2
Zeit des Anfangens
Die Lust des Anfangens. Berühmte Anfänger in der Literatur, von Kafka bis Frisch und Rimbaud. Der Fall Schwerte/Schneider. Anfangen, Freiheit und Determination. Erster Besuch bei Augustinus: Das programmierte Lied. Offene und geschlossene Zeit. Schwierige Anfänge im modernen Fortpflanzungsgeschäft. Mit sich anfangen und sich übernehmen. Hannah Arendts Philosophie der Natalität. Chancen für vielversprechende Anfänge.
Kapitel 3
Zeit der Sorge
Sorge – das diensthabende Organ der erfahrbaren Zeit. Die Sorge geht über den Fluss. Heideggers Sorge: der Welt verfallen und dem Tod ausweichen. Sorge als Möglichkeitssinn. Das Problem: in der Sorge derselbe bleiben. Wieder einmal die Entdeckung eines »glücklichsten Volkes«. Ohne Zukunftsbewusstsein, ohne Sorgen. Die modernisierte Sorge in der Risikogesellschaft. Die Rückkehr der alten Sorge.
Kapitel 4
Vergesellschaftete Zeit
Was misst die Uhr? Regelmäßige Bewegungsabläufe messen unregelmäßige. Die Uhr als gesellschaftliche Institution. Zeittakt des Geldes. Zeitdisziplin. Die wunderliche Pünktlichkeit. Robinsons Kalender. Gleichzeitigkeit. Echtzeitkommunikation. Prousts Telefon und die Stimmen aus dem Totenreich. Schwierigkeiten mit der erweiterten Gleichzeitigkeit. Aufwertung der Gegenwart und gespeicherte Vergangenheit.
Kapitel 5
Bewirtschaftete Zeit
Gefangen in Zeitplänen. Wenn die Zeit knapp wird, heilsgeschichtlich, geschichtlich, kapitalistisch. Schulden und Kredit. Zeit der Finanzwirtschaft. Beschleunigungen. Verschiedene Geschwindigkeiten. Rasender Stillstand. Eisenbahn. Der Angriff der Gegenwart auf den Rest der Zeit. Romantische Kritik: das sausende Rad der Zeit.
Kapitel 6
Lebenszeit und Weltzeit
Befristete Lebenszeit, entfristete Weltzeit. Die zyklische Zeit vermindert die Spannung. Der christliche Angriff auf die Weltzeit. Die Nichtigkeit der Zeit. Zweiter Besuch bei Augustinus. Zeitspanne, nicht Zeitpunkte. Eine kleine Phänomenologie der Zeiterfahrung. Vergangenheiten ohne Gegenwart. Die wirkliche und die vorgestellte Zeit. Das Absurde und die Weltzeiterfüllungen: materialistisch, christlich, fortschrittlich, evolutionär.
Kapitel 7
Weltraumzeit
Zeitanfang. Anfangssingularität. Physikalische Eschatologie. Bertrand Russells Floß der Kultur und die großeWeltraumnacht. Einsteins Relativitätstheorie. Es ist nicht alles relativ, aber wir leben nicht alle in derselben Zeit. Das Rätsel der Gleichzeitigkeit. Raumzeit. Überwindung des Dualismus zwischen Mensch und Welt. Einsteins Kosmosfrömmigkeit. Das Erhabene.
Kapitel 8
Eigenzeit
Die Eigenzeit des Körpers und Körperrhythmen. Die Verteidigung der Eigenzeit als politische Aufgabe. In den Labyrinthen der Eigenzeit. Worin die Wirklichkeit verschwindet. Eigenzeit löst Identität auf. Jeder ist ein letzter Zeuge. »Jene Wolke blühte nur Minuten«. Der ornithologische Gottesbeweis. Sartres Nichts und die Zeit. Die zweite kleine Phänomenologie der Zeiterfahrung. Warum wir uns notorisch verspäten. Das Plötzliche.
Kapitel 9
Spiel mit der Zeit
Spielräume durch Sprache und Schrift. Die Entdeckung der Zeitstufen und die Geburt des Erzählens. »Der Untergang von Kasch«, ein afrikanischer Mythos. Erzählen als Überlebensmittel. Eine kleine Typologie der literarischen Zeitmuster. Von der Odyssee bis Balzac, von Ödipus bis zum Detektivroman. Das Motiv der Lebenslüge. Hamlet und die Handlungshemmung. Epische und dramatische Zeitbehandlung. Zeit der Bilder. Warum schreit Laokoon nicht? Plötzlichkeit. Fotografie und Wahrheit. Eine Frau geht über den Fluss. Bob auf Augenhöhe. Zenons Paradoxie. Prousts unwillkürliche Erinnerungsbilder. Der ewige Augenblick. Musik.
Kapitel 10
Erfüllte Zeit und Ewigkeit
Platons Ewigkeit und die alltägliche Erfahrung von bleibender Gegenwart. Zeitvergessene Hingabe. Geistliche und weltliche Mystik. Der ästhetische große Augenblick. Nietzsche, Hofmannsthal, Proust und Adorno. Verlangen nach Unsterblichkeit. Lebensfristverlängerung. Unsterblichkeit der Seele? Urszene mit dem Tod von Sokrates. Das Denken kann sich nicht wegdenken. Christlicher Auferstehungsglaube. Höhere Egozentrik? Das Loslassen und seine Schwierigkeiten.
Bibliographie
Nachweise
Vorwort
Die Zeit, so die Marschallin in Hofmannsthals »Rosenkavalier«, die ist ein sonderbar Ding./Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts./Aber dann auf einmal,/da spürt man nichts als sie.
Nicht nur, wenn man so hinlebt ist die Zeit rein gar nichts. Seltsam ist vielmehr, dass sie auch rein gar nichts zu sein scheint, wenn man ihr die gesammelte Aufmerksamkeit schenkt. Jeder kann die Probe darauf machen, man muss nur auf das eigentümliche Vergehen der Zeit achten. Was eben noch gegenwärtig war, ist nicht mehr, und das Künftige ist noch nicht. Die Zeit bewirkt, dass wir einen schmalen Streifen von Gegenwärtigkeit bewohnen, nach beiden Seiten umgeben von einem Nicht-Sein: das Nicht-Mehr der Vergangenheit und das Noch-Nicht der Zukunft. Man kann darüber staunen, auch sich beunruhigen. Der Heilige Augustinus jedenfalls ist über dieses doppelte Nichtsein, das die Zeit mit sich bringt, ins Grübeln geraten und schreibt in dem berühmten elften Kapitel der »Bekenntnisse«: Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß ich’s nicht.
Wenn die Zeit nur das wäre, was die Uhren messen, dann wäre man mit der Antwort auf die Frage nach der Zeit schnell fertig. Sie wäre eben nichts weiter als die messbare Dauer von Ereignissen. Doch es drängt sich der Eindruck auf, dass damit ihre eigentliche Bedeutsamkeit noch gar nicht berührt ist. Ich wähle deshalb einen anderen Weg. Ich nähere mich der Zeit auf der Spur ihrer Wirkungen, ich beschreibe also, was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen.
Der Weg durch das Labyrinth unserer Erfahrungen mit der Zeit beginnt bei der Langeweile, denn nirgendwo sonst wird die Zeit so auffällig, dann nämlich, wenn sie nicht vergehen will, wenn sie stockt. Das Zeitvergehen als solches drängt sich vor, wenn es nur spärlich von Ereignissen zugedeckt wird. Diese gewissermaßen leere Zeit, so quälend sie unmittelbar empfunden wird, hat die Literatur und Philosophie von jeher herausgefordert, denn die Vermutung ist berechtigt, dass man besonders gut erkennen kann, was mit dem Menschen los ist, wenn sonst nichts los ist. (Kapitel 1)
Wenn die Zeit zu erstarren droht, wenn sich nichts mehr bewegt, hilft nur der Aufbruch, der Versuch, einen neuen Anfang zu setzen. Eine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Der Zauber, der jedem neuen Anfang innewohnt, liegt darin, dass die stockende Zeit in Bewegung gerät, sie wird vielversprechend, sie reißt einen mit sich. Natürlich gibt es da auch Probleme. Es kommt zu Verdrängungen, Zerstörungen, Rücksichtslosigkeiten aller Art. Und trotzdem: Die Zeit bietet dem Menschen die große Chance, nicht das Opfer seiner Vergangenheit zu bleiben, sondern sie hinter sich zu lassen. Zuerst haben die Anderen etwas mit einem angefangen, jetzt fängt man selbst etwas mit sich an. Das ist die beschwingende Zeit des Anfangens. Ich bin nicht nur Ich, ich bin auch ein Anderer, erklärt der Anfänger. (Kapitel 2)
Die Zeit des Anfangens ist auf Künftiges gerichtet, und zwar mit Zuversicht. In der Regel aber wird die Orientierung am Künftigen von der Sorge beherrscht, in allen ihren Formen – von der Fürsorge bis zur Vorsorge. Weil wir nicht nur in der Zeit leben, sondern uns der Zeit bewusst werden, ist es nicht zu vermeiden, dass sich uns ein ganzer Horizont von Zukunft eröffnet, auf den wir uns sorgend und vorsorgend beziehen. Die Sorge ist ein diensthabendes Organ unserer Zeiterfahrung. Alle Lebensbereiche werden davon erfasst, weil wir mit allem, was wir tun und sind, dem Vergehen der Zeit preisgegeben sind. Die Sorge vereinzelt den Menschen, drängt ihn aber auch zusammen ins gesellschaftliche Kollektiv, das sich, unter modernen Bedingungen, dann als Risikogesellschaft versteht. (Kapitel 3)
Die Zeit wird vergesellschaftet. In diesem Moment beginnt die Herrschaft der Uhren. Die Uhr ist nichts anderes als eine gesellschaftliche Institution. Mit regelmäßigen Ereignissen, auf die man sich gesellschaftlich geeinigt hat – von den Sonnenuhren bis zu Atomuhren –, wird die Dauer unregelmäßiger Ereignisse gemessen. Das Geschehen in der Gesellschaft wird zeitlich vernetzt. Im Zeitalter der Maschinen wird die Uhr zum Herrschaftsinstrument, und mit den Eisenbahnen entsteht das Erfordernis der überregionalen Koordinierung der Zeitabläufe. Die moderne Technik ermöglicht schließlich eine Kommunikation zwischen raumfernen Punkten in Echtzeit. Damit wird das Erlebnis von globaler Gleichzeitigkeit möglich. Das gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie zuvor, und es ist eine dramatische Herausforderung, vielleicht sogar eine Überforderung des bisherigen Menschentyps. Gut möglich, dass wir uns mitten in einer kulturellen Mutation befinden. (Kapitel 4)
Die vergesellschaftete Zeit ist auch die bewirtschaftete Zeit. Es wird mit Zeit gehandelt. Zeit wird zu Geld. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten beschleunigen sich in einem ungeheuren Ausmaß. Es bilden sich in der Gesellschaft Regionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, beispielsweise ist die Finanzwirtschaft schneller als die Demokratie, die für ihre Beschlüsse mehr Zeit braucht. Es bahnen sich politische Machtkämpfe an um die Frage: Wer bestimmt das Tempo. Die Zeit wird politisiert. Mit der Beschleunigung wird mehr Zukunft verbraucht und die Vergangenheit schneller entwertet. Die Gegenwart belastet die Zukunft mit ihren Abfällen und verbraucht die Naturschätze, die sich in Jahrmillionen gebildet haben: Der Angriff der Gegenwart auf den Rest der Zeit. (Kapitel 5)
Auch wenn es einem manchmal so vorkommt, als sei man vollkommen eingeschlossen in die vergesellschaftete und bewirtschaftete Zeit, ist diese Sphäre doch nicht alles. Wir blicken hinaus auf eine Weltzeit, die unsere persönlichen Lebensfristen, aber auch die Lebensdauer ganzer Gesellschaften und Kulturen unendlich weit übersteigt. Schon immer hat es Versuche gegeben, Lebenszeit und Weltzeit in eine sinnhafte Beziehung zu bringen. Die natürlichen Zyklen, die kosmischen Weltalter, die christliche Heilsgeschichte, die Idee des Fortschritts über Generationen hinweg, schließlich die Evolution als Geschichte einer Höherentwicklung – sie dienen zur Orientierung, um den ungeheuren Zeiträumen das Absurde zu nehmen und sie mit einiger Sinnhaftigkeit zu erfüllen. (Kapitel 6)
Doch das wird immer schwieriger, wenn wir uns wirklich auf die Weltraumzeit einlassen. Mit Einsteins Relativitätstheorien ist das Rätsel der Zeit noch größer geworden. Zwar ist nicht alles relativ, aber nicht alles existiert in der gleichen Zeit. Die Naturwissenschaft hat erkannt, dass die Zeit keine absolute Größe ist. Womöglich hat sie einen Anfang und ein Ende wie alles andere auch, und vielleicht ist sie überhaupt nur ein Vordergrundphänomen. Aber auch während Theorien über den angeblich illusionären Charakter der Zeit entwickelt werden, vergeht die Zeit. (Kapitel 7)
Zurück aus dem Weltraum in die Eigenzeit des Körpers und seiner Rhythmen: Die Begegnung mit der am eigenen Leibe erfahrenen Zeit. Zur Eigenzeit aber gehört auch die innere Zeit des Bewusstseins. Im bewussten Erleben des Zeitvergehens geschieht nämlich die geheimnisvolle Verwandlung des Wirklichen ins Unwirkliche. Wo ist das Vergangene, wenn es keine materiellen Spuren mehr davon gibt? Ist das Bewusstsein dann der einzige Aufbewahrungsort? Und wenn das Vergessen einsetzt und die Vergangenheiten auch aus dem Bewusstsein verschwinden, ist es dann so, als hätte es diese Vergangenheiten nie gegeben? Das gilt nicht nur für das Große und Ganze, sondern auch für den Einzelnen. Jeder ist der letzte Zeuge für etwas, das mit ihm unwiderruflich untergeht. Die modernen Speichermedien helfen da nichts, denn sie bewahren äußere Spuren, nicht innere Zustände auf. Das Bewusstsein der Zeit entdeckt die Furie des Verschwindens. Das ertragen wir nur, weil neue Wirklichkeiten auf den Schauplatz unseres Bewusstseins drängen, auch wenn, trotz aller Gleichzeitigkeit, jeder Eindruck ein wenig verspätet ins Bewusstsein tritt. (Kapitel 8)
Wir stehen unwiderruflich unter der Herrschaft der Zeit. Umso besser, dass wir wenigstens mit ihr spielen können. Wir können, erzählend, uns frei in der Zeit bewegen – vor und zurück. Das ist vielleicht überhaupt das Geheimnis der Anziehungskraft der Literatur. Wir beherrschen spielerisch die Zeit, unter deren Gewalt wir sonst stehen. Im Spiel mit der Zeit gewinnen wir eine befristete Souveränität, in der Literatur ebenso wie in der Welt der Bilder und in der Musik. Nochmals gewandelt hat sich das Spiel mit der Zeit im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit von Texten, Bildern und Tönen. Doch es bleibt dabei: Das Leben selbst hat keine Replay-Taste. (Kapitel 9)
Das Spiel mit der Zeit hat mit erfüllter Zeit zu tun, und die erfüllte Zeit kann als Vorgeschmack auf das gelten, was man Ewigkeit genannt hat. Ewigkeit ist nicht endlose Zeit, sondern etwas anderes als Zeit. Ewigkeit ist ein Sehnsuchtsbild der Menschheit, wie auch Unsterblichkeit oder der christliche Glaube an eine Auferstehung des Leibes und der Seele. Alle diese untereinander höchst verschiedenen Vorstellungen hängen zusammen mit dem wohl unauflöslichen Widerspruch, dass man sich von außen sehen kann und deshalb um seinen Tod weiß; von innen aber kann man sich eben doch nicht wegdenken. Man kann sich das eigene Nicht-Sein einfach nicht vorstellen – woraus Einiges folgt. (Kapitel 10)
Kapitel 1
Zeit der Langeweile
Vom Vorzug, sich langweilen zu können. Die Ereignisse gehen, die Zeit kommt. Unerträglichkeit der linearen Zeit. Das Warten. Godot. Kultur als Zeitvertreib. Ein dünner Ereignisvorhang lässt ins Nichts der Zeit blicken. Der metaphysische Tinnitus. Romantische Erkundungen der Langeweile. Die drei Akte des Dramas Langeweile. Wenn nichts geht, muss man sich selbst auf den Weg machen. Freiheit und Anfangen. Die Zeit zeitigen.
Der Mensch ist, im Unterschied zum Tier, ein Wesen, das sich langweilen kann. Wenn für das Lebensnotwendige gesorgt ist, bleibt immer noch überschüssige Aufmerksamkeit, die, wenn sie keine passenden Ereignisse und Tätigkeiten findet, sich auf das Zeitvergehen selbst richtet. Der sonst dicht geknüpfte Ereignisteppich, der das Zeitvergehen für die Wahrnehmung verhüllt, ist dann fadenscheinig geworden und gibt den Blick frei auf eine vermeintlich leere Zeit. Das lähmende Rendezvous mit dem reinen Zeitvergehen nennen wir Langeweile.
Die Langeweile lässt uns einen ungeheuren Aspekt des Zeitvergehens erfahren, allerdings auf paradoxe Weise: denn in der Langeweile will die Zeit ja gerade nicht vergehen, sie stockt, sie zieht sich unerträglich hin. Zeit, sagt Arthur Schopenhauer, erfahren wir in der Langeweile, nicht beim Kurzweiligen. Wenn man also begreifen will, was die Zeit ist, wendet man sich zuerst am besten nicht an die Physik, sondern an die Erfahrung der Langeweile.
Langeweile, so beschreibt William James diesen Zustand, tritt immer dann auf, wenn wir aufgrund der relativen Leere des Inhalts einer Zeitspanne auf das Vergehen der Zeit selbst aufmerksam werden.
Eine wirklich ereignislose Zeit gibt es nicht; es geschieht immer etwas. Ohne Ereignisse gibt es gar keine Zeit, denn Zeit ist die Dauer von Ereignissen und kann deshalb streng genommen gar nicht leer sein. Die Empfindung der Leere rührt daher, dass sich an die Ereignisse kein lebendiges Interesse knüpft. Das kann am Subjekt oder am Objekt liegen, meistens liegt es an beiden. Was das Subjekt betrifft, so kann es stumpf, erlebnisschwach sein. Es nimmt zu wenig wahr, und darum wird ihm schnell langweilig. Allerdings allzu stumpf darf es auch nicht sein, dann nämlich merkt es gar nicht, dass ihm etwas fehlt. Es döst vor sich hin. Ein Minimum an Offenheit, Neugier und Erlebnisbereitschaft braucht man also schon, um gelangweilt werden zu können.
Was die Objektseite bei der Langeweile betrifft, so kann es sein, dass die begegnende Wirklichkeit tatsächlich zu wenig Angebote und Anreize bietet, etwa bei der Monotonie mechanischer Vorgänge. Das zunächst Reizvolle kann verlieren durch Routine, Gewohnheit. Das einst Kurzweilige kann langweilig werden. Die regelmäßige Wiederkehr der äußeren Dinge, schreibt Goethe, sind eigentlich holde Anerbietungen des Lebens, die das Gefühl von Verlässlichkeit und Behagen vermitteln. Doch es kann geschehen, dass solches Behagen der Gewohnheit umschlägt in Langeweile, die sich bis zur müden Verzweiflung steigern kann. Von einem Engländer wird erzählt, so Goethe, erhabe sich aufgehangen, um nicht mehr täglich sich aus- und anzuziehn.
Ein phantasievoller, aufgeweckter Mensch wird sich, wenn die äußeren Reize stumpf werden oder ausbleiben, mit inneren Geschehnissen – Erinnerungen, Gedanken, Phantasien – eine Weile lang behelfen können, aber doch nicht gar zu lange, dann wird auch ihm die Zeit lang, auch ihm wird es am Ende langweilig.
Schopenhauer hat die Disposition für Langeweile auf die Lebensperiode bezogen. In der Jugend, erklärt er, lebt man mit einem aufnahmefähigeren Bewusstsein, das von der Neuheit der Gegenstände immer angeregt wird. Die Welt erscheint dicht, voll mit Eindrücken. Daher ist der Tag unabsehbar lang, ohne langweilig zu sein, und eine Reihe von Tagen und Wochen wird zur halben Ewigkeit. Dem Erwachsenen widerfährt solches nur in besonderen Fällen, bei hingebungsvoller Arbeit oder beim Reisen. Sonst aber verfliegt die Zeit, je älter man wird. Wenn ein Tag wie alle ist, heißt es in Thomas Manns »Zauberberg«, so sind alle wie einer; und bei vollkommener Einförmigkeit würde das längste Leben als ganz kurz erlebt werden. Kurz erscheint solches vorbeihuschendes Leben allerdings nur im Rückblick, im Augenblick jedoch kann es einen langweilen, gerade wegen seiner Flüchtigkeit. Es lässt einen leer zurück.
In dem Maße, wie die Ereignisse ausdünnen, wird die Zeit auffällig. Es ist, als käme sie aus ihrem Versteck, denn für unsere gewöhnliche Wahrnehmung ist sie hinter den Ereignissen verborgen und wird nie so direkt und aufdringlich erlebt. Ein Riss also im Vorhang, und dahinter gähnt die Zeit. Der Blick auf die Uhr verstärkt die Langeweile noch, denn die Dauer, interpunktiert durch regelmäßige Taktschläge oder die Bewegung des Zeigers, wird als noch ereignisärmer empfunden und ist kaum mehr auszuhalten, weshalb beispielsweise das stete Tropfen in einer sonst leeren Zelle auch als Folter eingesetzt wird. Schon in der Schlaflosigkeit kann man Bekanntschaft mit der Folter der leeren Zeit machen. E. M. Cioran, der notorische Schlaflose der Gegenwartsphilosophie, schreibt über diese Erfahrung: Drei Uhr morgens. Ich nehme diese Sekunde wahr, dann jene, ich ziehe die Bilanz jeder Minute. Wozu das alles? – Weil ich geboren wurde. Aus durchwachten Nächten besonderer Art erwächst die Infragestellung der Geburt.
Für die Erfahrung der Langeweile aber genügt es nicht, dass die inneren oder äußeren Ereignisse verblassen. Es muss, im Kontrast dazu, eine innere Unrast fortwirken, ein mattes Begehren, das man spürt, ohne von ihm erfüllt zu werden. Es gehört zur Langeweile, dass man eben nicht in etwas versinken kann, dem Augenblick ganz hingegeben, sondern dass man immer schon über den jeweiligen Moment hinaus ist und eine zeitliche Erstreckung erfährt, doch nicht als etwas Befreiendes und Beschwingendes, sondern als etwas Lähmendes. Lähmend erscheint die Aussicht, alles selber machen zu müssen, seinem Leben selbst einen Inhalt zu geben. Der auf diese Weise Gelangweilte wird ärgerlich fragen: Muss ich heute schon wieder das tun, was ich selber will!? Ungeduldig wartet man auf etwas, ohne zu wissen worauf. Ein leeres Treiben als Pulsschlag der inneren Zeit. Moment folgt auf Moment, der Sog der Zeit zieht mit und lähmt zugleich.
Die Zeitpathologie kennt das Phänomen des zeitbezogenen Zwangsdenkens. Eine Patientin brachte es dem Psychiater Viktor Emil von Gebsattel gegenüber auf den Punkt: Ich muss unaufhörlich denken, dass die Zeit vergeht. Sie kann die Ereignisse selbst kaum mehr wahrnehmen, immerzu drängt sich nur die Wahrnehmung des Zeitabschnittes auf, den sie einnehmen, und diese Gleichheit der Zeitabschnitte greift auf das Welterleben über. Die Patientin berichtet weiter: Wenn ich einen Vogel piepsen höre, muss ich denken: »das hat eine Sekunde gedauert«. Wassertropfen sind unerträglich und machen mich rasend, weil ich immer denken muss: Jetzt ist wieder eine Sekunde vergangen, jetzt wieder eine Sekunde.
In der Monotonie sind es wiederkehrende Zeitpunkte, die eine lineare Zeitreihe aufspannen. Michael Theunissen hat vorgeschlagen, diese Art des Zeiterlebens in der Langeweile zu verstehen als Auslieferung an die lineare Zeitordnung durch den Zerfall der dimensionalen Zeitordnung. Das bedeutet: Die dreidimensionale Zeitordnung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die in der Reflexion vielfach überlagert werden kann, verengt sich zum Tick-Tack des linearen Zeitvergehens. Das ist eine zwanghafte Wahrnehmungsverengung, die den möglichen Reichtum der Zeiterfahrung auslöscht. Die Erinnerungen und Erwartungen, die in das Erlebnis von Gegenwart hineinspielen, geben der Zeit ein Volumen, eine Breite, eine Tiefe und eine Erstreckung. Wenn sich aber die lineare Zeitreihe vordrängt, schrumpft die Zeit auf die Abfolge von Zeitpunkten, und es kommt zur monotonen Wiederkehr des Gleichen: Jetzt und Jetzt und Jetzt. Das ist die schlechte Unendlichkeit der Langeweile, bei der man darauf wartet, dass endlich etwas anderes geschieht als nur dieses Jetzt und Jetzt und Jetzt. Ein leeres Warten.
Es muss einem beim Warten ja nicht immer langweilig werden, denn immerhin ist man auf ein Ereignis bezogen, und das ergibt eine Spannung. Auch wenn die Zeit lang wird, drängt sie sich doch nicht vor, weil das erwartete Ereignis das Bewusstsein ausfüllt.
Zum Beispiel ein Rendezvous. Man sitzt im Café und wartet auf sie oder ihn, stellt sich tausend Dinge vor, Vorlust, Vorfreude, Neugier sind im Spiel. Man ist davon in Anspruch genommen. Nun verspätet sich der oder die Erwartete. Man zweifelt, ob man am richtigen Treffpunkt sitzt. Eine leise Kränkung meldet sich, denn der Wartende fühlt sich als Unterlegener. Bei solchem Warten geschieht Einiges, Ärger, Kränkung, Enttäuschung, Wut – doch Langeweile ist eher nicht dabei.
So verhält es sich bei eigentlich erwünschten Ereignissen. Doch auch befürchtete Ereignisse, auf die man wartet, bilden einen Hof von Vorgefühlen, die Langeweile in der Regel nicht aufkommen lassen. Anders ist es bisweilen in Amtsstuben. Hier kann man das Gefühl haben, dass einem die Zeit gestohlen und man daran gehindert wird, einen sinnvolleren Gebrauch von ihr zu machen.
Nicht jedes Warten also ist mit Langeweile verbunden, aber umgekehrt enthält jede Langeweile auch ein Warten, ein unbestimmtes Warten, ein Warten auf Nichts. Das in der Langeweile enthaltene Warten ist eine leere Intention, wie das die Phänomenologen nennen.
In Samuel Becketts »Warten auf Godot« wird mit einiger Komik ein solches leeres Warten als menschliche Grundsituation vorgeführt. Da warten zwei Landstreicher auf der Bühne, und ihnen selbst und den Zuschauern wird nicht ganz klar, worauf sie eigentlich warten. Da ist Godot, auf den sie warten. Aber unklar ist, ob es ihn überhaupt gibt, und wenn es ihn gibt, ob er sein Kommen wirklich in Aussicht gestellt hat und, falls das geschehen sein sollte, für wann. In diesen Unbestimmtheiten verliert sich die Gestalt Godots, und übrig bleibt eine Leere. Die beiden Protagonisten wissen nicht, worauf sie warten, und wissen auch nicht, was sie tun sollen. Kommt, reden wir zusammen/wer redet, ist nicht tot, heißt es bei Gottfried Benn. Und so reden sie und tun, was ihnen gerade so einfällt. Das ist aber zu wenig und ergibt keinen hinreichend dichten Zusammenhang, der sie – und die Zuschauer – abschirmen könnte gegen die Erfahrung der leer verstreichenden Zeit. »Warten auf Godot« ist auch deshalb über Nacht zum klassischen Stück der Moderne geworden, weil es das Betriebsgeheimnis jeglicher Dramatik aufdeckt. Was sind all diese farbenreichen, gut ausgedachten, aufregenden Dramen denn anderes, als erfolgreiche Versuche, die Zeit totzuschlagen. Da werden, im Erfolgsfall, dichte Ereignisteppiche geknüpft als Sichtblenden gegen die verstreichende Zeit. In »Warten auf Godot« wird diese lebenserhaltende Emsigkeit parodiert. Der Ereignisteppich bleibt einfach fadenscheinig. Das Nichts schimmert immer wieder hindurch.
WLADIMIR: … Was tun wir hier, das muss man sich fragen. Wir haben das Glück, es zu wissen. Ja, in dieser ungeheuren Verwirrung ist eines klar: wir warten darauf, dass Godot kommt.
ESTRAGON: Ach ja.
WLADIMIR: Oder, dass die Nacht kommt … Sicher ist, dass die Zeit unter solchen Umständen lange dauert und uns dazu treibt, sie mit Tätigkeiten auszufüllen … Du wirst mir sagen, dass es geschieht, um unseren Verstand vor dem Untergang zu bewahren. …
ESTRAGON: Wir werden alle verrückt geboren. Einige bleiben es. …
WLADIMIR: Wir warten. Wir … langweilen uns zu Tode, das ist unbestreitbar. Gut. Es ergibt sich eine Ablenkung, und was tun wir? Wir lassen sie ungenutzt.
Das bezieht sich auf das Herr-und-Knecht-Spiel, das Pozzo und Lucky vor ihnen aufführen, Theater im Theater wie in Shakespeares »Hamlet«; das Angebot einer Ablenkung, das Wladimir und Estragon zwar nicht zurückweisen, aber auch nicht nachhaltig genug nutzen – was sie sich selbst zum Vorwurf machen. Doch sie sind schuldlos: Das Angebot selbst entbehrt der Nachhaltigkeit. Das Herr-und-Knecht-Spiel sollte die Langeweile vertreiben und macht sie am Ende umso spürbarer. Was die beiden Protagonisten erfahren, ist das Grundgesetz der Unterhaltung: Langeweile lauert in den Mitteln, mit denen sie vertrieben werden soll. Kultur – wenn man das Slapstick-Geschehen auf der Bühne als Symbol dafür nehmen will – entspringt aus dem Kampf gegen die Langeweile. Und so liegt diese allem zugrunde, was hoch hinaus will.
Ähnlich hatte schon Kierkegaard mit nicht geringerem Witz die Langeweile zur Ursprungsmacht von Kultur und Geschichte erklärt. Die Götter langweilten sich, heißt es in einer berühmten Passage von »Entweder – Oder«, darum schufen sie die Menschen. Adam langweilte sich, weil er allein war, darum wurde Eva erschaffen. Von dem Augenblick an kam die Langeweile in die Welt und wuchs an Größe in genauem Verhältnis zu dem Wachstum der Volksmenge. Adam langweilte sich allein, dann langweilten Adam und Eva sich gemeinsam, dann langweilten Adam und Eva und Kain und Abel sich en famille, dann nahm die Volksmenge in der Welt zu, und die Völker langweilten sich en masse. Um sich zu zerstreuen, kamen sie auf den Gedanken, einen Turm zu bauen, so hoch, dass er bis in den Himmel rage … Danach wurden sie über die Welt zerstreut, so wie man heute ins Ausland reist; aber sie fuhren fort sich zu langweilen.
Die Langeweile, erklärt Kierkegaard, ist die Wurzel alles Übels, folglich ist der Mensch ein Wesen, das unterhalten werden muss. Unterhalten werden müssen die Absturzgefährdeten. Wohin drohen sie abzustürzen? In die ›leere‹ Zeit. Das ist der eigentliche Sündenfall.
Tatsächlich zählte im christlichen Mittelalter die ›acedia‹ genannte Langeweile zu den schlimmen Sünden. Sie wurde verstanden als Trägheit des Herzens, Verstocktheit, letztlich als eine Verschlossenheit gegenüber Gott, der einen sonst mit Leben erfüllt. Wer sich gegen ihn absperrt, erfährt die eigene Leere. So hat im 17. Jahrhundert Blaise Pascal die Langeweile gedeutet. Wenn Gott das Erhabene ist, so ist die empfundene Leere sein Schatten: das negativ Erhabene, das Nichts. Gott erfüllt die Zeit, und lässt man sich nicht von ihm erfüllen, so bleibt eben nur die leere Zeit, die man aber nicht aushalten kann, weshalb man Zerstreuung sucht. Daraus entsteht, Pascal zufolge, die moderne Hektik und Betriebsamkeit. Alles Unglück kommt davon, schreibt Pascal, dass die Menschen unfähig sind, in Ruhe in ihrem Zimmer zu bleiben, und sie können nicht in Ruhe im Zimmer bleiben, weil sie es nicht alleine bei sich aushalten. Und das wiederum können sie nicht, so Pascal, weil ihnen Gott fehlt. Wo er war, ist nun ein Hohlraum, der sie ansaugt und zu verschlingen droht. Es ist der Schrecken vor der inneren Leere, die erlebt wird in der Langeweile. Sie ist noch schlimmer als der Schreck angesichts des leeren Weltraums draußen, den Pascal nicht minder eindringlich mit den berühmten Worten evoziert: verschlungen von der unendlichen Weite der Räume … erschaudere ich.
Pascal sieht den Menschen sich verzehren in dem Hin und Her zwischen der Langeweile drinnen, der er zu entfliehen sucht, und der Zerstreuung draußen, in die er sich flüchtet. Die Langeweile ist also für ihn nicht nur ein psychologischer, sondern ein metaphysischer Zustand, ein Symptom des unerlösten Menschen. Das Leiden an der sinnentleerenden Zeit. Eine Begegnung mit dem Nichts.
In dieser Tradition denkt auch noch Kierkegaard, wenn er die Langeweile als jene Macht bezeichnet, die den Menschen vor das Nichts rückt und die damit als Ausdruck eines negativ gewordenen Gottesverhältnisses zu verstehen ist.
Um 1800 waren es die Romantiker, die sich besonders empfänglich zeigten für das dunkle und bedrohliche Geheimnis der leeren Zeit. Sie haben die Langeweile, wie auch sonst das Abgründige, mit literarischem Zauber ausgestattet. Ihre Empfänglichkeit für dieses Thema hatte subjektive und objektive Voraussetzungen. Sie waren subjektiv zu erlebnishungrig, um an der Normalität des Lebens Genüge zu finden, und fühlten sich deshalb gelangweilt. Sie spürten andererseits auch deutlicher die Anzeichen einer objektiven Veränderung: die Entzauberung durch die beginnende Rationalisierung und Mechanisierung der bürgerlichen Lebensverhältnisse. Die Romantiker, die durch die Schule der Empfindsamkeit und des Ich-Kultes gegangen waren, waren also einerseits empfänglich für die Langeweile, weil sie zu viel mit sich selbst und zu wenig mit der Wirklichkeit beschäftigt waren; andererseits waren sie höchst sensibel für die Veränderungen, die sich in der äußeren gesellschaftlichen Wirklichkeit vollzogen. Könnte nicht wirklich eine ganze Nation, schreibt Eichendorff, selbst bei dem größten äußeren Gewerbefleiße von einer inneren Langweiligkeit dieser eigentlichen Heckmutter aller Laster befallen werden?
Bei den Romantikern beginnt die Karriere der Langeweile als großes Thema der Moderne. Sie haben eine gültige literarische Form geschaffen für eine Erfahrung, die noch die unsere ist, weshalb sie hier auch zu Wort kommen. Eine besonders dichte Beschreibung der Langeweile findet sich in Ludwig Tiecks Jugendroman »William Lovell«: Langeweile ist gewiss die Qual der Hölle, denn bis jetzt habe ich keine größere kennengelernt; die Schmerzen des Körpers und der Seele beschäftigen doch den Geist, der Unglückliche bringt doch die Zeit mit Klagen hinweg, und unter dem Gewühl stürmender Ideen verfliegen die Stunden schnell und unbemerkt: aber so wie ich dasitzen und die Nägel betrachten, im Zimmer auf und nieder gehn, um sich wieder hinzusetzen, die Augenbraunen reiben, um sich auf irgend etwas zu besinnen, man weiß selbst nicht worauf; dann wieder einmal aus dem Fenster zu sehen, um sich nachher zur Abwechslung aufs Sofa werfen zu können – ach … nenne mir eine Pein, die diesem Krebse gleichkäme, der nach und nach die Zeit verzehrt, und wo man Minute vor Minute misst, wo die Tage so lang und der Stunden so viel sind, und man dann doch nach einem Monate überrascht ausruft: »Mein Gott, wie flüchtig ist die Zeit! …«
Das ist die Beschreibung einer momentanen Langeweile, die quälend genug ist. In einem späteren Werk, den »Abendgesprächen«, schildert Tieck eine Langeweile, die zäh und beharrlich das ganze Leben durchdringt: Hast Du nie in Deinem Leben einmal recht tüchtige Langeweile empfunden? Aber jene meine ich, die zentnerschwer, die sich bis auf den tiefsten Grund unsers Wesens einsenkt und dort fest sitzen bleibt: nicht jene, die sich mit einem kurzen Seufzer oder einem willkürlichen Auflachen abschütteln lässt, oder verfliegt, indem man nach einem heitern Buch greift: jene felseneingerammte trübe Lebens-Saumseligkeit, die nicht einmal ein Gähnen zulässt, sondern nur über sich selber brütet, ohne etwas auszubrüten, jene Leutseligkeit, so still und öde, wie die meilenweite Leere der Lüneburger Heide, jener Stillstand des Seelen-Perpendikels, gegen den Verdruss, Unruhe, Ungeduld und Widerwärtigkeit noch paradiesische Fühlungen zu nennen sind.
Diese Erfahrung von Langeweile wird, wie bei Pascal und der Acedia-Tradition, als existenzieller Zustand der Sinnferne verstanden, als das Leiden unter der Herrschaft einer Zeit, die nicht als schöpferisch, sondern als entleerend erlebt wird. Die Umstände, die sie hervorrufen, sind eher zweitrangig. Sie sind nur die Gelegenheiten, bei denen sich etwas zeigen kann, was für die schwarze Romantik zur Conditio humana gehört: der innere Abgrund, wo man das Rauschen der Zeit hört, den metaphysischen Tinnitus. Und wenn doch die Umstände eine bedeutendere Rolle spielen, so sind es gesellschaftliche Entwicklungen am Anfang des 19. Jahrhunderts, die als Verflachung empfunden werden. E. T. A. Hoffmann und Joseph von Eichendorff bedauern den Verlust von regionalen Eigentümlichkeiten an ein urbanes Einerlei, und Friedrich Schlegel beobachtet eine gleichmacherische Tendenz infolge der Französischen Revolution.
Eine solche Verflachung erleben wir heute auch, sogar in einem durch die Globalisierung der Geschmäcker, Moden und Geschäfte noch verstärkten Ausmaß. Für jene Langeweile, die von außen kommt, durch Standardisierung und kulturindustrielle Uniformität, gibt es genügend Anlässe, damals und heute, besonders an den Stützpunkten und Sammelstellen der modernen Nomaden, an den Flughäfen, Bahnhöfen, Malls und Einkaufszentren. In diesen Transiträumen des praktischen Nihilismus geben sich die Zeitvertreiber ein flüchtiges Stelldichein, den Horror Vacui hinter sich und die Flachbildschirme der Sehnsucht vor sich. Man kann heute wirklich den Eindruck haben, dass die Innenstädte inzwischen so aussehen wie das Innenleben derer, die sie bewohnen. Die langweilige Verödung im äußeren Städtebild brachten bereits die Romantiker in einen Zusammenhang mit dem ausgedörrten Geist der Geometrie. Nach Tieck zum Beispiel drückt die gerade Linie, weil sie immer den kürzesten Weg geht, die prosaische Grundbasis des Lebens aus. Dagegen treten die krummen Linien, die Arrangements, welche auf die Unerschöpflichkeit des Spielshinweisen, in den Hintergrund. Das Unübersichtliche, auch Dunkle zieht an, wenn es nur Abschweifungen und Ausschweifungen erlaubt, Überraschungen bereithält und eine reizende Verwirrung, wie Joseph von Eichendorff sagt, ermöglicht. Auch deshalb verklärt man die verwinkelte mittelalterliche Stadt und zieht die wilden Gärten dem abgezirkelten französischen Park vor. Das Gerade und Abgezirkelte, auch wenn es äußerlich geräumig sein mag, hat die paradoxe Wirkung, dass es ein Gefühl von Enge hervorruft. Das liegt daran, dass die Regelmäßigkeit im Raum dieselbe Wirkung tut wie die Wiederholung in der Zeit. Es stellt sich der Eindruck von ermattender und zugleich bedrängender Monotonie ein. Der gleichförmig gegliederte Raum entspricht dem Erlebnis des Immergleichen in der Zeit. Beide Male ist die Folge: Langeweile.
Um 1800 war für diejenigen, die viel und hart arbeiten mussten – und das waren die meisten –, Langeweile eine eher unbekannte Erfahrung. Nur die Großen und Reichen, schreibt Montesquieu, würden von Langeweile geplagt. Ähnlich erklärt Rousseau, das Volk langweile sich nicht, weil es ein tätiges Leben führe. Langeweile sei ausschließlich die große Geißel der Reichen, und die gewöhnlichen Leute, die eigentlich etwas Besseres zu tun hätten, müssten jene unterhalten mit kostspieligen Zerstreuungen,damit sie sich nicht zu Tode langweilen. Das ist lange her. Heute müssen nicht nur die wenigen Reichen, sondern die große Menge unterhalten werden. Die Verhältnisse haben sich auch in dieser Hinsicht demokratisiert.
Eine ganze Industrie wird aufgeboten, damit die Leute sich nicht zu Tode langweilen