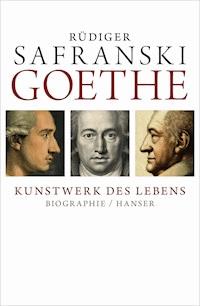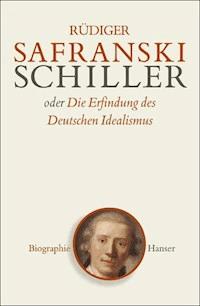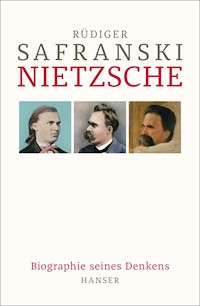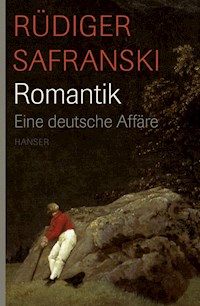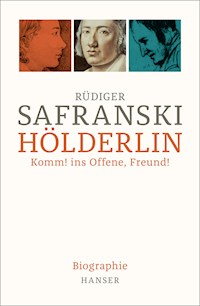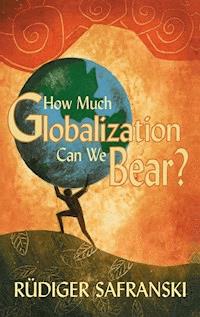Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rüdiger Safranski legt mit seinem großen Buch über Martin Heidegger die Biographie über den wirkungsmächtigsten (und umstrittensten) Philosophen des 20. Jahrhunderts vor. Es ist darüber hinaus auch die Biographie der Epoche, selbst ein Stück Philosophie über den Zusammenhang von Denken und Leben und der Ausdruck eines souveränen Verhältnisses zum philosophischen Erbe Heideggers. Und: endlich kann man Heidegger nicht nur lesen, sondern auch verstehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Hanser E-Book
Rüdiger Safranski
Ein Meister aus Deutschland
Heidegger und seine Zeit
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24659-1
Durchgesehene Ausgabe
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 1994, 2008, 2014
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Inhaltsübersicht
Vorwort
Erstes Kapitel
Geworfenheit. Der Himmel über Meßkirch. Das Schisma am Ort. Schlüsselrolle. Läuterbuben. Dem einzigen Bruder. Da-da-dasein. Die Eltern. Unter der Obhut der Kirche. Konstanz. Die Weltlichen und die Anderen. Am Freiburger Gymnasium. Beinahe ein Jesuit.
Zweites Kapitel
Unter den Antimodernisten. Abraham a Sancta Clara. Der Jenseitswert des Lebens. Die himmlische Logik. Heidegger entdeckt Brentano und Husserl. Das philosophische Erbe des 19. Jahrhunderts. Die Trockenlegung des deutschen Idealismus. Philosophie des Als-ob. Zuflucht bei den Kulturwerten. Das Gelten und das Geld.
Drittes Kapitel
Ölbergstunden. Karriereplanung. Dissertation. Gibt es das Nichts? ›Es kracht‹. Bitten bei den Hochwürden. Jenseits der Lebensphilosophie. Der Einbruch des Lebens in die Philosophie. Diltheys Erleben und Nietzsches Ausleben. Bergsons großer Strom. Max Schelers blühender Garten.
Viertes Kapitel
Kriegsausbruch. Die Ideen von 1914. Heideggers Philosophieren trotz Geschichte. Verflüssigen der Scholastik. Duns Scotus. Habilitation. Kriegsdienst. Die schnelle Karriere mißlingt. Der Männerbund. Heirat.
Fünftes Kapitel
Der Triumph der Phänomenologie. Die offenen Sinne. Die Welt im Kopf. Husserl und seine Gemeinde. Der verrückte Uhrmacher. Arbeit an den Fundamenten. Die Poesie als geheime Sehnsucht der Philosophie. Proust als Phänomenologe. Husserl und Heidegger, Vater und Sohn. Elisabeth Blochmann. Heideggers Lust zu leben und die »wahnsinnigen Zustände‹.
Sechstes Kapitel
Revolutionszeit. Max Weber gegen die Kathederpropheten. Inflationsheilige. Heideggers Katheder. Aus der Frühgeschichte der Seinsfrage. Erleben und Entleben. Es weitet. Kahlschlagphilosophie. Heideggers Dadaismus. Transparenz des Lebens. Das Dunkel des gelebten Augenblicks. Verwandte Geister: Heidegger und der junge Ernst Bloch.
Siebtes Kapitel
Abschied vom Katholizismus. Das ›faktische Leben‹ und das ›Handaufheben gegen Gott‹. Destruktionsarbeiten. Der Gott des Karl Barth. Wie man fallend die Fallgesetze studiert. Beginn der Freundschaft mit Karl Jaspers. Die Ontologie-Vorlesung von 1923. Das Präludium von Sein und Zeit.
Achtes Kapitel
Berufung nach Marburg. Kampfgemeinschaft mit Jaspers. Die Geister von Marburg. Unter den Theologen. Hannah Arendt. Die große Passion. Hannahs Kampf um Sichtbarkeit. Heideggers Sieg im Verborgenen. ›Das Leben liegt rein, einfach und groß vor der Seele‹. Die Entstehung von Sein und Zeit. Der Mutter aufs Totenbett gelegt.
Neuntes Kapitel
Sein und Zeit. Der Prolog im Himmel. Welches Sein? Welcher Sinn? Wo beginnen? Das Dasein als Algenkolonie: alles hängt zusammen. Das In-Sein. Die Angst. Die Sorge geht über den Fluß. Wieviel Eigentlichkeit erträgt der Mensch? Plessners und Gehlens Alternative. Heideggers Moralphilosophie. Das Geschick und die Freiheit. Kollektives Dasein: Gemeinschaft oder Gesellschaft?
Zehntes Kapitel
Die Zeitstimmung: das Warten auf den großen Augenblick. Carl Schmitt, Tillich und andere. Geistesgegenwart. Die Entschlossenheit und das Nichts. Befreiung vom Schulzwang. Beschwörung des Daseins. Die Nachtmesse von Beuron. Andacht und Verwegenheit. Das Böse. Die große Debatte von Davos: Heidegger und Cassirer auf dem Zauberberg. Die Nacht und der Tag.
Elftes Kapitel
Ein heimliches Hauptwerk: die Metaphysik-Vorlesung von 1929/30. Über die Langeweile. Das Geheimnis und sein Schrecken. Heideggers Versuch einer Naturphilosophie. Vom Stein zum Bewußtsein. Die Geschichte einer Eröffnung.
Zwölftes Kapitel
Bilanzen am Ende der Republik. Plessner. Einstürzende ›Überwölbungen‹. Freund und Feind. Heideggers Zweideutigkeit: der Einzelne oder das Volk? Der erste Ruf nach Berlin. Karl Mannheim. Der Streit um die Wissenssoziologie, Rettungsversuch des Liberalismus. Leben mit den ›Unschlichtbarkeiten‹. Heidegger in Platons Höhle. Die Idee der Ermächtigung. Wie das Seiende seiender wird.
Dreizehntes Kapitel
Winter 1931/32 auf der Hütte: ›Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.‹ Die nationalsozialistische Revolution. Kollektiver Ausbruch aus der Höhle. Das Sein ist angekommen. Die Sehnsucht nach unpolitischer Politik. Das Bündnis zwischen Mob und Elite. Hitlers ›wunderbare Hände‹. Heidegger schaltet sich ein. Wahl zum Rektor. Rektoratsrede. Explodierende Altertümer. Der Priester ohne Botschaft.
Vierzehntes Kapitel
Die Rektoratsrede und ihre Wirkungen. Die Universitätsreform. Heidegger ein Antisemit? Heideggers revolutionäre Umtriebe. Ähnlichkeiten mit der 68er-Bewegung. Dem Volke dienen. Das Wissenschaftslager.
Fünfzehntes Kapitel
Der Kurzschluß zwischen Philosophie und Politik. Der Mensch im Singular und im Plural. Das Verschwinden der Verschiedenheit. Keine Ontologie der Differenz. Der zweite Ruf nach Berlin. Heideggers Kampf um die Reinheit der Bewegung. Der Revolutionär als Denunziant.
Sechzehntes Kapitel
Wo sind wir, wenn wir denken? Todtnauberg in Berlin: der Plan einer Dozentenakademie. Abschied vom politischen Umtrieb. ›Ich lese Logik …‹. Heidegger wählt sich seine Helden: von Hitler zu Hölderlin. Die ›Weltverdüsterung‹ und der real existierende Nationalsozialismus.
Siebzehntes Kapitel
Die Zeit des Weltbildes und der totalen Mobilisierung. Heidegger auf dem Rückzug. Vom Ins-Werk-Setzen der Wahrheit. Der feierliche Pragmatismus. Staatsgründer, Künstler, Philosophen. Kritik des Machtdenkens. Nietzsche und Heidegger – wer überwindet wen? Vom Bauen der Flöße auf offener See.
Achtzehntes Kapitel
Heideggers philosophisches Tagebuch: Beiträge zur Philosophie. Heideggers philosophischer Rosenkranz. Die große Leier. Kleine Himmelfahrten. Das wortreiche Schweigen
Neunzehntes Kapitel
Heidegger unter Beobachtung. Der Philosophiekongreß in Paris 1937. Heidegger grollt. Ideen zu einer deutsch-französischen Verständigung. Heidegger und der Krieg. ›Der Planet steht in Flammen‹. Das Denken und das Deutsche.
Zwanzigstes Kapitel
Heidegger beim Volkssturm. Freiburg zerstört. Panische Idylle: Burg Wildenstein. Heidegger vor dem Bereinigungsausschuß. Das Gutachten von Jaspers: ›unfrei, diktatorisch, communikationslos‹. Lehrverbot. Frankreich entdeckt Heidegger. Kojève, Sartre und das Nichts. Heidegger liest Sartre. Verpaßte Begegnung. Besuch beim Erzbischof. Zusammenbruch und Genesung im Winterwald.
Einundzwanzigstes Kapitel
Was tun wir, wenn wir denken? Antwort an Sartre. Der Brief über den Humanismus. Renaissance des Humanismus. Hohe Töne. Befindlichkeiten im Nachkriegsdeutschland. Vom Platzhalter des Nichts zum Hirt des Seins. Heideggers Selbstinterpretation: die Kehre. Kein Bildnis machen, nicht vom Menschen, nicht von Gott.
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Martin Heidegger, Hannah Arendt und Karl Jaspers nach dem Krieg. Eine persönliche und philosophische Beziehungsgeschichte.
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Die andere Öffentlichkeit. Heideggers Technikkritik: Gestell und Gelassenheit. Am Ort der Träume: Heidegger in Griechenland. Die Träume eines Ortes: Die Seminare von Le Thor, Provence. Medard Boss. Zollikoner Seminare: Daseinsanalyse als Therapie. Der Abituriententraum.
Vierundzwanzigstes Kapitel
Kassandrarufe. Adorno und Heidegger. Amorbach und Feldweg. Vom Jargon der Eigentlichkeit zum eigentlichen Jargon der sechziger Jahre. Vom Reden und vom Schweigen über Auschwitz. Das »Spiegel«-Interview. Paul Celan in Freiburg und Todtnauberg.
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Lebensabend. Noch einmal Hannah. Heidegger und Franz Beckenbauer. Das Laub, die Lasten, Abgesänge. Was man nicht vergessen wird. Vom Sinn der Seinsfrage und des Seins: zwei Zen-Geschichten. Die Brücke. Die Tätowierung. Der Uhu. Der Tod. Zurück unter den Himmel von Meßkirch.
Anhang
Siglenverzeichnis
Chronik
Werkregister Martin Heidegger
Sachregister
Namenregister
Literaturverzeichnis
Weiterführende Literatur
»Der Sturm, der durch das Denken Heideggers zieht – wie der, welcher uns nach Jahrtausenden noch aus dem Werke Platons entgegenweht – stammt nicht aus dem Jahrhundert. Er kommt aus dem Uralten, und was er hinterläßt, ist ein Vollendetes, das, wie alles Vollendete, heimfällt zum Uralten.«
Hannah Arendt
»Eine Wahrheit muß das Zeitliche segnen können, wie man früher gesagt hat; sonst bleibt sie weltlos. Die Welt ist so dürr geworden, weil sich so viele hergestellte Gedanken herumtreiben, ortlos und bildlos.«
Erhart Kästner
»Ohne den Menschen wäre das Sein stumm: es wäre da, aber es wäre nicht das Wahre.«
Alexandre Kojève
für Gisela Maria Nicklaus
Ich danke den Freunden, die mir mit ihrer Anteilnahme, Neugier und mit ihren eigenen Erkundungen geholfen haben: Ulrich Boehm, Hans-Peter Hempel, Helmut Lethen, Cees Nooteboom, Peter Sloterdijk, Ulrich Wanner.
Vorwort
Es ist eine lange Geschichte mit Heidegger, mit seinem Leben, seiner Philosophie. Die Leidenschaften und Katastrophen des ganzen Jahrhunderts sind darin.
Philosophisch kommt Heidegger von weither. Mit Heraklit, Platon, Kant ging er um, als seien es seine Zeitgenossen. Er kam ihnen so nahe, daß er das bei ihnen Ungesagte hören und zur Sprache bringen konnte. Bei Heidegger ist noch die ganze wunderbare Metaphysik da, aber im Augenblick ihres Verstummens; man kann auch sagen: im Augenblick, da sie sich für etwas anderes öffnet.
Das Fragen war Heideggers Leidenschaft, nicht das Antworten. Wonach er fragte und suchte, das nannte er – das Sein. Ein philosophisches Leben lang stellte er immer wieder diese eine Frage nach dem Sein. Der Sinn dieser Frage ist kein anderer, als dem Leben das Geheimnis, das in der Moderne zu verschwinden droht, wieder zurückzugeben.
Heidegger begann als katholischer Philosoph. Er nahm die Herausforderung der Moderne an. Er entwickelte die Philosophie eines Daseins, das sich unter einem leeren Himmel und unter der Gewalt einer alles verschlingenden Zeit vorfindet, geworfen und mit der Fähigkeit begabt, das eigene Leben zu entwerfen. Eine Philosophie, die den einzelnen in seiner Freiheit und Verantwortlichkeit anspricht und den Tod ernst nimmt. Die Seinsfrage im Heideggerschen Sinne bedeutet, das Dasein lichten, so wie man die Anker lichtet, um befreit in die offene See hinauszufahren. Es ist eine traurige Ironie der Wirkungsgeschichte, daß Heideggers Seinsfrage diesen befreienden, lichtenden Zug zumeist verloren und das Denken eher eingeschüchtert und verkrampft hat. Es wird darauf ankommen, diese Verkrampfung zu lösen. Dann wird man vielleicht auch frei genug sein, um das Lachen der thrakischen Magd auf manchen verunglückten Tiefsinn dieses philosophischen Genies antworten zu lassen.
Verkrampfungen bewirkt immer noch Heideggers politische Verstrickung. Aus philosophischen Gründen wurde er zeitweilig zum nationalsozialistischen Revolutionär, aber seine Philosophie half ihm auch, sich wieder vom politischen Umtrieb zu befreien. Es war ihm eine Lehre, was er getan hatte. Fortan umkreiste sein Denken auch das Problem der Verführbarkeit des Geistes durch den Willen zur Macht. Heideggers philosophischer Weg führt von der Entschlossenheit über die Metaphysik des großen geschichtlichen Augenblicks schließlich zur Gelassenheit und zu einem Denken des schonenden Umgangs mit der Welt.
Martin Heidegger – ein Meister aus Deutschland.
Er war wirklich ein ›Meister‹ aus der Schule des Mystikers Meister Eckhart. Wie kein anderer hat er in einer nichtreligiösen Zeit den Horizont für religiöse Erfahrung offen gehalten. Er hat ein Denken gefunden, das den Dingen nahe bleibt und vor dem Absturz in die Banalität bewahrt.
Er war wirklich sehr ›deutsch‹, so deutsch wie Thomas Manns Adrian Leverkühn. Heideggers Lebens- und Denkgeschichte ist noch einmal eine Faustus-Geschichte. Zutage tritt das Liebenswerte, Faszinierende und Abgründige eines deutschen Sonderwegs in der Philosophie, der zum europäischen Ereignis werden sollte. Und schließlich: Er hatte durch seinen politischen Umtrieb auch etwas von jenem ›Meister aus Deutschland‹ von dem in Paul Celans Gedicht die Rede ist.
So steht der Name Martin Heideggers für das erregendste Kapitel der Geschichte des deutschen Geistes in diesem Jahrhundert. Man muß davon erzählen, im Guten wie im Bösen und jenseits von Gut und Böse.
Erstes Kapitel
Geworfenheit. Der Himmel über Meßkirch. Das Schisma am Ort. Schlüsselrolle. Läuterbuben. Dem einzigen Bruder. Da-da-dasein. Die Eltern. Unter der Obhut der Kirche. Konstanz. Die Weltlichen und die Anderen. Am Freiburger Gymnasium. Beinahe ein Jesuit.
Im Jahre 1928 schreibt der inzwischen schon berühmte Martin Heidegger an den ehemaligen Präfekten des geistlichen Konvikts in Konstanz, wo er einige Schuljahre verbracht hatte: Vielleicht zeigt die Philosophie am eindringlichsten und nachhaltigsten, wie anfängerhaft der Mensch ist. Philosophieren heißt am Ende nichts anderes als Anfänger sein.
Heideggers Lob des Anfangens ist vieldeutig. Er will ein Meister des Anfangs sein. In den Anfängen der Philosophie in Griechenland suchte er nach der vergangenen Zukunft, und in der Gegenwart wollte er den Punkt entdecken, wo mitten im Leben die Philosophie stets aufs neue entspringt. Solches geschieht in der – Stimmung. Er kritisiert die Philosophie, die vorgibt, sie begänne mit Gedanken. In Wirklichkeit, sagt Heidegger, fängt sie mit einer Stimmung an, mit dem Staunen, der Angst, der Sorge, der Neugier, dem Jubel.
Für Heidegger verbindet die Stimmung das Leben mit dem Denken, und es entbehrt nicht der Ironie, daß er dem Nachspüren des Zusammenhangs zwischen Leben und Denken im eigenen Falle so ablehnend gegenüberstand. Eine Vorlesung über Aristoteles begann er einmal mit dem lapidaren Satz: Er wurde geboren, arbeitete und starb. So wollte Heidegger, daß auch von ihm gesprochen werde, denn das war wohl sein großer Traum: für die Philosophie leben und vielleicht sogar in der eigenen Philosophie verschwinden. Auch das hat mit seiner Stimmung zu tun, die, vielleicht allzuschnell, im Anwesenden das Aufdringliche entdeckt und darum nach dem Verborgenen fahndet. Aufdringlich kann das Leben selbst sein. Heideggers Stimmung läßt ihn sagen: das Dasein sei geworfen und das Sein sei als Last offenbar geworden, denn: Hat je ein Dasein als es selbst frei darüber entschieden, und wird es je darüber entscheiden können, ob es ins ›Dasein‹ kommen will oder nicht? (SuZ, 228).
Heidegger liebte die große Gebärde, weshalb man nie genau weiß, ob er vom Abendland oder von sich spricht, ob nun das Sein überhaupt oder sein Sein zur Debatte steht. Aber wenn der Grundsatz gilt, daß die Philosophie nicht dem Gedanken, sondern der Stimmung entspringt, dann darf man die Gedanken nicht nur im Handgemenge mit den anderen Gedanken, also auf dem Hochplateau der geistigen Tradition ansiedeln. Heidegger hat natürlich an Traditionen angeknüpft, aber aus Gründen, die auf sein Leben zurückführen. Sie erlauben es ihm offenbar nicht, das eigene Zur-Welt-Kommen als Geschenk oder als vielversprechende Ankunft zu erleben. Es muß ein Sturz gewesen sein, so will es seine Stimmung.
Die Welt aber, in die er sich geworfen fühlt, ist nicht die von Meßkirch am Ende des letzten Jahrhunderts, wo er am 26. September 1889 geboren wurde, wo er seine Kindheit erlebte und wohin er stets gerne wieder zurückkehrte. Geworfen fühlte er sich erst, als er aus dieser heimatlichen Welt, die ihn vor den Zumutungen der Modernität schützte, hinausgeworfen wurde. Man sollte nicht vergessen, daß mit der Geburt das Zur-Welt-Kommen noch nicht erledigt ist. In einem Menschenleben sind mehrere Geburten nötig, und es kann geschehen, daß man nie ganz bei der Welt ankommt. Aber bleiben wir zunächst bei der ersten Geburt.
Der Vater, Friedrich Heidegger, ist Küfermeister und Mesner an der katholischen St.-Martins-Kirche von Meßkirch. Er stirbt 1924. Er muß erleben, wie sein Sohn mit dem Katholizismus bricht, aber seinen philosophischen Durchbruch erlebt er nicht. Die Mutter stirbt 1927. Martin Heidegger legt ihr ein Handexemplar der soeben erschienenen Ausgabe von SEIN UND ZEIT aufs Totenbett.
Die Mutter stammt aus dem Nachbardorf Göggingen. Wenn die kalten Winde von den Hochebenen der Schwäbischen Alb herunterkommen, so sagt man in Meßkirch: »Es weht von Göggingen her …« Die mütterlichen Vorfahren lebten dort seit Generationen auf einem stattlichen Anwesen, dem »Lochbauernhof«. Ein Vorfahre, Jakob Kempf, hatte 1662 den Hof zu bäuerlichem Lehen vom Zisterzienserkloster Wald bei Pfullendorf erhalten. Heideggers Großvater konnte ihn 1838 gegen eine Kaufsumme von 3800 Gulden ablösen. Aber geistig blieb man unter der Obhut der Kirche.
Die Vorfahren väterlicherseits waren kleine Bauern und Handwerker. Von Österreich her waren sie im 18. Jahrhundert in die Gegend gekommen. Heimatforscher in Meßkirch haben herausgefunden, daß es weitläufige Verwandtschaftsbeziehungen gibt zu den Mägerles und den Kreutzers. Aus der einen Familie stammt der berühmteste Kanzelredner des 17. Jahrhunderts, Abraham a Sancta Clara, aus der anderen Konradin Kreutzer, der Komponist. Auch mit Conrad Gröber, Martins geistlichem Mentor im Konstanzer Konvikt, später Erzbischof von Freiburg, waren die Heideggers entfernt verwandt.
Meßkirch ist eine Kleinstadt, zwischen Bodensee, Schwäbischer Alb und oberer Donau gelegen. Eine karge, vormals ärmliche Gegend, auf der Grenze zwischen dem Alemannischen und dem Schwäbischen. Das alemannische Naturell ist eher schwerfällig, hintersinnig, auch grüblerisch. Das schwäbische ist heiterer, offener, auch verträumter. Die einen neigen zum Sarkasmus, die anderen zum Pathos. Martin Heidegger hatte von beidem etwas, und es sind Johann Peter Hebel, ein Alemanne, und Friedrich Hölderlin, ein Schwabe, die er sich zu Schutzpatronen erwählte. Für ihn sind beide geprägt von der Region und ragen doch in die große Welt hinein. So hat er auch sich selbst gesehen: der Weite des Himmels sich öffnen und zugleich in das Dunkel der Erde wurzeln (D, 38).
In einer Vorlesung von 1942 interpretiert Heidegger Hölderlins Donau-Hymne »Der Ister«. Dem Vorlesungsmanuskript legte er eine Notiz bei, die dann im Drucktext fehlt: Vielleicht muß Hölderlin, der Dichter, zum bestimmenden Geschick … werden für einen Denkenden, dessen Großvater um dieselbe Zeit der Entstehung der ›Isterhymne‹… im Schafstall einer Meierei geboren wurde, die im oberen Donautal nahe dem Ufer des Stromes unter den Felsen liegt.(zit. O. Pöggeler, Heideggers politisches Selbstverständnis, 41)
Selbstmythisierung? Auf jeden Fall der Versuch, sich eine Herkunft zu geben, aus der man stammen möchte. Der Glanz Hölderlins auf dem Donauhaus, am Fuße von Burg Wildenstein, unterhalb Meßkirchs. Dort lebten die Heideggers im 18. Jahrhundert. Das Haus steht noch, und seine Bewohner berichten, wie der Professor mit der Baskenmütze immer wieder zu Besuch kam.
In der Nähe von Donauhaus und Burg Wildenstein liegt Beuron mit seinem Benediktinerkloster, einstmals ein Chorherrenstift der Augustiner. Diese mönchisch stille Welt mit ihrer großen Bibliothek, den Viehställen und Scheunen zog Martin Heidegger an, auch dann noch, als er sich von der Kirche gelöst hatte. In den zwanziger Jahren verbrachte er während der Semesterferien manches Mal einige Wochen in der Klosterzelle. Zwischen 1945 und 1949, in der Zeit seines Lehrverbotes, war Kloster Beuron der einzige Ort, wo er öffentlich auftrat.
Meßkirch zählte am Ende des 19. Jahrhunderts 2000 Einwohner. Die meisten davon waren in Landwirtschaft und Handwerk beschäftigt. Es gab auch einige Industrie am Ort, eine Brauerei, eine Spulenfabrik, eine Molkerei. In Meßkirch befanden sich die Dienststellen des Amtsbezirks, Gewerbeschulen, ein Telegrafenamt, ein Bahnhof, ein Postamt zweiter Klasse, ein Amtsgericht, Genossenschaftszentralen, Domänen- und Schloßverwaltungen. Meßkirch gehörte zu Baden, was für die geistige Atmosphäre des Städtchens von Bedeutung war.
In Baden gab es seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine kraftvolle liberale Tradition. 1815 wurde eine Repräsentativverfassung erlassen, 1831 die Pressezensur aufgehoben. Baden war eine Hochburg der Revolution von 1848. Hecker und Struve riefen im April des Jahres vom nahen Konstanz aus zur bewaffneten Erhebung auf. Die revolutionären Kontingente sammelten sich bei Donaueschingen; sie wurden geschlagen, ein Jahr später eroberten sie für kurze Zeit die Macht, der Großherzog floh ins Elsaß; nur mit Hilfe der preußischen Truppen konnten die alten Verhältnisse wiederhergestellt werden. In Baden dachte man nicht freundlich über Preußen, und nach 1871 behielt hier das Reichsdeutsche immer einen schlechten preußischen Beigeschmack. Der badische Liberalismus hatte sich schließlich doch mit dem Reich arrangiert, auch weil er einen anderen Gegner gefunden hatte: die katholische Kirche.
Die Kirche hatte seit 1848 den Geist des Liberalismus, den sie sonst heftig bekämpfte, geschickt für die eigenen Interessen genutzt; sie forderte die freie Kirche im freien Staat, Beseitigung der staatlichen Bevormundung in Schulen und Universitäten, freie Besetzung der kirchlichen Pfründe, freie Verwaltung des kirchlichen Vermögens. Man solle Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Konflikt spitzte sich zu, als die Staatsregierung den Erzbischof von Freiburg 1854 verhaften ließ. Schließlich lenkte die Regierung ein, denn die Kirche war offenbar zu stark verwurzelt in den Denk- und Lebensgewohnheiten der Bevölkerung, besonders auf dem Land und in den kleinen Städten. Dieser katholische Populismus im Südwesten war kirchenfromm, aber staatsverdrossen, hierarchisch, aber auf Autonomie pochend gegenüber der staatlichen Macht. Er war antipreußisch, eher regionalistisch als nationalistisch gesinnt, antikapitalistisch, agrarisch, antisemitisch, heimatverbunden, und er war besonders in den unteren sozialen Schichten verwurzelt.
Die Konflikte zwischen Staat und Kirche verschärften sich wieder, als das Konzil in Rom 1870 das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes beschloß. Wenn im Zeitalter des Nationalismus die universelle Herrschaft der Kirche sich nicht wiederherstellen ließ, dann sollte wenigstens die katholische Welt wirkungsvoll abgeschirmt werden gegenüber dem Staat und der säkularisierten Gesellschaft.
Dagegen formierte sich eine Opposition, die sogenannte »altkatholische« Bewegung, die ihre sozialen Wurzeln vor allem im nationalliberalen katholischen Bildungsbürgertum Süddeutschlands hatte. In diesem Milieu wollte man nicht allzu »römisch« werden und das Katholische mit dem Nationalen verbinden. Manche »Altkatholiken« strebten darüber hinaus eine Modernisierung der Kirche insgesamt an: Abschaffung des Zölibats, Einschränkung der Heiligenverehrung, Selbstbestimmung der Gemeinden, Priesterwahl.
Die Bewegung schuf sich eine eigene Kirchenorganisation, wählte einen Bischof, blieb aber zahlenmäßig klein; zu keinem Zeitpunkt hatte sie mehr als 100.000 Mitglieder, obwohl sie bei den Regierungen Unterstützung fand, besonders in Baden, wo die altkatholische Bewegung sich stark entwickelte. Meßkirch war in den siebziger und achtziger Jahren eine ihrer Hochburgen. Zeitweilig war dort fast die Hälfte der Bevölkerung altkatholisch.
Conrad Gröber, ein engagierter Vertreter des römischen Katholizismus, zeichnet ein düsteres Bild der Meßkirchener »Kulturkampfzeit«, die noch in die Kindheit Martins hineinragt: »Wir wissen es aus der eigenen bitteren Erfahrung, wieviel Jugendglück in jenen rauhen Jahren zerstört wurde, wo die reicheren altkatholischen Kinder die ärmeren katholischen Kinder abstießen, ihre Geistlichen und sie mit Übernamen belegten, sie durchprügelten und in Brunnentröge tauchten, um sie wiederzutaufen. Wir wissen leider auch aus der eigenen Erfahrung, wie selbst die altkatholischen Lehrer die Schafe von den Böcken schieden, die katholischen Schüler mit dem Kosenamen ›schwarze Siechen‹ belegten und es handgreiflich fühlen ließen, daß man nicht ungestraft auf römischen Pfaden wandeln dürfe. Sie waren ja alle bis auf einen abgefallen und mußten sich den Altkatholiken anschließen, wenn sie in Meßkirch eine definitive Stelle erhalten wollten. Es hat sich auch viel später noch gezeigt, daß man nur durch Religionswechsel ein Ämtchen in der Ablachstadt erobern könne.« (C. Gröber, Der Altkatholizismus in Meßkirch, 158)
Zu den Standhaften zählte Heideggers Vater. Er blieb bei den »Römischen«, obwohl er zunächst nur Nachteile davon hatte.
Die Regierung hatte den Meßkirchener Altkatholiken ein Mitbenutzungsrecht an der Stadtkirche St. Martin zugesprochen. Für die »Römischen« bedeutete das eine Entweihung des Gotteshauses, und deshalb zogen sie aus. Unweit der Stadtkirche bauten sie 1875 einen alten Fruchtspeicher mit tätiger Hilfe der Beuroner Mönche zu einer »Notkirche« um. Dort war auch die Küferwerkstatt des Mesners Friedrich Heidegger untergebracht, und dort wurde Martin getauft.
Der Gegensatz zwischen den »Römischen« und den Altkatholiken zerriß die Stadtgemeinde in zwei Lager. Die Altkatholiken – das waren die ›besseren Kreise‹, die ›Liberalen‹, die ›Modernen‹. Aus deren Sicht galten die »Römischen« als die Fußkranken des Fortschritts, beschränkte, zurückgebliebene kleine Leute, die am überlebten kirchlichen Brauchtum festhielten. Wenn die »Römischen« zum Frühjahrs- und Herbstsegen auf die Felder hinauszogen, blieben die Altkatholiken zu Hause, und die Kinder aus ihren Familien warfen mit Steinen nach den Monstranzen.
In diesen Konflikten erlebte der kleine Martin zum erstenmal den Gegensatz zwischen Tradition und Moderne. Er erfuhr das Kränkende dieser Modernen. Die Altkatholiken gehörten zu ›denen da oben‹, und die »Römischen«, obwohl in der Mehrheit, mußten sich als Unterlegene fühlen. Um so fester schlossen sie sich in ihrer Gemeinschaft zusammen.
Als gegen Ende des Jahrhunderts die Zahl der Altkatholiken auch in Meßkirch drastisch zurückging und das Kulturkampfklima sich entspannte, erhielten die »Römischen« die Stadtkirche samt Vermögen und Liegenschaften zurück. Die Heideggers konnten wieder ins Mesnerhaus am Kirchplatz einziehen. Am 1. Dezember 1895 besiegelte ein feierlicher Gottesdienst diesen Sieg über die »Abtrünnigen«. Dabei geriet der kleine Martin unverhofft in eine Schlüsselrolle: Dem altkatholischen Mesner war es peinlich, die Kirchenschlüssel seinem Nachfolger zu übergeben, und so steckte er sie einfach dem kleinen Mesnersohn zu, der da gerade auf dem Kirchplatz spielte.
Die Welt der Kindheit – das ist das kleine geduckte Mesnerhaus am Kirchplatz gegenüber der mächtig aufragenden Kirche St. Martin. Der Platz öffnet sich zum Fürstenbergschen Schloß hin, erbaut im 16. Jahrhundert. Die Kinder konnten durchs große Portal in den Innenhof und weiter in den Schloßpark vordringen bis zum Hofgartentor am anderen Ende, wo die freie Landschaft mit dem Feldweg beginnt: Er läuft aus dem Hofgartentor zum Ehnried. Die alten Linden des Schloßgartens schauen ihm über die Mauer nach, mag er um die Osterzeit hell zwischen den aufgehenden Saaten und erwachenden Wiesen leuchten oder um Weihnachten unter Schneewehen hinter dem nächsten Hügel verschwinden (D, 37).
Die »Mesnerbuben«, Martin und sein jüngerer Bruder Fritz, mußten helfen beim kirchlichen Dienst. Sie waren Ministranten, pflückten Blumen für den Kirchenschmuck, versahen Botendienste für den Pfarrer und mußten die Glocken läuten. Sieben Glocken, so erinnert sich Heidegger in VOM GEHEIMNIS DES GLOCKENTURMS, hingen im Turm, jede hatte einen Namen, einen eigenen Klang und eine eigene Zeit. Es gab die Viere für nachmittags um vier, das sogenannte Schrecke-Läuten, das die Schläfer des Städtchens aufschreckte; die Dreie war auch die Sterbeglocke. Die Kinde läutete zur Christenlehre und zu den Rosenkranzandachten, die Zwölfe beendete den Vormittagsunterricht in der Schule, die Klanei war die Glocke, auf die der Stundenhammer schlug, und die mit dem schönsten Klang war die Große; mit ihr wurden am Vorabend und in der Frühe die hohen Festtage eingeläutet. Zwischen Gründonnerstag und Karsamstag schwiegen die Glocken, dann wurde gerätscht. Eine gedrehte Kurbel setzte eine Reihe von Hämmerchen in Bewegung, die auf hartes Holz schlugen. In den vier Ecken des Turms stand eine Rätsche, die Läuterbuben mußten abwechselnd drehen, in alle vier Himmelsrichtungen sollte das herbe Geräusch hinausgehen. Am schönsten aber war es an den Weihnachtsfeiertagen. Gegen halb vier in der Frühe kamen die Läuterbuben ins Mesnerhaus, wo die Mutter den Tisch mit Kuchen und Milchkaffee gedeckt hatte. Nach diesem Frühstück wurden im Hausflur die Laternen angezündet und man ging durch den Schnee und die Winternacht hinüber zur Kirche und hinauf in den dunklen Glockenturm zu den gefrorenen Seilen und eisüberzogenen Klöppeln. Die geheimnisvolle Fuge, schreibt Martin Heidegger, in der sich die kirchlichen Feste, die Vigiltage, und der Gang der Jahreszeiten und die morgendlichen, mittäglichen und abendlichen Stunden jedes Tages ineinanderfugten, so daß immerfort ein Läuten durch die jungen Herzen, Träume, Gebete und Spiele ging – sie ist es wohl, die mit eines der zauberhaftesten und heilsten und währendsten Geheimnisse des Turmes birgt … (D, 65/66).
Es war ein Leben unter der Obhut der Kirche in einem Provinzstädtchen am Anfang des Jahrhunderts. Im FELDWEG erinnert sich Heidegger an die Spiele mit den selbstgeschnitzten Schiffchen im Schulbrunnen: Das Träumerische solcher Fahrten blieb in einem ehemals noch kaum sichtbaren Glanz geborgen, der auf allen Dingen lag. Ihr Reich umgrenzten Auge und Hand der Mutter … Jene Fahrten des Spiels wußten noch nichts von Wanderungen, auf denen alle Ufer zurückbleiben … (D, 38).
Dieser ehemals noch kaum sichtbare Glanz liegt über allen Erinnerungen Heideggers an die Meßkirchener Kindheit, und es ist dabei wohl nicht nur Verklärung im Spiel, denn auch der Bruder Fritz hat jene Jahre ähnlich erlebt. »So genossen die meisten von uns durch alle Lausbubereien hindurch die Wohltat einer seitdem nie mehr erlebten stetigen Schwerelosigkeit.« (zit. A. Müller, Der Scheinwerfer, 11) Der Bruder Fritz blieb sein Leben lang am Ort der Kindheit, hier arbeitete er als Beamter bei der Örtlichen Kreditbank, und hier starb er.
Für die Meßkirchener war Fritz Heidegger ein ›Original‹. Er war hier so populär, daß auch später der weltberühmte Philosoph immer nur als der ›Bruder vom Fritz‹ galt. Fritz Heidegger war ein Stotterer, aber nur wenn er »ernscht« wurde, erzählen sie in Meßkirch, »hot er sei Sach nit rausbrocht«, dann kam bei ihm das Heideggersche ›Dasein‹ als ›Dada-dasein‹ heraus. Er sprach ohne Stocken, wenn er spotten konnte, beispielsweise bei seinen berühmten Fastnachtsreden. Bei dieser Gelegenheit kannte er keine Scheu, in der Hitler-Zeit legte er sich sogar mit ortsbekannten Nazis an, seine Popularität schützte ihn. Fritz hatte keine Universität besucht. Der Bankbeamte nannte sich bisweilen einen »Scheinwerfer«. Für seinen Bruder hat er 30.000 Manuskriptseiten abgetippt und während der Kriegsjahre in einem Banktresor verwahrt. Man würde sie, so sagte er, doch erst mit Verständnis lesen können im 21. Jahrhundert, »wenn die Amerikaner schon längst auf dem Mond einen riesigen Großmarktladen eingerichtet haben«. (zit. L. Braun, Da-da-dasein) Er habe, erzählt er, beim Kollationieren und Überarbeiten der Texte mitgeholfen. Er wollte in einem Satz nicht zwei Gedanken dulden. Du mußt sie auseinanderreißen, habe er dem Bruder gesagt. Durch eine schmale Tür komme nur eins nach dem anderen. In diesem Fall also bevorzugte Fritz die übersichtlichen Verhältnisse, sonst aber konnte es ihm nicht unübersichtlich genug zugehen. Eine seiner Redewendungen war: Sollen die Leute mich doch übersehen, aber sie dürfen mich nicht für übersichtlich halten! Er schätzte an der Philosophie ihre närrischen Seiten und bedauerte es, wenn Philosophen sich selbst allzu ernst nahmen. Wer sich den Sinn fürs Närrische bewahrt, kommt mit diesem Dada-dasein ganz gut zurecht, pflegte er zu sagen: »In uns, im innersten Herzwinkel lebt etwas, das alle Not überdauert: die Freude, der letzte Rest jener ursprünglichen Narrheit, die wir alle kaum noch ahnen.« (zit. A. Müller, Der Scheinwerfer, 32) Fritz Heidegger besaß jene Selbstironie, die seinem Bruder Martin fehlte. Die eigene Geburt, er kam fünf Jahre nach Martin zur Welt, kommentierte er so: »Der Lebens-Schmerz fängt bei dem einen heute und bei dem anderen morgen an. Bei dem kleinen Erdenwurm in der Schloßstraße fing er am Aschermittwoch an: Erbrechen, Gerben, fürchterliches Abweichen. Wie es eben am Aschermittwoch üblich ist.« (zit. A. Müller, Der Scheinwerfer, 9)
Martin Heidegger wird seinem Bruder in Dankbarkeit ein Buch widmen. Dem einzigen Bruder, heißt es da mit schöner Doppeldeutigkeit.
Die Eltern waren gläubig, aber ohne Fanatismus und rigiden Konfessionalismus, berichtet Fritz Heidegger. Das katholische Leben war ihnen so in Fleisch und Blut übergegangen, daß sie ihren Glauben gar nicht zu verteidigen brauchten oder gegen andere durchsetzen mußten. Um so fassungsloser waren sie dann, als ihr Sohn Martin vom ›rechten Weg‹ abkam, der ihnen einfach der selbstverständlichste war.
Die Mutter war eine heitere Frau. »Oft sagte sie«, (zit. ebenda, 11) berichtet Fritz Heidegger, »das Leben sei so schön eingerichtet, daß man sich immer auf etwas freuen dürfe.« Sie war resolut, manchmal stolz, sie versteckte nicht das Selbstbewußtsein ihrer gutbäuerlichen Herkunft. Sie galt als arbeitsam, man kannte sie fast nur mit Schürze und dem »Kopftüchle«. Der Vater war ein in sich gekehrter Mann, der tagelang schweigen konnte, unauffällig, fleißig, rechtschaffen. Ein Mensch, zu dem den Söhnen später nicht viel eingefallen ist.
Bei den Heideggers ging es nicht üppig zu, aber auch nicht ärmlich. 2000 Mark Grundvermögen und 960 Mark Einkommensteuerveranschlagung (im Jahr 1903) bedeutete unterer Mittelstand. Eine Familie konnte davon leben, aber es reichte nicht aus, um aus eigenen Mitteln die Kinder auf die teuren weiterführenden Schulen zu schicken. Hier nun sprang die Kirche ein. Es war die übliche Praxis der kirchlichen Begabtenförderung und zugleich der Rekrutierung des Priesternachwuchses vor allem in den ländlichen Regionen.
Der Stadtpfarrer Camillo Brandhuber schlug den Eltern vor, den begabten Sohn nach Abschluß der Meßkirchener Bürgerschule (ein Gymnasium gab es nicht am Ort) ins katholische Konvikt Konstanz zu schicken, ein Internat für den Priesternachwuchs. Brandhuber hatte seinem Zögling kostenlosen Lateinunterricht erteilt und damit den Übergang in ein Gymnasium möglich gemacht. Der Präfekt des Konstanzer Konvikts war Conrad Gröber. Brandhuber und Gröber hatten für Martin ein Stipendium aus einer Lokalstiftung besorgt. Die Eltern waren stolz, daß die Kirche den Sohn in ihre Obhut nahm. Für Martin aber begann die Zeit der finanziellen Abhängigkeit von der Kirche. Nun war er zu Dank verpflichtet.
Dreizehn Jahre lang, bis 1916 sollte diese finanzielle Abhängigkeit fortbestehen. Nach dem Weißschen Stipendium für die Konstanzer Konviktszeit (1903-06) erhielt Martin für die letzten Gymnasialjahre und die ersten vier theologischen Semester in Freiburg bis 1911 das an die Priesterausbildung gebundene Eliner-Stipendium. Die Studienjahre zwischen 1913 und 1916 wurden finanziert aus der Schätzlerschen Dotation, deren Stiftungszweck den Stipendiaten auf die Bewahrung der Philosophie und Theologie des hl. Thomas von Aquin festlegte. Heidegger blieb über den Zeitpunkt hinaus, da er sich innerlich bereits von der Kirche zu lösen begann, von der katholischen Welt abhängig. Er mußte sich anpassen, und das beschämte ihn – eine Kränkung, die er dem System des Katholizismus, wie er es nannte, nicht verzeihen konnte. Dieses institutionelle System mit seiner Interessenpolitik im öffentlichen Leben wird ihm so verleidet, daß er später mit der Nazibewegung auch deshalb sympathisiert, weil sie antiklerikal auftritt.
Im Jahr 1903 bezieht Heidegger das Konstanzer Konvikt und das dortige Gymnasium.
Meßkirch war noch eine geschlossene katholische Welt, auch wenn die Konflikte mit den Altkatholiken noch nachwirkten. Im fünfzig Kilometer entfernten Konstanz aber ist die moderne Zeit schon deutlicher zu spüren.
Die ehemalige Reichsstadt war konfessionell gemischt. Die große Geschichte der Stadt lebte noch fort in den Baudenkmälern. Da gab es das alte Kaufhaus, wo im 15. Jahrhundert das Konzil getagt, und das Haus, wo Hus auf seinen Prozeß gewartet hatte. Das Dominikanerkloster, wo der ›Ketzer‹ gefangen saß, war inzwischen zu einer Hotelanlage umgebaut worden, das sogenannte »Inselhotel«, mit seinen Versammlungssälen ein Mittelpunkt des geistigen Lebens der Stadt. Hier fanden Konzerte und Vortragsveranstaltungen statt, die von den Gymnasiasten gerne besucht wurden. Hier huldigte man dem ›modernen Geist‹. Gesprochen wurde über Nietzsche, Ibsen, den Atheismus, über Hartmanns »Philosophie des Unbewußten«, Vaihingers »Philosophie des Als-ob«, sogar über Psychoanalyse und Traumdeutung. In Konstanz wehte eben ein fortschrittlicher Geist, die Stadt war seit Heckers Tagen von 1848 eine Hochburg des badischen Liberalismus geblieben. Günther Dehn, der zu Heideggers Zeiten das Konstanzer Gymnasium besuchte, erzählt in seiner Lebenserinnerung von dem wohligen Schauder, den er und seine Klassenkameraden empfunden hätten, als sie hörten, der Bademeister der Männerbadeanstalt sei ein alter Achtundvierziger, der noch auf der Barrikade gekämpft habe. Die auflagenstärkste Zeitung am Ort, die »Abendzeitung«, war demokratisch, antiklerikal und auch vorsichtig antipreußisch, obwohl oder gerade weil in der Stadt ein badisches Infanterieregiment stand und Offiziere aus dem ganzen Reich in der Stadt am Bodensee gerne ihren Urlaub verbrachten.
Das Konvikt, Studienhaus St. Konrad oder auch einfach nur »Konradihaus« genannt, war in den Jahren des Kulturkampfes geschlossen und erst 1888 wieder geöffnet worden. Das Gymnasium, ein ehemaliges Jesuitenkolleg, stand unter staatlicher Aufsicht. Die Konviktler besuchten also eine ›weltliche‹ Schule, in der ein gemäßigt liberaler, antikonfessioneller Bildungshumanismus vorherrschte. Da gab es den Lehrer für neuere Sprachen, Pacius, ein Demokrat, Freidenker und Pazifist, der bei den Schülern sehr beliebt war, weil er so starke Aussprüche tat. Die Konviktler, bei denen als angehende Theologen Aristoteles hoch im Kurs zu stehen hatte, ärgerte er mit der Behauptung: »Aristoteles, was war er schon, verglichen mit Platon, diesem Riesengeist«, (G. Dehn, Die alte Zeit, die vorigen Jahre. Lebenserinnerungen, 37) aber auch die Protestanten wurden nicht geschont: »Astrologie«, pflegte er zu sagen, »nach meiner Forschung stammt dieser Aberglaube von Melanchthon.« Für den Deutsch- und Griechischlehrer Otto Kimmig war Lessings »Nathan der Weise« der einzige heilige Text, den er akzeptierte. Der Einfluß dieser Schulmänner, von denen auch Martin Heidegger unterrichtet wurde, muß beträchtlich gewesen sein: »Wie sehr ich durch diese beiden Lehrer aus der christlichen Gedankenwelt, die für sie gar nicht existierte, sozusagen unversehens herausgeführt wurde, ist mir erst später klar geworden«, (ebenda, 38) so das Resümee von Günther Dehn.
Die Konviktler im Konradihaus wurden, so gut es ging, gegen die Freigeisterei in der Schule immunisiert. Sie bekamen apologetischen Schliff, wurden präpariert für die Händel mit den ›Weltlichen‹. Reihum hatten sie Vorträge auszuarbeiten, in denen sie sich gewappnet zeigen mußten. Da ging es beispielsweise um die Frage, ob der Mensch tatsächlich aus eigener Kraft zur Humanität gelangen könne und wo die Grenzen der Toleranz lägen; über Freiheit und Erbsünde wurde gesprochen und das Problem erörtert, ob Goethes Iphigenie eine heidnisch-christliche oder eine christlich-deutsche oder eine nur heidnische Gestalt sei. Von solchen Streitfragen durfte man sich erholen bei den heimatkundlichen Themen, der Geschichte des Klosters Reichenau, den Sitten und Gebräuchen des Hegau, den urzeitlichen Pfahlbürgern am Bodensee. Manchmal ging es bei den Konviktlern auch jugendbewegt zu: an sonnigen Tagen wanderte man mit Klampfe und Gesang hinaus ins Grüne, auf die Mainau, zum Grafengarten in Bodman und zu den Weinbergen am Untersee. Man übte Dialektstücke ein, musizierte, und wenn die weltlichen Mitschüler mit ihren Besuchen bei den Künstlerinnen vom Theater renommierten, konnten die Konviktler von ihrem letzten Krippenspiel berichten. ›Mucker‹ allerdings waren die Konviktler nicht: sie wählten, wie sollte es im Badischen anders sein, ein Repräsentativorgan, das beratende Stimme bei der Leitung des Hauses hatte, und gaben eine Zeitung heraus, die in regelmäßigen Abständen daran erinnerte, daß Baden als erstes deutsches Land die Pressezensur aufgehoben habe.
Die Konviktler lebten unter sorgfältiger, aber offenbar nicht unduldsamer Aufsicht. Martin Heidegger blickte jedenfalls ohne Zorn auf seine Konstanzer Jahre zurück. Dem damaligen geistlichen Präfekten für die unteren Klassen, Matthäus Lang, schrieb er 1928: Ich denke gern und dankbar an die Anfänge meines Studiums im Konradihaus zurück und spüre immer deutlicher, wie stark alle meine Versuche mit dem heimatlichen Boden verwachsen sind. Es ist mir noch deutlich in Erinnerung, wie ich zu Ihnen als damaligem neuen Präfekten ein Vertrauen faßte, das geblieben ist und mir den Aufenthalt im Hause zur Freude machte.(zit. H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 55)
Weniger erfreulich war für die Konviktler der Umgang mit ihren ›freien‹ Mitschülern am Gymnasium, besonders wenn diese aus den besseren Kreisen stammten. Diese Söhne von Advokaten, Beamten und Kaufleuten fühlten sich den »Kapaunern«, wie sie genannt wurden, überlegen. Die Konviktler kamen ja zumeist vom Lande und, wie auch Martin Heidegger, aus bescheidenen oder gar ärmlichen Verhältnissen. Günther Dehn, Sohn eines Oberpostdirektors, erinnert sich: »Wir haben die ›Kapauner‹ immer etwas von oben herab behandelt. Sie waren schlecht gekleidet und, wie wir meinten, auch nicht recht gewaschen. Wir dünkten uns etwas Besseres. Das hinderte uns aber nicht daran, sie gründlich auszubeuten. Sie wurden dazu angehalten, ihre Hausarbeiten aufs sorgfältigste zu erledigen. So mußten sie denn in der Pause uns vorübersetzen, was sie immer willig taten.« (G. Dehn, Die alte Zeit, die vorigen Jahre. Lebenserinnerungen, 39)
Die Konviktler blieben unter sich, so konnten sie sich besser behaupten – eine Gemeinschaft, die von den anderen ein wenig belächelt wurde. Von manchen Vergnügungen ihrer ›weltlichen‹ Mitschüler blieben sie ausgeschlossen, es fehlte an Taschengeld, oder es gab einschlägige Verbote. Sie blieben Zaungäste, wenn die Fastnacht drei Tage lang in den winkligen Straßen und in den Kneipen der Stadt tobte und die Schüler ihre eigene närrische Zunft bildeten; wenn im Sommer die fremden Urlauber in die Stadt kamen, die bunt bewimpelten Vergnügungsschiffe nach Meersburg hinausfuhren und abends eine torkelnde Menschenmenge zurückbrachten, die singend und johlend durch die Altstadtgassen zog, die Gymnasiasten mit ihren bunten Mützen immer dabei. Anderntags ging das Renommieren los, da wurde in den Unterrichtspausen von Erlebnissen und Eroberungen erzählt, daß es den Konviktlern in den Ohren klang. In der Zeit der Weinlese gab es überall den leicht berauschenden Sauser. In bestimmten Lokalen durften die Gymnasiasten bis zehn Uhr abends verkehren. Dort trafen sie ihre Lehrer beim Schoppen Wein, eine gute Gelegenheit, um zu fraternisieren, Intimitäten und Souveränitätsgewinne, die den Konviktlern versagt blieben.
Sie gehörten eben doch zu einer anderen Welt, und man ließ es sie auch spüren. Sie mußten gegen das Gefühl der Unterlegenheit ankämpfen. Dabei half der Trotz: die Ausgeschlossenen konnten sich ja auch als die Auserwählten fühlen.
Im Spannungsverhältnis zwischen Konvikt und dem munteren Stadtleben draußen, zwischen katholischer Welt und bürgerlich-liberalem Milieu könnte sich schon beim Schüler Martin Heidegger die Vorstellung jener beiden Welten gebildet haben: hier die strenge, schwere, beharrliche, langsame Welt und dort die schnellebige, oberflächliche, den Augenblicksreizen hingegebene; hier die Mühe, dort die bloße Geschäftigkeit; hier wird gewurzelt, dort geht es haltlos zu; die einen machen es sich schwer, die andern suchen den bequemsten Weg; die einen sind tiefsinnig, die anderen leichtsinnig; die einen bleiben dem Eigenen treu, die anderen verlieren sich in der Zerstreuung.
Dieses Schema wird später unter den Begriffen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit in Heideggers Philosophie Karriere machen.
Im Herbst 1906 wechselte Martin Heidegger vom Konstanzer Konradihaus zum erzbischöflichen Gymnasialkonvikt St. Georg in Freiburg, wo er das angesehene Bertoldgymnasium besuchte. Das Stipendium aus der Meßkirchener Lokalstiftung deckte nicht mehr die Internatskosten für Konstanz. Die rührigen Mentoren des Mesnersohnes, Conrad Gröber und Camillo Brandhuber, hatten eine andere Finanzquelle aufgetan: das Eliner-Stipendium. Es war im 16. Jahrhundert gestiftet worden von Christoph Eliner, einem Theologen aus Meßkirch. Theologiekandidaten aus dem Ort sollten gefördert werden, und vorgeschrieben war der Besuch des Gymnasiums und der Universität in Freiburg.
Der Wechsel von Konstanz nach Freiburg kam einer Auszeichnung gleich. Ohne Groll konnte Martin von Konstanz scheiden, das er stets in guter Erinnerung behielt. Auch noch in späteren Jahren besuchte er die Treffen der ehemaligen Klassenkameraden. Zum Konvikt in Freiburg entwickelt er nicht solche Gefühle der Anhänglichkeit. Da er fast sein ganzes Leben in dieser Stadt verbringen wird, muß er Distanzen schaffen. Hier wird er sich abkehren vom Katholizismus, der in Freiburg besonders mächtige Schatten wirft: das Münster, in der Hochgotik vollendet, überragt die Stadt. Es liegt wie ein gewaltiges Schiff am Fuße der Bergketten des Schwarzwaldes, als sei es im Begriff, in die Bucht des Breisgaus hinauszufahren.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war die dicht um das Münster gruppierte Altstadt noch fast vollständig erhalten. Es gab noch die zahlreichen Gassen, die sternförmig auf den Münsterplatz zuliefen, manche von kleinen Kanälen gesäumt. In der Nachbarschaft der klerikalen Herrensitze waren die Konviktler untergebracht.
Als der junge Martin Heidegger nach Freiburg kam, bot diese Stadt fast immer noch jenen Anblick, den Sulpiz Boisseré ein Jahrhundert zuvor in einem Brief an Goethe so geschildert hatte: »Von Freiburg hätte ich Dir ein ganzes Buch zu schreiben, das ist ein Ort aller Orte, alles Alte so schön mit Liebe erhalten, eine herrliche Lage, in jeder Gasse ein kristallheller Bach, in jeder ein alter Springbrunnen,… rundherum Weinwuchs; alle Wälle, ehemalige Festungswerke, mit Reben bepflanzt.« (zit. W. Kiefer, Schwäbisches und alemannisches Land, 324)
Martin war ein strebsamer Schüler des Bertoldgymnasiums. Sein intellektueller Ehrgeiz suchte noch das kirchliche Betätigungsfeld: er wollte nach dem Abitur in den Jesuitenorden eintreten. Seine Lehrer unterstützten dieses Vorhaben. Der Rektor des Gymnasialkonvikts schreibt im Abschlußzeugnis von 1909: »Seine Begabung sowie sein Fleiß und seine sittliche Haltung sind gut. Sein Charakter hatte schon eine gewisse Reife, und auch in seinem Studium war er selbständig, betrieb sogar auf Kosten anderer Fächer zuweilen etwas zu viel deutsche Literatur, in welcher er große Belesenheit zeigt. – In der Wahl des theologischen Berufs sicher und zum Ordensleben geneigt, wird er sich wahrscheinlich um Aufnahme in die Gesellschaft Jesu melden.« (zit. H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 59)
Anders als manche seiner Mitschüler fühlte sich der junge Martin Heidegger nicht hingezogen zu den ›modernen‹ geistigen Tendenzen des Zeitalters. Die jungen Autoren des Naturalismus, Symbolismus oder des Jugendstils kommen in seinem persönlichen Lektürekanon noch nicht vor. Seine geistigen Exerzitien sind von strengerer Art. Über die Anregungen, die er in der Schule empfing, schreibt Heidegger in seinem für die Habilitation 1915 verfaßten LEBENSLAUF:Als in der Obersekunda der mathematische Unterricht vom bloßen Aufgabenlösen mehr in theoretische Bahnen einbog, wurde meine bloße Vorliebe zu dieser Disziplin zu einem wirklichen sachlichen Interesse, das sich nun auch auf die Physik erstreckte. Dazu kamen Anregungen aus der Religionsstunde, die mir eine ausgedehnte Lektüre über die biologische Entwicklungslehre nahelegten. In der Oberprima waren es vor allem die Platostunden …, die mich mehr bewußt, wenn auch noch nicht mit theoretischer Strenge in philosophische Probleme einführten.(zit. ebenda, 86)
Ausgerechnet der Religionsunterricht erweckt sein Interesse an der damals besonders religionsfeindlichen biologischen Entwicklungslehre. Es lockt ihn offenbar in geistig gefährlichere Gegenden hinaus, wo der Glaube von Meßkirch einen schweren Stand hat. Ihm ist vor dem geistigen Abenteuer nicht bange, denn noch spürt er Grund unter den Füßen, Glaubensgrund. Und so tritt er am 30. September 1909 in das Noviziat der Gesellschaft Jesu in Tisis bei Feldkirch (Vorarlberg) ein. Zwei Wochen später, nach Ablauf der Probezeit, wird er bereits entlassen. Offenbar habe Heidegger, so berichtet Hugo Ott, über Herzbeschwerden geklagt und sei deshalb aus gesundheitlichen Gründen wieder nach Hause geschickt worden. Diese Beschwerden werden sich zwei Jahre später wiederholen und dann den Abbruch der Priesterausbildung veranlassen. Vielleicht hatte sich damals das Herz gewehrt gegen die Pläne des Kopfes.
Zweites Kapitel
Unter den Antimodernisten. Abraham a Sancta Clara. Der Jenseitswert des Lebens. Die himmlische Logik. Heidegger entdeckt Brentano und Husserl. Das philosophische Erbe des 19. Jahrhunderts. Die Trockenlegung des deutschen Idealismus. Philosophie des Als-ob. Zuflucht bei den Kulturwerten. Das Gelten und das Geld.
Noch ist Martin Heidegger unbeirrt: von den Jesuiten abgewiesen, bewirbt er sich um Aufnahme unter die Kandidaten des Theologischen Konviktes in Freiburg. Das mag auch finanzielle Gründe gehabt haben. Die Eltern können ihm ein Studium nicht bezahlen, und das Eliner-Stipendium, das er seit der Freiburger Gymnasialzeit bezieht, ist an die Theologenausbildung gebunden.
Zum Wintersemester 1909 beginnt er das Studium der Theologie. Im LEBENSLAUF von 1915 schreibt er: Die damals vorgeschriebenen Vorlesungen befriedigten mich wenig, sodaß ich mich auf das Selbststudium der scholastischen Lehrbücher verlegte. Sie verschafften mir eine gewisse formale logische Schulung, gaben mir aber in philosophischer Hinsicht nicht das, was ich suchte.(H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 86)
Nur einen Freiburger Theologen hebt er besonders hervor und wird ihn auch später stets als seinen Lehrer bezeichnen: Carl Braig. Als Oberprimaner bereits hatte er dessen Kompendium »Vom Sein. Abriß der Ontologie« (1896) studiert und sich dort mit einigen Grundbegriffen der ontologischen Tradition vertraut gemacht. Durch ihn ist er erstmals zur Auseinandersetzung mit Hegel und Schelling angeregt worden; bei Spaziergängen, auf denen er ihn begleiten durfte, lernte er Braigs eindringliche Art (Z, 82) des Denkens kennen. Braig habe es verstanden, Gedanken lebendige Gegenwart werden zu lassen, berichtet Heidegger noch fünfzig Jahre später.
Carl Braig war ein Theologe des Antimodernismus.
Seit der Enzyklika »Pascendi dominici gregis« von 1907, die dem »Modernismus« den Kampf angesagt hatte – »De falsis doctrinis modernistarum« –, waren »Modernismus« und »Antimodernismus« zu Feldstandarten einer Geisterschlacht nicht nur im Katholizismus geworden. Den Antimodernisten ging es nicht einfach darum, die kirchlichen Dogmen (z.B. die »Unbefleckte Empfängnis«) und die Prinzipien der klerikalen Hierarchie (z.B. die Unfehlbarkeit des Papstes) zu verteidigen. So haben es ihre Gegner gerne dargestellt und deshalb im Antimodernismus nichts anderes gesehen als eine gefährliche oder gar lächerliche Verschwörung von Dunkelmännern gegen den wissenschaftlichen Geist der Zeit, gegen Aufklärung, Humanismus und Fortschrittsideen jeglicher Art.
Doch daß man Antimodernist sein konnte, ohne zum Obskuranten werden zu müssen, zeigt das Beispiel Carl Braig – ein scharfsinniger Kopf, der die unreflektierten Glaubensvoraussetzungen in den verschiedenen Spielarten der modernen Wissenschaftlichkeit aufdeckte; was sich glaubenslos und voraussetzungslos dünkte, das wollte er aus seinem »dogmatischen Schlummer« aufwecken. Die sogenannten Agnostiker, sagte er, haben auch einen Glauben, allerdings einen besonders primitiven und hausbackenen: den Glauben an den Fortschritt, an die Wissenschaft, an die biologische Evolution, die es angeblich so gut mit uns meint, an ökonomische und historische Gesetze … Der Modernismus sei, so Braig, »geblendet für alles, was nicht sein Selbst ist oder nicht seinem Selbst dient«, (C. Braig, Was soll die Gebildete von dem Modernismus wissen?, 37) die Autonomie des Subjektes sei zu einem selbstgezimmerten Gefängnis geworden. Braig kritisiert an der modernen Zivilisation die mangelnde Ehrfurcht vor dem unausschöpflichen Geheimnis einer Wirklichkeit, deren Teil wir sind und die uns umgreift. Wenn der Mensch sich anmaßend in den Mittelpunkt stellt, so bleibt ihm am Ende nur noch ein pragmatisches Verhältnis zur Wahrheit: ›Wahr‹ ist, was uns nützt und womit wir praktischen Erfolg haben. Dagegen nun Braig: »Die geschichtliche Wahrheit, wie alle Wahrheit – am siegreichsten leuchtet hier die mathematische Wahrheit auf, die strengste Form der ewigen Wahrheit – ist vor dem subjektiven Ich und ohne dasselbe … So wie das Ich der Vernunft die Vernünftigkeit der Dinge insgesamt ansieht, so sind sie nicht in der Wahrheit … und kein Kant … wird das Gesetz abändern, das dem Menschen gebietet, sich nach den Dingen zu richten.« (ebenda)
Tatsächlich will Braig hinter Kant zurückgehen, aber mit Hegel, der gegen den allzu vorsichtigen Kant eingewandt hatte, daß die Furcht zu irren selbst der Irrtum sei. Braig ermuntert dazu, die transzendentalen Grenzen zu überschreiten: Ist es denn ausgemacht, daß nur wir die Welt entdecken, warum sollte es nicht die Welt sein, die sich uns entdeckt? Erkennen wir nicht vielleicht nur deshalb, weil wir erkannt sind? Wir können Gott denken, warum sollten wir dann nicht die Gedanken Gottes sein? Bisweilen recht grobianisch zerschlägt Braig das Spiegelkabinett, in dem er den modernen Menschen gefangen sieht. Braig plädiert offen für einen vormodern anmutenden Realismus, spirituell und empirisch. Er begründet ihn mit dem Hinweis, daß wir, weil wir von Grenzen wissen, schon über sie hinaus sind. Indem wir das Erkennen erkennen und das Wahrnehmen wahrnehmen, bewegen wir uns bereits im Raum des absolut Wirklichen. Wir müssen uns, sagt Braig, vom Absolutismus des Subjekts lösen, um frei zu werden für die Wirklichkeiten des Absoluten.
Auf diesem Kampfboden des Modernismusstreits hatte der junge Martin Heidegger seinen ersten publizistischen Auftritt. Er ist inzwischen Mitglied im »Gralbund«, einer strikt antimodernistischen Gruppierung der katholischen Jugendbewegung, deren geistiger Führer der Wiener Richard von Kralik war, ein Eiferer für die Wiederherstellung des reinen katholischen Glaubens und des alten römisch-katholischen Weltreichs deutscher Nation. Habsburg, nicht Preußen, sollte dessen Mittelpunkt sein. Es ging also auch um eine politische Mitteleuropa-Konzeption. In diesen Kreisen träumte man von dem romantischen Mittelalter eines Novalis und vertraute auf das Stiftersche »sanfte Gesetz« des treu bewahrten Herkommens. Man war aber in diesen Kreisen auch bereit, solches Herkommen außerordentlich robust gegen die modernen Zumutungen und Verführungen zu verteidigen. Gelegenheit dazu bot sich für den jungen Martin Heidegger anläßlich der Feierlichkeiten bei der Einweihung des Denkmals für Abraham a Sancta Clara im August 1910 in Kreenhainstetten, einer kleinen Nachbargemeinde von Meßkirch.
Der Meßkirchener Lokalpatriotismus hatte stets das Andenken an den berühmten, in Kreenhainstetten 1644 geborenen und 1709 in Wien hochgeehrt gestorbenen Hofprediger Abraham a Sancta Clara gepflegt, mit Artikeln in der Lokalpresse und mit kleinen Feiern zu den runden Geburtstagen. Seit Anfang des Jahrhunderts aber war in diese gemütvolle und heimatverbundene Traditionspflege ein scharfer, polemischideologischer Zug hineingekommen. Die süddeutschen »Antimodernisten« hatten sich Abraham a Sancta Clara zur Leitfigur erkoren. Auf ihn beriefen sie sich in ihren Polemiken gegen die liberale Strömung des Katholizismus. Bei dem berühmten Augustinermönch konnte man kräftige Worte finden gegen das genußsüchtige, verderbte Stadtleben, gegen geistigen Hochmut, der sich nicht mehr vor den geoffenbarten Lehren der Kirche beugt, gegen die Verschwendungssucht der Reichen, aber auch gegen die sogenannte Raffgier der »Zinsjuden«. Dieser Prediger hatte die Partei der kleinen und armen Leute ergriffen, hatte sich stolz zu seiner niederen Herkunft bekannt. Nicht jeder, der unter einem Strohdach geboren werde, habe Stroh im Kopf, so lautete einer seiner häufig zitierten Aussprüche. Abraham a Sancta Clara war christlich-sozial, volkstümlich, derb, fromm, aber nicht bigott, heimatverbunden und auch antisemitisch – genau die richtige Mischung für die Antimodernisten.
Die Denkmalenthüllung an diesem 16. August 1910 war ein großes Volksfest. Martin Heidegger war von Meßkirch herübergekommen.
Das Dorf hatte sich mit Blumen geschmückt, Transparente mit Aussprüchen des Predigers hingen aus den Fenstern und waren über die Dorfstraße gespannt. Ein Festzug setzte sich in Bewegung, vorneweg berittene Herolde in historischen Kostümen der Zeit Abraham a Sancta Claras; die Mönche aus Beuron, geistliche und weltliche Würdenträger, die Schuljugend mit bunten Fähnchen, die Mädchen im Blumenschmuck, die Landleute in ihrer Tracht; eine Musikkapelle spielte, Reden wurden gehalten, Gedichte und Sprüche Abrahams von den Schülern der Meßkirchener Bürgerschule vorgetragen.
Von diesem Ereignis berichtete der Artikel, den Martin Heidegger für die in München erscheinende katholisch-konservative Wochenzeitschrift »Allgemeine Rundschau« schrieb, ein Text, den Hermann Heidegger für wert befand, in die Werkausgabe aufgenommen zu werden.
Der naturhafte, frischgesunde, zuweilen grobkörnige Akzent gibt diesem Ereignis sein spezifisches Gepräge. Das anspruchslose Dorf Kreenhainstetten mit seinen zähen, selbstbewußten, eigenbrödlerischen Bewohnern liegt verschlafen in einer niederen Talmulde. Selbst der Kirchturm ist ein Sonderling. Nicht wie seine Brüder schaut er frei ins Land, er muß sich bei seiner Schwerfälligkeit zwischen den schwarzroten Dächern vergraben … So schlicht, klar und wahr gestaltet sich die Enthüllungsfeier (D, 1).
Man darf nicht vergessen: Als Martin Heidegger diese Sätze schreibt, hat er schon städtische Luft geschnuppert, in Konstanz und seit 1906 in Freiburg. Er weiß, was ihn von denen unterscheidet, die sich selbstbewußt und geschickt im bürgerlichen Milieu bewegen können, modisch gekleidet, versiert in den Fragen der neuesten Literatur, Kunst und Philosophie. Auf den Unterschied zwischen der eigenen Welt, der von Meßkirch und Kreenhainstetten, und der Welt dort draußen – worin sich schon der Unterschied zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit andeutet – hat es Heidegger abgesehen. Und so kann man auch in den Sätzen über die Denkmalenthüllung eine Art Selbstporträt des Autors finden. Der Kirchturm ist ein Sonderling, aber auch er ist es. Die anderen schauen frei ins Land, ihn drückt seine Schwerfälligkeit in den Boden zurück, aus dem er kommt, zäh, selbstbewußt, eigenbrödlerisch wie seine Bewohner. Er möchte sein wie die Leute dort, aber auch wie Abraham a Sancta Clara. Der hatte etwas von der Gesundheit des Volkes an Leib und Seele, beeindruckend war seine urkatholische Kraft, Glaubenstreue und Gottesliebe, aber er zeigte sich auch als versiert in der raffinierten Geisteskultur seiner Zeit, er beherrschte sie, ohne von ihr beherrscht zu werden. Daher, so Heidegger, konnte er sich auch das furchtlose Dreinschlagen auf jede erdhaft überschätzte Diesseitsauffassung des Lebens erlauben. Abraham a Sancta Clara wußte, wovon er redete. Das war keiner, der nach den Trauben bellte, weil sie ihm zu hoch hingen.
Der junge Heidegger argumentiert gegen die Dekadenz seiner Zeit. Was wirft er ihr vor? Die erstickend wirkende Schwüle, es sei eine Zeit der Außenkultur, der Schnellebigkeit, der grundstürzenden Neuerungswut, der Augenblicksreize, vorherrschend sei das tolle Hinwegspringen über den tieferen seelischen Gehalt des Lebens und der Kunst (D, 3).
Das ist gängige konservative Kulturkritik; nicht nur im »Gralbund« redet und denkt man so, auch bei Langbehn und Lagarde findet man eine ähnliche Polemik gegen Oberflächlichkeit, Effekthascherei, Schnellebigkeit und Neuerungswut. Auffällig ist jedoch, daß der sonst in diesem Zusammenhang notorische Antisemitismus beim jungen Martin Heidegger fehlt. Das ist um so bemerkenswerter, da es immerhin der wegen seines Antisemitismus populäre Wiener Bürgermeister Karl Lueger war, der die Finanzierung des Denkmals in Kreenhainstetten in die Wege geleitet hatte. Auffällig ist auch die Selbstgewißheit, mit der Heidegger hier noch vom Jenseitswert des Lebens spricht, den er in allen diesen Zeiterscheinungen verraten sieht. Was man darunter zu verstehen hat, erläutert er in den anderen (von Victor Farias aufgefundenen) Artikeln, die Heidegger zwischen 1910 und 1912 für die Zeitschrift »Der Akademiker« verfaßt, eine Monatsschrift des integralistischen katholischen Akademikerverbandes.
In der Märznummer von 1910 stellt er den Lebensbericht des dänischen Schriftstellers und Essayisten Johannes Jørgensen vor. »Lebenslüge und Lebenswahrheit«, so der Titel des Buches. Es schildert den geistigen Entwicklungsweg vom Darwinismus zum Katholizismus, dargestellt als Weg aus der Verzweiflung in die Geborgenheit, aus dem Stolz in die Demut, aus der Zügellosigkeit in die lebendige Freiheit. Für den jungen Martin Heidegger ein exemplarischer und darum lehrreicher Weg, weil er alle Torheiten und Verlockungen der Moderne durchquert, um am Ende in Ruhe und Heil des kirchlichen Glaubens, im Jenseitswert des Lebens also, einzukehren. Da hat sich jemand von der großen Illusion der Moderne, die das Ich restlos zur Entfaltung bringen will, befreit, da demonstriert endlich jemand am eigenen Leib und Leben, daß sein Sach’ auf nichts stellt, wer es auf sich stellt. In unseren Tagen spricht man viel von ›Persönlichkeit‹… Die Person des Künstlers rückt in den Vordergrund. So hört man denn viel von interessanten Menschen. O. Wilde, der Dandy, P. Verlaine, der ›geniale Säufer‹, M. Gorky, der große Vagabund, der Übermensch Nietzsche – interessante Menschen. Und wenn dann einer in der Gnadenstunde der großen Lüge seines Zigeunerlebens sich bewußt wird, die Altäre der falschen Götter zerschlägt und Christ wird, dann nennen sie das ›fade, ekelhaft‹.(zit. V. Farías, Heidegger und der Nationalsozialismus, 88)
Martin Heidegger wird 1930 in seinem berühmten Vortrag VOM WESEN DER WAHRHEIT sagen: Die Freiheit wird uns wahr machen. In diesen Jugendaufsätzen gilt genau das Umgekehrte: Die Wahrheit wird uns frei machen. Und diese Wahrheit ist nichts, was der Mensch auf sich gestellt und von sich her entwickeln könnte, sondern er empfängt sie in der lebendigen Glaubensgemeinschaft und ihren Traditionen. Nur hier gibt es das hohe Glück des Wahrheitsbesitzes, zu dem keiner von sich aus gelangen kann. Der junge Heidegger vertritt jenen gläubigen Realismus seines Lehrers Carl Braig. Die protestantisch-pietistische Empfindungsfrömmigkeit ist ihm noch zu subjektiv. In einer Rezension von F.W. Foersters »Autorität und Freiheit. Betrachtungen zum Kulturproblem der Kirche« polemisiert er gegen das selbstverliebte Schwelgen in Erlebnissen, gegen den Impressionismus der Weltanschauungen, in denen nur persönliche Stimmungen, aber kein objektiver Gehalt zum Ausdruck kommt. Heideggers Standardargument seiner Polemiken gegen die Weltanschauungen: sie würden sich nach den Bedürfnissen des Lebens richten. Wer aber nach Wahrheit verlangt, der macht es umgekehrt, er zwingt das Leben unter das Kommando seiner Einsichten. Für den jungen Heidegger ist es offenbar ein entscheidendes Kriterium der Wahrheit, daß man es nicht leicht mit ihr hat, daß sie nur zu haben ist in der Kunst der Selbsterraffung und Selbstentäußerung. Wahrheit erkennt man daran, daß sie uns widerstrebt, herausfordert und verwandelt. Nur wer von sich selbst absehen kann, wer auch die geistige Freiheit gegenüber der Triebwelt erlangt, wird die Wahrheit finden. Sie ist eine Zumutung für den Geist des schrankenlosen Autonomismus. Sie erleuchtet, aber sie ist nicht spontan einleuchtend. Der Eigendünkel muß sich der religiös-sittlichen Autorität beugen. Schon die eine fast erdrückende Tatsache, daß die meisten Menschen, auf sich selbst gestellt, die Wahrheit nicht finden, nicht erringen wollen, sie vielmehr ans Kreuz schlagen, entzieht den Möglichkeiten einer individualistischen Ethik jedes Fundament.(zit. ebenda, 89)
Man sollte sich diese Argumentation merken, denn Heidegger wird an ihr festhalten: Die Zumutung und das Unbequeme bleiben Wahrheitskriterien; aber später gilt gerade der vermeintliche Wahrheitsbesitz unter der Obhut des Glaubens als bequemer Weg und deshalb als Verrat an der Wahrheit. Und als das Schwere und Harte, das man sich zumuten soll, gilt dann die zuvor beargwöhnte Freiheit, die ihre metaphysische Obdachlosigkeit aushält und sich nicht von den festgefügten Wahrheitssätzen eines gläubigen Realismus beschirmen läßt.
Heideggers Invektiven gegen den Persönlichkeitskult sind nicht frei von Ressentiments, denn er kann nicht verhehlen, daß ihm jener verlästerte Persönlichkeitsschliff fehlt. Dieser von der Kirche alimentierte Theologiekandidat wirkt im gutbürgerlichen Milieu des Gymnasiums und der Universität eher unbeholfen. Seinen Auftritten auf nichtphilosophischem Parkett wird immer die Sicherheit fehlen. Der ›Kleine-Leute-Geruch‹ haftet ihm an. Das wird so bleiben. Noch in den zwanziger Jahren in Marburg, inzwischen schon der heimliche König der Philosophie in Deutschland, verwechseln ihn manche Kollegen und Studenten, die ihn nicht kennen, mit dem Heizungsmonteur oder dem Hausmeister. Das Interessante, wogegen er polemisiert, es fehlt ihm einstweilen. Weil er die Rolle, die sich wirkungsvoll inszenieren läßt, noch nicht gefunden hat, scheut er jene gesellschaftliche Bühne, wo es darauf ankommt, schnell wirkenden Effekt zu machen. Die eindrucksvollen Selbstinszenierungen der jungen Nietzscheaner, die in den Cafés der Städte herumhocken, nennt er verächtlich Cesare-Borgia-Enthusiasmus. Was leicht von der Hand geht, das unbekümmert Spontane, steht bei ihm unter dem Verdacht der Oberflächlichkeit. So denkt jemand, der für seine Spontaneität noch nicht das passende Milieu gefunden hat und dem deshalb das ›Eigene‹ dort draußen bei den Anderen zu einer verpflichtenden Last wird. Wenn er die ›Wahrheit‹ mit dem Nimbus des Schweren, Harten und Widerstrebenden umgibt, so ist das ein Reflex jenes Widerstandes, den er draußen unter den ›Weltlichen‹ spürt und wogegen er sich behaupten muß. Zu Hause aber verliert diese Wahrheit des Glaubens alles Lastende und Schwere. So endet denn auch seine Jørgensen-Rezension mit einem lyrischen Lob auf die Geborgenheit in der katholischen Heimat: Er (Jørgensen, R.S.) sieht in den alten Städten die schattigen Erker, die vertrauten Madonnenbilder an den Häuserecken, er hört verschlafen die Brunnen rauschen, lauscht den schwermütigen Volksliedern. Wie deutscher Juniabend, der sich in traumhaftes Schweigen gelöst, liegt es über seinen lieben Büchern. Das gottsuchende und erfüllte Heimatverlangen des Konvertiten dürfte das mächtige Ferment seiner Kunst sein.(zit. ebenda, 88)
In dieser Welt ist die katholische Wahrheit noch zu Hause. Es ist eine Welt, die der von Meßkirch zum Verwechseln ähnlich sieht. Hier gehört der Glaube noch zur Ordnung des Lebens und man empfängt ihn, ohne daß man sich zur Selbsterraffung und Selbstentäußerung zwingen müßte. Aber wenn man mit seinem Glauben in die Fremde gerät, dann muß Disziplin und Logik ihm aufhelfen. Vor jedem Glauben tut sich ein Abgrund auf. Wie kommt man hinüber? Der junge Heidegger setzt auf Tradition und Disziplin. Später ist es dann die Entschlossenheit, der Dezisionismus. Noch später die Gelassenheit, auf die er sich verläßt.
Um 1910 gilt für Heidegger noch: Der Wahrheitsschatz der Kirche ist ein Geschenk, und nicht ein von uns angespartes Guthaben, über das wir frei verfügen können. Der Glaube an diesen Wahrheitsschatz ist auch nicht ein bloßes Gefühl. Die bloß gefühlige Religion in der Art Schleiermachers ist für Braig und seinen Schüler Martin Heidegger ein Zugeständnis an den modernen Subjektivismus. Der Glaube ist kein sentimentaler Komfort, sondern eine harte Herausforderung. Kein Wunder, daß die aufgeklärte Welt ihn als Zumutung empfindet, denn der Glaube ist tatsächlich eine Zumutung. Er mutet beispielsweise zu, um der ›Wahrheit‹ willen auf die Psycho-Logik des Auslebens zu verzichten. Der junge Heidegger: Und willst du geistig leben, deine Seligkeit erringen, dann stirb, ertöte das Niedere in dir, wirke mit der übernatürlichen Gnade und du wirst auferstehen.(zit. ebenda)
Diese Hinwendung zu Gott ist ohne jede heimatliche Milde. Sie will sich das Leben schwermachen, sie will sich keine Weichlichkeit von der Art des Schleiermachschen Gefühls durchgehen lassen, sie will auch nicht zum Asyl bloßer Innerlichkeit verkommen. Den Geist Gottes auf Erden will Heidegger zur Zeit woanders suchen. Braigs Ausspruch – »am siegreichsten leuchtet hier die mathematische Wahrheit auf, die strengste Form der ewigen Wahrheit« – hatte ihm die Richtung gewiesen, und so schreibt Heidegger im »Akademiker«: Eine strenge, eisig kalte Logik widerstrebt der feinfühligen modernen Seele. Das ›Denken‹ kann sich nicht mehr einzwängen lassen in die unverrückbaren ewigen Schranken der logischen Grundsätze. Da haben wirEs schon. Zum streng logischen Denken, das sich gegen jeden affektiven Einfluß des Gemüts hermetisch abschließt, zu jeder wahrhaft voraussetzungslosen wissenschaftlichen Arbeit gehört ein gewisser Fonds ethischer Kraft, die Kunst der Selbsterraffung und Selbstentäußerung.(zit. ebenda, 86)