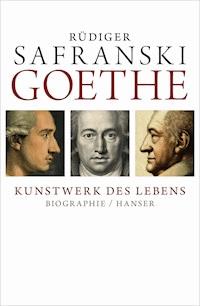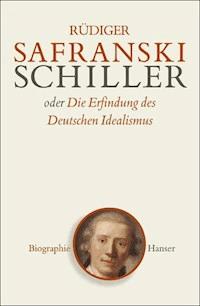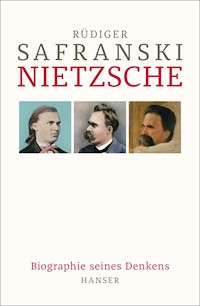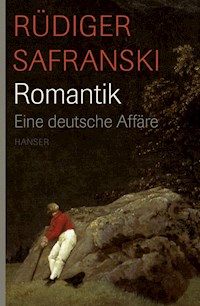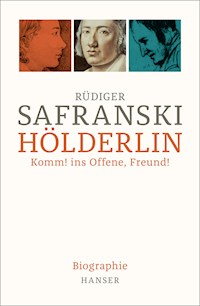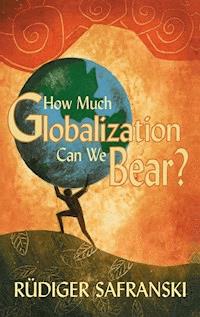25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zum 200. Todestag von E.T.A. Hoffmann: Bestsellerautor Rüdiger Safranskis bis heute konkurrenzlose Biografie, erweitert um ein Nachwort
Eigentlich wollte E. T. A. Hoffmann Musiker werden, und als Komponist und Kapellmeister hat er es zu einigen Erfolgen gebracht. Zur Sicherheit studierte er Jura, aber dann begann er aus einer Laune heraus Erzählungen und Romane zu schreiben, die bis heute lebendig geblieben sind: „Lebens-Ansichten des Katers Murr“, „Die Elixiere des Teufels“, „Die Serapionsbrüder“. Rüdiger Safranski hat ihm 1984 seine erste Biographie gewidmet, nun erscheint sie neu zum 200. Todestag, erweitert um ein Nachwort. Man findet in ihr alles Wissenswerte über Leben und Werk, aber sie weckt vor allem die Lust, in die wilden Geschichten des E. T. A. Hoffmann einzutauchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Zum 200. Todestag von E.T.A. Hoffmann: Bestsellerautor Rüdiger Safranskis bis heute konkurrenzlose Biografie, erweitert um ein NachwortEigentlich wollte E. T. A. Hoffmann Musiker werden, und als Komponist und Kapellmeister hat er es zu einigen Erfolgen gebracht. Zur Sicherheit studierte er Jura, aber dann begann er aus einer Laune heraus Erzählungen und Romane zu schreiben, die bis heute lebendig geblieben sind: »Lebens-Ansichten des Katers Murr«, »Die Elixiere des Teufels«, »Die Serapionsbrüder«. Rüdiger Safranski hat ihm 1984 seine erste Biographie gewidmet, nun erscheint sie neu zum 200. Todestag, erweitert um ein Nachwort. Man findet in ihr alles Wissenswerte über Leben und Werk, aber sie weckt vor allem die Lust, in die wilden Geschichten des E. T. A. Hoffmann einzutauchen.
Rüdiger Safranski
E. T. A. Hoffmann
Das Leben eines skeptischen Phantasten
Hanser
Für Rike
Nichts ist langweiliger als festgewurzelt in den Boden jedem Blick, jedem Wort Rede stehen zu müssen.
Prinzessin Brambilla
Vorwort
E. T. A. Hoffmann war ein Spätentwickler, obwohl er früh als musikalisches Wunderkind galt und als Einundzwanzigjähriger zwei selbstverfasste dickleibige Romane in der Schublade liegen hatte. Er ist siebenundzwanzig Jahre alt, als zum ersten Mal etwas Gedrucktes von ihm erscheint, dann dauert es noch einmal sechs Jahre, bis er 1809 mit dem Ritter Gluck sein literarisches Debüt gibt. Seit frühen Jahren hat er von der Künstlerexistenz geträumt. Er hat nicht genug getan, diese Träume zu verwirklichen. Er hätte sich, was er vermied, gegen die Erwartungen der Familie und des Herkommens stellen müssen. Er nimmt sich — zunächst — nur wenig Freiheit, »etwas aus dem zu machen, wozu man gemacht worden ist« (Sartre). Unwillig, geplagt und beglückt von Ausbruchsphantasien, aber zuletzt doch folgsam geht er den Weg, der ihn unter den juristischen »Brotbaum« führen soll. Er geht ihn aber mit Vorbehalt, er behält sich zurück, bleibt in der Reserve. Die lange Abwesenheit hat ihn nicht vor der routinierten Alltagsexistenz, aber vor ihren Verwüstungen bewahrt. Dieser quirlige, übernervöse kleine Gnom kann warten, ohne dabei zu verzichten. Er nimmt, was der Tag gibt, bleibt aber zu ungeduldig, zu anspruchsvoll fürs Behagen. Unfreiwillig geht er in die Lehre der Langsamkeit.
Er ist Ende dreißig, als die angesammelten und angestauten Massen musikalischer und literarischer Phantasien losbrechen. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Es dauert nur wenige Wochen, dann redet das ganze literarische Deutschland von ihm. Auch der andere große Wunsch erfüllt sich: Seine Oper Undine kommt auf die Bühne in Berlin. Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes reibt er sich verwundert die Augen: Und das soll es nun gewesen sein? Er macht weiter, muss aber nun mehr Wein zugießen. Er liebt das Leben und stirbt unter Protest.
In Deutschland vergisst man ihn nach seinem Tode ziemlich schnell, ein Tagesschriftsteller offenbar, dessen Zeit abgelaufen ist. Besonders in Frankreich aber wächst sein Ruhm. Dort gilt Hoffmann schon damals neben Goethe als wichtigster Repräsentant der deutschen Literatur. Erst mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist — angeregt durch die expressionistische und lebensphilosophische Faszination durch das Abgründige — Hoffmanns Stern am deutschen Literaturhimmel wieder aufgegangen.
Doch nie hat er sich, wie andere »Klassiker«, dafür geeignet, über die Leisten eines Anliegens, einer Botschaft, einer Philosophie, eines Systems etc. geschlagen zu werden. Man gab ihm, halb bewundernd, halb herabsetzend, das Etikett: »Dichter der entwurzelten Geistigkeit«.
Tatsächlich: Vom Wurzelwesen hat Hoffmann wenig gehalten; über jene, die auf alle Fälle Wurzeln schlagen wollen, hat er in seinem Karotten-Märchen Die Königsbraut köstlich gespottet. Und in der Prinzessin Brambilla, jenem Märchen von überschäumender Karnevalslust, heißt es: »Nichts ist langweiliger als festgewurzelt in den Boden jedem Blick, jedem Wort Rede stehen zu müssen.« So hat Hoffmann auch gelebt, die Tyrannei der Authentizität abwehrend.
Nicht »festgewurzelt« in der Familie: Die Mutter- und Vaterrollen waren schwach besetzt; die gesellschaftlichen Mächte, sie lenken ihn, sie dringen aber nicht tief genug in ihn ein: Er behält Spielraum. Er beherrscht die Kunst des »Als-ob«; er wird zu einem Gegner des »Entweder-oder«, jeder Ausschließlichkeit sich verweigernd, egal ob nun die Kunst, die Ideologie, die Familie, das Amt oder die Politik nach ihm greifen wollen. Seine Zeit macht es ihm nicht leicht, die Balance zwischen Engagement und Distanzierung aufrechtzuerhalten. Denn damals geht alles aufs Ganze: Philosophie und Kunst geraten unter den Druck der höchsten Wahrheit und des tiefsten Ernstes, und die Politik explodiert in alle Lebensbereiche hinein. Das Ganze ist das Wahre, lehrt der Hegel’sche Zeitgeist; da man aber nun beginnt, das »Ganze« politisch zu definieren, so ist es schließlich die Politik, die nach dem ganzen Menschen greift: eine schlechte Zeit für die Gewaltenteilung, für den fröhlichen Relativismus, für das levantinische Lavieren, auf das sich Hoffmann so gut verstand.
Nicht »festgewurzelt« in der Literatur, nicht im juristischen Beruf, nicht in der Musik, nicht in der Malerei. Den Preis, den er bezahlt: nirgends ganz ernst genommen zu werden. Er entschädigt sich, indem er auch seinerseits nichts ganz ernst nimmt. Bei den Autoritäten war er deshalb schlecht angesehen. Goethe hielt von ihm genauso wenig wie der preußische Polizeiminister Schuckmann, der ihn für einen »Wüstling« hält, der »hauptsächlich für den Erwerb seines Weinhauslebens arbeitete«. So ganz unrecht hatte der übelmeinende Bürokrat gar nicht: Die künstlichen Paradiese des Rausches wollte der skeptische Phantast nicht missen, und sein berühmtestes Märchen, Der goldne Topf, trägt die Punschterrine ins Allerheiligste der Literatur.
Nicht »Rede stehen«: den Gewalten, die zu bestimmter Rede zwingen wollen, ihnen hat Hoffmann widerstanden. Dem Geist seiner und unserer Zeit entgegen vermeidet er beides: die Sprache der Herzensergießung und die Sprache der Weltverbesserung. Zwischen Innenwelt und Außenwelt, gegen die Zumutungen der Intimität und gegen die Zumutungen der Politik bewahrt die Literatur bei Hoffmann die Dimension des Gesellschafts-Spiels — denkwürdig für uns heute, die wir Literatur gerne als Therapie, als Botschaft oder als Bekenntnis verstehen und vielleicht missverstehen.
Erstes Buch
In der Gewalt des Herkommens
1776—1808
Dass es zuweilen etwas exzentrisch in meinem Gehirnkasten zugeht, darüber freue ich mich eben nicht beim Besinnen — dies Exzentrische setzt mich offenbar herunter in den Augen aller, die um mich sind — und Leute, die alles in Nummern teilen und apothekerartig behandeln, möchten mir manchmal ihren orthodoxen Schlagbaum vorhalten, oder ihr offizielles Krummholz um den Hals werfen.
Brief an Hippel
Erstes Kapitel
»Was hat mir das Geschick für Verwandte gegeben«
Am 24. Januar kommt er in Königsberg zur Welt. Seine Eltern geben ihm den Namen Ernst Theodor Wilhelm. Er wird später aus Bewunderung für den großen Mozart seinen dritten Vornamen durch »Amadeus« ersetzen.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann entstammt einer Verwandtenehe, und fast wäre er dem Vorbild seiner Eltern gefolgt, als er sich im Jahre 1798 mit seiner Cousine Minna Doerffer verlobte. Zur Heirat kam es aber dann doch nicht.
Die Eltern: Im Jahre 1767 heiratete in Königsberg der Hofgerichtsadvokat Christoph Ludwig Hoffmann seine Cousine Lovisa Albertina Doerffer und zeugte mit ihr drei Söhne. Dem ersten, Johann Ludwig, 1768 geboren, sollte es in seinem Leben schlecht ergehen. Wegen seines »unordentlichen« Lebenswandels wurde er später entmündigt und in ein Arbeitshaus gesperrt. Der zweite starb kurz nach der Geburt. Ernst Theodor war der dritte. Er wurde geboren, als die Ehe der Eltern sich schon aufzulösen begann.
Die Hoffmanns waren ein Geschlecht von Pfarrern, Feldpredigern und Schulmeistern, schon über Generationen in Ostpreußen ansässig. Eine Urururgroßmutter ist die einzige Berühmtheit unter den Vorfahren. Es war die Anna Neander aus Tharau, die 1636 einen Pfarrer heiratete, dessen Freund, vermutlich Simon Dach, zum Festtag ein nachmals sehr volkstümliches Lied verfasste: »Annken von Tharau ist die mir gefällt«.
Juristen waren damals angesehener als Pfarrer und Schulmeister. Hoffmanns Vater hatte also einen sozialen Aufstieg geschafft, als er Hofgerichtsadvokat wurde, weshalb die Doerffers, die Eltern der Mutter, eine alteingesessene angesehene Juristenfamilie in Königsberg, in ihm auch eine halbwegs gute Partie sahen. Doch der Vater hielt nicht, was die Doerffers sich von ihm versprachen: Er war nicht karrierebewusst, trank, liebte das Musizieren, dichtete auch ein wenig und vernachlässigte seine Amtsgeschäfte. Kein ordentlicher Beamter, kein solider Ehemann, schwer zu ertragen für Lovisa Albertina, die Mutter, deren Welt die Meinung der Leute, die Pflichten des Anstandes und die Reinlichkeit der häuslichen Ordnung war.
Zwei Jahre nach der Geburt Ernst Theodors trennten sich die Eltern. Der Vater zog mit seinem ältesten Sohn nach Insterburg, die Mutter kehrte mit dem zweijährigen Ernst Theodor in das Haus ihrer Eltern, zu den Doerffers zurück. Dort lebte Hoffmann bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr.
Die Doerffers sind eine angesehene Familie. Ihr Haus liegt im vornehmen Wohngebiet Königsbergs. Der Stadtpräsident Hippel, ein Onkel von Hoffmanns Jugendfreund, gehört zu den Nachbarn. Das Lesewang’sche Fräuleinstift, wo adelige Töchter erzogen werden, grenzt an den Doerffer’schen Garten.
Als der Großvater, der Hofgerichtsadvokat und Konsistorialrat Johann Jacob Doerffer, noch lebte, führte man ein offenes Haus. Das war vor Hoffmanns Geburt. Jetzt leben dort zwei unverheiratet gebliebene Tanten und ein ebenfalls unverheirateter Onkel gedämpft, zurückgezogen, bedacht, die Formen der Schicklichkeit einzuhalten. Die Großmutter, eine ehrfurchtgebietende alte Dame, wacht darüber.
Der Onkel, Otto Wilhelm Doerffer, ist der einzige Mann im Hause. Er ist ein gescheiterter Mensch. Er hatte seine juristische Laufbahn abbrechen müssen, weil »die erste Probe im Plädieren als Advokat … gegen einen überlegenen Gegner … unvorteilhaft ausgefallen war« (Hippel). Er hatte noch Glück, dass er sich im Zuge einer Justizreform 1782 mit dem Titel eines Justizrates vorzeitig pensionieren lassen konnte. Er gründete keinen Hausstand, blieb als Junggeselle bei seiner Mutter, wo er mit seinem Neffen Ernst Theodor zusammen ein Zimmer bewohnte. Einem leeren Leben suchte er durch Pedanterie und Pünktlichkeit wenigstens eine äußere Form zu geben. Besuche außer Haus absolvierte er als Pflichtpensum, Gäste sah er kaum. Ein ängstlicher Mensch, auf Sicherheit bedacht, der Lebendiges nur ertragen konnte, wenn es in Wiederholungen erstarrte. Gegen das Unvorhersehbare versuchte er die Abschirmung. Später schrieb er einmal seinem Neffen: »Die Zeiten sind schlecht und überall hört man nichts als Klagen und Jammer — doch Gott lebet noch und wird alles wohl machen. Ich habe mir jetzt zwei Geistliche zu Freunden zugelegt« (6.10.1800).
Dieser Onkel, den die Großmutter als Minderjährigen behandelte und »Ottchen« rief, sollte beim jungen Hoffmann Vaterstelle einnehmen. Das konnte nicht gutgehen. Denn Ernst Theodor, über das Alter frühkindlicher Vaterbindung schon hinaus, spürte die bloße Anmaßung von Autorität.
Er brauchte den Onkel nie zu hassen, sehr früh lernte er die Haltung bald mitleidiger, bald spottlustiger Verachtung. In seinen Jugendbriefen nennt Hoffmann ihn »Sir Otto« oder den »dicken Sir« oder »heiliger Sankt Otto« oder einfach »der Bratenschnapper«. Theodor Hippel, der Jugendfreund, hat den Onkel später so charakterisiert: »Er hatte eine sorgfältige Erziehung genossen. Da ihm aber alles Talent abging, das Erlernte in Eigentum zu verwandeln, so fand er sich verarmt, sobald er auf sich selbst beschränkt war.« Hippel hält ihm zugute, er habe in Hoffmann den »Sinn fürs Schickliche« befestigt. Wahrscheinlicher aber ist, dass Hoffmann an seinem Onkel das Lächerliche des nur Schicklichen studieren konnte und dass er lernte, die komischen Züge im Gesicht der Macht zu entdecken. Das hat ihn gewitzt werden lassen und ihm die Ermunterung auf den Lebensweg mitgegeben, auch mit Gewalten und Gewaltigen sein Spiel zu treiben.
Es waren manchmal recht unappetitliche Späße, mit denen er seinen Onkel »mystifizierte«, wie er das nannte. Einmal goss er nach einem Regenschauer den Nachttopf über der draußen hängenden Sonntagshose des Onkels aus. Er genoss die peinliche Szene, wie der Onkel die erbärmlich stinkende Hose auswrang und mit der »Angst seines Herzens« darüber klagte, »daß mit dem Platzregen häßliche Teile und verderbende Dünste heruntergefallen wären, die totalen Mißwachs verursachen würden«. Die Tante, so erzählt Hoffmann in einem Brief an Hippel (7.12.1794), habe bei dieser Theorie des sauren Regens gelächelt und versteckt geäußert, »daß der Gestank wohl aus der Auflösung gewisser angetrockneter Teile — — — entstanden sein könnte«, was der Onkel natürlich heftig abstritt. Der junge Übeltäter springt ihm zum Scheine bei mit dem damals noch phantastischen Hinweis, dass bei hellgrünem Himmel in der Tat oftmals stinkender Regen niedergehe.
Dieses Scharmützel zeigt die streitlustige Phantasie des jungen Hoffmann, eine Phantasie der Polemik.
Eine Phantasie der Selbstbehauptung in »bedrohlicher« Situation offenbart eine andere Jugendepisode, die Hippel erzählt: »Die Freunde beschlossen … nichts weniger Kühnes, als in den Garten des angrenzenden Fräuleinstifts einen unterirdischen Gang zu graben, und von diesem aus unentdeckt die schönen Fräulein zu belugen. Der Scharfblick des Onkels Otto, der zur Verdauung viel im Garten arbeitete und lustwandelte, machte dem gigantischen Plane ein Ende. Hoffmann bildete ihm ein, das gegrabene Loch habe die Wurzeln einer neuen amerikanischen Pflanze aufnehmen sollen, und der gute Alte bezahlte zwei Arbeiter, um die Grube auszufüllen.« Der gute Alte ist wirklich der Dumme: Er muss bezahlen und kann noch nicht einmal strafen, die Ausrede ist zu gut, zu phantastisch ausgedacht. Vielleicht musste der Onkel lachen über so viel Witz, was aber bei seiner notorischen Humorlosigkeit unwahrscheinlich ist, er wird die Geschichte geglaubt haben.
Die Phantasie rettet den jungen Hoffmann vor Schlägen, sie bahnt ihm die Fluchtwege. Das wird so bleiben. Bedrohungen machen ihn erfinderisch und die Phantasie der Ausflüchte wird bei ihm später zur Quelle der poetischen Kraft, die eine beengende Wirklichkeit zum Tanzen bringt. Die Phantasie gibt ihm Luft in der Atemnot. Am Ende seines Lebens, als ein Disziplinarverfahren anhängig ist gegen den Kammergerichtsrat, der im Meister Floh (1822) die Hysterie und Willkür der »Demagogenverfolgung« satirisch aufs Korn genommen hat, liefert Hoffmann sein Meisterstück in der Kunst der phantastischen Ausflüchte. Natürlich wusste jeder, dass die inkriminierten Passagen Satire, sogar Personalsatire auf hochgestellte Beamte sind. Doch die ganze Verteidigung, die solches in Abrede stellt, ist so einfallsreich ausgedacht und erregt so unverhohlene Bewunderung selbst in der Staatskanzlei Hardenbergs, dass die Energie der strafenden Instanzen darüber erlahmt und das Verfahren zunächst einmal auf Eis gelegt wird. Ein wirklich entwaffnender Einfallsreichtum. Allerdings zehrte dieser letzte Streit die Lebenskraft Hoffmanns auf. Er hat das Disziplinarverfahren nicht überlebt.
Zurück zum Onkel: Er war sein erster Kontrahent, im Clinch mit ihm erlernte er die Kunst der phantasievollen Ausrede, das »Vexieren«, das »Mystifizieren«. Er übte sich darin, in der Verblüffung seines Gegners Schutz zu suchen. Aber vielleicht gerade deshalb, weil ihm hier die Siege so leicht gemacht wurden, konnte er in späteren Jahren seinem Onkel gegenüber milde werden. Nur noch belustigt registriert er dessen pedantische Briefe aus Königsberg. Die Galle kommt ihm erst wieder hoch nach dem Tode der Tante Johanna Sophia Doerffer, Ende 1803. Die Tante hatte ihn zum Universalerben ihres nicht unbeträchtlichen Vermögens eingesetzt, jedoch mit der Klausel, dass der Erbfall erst mit dem Tod des Onkels eintreten dürfe. So lange aber stehe diesem der alleinige Nießbrauch am Vermögen zu. Hoffmann hatte große Hoffnungen an die Erbschaft geknüpft. Er dachte, sich mit ihrer Hilfe aus dem »Exil« des polnischen, damals aber zu Südpreußen gehörenden Plock zu befreien, wo er die Stelle eines Regierungsrates bekleidete. Der Tod der Tante schien dem Traum, ganz der Kunst leben zu können, Wirklichkeit zu geben. Doch Onkel Otto, der Johannas Testament mit aufgesetzt hatte, versperrte ihm nun diese Aussicht. Und da der Onkel in der Folgezeit recht großzügige Spenden an die Kirche vergab, um sein Seelenheil sicherzustellen, wuchs natürlich Hoffmanns Ärger in dem Maß, wie das Vermögen hinschmolz. Der heikle Wunsch, der alte Onkel in Königsberg möge doch nun bald sterben, war nur schwer abzuweisen. Der Onkel aber ließ sich Zeit. Als er schließlich 1811 starb, war von dem Vermögen nicht mehr viel übrig.
Der Jugendfreund Hippel will, wie wir gesehen haben, doch so manches gute Haar am Onkel lassen. So soll der Onkel in Hoffmann nicht nur den »Sinn fürs Schickliche«, sondern auch den Sinn für die Musik geweckt haben: Er »war sein erster Lehrer in der Musik gewesen, der sich späterhin sein ganzes Gemüt zuwandte«, schreibt Hippel in seinen Erinnerungen. Hoffmann selbst hat das anders gesehen.
Sicherlich, musikalische Anregung gab es im Hause Doerffer. Der Onkel spielte ganz passabel auf dem Klavier, er war auch Hoffmanns erster Klavierlehrer, er achtete auf die pünktliche Einhaltung der Übungsstunden, auf die korrekte Technik des Spiels, auf die metrische Exaktheit. Aber ihm fehlte jedes Verständnis für die früh erwachte musikalische Leidenschaft des Neffen.
In Johannes Kreislers Lehrbrief (1815) schildert Hoffmann eine Episode, die wohl auf Selbsterlebtes zurückgeht. Dort tritt der Onkel als Vater auf, der den jungen Erzähler in den Anfangsgründen des Klavierspiels und der Komposition unterweist. Der Kleine aber sitzt träumend am Klavier und brütet über ahnungsvollen, wunderbaren Tönen, die ihn aus einer märchenhaften Erzählung anwehen. Das Erlernen der bloßen Technik hilft ihm nicht, diese Töne laut werden zu lassen. »Ich gab mir viele Mühe, aber je mehr ich des Mechanischen Herr wurde, desto weniger wollte es mir gelingen, jene Töne, die in wunderherrlichen Melodien sonst in meinem Gemüte erklangen, wieder zu erlauschen.« Das ratlose Bemühen, die innere Musik erklingen zu lassen, deutet der Vater/Onkel als Stümperei und mangelndes Talent. Er gibt den Unterricht auf. Im Musikfeind (1814) nimmt der Vater/Onkel den bis zum Weinen erregten Musikenthusiasmus des Sohnes als widriges Betragen, schilt ihn einen »dummen Jungen« und »antimusikalischen Hund«. Er kann die Leidenschaft des Sohnes nicht billigen, da die Musik, weil sie nicht den »Verstand« beschäftige, doch nur ein »Dudeldumdei« sei, ein angenehmes Spiel, aber nicht wichtig genug, dass man darüber weinen könnte.
Es waren wohl mehr die »sekundären Tugenden« wie Fleiß, Pünktlichkeit, Strebsamkeit, Lernwilligkeit, die der Onkel mit seinem Musikunterricht im Auge hatte. Dazu noch eine Episode aus dem Musikfeind: Der Kleine soll ein Stück in der schwierigen E-Dur-Tonart vorspielen. Er erleichtert sich die Aufgabe, indem er es ins einfacher zu spielende F-Dur transponiert. Beim Vorspiel zeigt der Vater stolz auf den Sohn, der das schwierige E-Dur gemeistert habe. Von einem anderen Zuhörer auf die Transposition hingewiesen, freut er sich nicht etwa über die musikalische Findigkeit, sondern verabreicht dem Sohn eine Ohrfeige wegen arglistiger Täuschung und mangelnder Korrektheit.
Also auch auf musikalischem Gebiet konnte der Onkel keine erzieherische Autorität ausüben. Nein, Onkel Otto war kein überzeugender Repräsentant für die Welt der Väter; unfreiwillig machte er sie in den Augen seines jungen Neffen zum Gespött.
Und die Welt der Mütter?
Auch sie war in Hoffmanns Jugend nur schwach besetzt. Nach der Trennung von ihrem Ehemann, deren Ursache, so Hoffmann in der Kreisler-Biographie, man in einer »Ifflandschen Hauskreuzkomödie nachlesen« könne, wird die Mutter im elterlichen Haus wieder zur Tochter. Sie war ja schon vorher ängstlich, ordentlich, schicklich. Jetzt nach der Trennung wird es noch schlimmer damit. Im Urteil der Umwelt, das ihr alles bedeutet, liegt der Makel der Scheidung natürlich vor allem auf der Frau: Sie ist die anrüchig Gescheiterte. Unter diesem Druck wird ihr Ordnungssinn und ihre Angst vor der Meinung der Leute geradezu pathologisch. Manchmal hat sie hysterische Weinkrämpfe und stürzt sich dann wieder bienenfleißig in die Hausarbeit. Selten geht sie außer Haus, später verlässt sie nicht einmal das Zimmer. Zuletzt ist sie nur noch ein Häufchen Elend. »Schon ihr Äußeres war ein Bild der Schwäche und des Gemütskummers, der sie tief zu beugen schien«, schreibt Hippel. Wahrscheinlich haben die anderen Doerffers ihre Initiative gelähmt und sie in der Mutterrolle, falls sie diese überhaupt je übernommen hat, entmutigt. Es gelang ihr nicht, zugleich Mutter und Tochter zu sein, und sie regredierte unter den Augen ihrer eigenen Mutter wieder zum Kinde. Vielleicht hat sie der heranwachsende Ernst Theodor an den liederlichen und genialischen Ehemann erinnert. Vielleicht war sie auch zu stark in ihr eigenes seelisches Leiden verstrickt, um eine wirkliche Beziehung zu ihrem heranwachsenden Kind entwickeln zu können. Wie dem auch sei, jedenfalls verspürte Hoffmann keine Mutterbindung an sie. Sie war für ihn eine ältere Schwester, durch den Altersabstand ferngerückt. Im Kater Murr (Bd. I, 1819) bekennt Hoffmanns anderes Ich, Johannes Kreisler, »daß der Tod meiner Mutter … keinen sonderlichen Eindruck auf mich machte«. Tatsächlich ist Hoffmann beim Tode seiner Mutter, am 13.3.1796, ziemlich ungerührt. In einem Brief an Hippel vom selben Tag hat er Abstand genug, um kluge, vielleicht auch angelesene Bemerkungen über das Sterben im Allgemeinen zu machen. »Heute morgen fanden wir meine gute Mutter tot aus dem Bette herausgefallen — Ein plötzlicher Schlagfluß hatte sie in der Nacht getötet, das zeigte ihr Gesicht, von gräßlicher Verzuckung entstellt« — nach dieser kühlen Schilderung einer Toten fährt er mit Werther-Emphase fort: »Ach Freund, wer nicht den Tod sich beizeiten zum Freunde macht, und auf vertraulichem Fuß mit ihm umgeht, dem macht er zuletzt seine Visite immer auf die quälendste Art.«
Man vergleiche diesen Abschied des Zwanzigjährigen von seiner Mutter mit der Schilderung des Todes von »Tante Füßchen«, die starb, als Hoffmann drei Jahre alt war. Diese Tante, Charlotte Wilhelmine, war ihm der liebste Mensch seiner frühen Kindheit. Ihr Lautenspiel und ihren Gesang konnte er nie vergessen. Ihren Tod erlebte er als wirklich schmerzhafte Zäsur: die Geburt in eine kalte Welt. »Noch jetzt«, so lässt Hoffmann seinen Kreisler erzählen, »jenes Augenblicks gedenkend, erbebe ich in dem namenlosen Gefühl, das mich damals erfaßte. Der Tod selbst preßte mich hinein in seinen Eispanzer, seine Schauer drangen in mein Innerstes und vor ihnen erstarrte alle Lust der ersten Knabenjahre.« Vom Tode dieser Tante an datiert Hoffmann seine Elternlosigkeit. Inmitten der Onkel und Tanten, ohne Geschwister, mit einer Mutter, die hinter der Verwandtenphalanx verschwindet, und mit einem Vater, den er nur aus Erzählungen kennt, erfährt sich der kleine Ernst Theodor als verwaistes Kind. Im Rückblick kommt es ihm so vor, als habe er einen »guten Teil« seiner Kindheit und Jugend »im trostlosen Einerlei« verlebt (Kreisler-Biographie, Kater Murr). Die »Tante Füßchen« aus der Kreisler-Biographie ist Hoffmanns jüngste Tante, Charlotte Wilhelmine Doerffer, die im Alter von vierundzwanzig Jahren 1779 an den Pocken starb. Von ihr wissen wir nicht mehr, als was Hoffmann seinen Kreisler erzählen lässt, und das wenige ist eingehüllt in den verklärenden Zauber der frühen Jahre. Alles Glück, das diese Frau dem Kind gespendet hat, verdichtet die Erinnerung in den Glanz ihrer »mildblickenden Augen«, den Klang ihrer Stimme und das Spiel ihrer Laute. »Tante Füßchen« starb zu früh, sie konnte nicht zur Mutter des kleinen Ernst Theodor werden.
Bleibt noch die zweite Schwester der Mutter, Johanna Sophia Doerffer. Diese ebenfalls unverheiratet gebliebene Tante nimmt sich des kleinen Ernst Theodor an. Das Schicksal hatte Johanna Sophia nicht bitter gemacht. Unverheiratet zu bleiben bedeutete damals für eine Frau, nie recht erwachsen sein zu dürfen. Das Leben im elterlichen Haus hielt auch sie in der Rolle einer Tochter fest, die ihren Neffen als jüngeren Bruder behandelte. Da sie eine Frau von Witz und Phantasie war und sich weniger als die anderen Doerffers unter die Macht des Schicklichen beugte, fand sie auch genügend innere Freiheit, ihrem Neffen mit Verständnis zu begegnen. »Sie war die einzige im Hause, die seinen Geist begriffen hatte«, schreibt Hippel. Sie umsorgte ihn, und Hoffmann bewahrte ihr eine Anhänglichkeit bis zu ihrem Tode 1803. Bei Konflikten nahm sie oft die Partei des Neffen. Hoffmann hat es ihr gedankt und sie bisweilen ins Vertrauen gezogen. Doch war die emotionale Bindung nicht stark genug, um ein Gegengewicht zum Gefühl der Verlassenheit, das der heranwachsende Hoffmann im Doerffer’schen Haus empfand, bilden zu können.
Hoffmann wuchs also unter Frauen auf, aber es fehlte eine Mutter. Seine späteren Werke sind von dieser Erfahrung geprägt: Die Mutter des Klein Zaches (1818) will ihren verwachsenen Gnom am liebsten loswerden. Es findet sich dann auch eine gute Fee, die ihr diese Last abnimmt. Auch die Mutter des Medardus in den Elixieren des Teufels (1815/16) überlässt sehr früh ihren Sohn einer wohlgesinnten Äbtissin. Der Kater Murr lernt seine Katzenmutter erst kennen, als er schon »erwachsen« ist. Er muss sich ihr Gejammer über den untreuen Vater anhören. So wird auch Hoffmanns Mutter geklagt haben. »›Ha, diese Ähnlichkeit‹, sprach die Gefleckte, ›diese Ähnlichkeit, diese Augen, diese Gesichtszüge, dieser Bart, dieser Pelz, alles erinnert mich nur zu lebhaft an den Treulosen, Undankbaren, der mich verließ.‹« Murr will ihr etwas Gutes tun und ihr einen Heringskopf spendieren. Doch das Pflichtgefühl des Sohnes kann es mit den gebieterischen Forderungen der »Mutter Natur« nicht aufnehmen, der Appetit siegt: Murr verspeist den Heringskopf selbst.
In Hoffmanns Werk haben die Mütter kaum eine Daseinsberechtigung. Schattenhaft stehen sie am Rand, verschwinden oder lassen sich vertreten durch andere Personen und Instanzen. Gegen böses Geschick bieten sie keinen Schutz. Die Mutter im Sandmann (1816) kann den kleinen Nathanael nicht vor dem dämonischen Coppelius bewahren.
Nur manchmal zeigt sich die Präsenz der Mutter in den Kindern, dann aber auf verhängnisvolle Weise: In den Adern des Medardus »kocht« ein Blut, das die Sinnenlust der mütterlichen Vorfahren erhitzte. In einer anderen Erzählung erbt die Tochter das blutsaugerische und männermordende Begehren von der Mutter (Vampirismus, 1821).
Eine solch verhängnisvolle Präsenz der Mutter im Leben ihres Kindes erlebt der junge Hoffmann in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Im ersten Stock des Doerffer’schen Hauses lebt eine hysterische Mutter, die ihren Sohn, den später gefeierten romantischen Dramatiker Zacharias Werner (1768—1823), in dem Wahn erzieht, er sei eine neuerliche Verkörperung von Jesus Christus. Dass Zacharias Werner eine solche Erziehungstortur nicht heil überstehen konnte, lässt sich denken. In den Gesprächen der Serapionsbrüder berührt Hoffmann dieses Thema. Er führt dort das überspannte Selbstbewusstsein, die heuchlerische Verlogenheit, das eitle und bigotte Wesen des Dichters und seine »Lüsternheit«, die dieser vor sich selbst und den anderen verbarg, auf das Erziehungsmilieu zurück, worin der Wahn der Mutter den jungen Zacharias festhielt. Auch auf den »Hysterismus« seiner eigenen Mutter kommt Hoffmann bei dieser Gelegenheit zu sprechen: Sie habe in ihm die »ganze exzentrische Phantasie« erzeugt. Nur diese Mitgift will er von ihr empfangen haben, eine andere von ihr ausgehende Einwirkung auf sein Leben kann er nicht entdecken.
Die Vater- und Mutterrolle blieben also in Hoffmanns Kindheit unbesetzt. Seinem Freund Hippel gegenüber, den er dessen Familie wegen beneidet, beklagt er sich: »Ja, ja — in meiner ersten Erziehung, zwischen den vier Mauern mir selbst überlassen, liegt der Keim mancher von mir hinterher begangenen Torheit« (undatiert, Frühjahr 1803). »Torheit« nennt Hoffmann in diesem Brief seine respektlosen Karikaturen der Posener Honoratioren; sie hatten ihm eine Strafversetzung nach Plock eingebracht. Er leidet unter dieser Verbannung und gibt die Schuld dem Schicksal, das ihm eine erzieherische Autorität in der Jugend vorenthalten hat, weshalb es ihm in der Folgezeit an der respektvollen Einstellung zu Autoritätspersonen gemangelt habe.
Nicht immer empfand Hoffmann seine Respektlosigkeit als Mangel, doch vor dem soliden und autoritätsfrommen Hippel schämte er sich ihrer bisweilen. Dabei kannte seine Respektlosigkeit Grenzen, denn mit den Konventionen seiner gutbürgerlichen Umwelt hat er letztlich doch nicht gebrochen. Er ist ihnen in seinem Werdegang sogar sehr beflissen gefolgt. Das überrascht, da in seiner Jugend, »sich selbst überlassen«, die Chancen nicht schlecht standen, gar kein oder ein nur sehr schwaches Über-Ich zu entwickeln.
Hoffmann, der sehr früh seine künstlerischen Neigungen in sich entdeckte, ist geworden, was seine Familie aus ihm machen wollte: ein Jurist, ein Beamter. Doch die Familie hat keinen unmittelbaren Zwang ausgeübt, schon gar nicht der hilflose Onkel Otto. In der Kreisler-Biographie nimmt Hoffmann ihn und die ganze Familie vor einem solchen Vorwurf ausdrücklich in Schutz: »So ist es auch gewiß, daß es nicht Erziehungszwang …, nein, daß es der gewöhnlichste Lauf der Dinge war, der mich fortschob, so daß ich unwillkürlich dorthin kam, wo ich eben nicht hinwollte.« Der »Lauf der Dinge« — das ist die Macht des Herkommens, und das sind die als selbstverständliche Verpflichtung empfundenen Erwartungen der Familie Doerffer, in der es von Juristen nur so wimmelt. Er übernimmt zwar nicht die in der Familie herrschende Auffassung von der Kunst als angenehmem Zeitvertreib für Mußestunden, doch zähneknirschend befolgt er zunächst den aus dieser Auffassung abgeleiteten Grundsatz, aus der Kunst keine Profession zu machen.
Nicht eine persönliche Autorität, mit der man sich identifizieren könnte, kein Vater, keine Mutter, lasten auf dem jungen Hoffmann, sondern es ist die verpflichtende, aber unpersönlich, äußerlich bleibende Tradition des ganzen Familienclans, dem sich der widerspenstige Musensohn fügen soll. Und er fügt sich, doch ohne die Normen, denen er gehorcht, verinnerlichen zu können. Denn ihre Verinnerlichung gelingt nur dann, wenn sie über eine starke persönliche Bindung in den Heranwachsenden eingepflanzt werden. Gerade das aber ist bei Hoffmann nicht geschehen. Er befolgt die Normen des bürgerlichen Lebens, doch sie sitzen bei ihm locker. Er spürt ihren Druck, aber auch die innere Kraft, mit ihnen wenigstens spielen zu können. Sich ihnen ganz zu entziehen, dazu reicht sie allerdings nicht aus. Wer die konditionierende Macht nicht verinnerlichen, sie aber auch nicht abschütteln kann, dessen Lebensstil wird ausweichend sein, der wird es mit der Nichtbelangbarkeit versuchen: Nirgendwo ist man voll und ganz da, man ist nicht zu fassen. Man »mystifiziert« sich und die anderen, indem man die eigene Identität im Vexierspiegel der Verwandlungslust vervielfältigt. Man wird kein Protestant, der sagt: Hier steh ich — ich kann nicht anders. Hoffmanns Maxime könnte lauten: Hier steh ich, ich kann auch anders. Nicht Kreisler, der sich mit Haut und Haaren dem Künstlertum verschreibt und deshalb auch so verletzlich ist, wird zum Spiegelbild der Hoffmann’schen Existenz, sondern der Archivarius und gleichzeitige Feuersalamander Lindhorst aus dem Goldnen Topf repräsentiert jenen Lebensstil, auf den sich der Kammergerichtsrat Hoffmann so gut verstehen wird.
Wer sich so früh wie Hoffmann in der Kunst des »Sowohl-als-auch« und des »Als-ob« übt, der bekommt zwangsläufig etwas von einem Spieler, dem die leichte Hand viel gilt. Deshalb Hoffmanns Vorsicht gegenüber allem, was nach totaler Inanspruchnahme aussieht. Hoffmann wird nie restlos aufgehen in dem, was er tut. Er will sich immer zugleich auch von außen sehen können. Das wird ihm natürlich im ungeliebten Justizberuf besonders leichtfallen; dieser ist ihm äußerlich, er gehört zur Welt der anderen, die er wohl oder übel ein Stück weit in sich hineinlassen muss. Für diese Welt der anderen stellt er eine wohldosierte Menge von Intelligenz und Energie zur Verfügung, nicht mehr und nicht weniger, als für die Aufrechterhaltung dieser beruflichen Existenzform notwendig ist. Schnell und geschickt eignet er sich die Regeln und Mittel an, die zum Spiel, das die anderen ihm aufdrängen, gehören. Er wird ein exzellenter Jurist und betreibt das Spiel so gewissenhaft, dass er später die Regeln eines korrekten Verfahrens sogar gegen seine Vorgesetzten verteidigen wird.
Einer leichten Hand bedarf auch die Kunst, wenn sie gelingen soll. Dazu aber muss sie frei sein vom lastenden Druck der Selbstbehauptung; nur wenn es nicht um alles oder nichts geht, kann sie ihr freies Spiel entfalten. Wer emphatisch seine ganze Existenz auf die Kunst wirft und in ihr seine innerste Wahrheit und seine volle Selbstverwirklichung sucht, der lädt sich erneut eine Last auf, unter der er zusammenbrechen kann. Hoffmann wird dies am eigenen Leib erfahren. Als Komponist wird er nicht erreichen, was ihm vorschwebt, und zwar deshalb nicht, weil er von der Musik zu viel, um nicht zu sagen: alles erwartete; sie sollte seinem »eigentlichen« Leben Gestalt geben. Bei solcher Anspannung steht zu viel auf dem Spiel, nämlich das ganze Leben. Wenn es sich so verhält, dann verliert man die leichte Hand. Die Verkrampfung erlaubt keinen großen Wurf.
Für Hoffmann hängen am Komponieren zu große Gewichte, nicht aber am Schreiben, das er mit der spielerisch leichten Hand des Nebenher betreibt. Deshalb gelingt ihm in der Literatur der große Erfolg, der ihm als Musiker und Komponist versagt bleibt.
Man kann also sagen, dass Hoffmanns Lebensstrategie, die bürgerlichen Normen zu befolgen, ohne sie zu verinnerlichen, dass die Doppelexistenz als Amtsschimmel und Pegasus sich nicht ungünstig auf seine künstlerische Arbeit ausgewirkt haben. Doch es bleibt ein Selbstzweifel: Ist nicht mangelnde künstlerische Kraft dafür verantwortlich, wenn es einem nicht gelingt, sein Leben ganz auf die Kunst zu gründen? Diese Frage ist in Hoffmanns Werk allgegenwärtig. Deshalb begegnen wir in seinen Erzählungen auch so häufig jenen Figuren, die aus ihrem bürgerlichen Beruf ausbrechen, um Künstler zu werden und dabei scheitern, weil sie ihre Kraft überschätzt haben. Sie reicht aus zur Abfahrt, nicht aber zur Ankunft. Die Phantasien über die Risiken des Aussteigens aus der bürgerlichen Sekurität um der Kunst willen verarbeiten jene Scham, die Hoffmann darüber empfindet, es ohne die äußere Sicherheit des Lebens nicht ausgehalten zu haben. Die Mächte des bürgerlichen Lebens, die er hasst, weil sie ihn konditionieren, an sie lehnt er sich doch auch an. Die Philisterwelt, sonst Zielscheibe seines vernichtenden Spotts, auf die Sicherheit, die sie zu bieten hat, mag er nicht verzichten. Seine Spießer-Kritik hat deshalb auch etwas Versöhnliches, und wo sie radikal ist, da ist sie doch auch zerknirscht.
Befehle nennt Canetti einmal »Stachel«, die zurückbleiben in dem, der ihnen gehorcht. Hoffmann hat den Befehlen seiner Umwelt und seiner Familie oft gehorcht. Er ist davon ganz »stachelig« geworden. Die »Befehlsstachel« machen sich bei ihm besonders schmerzhaft bemerkbar, weil sie Fremdkörper bleiben, nicht verinnerlicht werden; denn er hat sie von einer Familie empfangen, die er nicht liebt, die er sogar herzlich verachtet. Wer den Spuren der »gänsedummen Bocksprünge des gemeinen maulaffenden Pöbels« (1.5.1795) — so bezeichnet Hoffmann einmal seine Familie — folgt, der hat sich etwas vorzuwerfen, dessen Selbstachtung nimmt Schaden.
Man könnte meinen, Hoffmann habe an der Familie gelitten, weil sie bürgerlich-konventionell war und wenig Verständnis für sein exzentrisches, phantasievolles, der künstlerischen Leidenschaft ergebenes Wesen aufbrachte. Das ist sicherlich der Fall, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Es ist nicht die Bürgerlichkeit allein, sondern die Bürgerlichkeit ohne Format, die ihn beengt. Gegenüber seinem Freund Hippel, dessen Familie kaum weniger sittenstreng, auf Anstand, Herkommen und Ordnung bedacht war, äußert er einmal: »Was hat mir das Geschick für Verwandte gegeben! Hätt ich einen Vater und einen Onkel wie Du, mir würde ja dergleichen (Spott über die Verwandten, R. S.) nicht in den Sinn kommen.« Hippels Onkel, der Königsberger Stadtpräsident, ist zu diesem Zeitpunkt (Anfang 1790) nicht mehr der lockere, etwas rokokohafte, lebenslustige Bonvivant, der er einmal war, sondern ein steifer, förmlicher, auf Ehrbarkeit bedachter Pedant. Aber eben einer mit hohem Ansehen, mit Vermögen und stattlichem Haus. Er ist nicht weniger konventionell als Hoffmanns Anverwandte. Er hätte es zum Beispiel nie geduldet, wenn sein Neffe eine andere als die staatsmännisch-juristische Laufbahn hätte einschlagen wollen. Doch seine Konventionalität kommt aus dem sozialen Stolz, nicht aus der kleinlichen Angst vor den Leuten. Die Starrheit des alten Hippel ist großspurig, die der Doerffers kleinkariert.
»Du bist … von Deiner Familie umgeben gewesen«, schreibt Hoffmann in einem Brief an Hippel vom 6.3.1806, »ich habe keine — Du sollst für den Staat leben und steigen, mich fesselt eine elende Mediokrität, in der ich sterben und verderben kann.«
Die soziale Stellung der Doerffers war, solange der Großvater, der Hofgerichtsadvokat und Konsistorialrat Johann Jacob Doerffer, noch lebte, durchaus nicht »medioker« gewesen. Doch nach des alten Doerffers Tod beginnt sich das zu ändern. Ein Haus, dem ein gescheiterter Beamter, eine sitzengebliebene und eine geschiedene Frau mit ihrem Kind — geschieden von einem Manne, der nicht den besten Ruf hat — angehören, ein solches Haus verliert langsam die Reputation, auch wenn ihm noch die alte Konsistorialrätin vorsteht. Und wenn man sich dann noch vom gesellschaftlichen Leben der Stadt so zurückzieht, wie das die Doerffers tun, ist das ehemalige Prestige bald aufgezehrt. Langsam wächst bei den Doerffers die Angst vor dem Abstieg. Die Angst macht eng. Überanpassung an Normen, vor denen man auf keinen Fall versagen will, ist die Folge. Wenn ein selbstbewusst-gelassener Umgang mit der Konventionalität fehlt, verliert diese an Überzeugungskraft. Die ängstliche Weitergabe von Normen bleibt ohne Autorität. Wenn Hoffmann seiner Familie bei Gelegenheit vorwirft, sie sei zu schwach gewesen, ihn zu lehren, sich in die Umstände zu »schicken« (Brief an Hippel vom Frühjahr 1803), dann bezieht er sich auf diese Art des Autoritätsverlustes.
Mit dem langsamen Abstieg der Familie hängt auch zusammen, dass die geselligen Musikabende im Hause Doerffer fast ganz aufhören. Nur sehr frühe Kindheitserinnerungen Hoffmanns berichten davon. Man trieb damals beträchtlichen Aufwand. Manchmal war der Stadtpfeifer zu Gast, brachte auch seine Gesellen mit. Es wurden kleine Sinfonien gespielt, der Knabe durfte auf die Pauke hauen. An einen flötenden Zollinspektor erinnert sich Hoffmann, der sich im Atem so gewaltig übernahm, dass er die Lichter am Notenpult ausblies. Die Damen vereinigten sich zum Gesang und intonierten Chöre aus populären Singspielen. Man stellte lebende Bilder, die der alte Podbielski, der Domorganist von Königsberg, auf einem knarrenden Flügel begleitete. Dazwischen wurde Punsch und Tee getrunken. Einmal war sogar eine pensionierte Hofsängerin zu Gast. Sie brachte einen Hauch Rokoko in das bürgerliche Gesellschaftszimmer. Im reich verzierten, eng geschnürten bunten Kleid trug sie Bravourarien vor. Im aufgesteckten und gepuderten Haar nickten Porzellanblumen zum Takt. Während der Pausen schnupfte sie aus einer Porzellandose, die wie ein Mops aussah. Man bewunderte die Demoiselle und hielt sich viel darauf zugute, ihrer nicht mehr ganz reinen Stimme lauschen zu dürfen.
Das alles war für den heranwachsenden Hoffmann die versinkende Welt der frühesten Kindheit.
Jetzt ist es im Hause still geworden. Gesellschaften werden nur noch selten gegeben. Die Doerffers schirmen sich ab. So wächst Hoffmann auf, in »dürrer Heide«, wie er einmal schreibt.
Seine Umwelt muss er sich alleine entdecken und erobern.
Zweites Kapitel
Eine Jugend in Königsberg
»Eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, in welchem sich die Landescollegia der Regierung desselben befinden, die eine Universität (zur Kultur der Wissenschaft) und dabei noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch Flüsse aus dem Inneren des Landes sowohl, als auch mit angrenzenden entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen und Sitten, einen Verkehr begünstigt, — eine solche Stadt, wie etwa Königsberg am Pregelflusse, kann schon für einen schicklichen Platz zu Erweiterung sowohl der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden; wo diese, auch ohne zu reisen, erworben werden kann.«
So begründet Kant1798 in der Vorrede zu seiner Anthropologie, weshalb er sich Menschen- und Weltkenntnis zutraut, ohne doch größere Reisen unternommen zu haben: Königsberg ist die Welt im Kleinen. Nicht alle Zeitgenossen haben so günstig über die Pregelstadt gedacht. Ihr prominentester Kritiker ist Friedrich der Große. »Müßiggang und Langeweile sind, wenn ich nicht irre, die Schutzgötter von Königsberg, denn die Leute, die man hier sieht, und die Luft, die man hier atmet, scheinen nichts anderes einzuflößen«, schreibt er als Kronprinz und weigert sich später beharrlich, seinen Fuß in die gescholtene Stadt zu setzen. Er konnte der Stadt auch nicht verzeihen, dass sie im Siebenjährigen Krieg die russische Besetzung (1758—1762) schon fast freudig ertrug. Man hatte der Zarin über Gebühr gehuldigt. Königsbergs Musensöhne überboten sich in der Anfertigung von Lobgedichten. Die Schulchöre sangen zum Geburtstag der Zarin. Im Hause des russischen Gouverneurs traf sich alles, was Rang und Namen hatte. Den russischen Offizieren folgten die schönen Kurtisanen aus St. Petersburg und bezauberten die Königsberger Bürgersöhne. Die Galanterie zog ein. Das nüchtern protestantische Königsberg lockert sich. Die Russen bringen den Punsch mit, den Hoffmann so sehr schätzen wird. Die Zahl der Prostituierten und der unehelichen Kinder steigt. Handel und Gewerbe stehen in Blüte, denn das beschwingtere Lebensgefühl schafft neue Bedürfnisse, und die Zollschranken nach Russland sind für eine Zeitlang verschwunden. In diesen Jahren wird Königsberg wirklich weltoffen. Friedrich der Große hätte sich davon überzeugen können, hätte er die Stadt noch einmal aufgesucht.
Doch diese Blütezeit hält nicht an. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts — es ist Hoffmanns Königsberger Zeit — beginnt ein langsamer Abstieg, wirtschaftlich und politisch.
Königsberg ist Residenz der preußischen Könige. Im Mittelpunkt liegt das große Schloss. Ein beträchtlicher Teil der Stadt gehört zur sogenannten »königlichen Freiheit«; dort gibt es Sonderrechte, Sonderabgaben, besondere Verwaltung. Weil die Hohenzollern nur als Könige in Preußen (also nicht in der Mark Brandenburg) gelten durften, hatte die erste Königskrönung 1701 auch in Königsberg stattfinden müssen. Doch zum Mittelpunkt der Dynastie war die Stadt nie ausersehen. Die Königsberger Königswürde war für die Hohenzollern ein Vehikel zur Expansion nach Deutschland hinein. Königsberg blieb ein Stützpunkt am Ostrand; in Berlin zog man sogar seine Verlässlichkeit in Zweifel. Die russische Okkupationszeit immerhin hatte bewiesen, dass es mit der dortigen Anhänglichkeit ans Königshaus nicht weit her war.
Königsberg wird, wie die anderen Städte auch, in die zentralistische Verwaltungshierarchie eingefügt und verliert dabei althergebrachte städtische Selbstverwaltungsrechte. Der Magistrat wird zum ausführenden Organ der königlichen Kriegs- und Domänenkammer. Der Oberbürgermeister ist nicht mehr Repräsentant der Bürgerschaft, sondern königlicher Beamter. Er darf sich (Stadt-)Präsident nennen, wie andere Leiter königlicher Behörden auch.
Besonders hemmend wirkt sich das zentralistische Regime auf das Wirtschaftsleben aus. Handel und Gewerbe können sich in dem merkantilistischen Gestrüpp von Zöllen, Einfuhrverboten, Staatsmonopolen und Verwaltungsvorschriften nicht entfalten. Allein zwischen 1775 und 1780 gehen in Königsberg dreiundvierzig große Handelshäuser bankrott, darunter das bedeutendste, das Haus Saturgus. Die Kaufmannschaft wehrt sich gegen die Bevormundungen und Einschränkungen, worüber man sich in Berlin natürlich ärgert. Friedrich der Große in einem Reskript: »Die Sachen wegen des Preußischen Commerce sind schon öfters vorgewesen und kömt gar nichts damit heraus, als daß die dortigen Kaufleute lieber fremde Tücher und Stoffe als unsere verkauffen wollen. Das gehet aber nicht an, also ist mit den Leuten nichts anzufangen.«
Die Kaufleute ziehen in diesen Auseinandersetzungen zwar ökonomisch den Kürzeren, sie wissen aber die Stadtbevölkerung hinter sich. Ihr Selbstbewusstsein und ihr Ansehen steigen. Zum Beispiel scheut sich Kant, aus Achtung vor den Kaufleuten, seinen Diener Johannes Kauffmann bei seinem Nachnamen zu rufen, um nicht einen Unwürdigen mit einem solchen Ehrentitel in Verbindung bringen zu müssen.
Hoffmann hat dem Ansehen der Kaufmannschaft später auch seine Reverenz erwiesen — im Artushof. Diese Erzählung spielt allerdings in Danzig, das Königsberg inzwischen den Rang als Handelsmetropole abgelaufen hat.
Trotz des wirtschaftlichen Niedergangs wächst die Stadt. Am Ende des 18. Jahrhunderts zählt man ungefähr 50.000 Einwohner. Doch auch die Zahl der Armen nimmt zu. Die Bettelvögte sorgen dafür, dass sich das Elend versteckt hält. Betteln ist verboten. Die Allerärmsten werden aus der Stadt getrieben oder kommen ins Arbeitshaus. Das verrät den Geist der neuen Zeit, in die Hoffmann hineinwächst: Man will mit der alten »Unordnung« aufräumen. Es ist eine Zeit des Umbruchs.
Das Stadtbild verändert sich. Zwei fürchterliche Brandkatastrophen, 1764 und 1769, haben ganze Stadtteile in Schutt und Asche gelegt. Zuerst den Löbenicht, dann die Vorstadt. Der Neuaufbau ist zugleich eine städtebauliche Flurbereinigung. Das Verwinkelte, Ineinander-Geschachtelte des alten Stadtbildes verschwindet. Jetzt wird übersichtlich, gradlinig, schmucklos gebaut. Dem Nutzen, doch nicht dem Schönheitsempfinden wird Genüge getan. Das bemängeln schon die Zeitgenossen. Da man gerade beim Neuaufbau ist, wird auch manche alte, noch erhaltenswerte Bausubstanz zerstört. Die Zeit hat noch kein Verständnis für die Erhaltung alter Bauwerke. Abgerissen werden 1782 das Honigtor und das altstädtische Schmiedetor, 1790 das Holztor und die meisten Türme der Stadtmauer. Verschont wurden alte Gebäude nur dann, wenn der Stadtbaumeister errechnete, dass die Kosten des Abbruchs höher sein würden als der Gewinn, der aus dem Verkauf der Steine zu erzielen ist. Um künftig gegen Brände besser geschützt zu sein, verbietet eine baupolizeiliche Verordnung von 1782 die Verwendung von Fachwerk innerhalb der Stadt. Natürlich dauert es noch lange, bis die Fachwerkhäuser ganz aus dem Straßenbild verschwinden, aber das Todesurteil über sie war damit doch schon gesprochen.
1783 wird auf Antrag Immanuel Kants der erste Blitzableiter installiert. Es ist die Haberberger Kirche, die unter diesen technischen Schutz gestellt wird. Am Pregelufer entstehen neue Getreide- und Salzspeicher, nicht mehr aus Holz, sondern aus massivem Stein. Überall wird gebaut in dieser Zeit des Umbruchs. Doch man kommt nicht so schnell voran, wie man es wünscht. Noch 1792 gibt es 160 wüste Baustellen.
Alles will man »verbessern« — ganz im Geiste jenes aufklärerischen Regimes, das Hoffmann im Klein Zaches karikierte. Gegen den Brand, gegen die Überschwemmungen des Pregel will man bessere Vorkehrungen treffen. Wasser- und brandpolizeiliche Verordnungen füllen Foliobände. Man will Handel und Gewerbe verbessern und setzt dafür eine Kommission ein, die Vorschläge erarbeiten soll. Als diese dann die Abschaffung merkantilistischer Handelsbeschränkungen fordert, kommt aus Berlin der Bescheid: »So müsset Ihr Eure fünf Sinne da nicht zusammen gehabt haben …«
Man will die Zuchthäusler verbessern, indem man sie Choräle singen lässt. Kant, der das Pech hat, in der Nähe des Gefängnisses zu wohnen, stellt den Antrag, man möge den Gesang abstellen. Weil der Stadtpräsident Hippel zu seinen Freunden zählt, hat er damit Erfolg. Hippel seinerseits gehört ebenfalls zu den Verbesserern. Er schreibt ein Buch Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber (1792). Man will die Verrückten verbessern und richtet deshalb im Hospital »Tollstuben« ein. Die aufgeklärte Stadtregierung betätigt sich auch als Lichtbringerin: Sie vermehrt die Zahl der Straßenlaternen, verpachtet sie aber dann. Der Pächter fordert von den Anwohnern hohe Preise, die diese nicht zahlen wollen. Also bleibt es dunkel.
Der rationalistische Geist der Zeit war auch dem Brauchtum und den überlieferten Formen der Geselligkeit nicht gewogen. Hier wurde vieles niedergerissen und ausgelöscht, weil man es für nutzlos, verschwenderisch, abergläubisch, sittenlos oder einfach für unvernünftig hielt. Besonders dem unmäßigen Fressen und Saufen bei allen möglichen Festgelegenheiten — auch die Zahl der Feste wurde reduziert! — sollte Einhalt geboten werden. Berühmt-berüchtigt für solche Gelage waren vor allem die Bäckergesellen. Die Bäckerinnung, eine der wohlhabendsten der Stadt, hatte eine Gesellenherberge errichtet. Das Anbringen eines neuen Herbergsschildes war zum Beispiel für die Gesellen Grund genug, über zwei Tage hinweg ein opulentes Fest zu feiern. Die höchstens hundert Teilnehmer verbrauchten sechs Rinder, große Mengen Pökelfleisch, Karpfen und andere Fische, sechs Fass Bier, zwölf Pfund Kaffeebohnen und zwölf Schmalztöpfe. Sie ließen sich von den Stadtmusikanten aufspielen und veranstalteten einen Umzug.
Die Stadtverwaltung sieht in den alten Bräuchen überflüssige »Grillen und Usancen«. Die farbenprächtigen Umzüge der Zünfte werden verboten. Sie verlocken nur zum »Versäumnis der Zeit«, heißt es. Den Pauper-Schülern wird das Straßensingen untersagt mit der Begründung, es sei zur Bettelei ausgeartet. Das studentische Leben verliert an Farbigkeit. Man trägt jetzt bürgerliche Kleidung, und als die Studenten 1795 die Wiedereinführung der alten akademischen Tracht fordern, lehnt der Senat ab: Die Tracht sei zu teuer, reine Geldverschwendung, und hebe den Studenten zu sehr von den anderen Ständen ab. Wenn die Studenten an Sommerabenden mit ihrem Serenadenspiel durch die Straßen hinunter zum Pregel ziehen, fühlen sich prosaische Gemüter neuerdings in ihrer Ruhe gestört und erreichen bei den Behörden, dass man den Studenten das nächtliche Waldhornblasen verbietet.
Natürlich hören Geselligkeit und Vergnügen nicht auf. Sie ändern jedoch ihren Charakter. Der Sinn für das Zeremoniale des alten Brauchtums geht verloren. Die tradierte Strenge und Förmlichkeit erscheinen ebenso unzeitgemäß wie die tradierten Formen der Entladung und Enthemmung. Die alte Völlerei der Feste, ihre lange Dauer und Häufigkeit, das Derbe und Verschwenderische widersprechen dem bürgerlichen Geist des An-sich-Haltens, der sich jetzt ausbreitet. Das bürgerliche Milieu, in dem Hoffmann aufwächst, grenzt sich in seiner Geselligkeit doppelt ab: gegen die tradierte Strenge und die tradierte Wildheit. Man bewegt sich auf einer mittleren, moderaten Ebene. Noch halb private Einrichtungen der Geselligkeit sind die »Ressourcen«. Sie finden zumeist in Privathäusern statt; man treibt dort Konversation, liest die Zeitung und spielt Karten. Frauen bleiben ausgeschlossen. Erst in den Salons werden sie eine wichtige Rolle spielen. Die »Ressource« ist das Offizierskasino für bürgerliche Zivilisten. Hier kann die bürgerliche Männer-Elite sich lockern und erholen von der Zucht der Logen — einer sehr strengen und ambitionierten Form bürgerlicher und aristokratischer Geselligkeit. Zu Hoffmanns Zeiten gibt es in Königsberg zwei große Logen — die Dreikönigsloge und die Totenkopfloge. Fast alles, was in Königsberg etwas auf sich hält, gehört zu den Mitgliedern. Dort übt man sich in weltbürgerlicher Gesinnung, nimmt deshalb auch russische und polnische Diplomaten und Kaufleute auf sowie die französischen Beamten der im Übrigen verhassten preußischen Zoll- und Steuerverwaltung. In den Logen wird anstrengende Kulturarbeit geleistet. Hier kann man sich nicht gehen lassen. Hier wird man durch ein kompliziertes Filtersystem der sittlichen Veredelung geschleust. Die Hierarchie der Grade und Ränge soll die Stufen der Erkenntnis und Moralität zum Ausdruck bringen. Ein raffiniertes Spiel der Geheimhaltung, das die Hierarchie der Logen auch vor den Mitgliedern verbirgt, erzeugt das Gefühl, unter ständiger Beobachtung zu stehen; bei den Außenstehenden nährt dieser Geheimniskult misstrauische Phantasien über Macht und Einfluss der Logen. Darüber später mehr.
»Ressourcen« und Logen sind Institutionen der Entmischung des geselligen Lebens. Ihre Exklusivität verpflichtet zur Anstrengung, sich ihrer stets würdig zu erweisen. Wirkliche Erholung verschaffen sich die Bürger denn doch lieber in den öffentlichen Lokalen, die am Ende des Jahrhunderts wie Pilze aus dem Boden schießen. Bürgerliches Publikum findet man vor allem in den Wein- und Kaffeehäusern, in den Gartenlokalen, wo zum Tanz aufgespielt wird; hier sind auch die Frauen zugelassen, die Bürgertöchter und Ladenmädchen. Die Universität warnt die Studenten vor dem Besuch dieser Orte, besonders als sich die Prostituierten zu zahlreich unter die Gäste mischen. Die Warnungen bleiben wirkungslos, und die Universitätsgerichte müssen sich damit begnügen, einzelne Studenten, denen »unwürdiges Betragen« nachgewiesen werden kann, zu bestrafen. Zum »unwürdigen Betragen« gehörte auch der Besuch in einer der über sechzig Bierschenken der Stadt. Dort verkehrt das einfache Volk, die Gesellen, Manufakturarbeiter, Dienstboten. In manchen dieser Lokale findet auch ein Bordellbetrieb statt. Anders als in anderen großen Städten Preußens gibt es in Königsberg keine konzessionierte Anstalt dieser Art. Das »Laster« war dort nicht kaserniert. Ob Johannes Timotheus Hermes aber recht hatte, als er 1778 behauptete, »daß das Sprichwort ›große Städte große Sünden‹ nirgend so wenig zutrifft wie in Königsberg«, darf bezweifelt werden.
Hoffmann, der später einen beträchtlichen Teil seiner wachen Stunden in Weinhäusern verbringen wird, ist in seiner Studentenzeit noch ein mäßiger Besucher öffentlicher Lokale. Sein Glas Wein trinkt er lieber zu Hause, zumeist im vertrauten, seelenvollen Gespräch mit Hippel, seinem Freund.
Der rationalistische Geist hält am Ende des 18. Jahrhunderts auch Einzug in die höhere Schule. »Jeder ein Theologus« — diese Losung über dem Portal der Burgschule, die Hoffmann besuchte, wird 1779 umgeändert in: »Jeder ein Philosophus«. Der Rektor dieser Schule zu Hoffmanns Zeiten, der polnische Prediger Stephan Wannowski, war bekannt für seinen Unterricht in »natürlicher Religion und Moral«. Ganz im Sinne Kants lehrt er die Religion als vernünftiges System der Sittlichkeit und zeigt großes Geschick darin, auch an antiken Texten ihre Wirksamkeit und Verbindlichkeit zu demonstrieren. Die Säkularisierung ist eben im vollen Gange. 1795 wird zum ersten Mal ein Nichttheologe Rektor einer Lateinschule. Es ist Michael Hamann, der Sohn des berühmten alten Hamann. Die Kneiphöf’sche Schule verkauft ihre theologischen Werke und schafft aus dem Erlös eine Elektrisiermaschine an.
Die Königsberger Universität, die »Albertina«, zählt während Hoffmanns Studienzeit nicht zu den bedeutenden des deutschen Sprachgebietes. Daran kann auch Kants Ruhm nichts ändern. Halle, Leipzig und Jena — das waren damals die akademischen Metropolen. Die Zahl der Studenten in Königsberg ging zurück. Wäre Kant nicht gewesen, der Rückgang wäre noch dramatischer ausgefallen. Immerhin saßen in Kants Vorlesungen — morgens von 7 bis 9 Uhr — bisweilen ein Drittel aller immatrikulierten Studenten, und dies obwohl Kants Vortragsweise wenig attraktiv gewesen sein soll. Fichte jedenfalls notiert 1791: »Sein Vortrag ist schläfrig.« Seit 1792, Hoffmann beginnt in diesem Jahr sein Studium, reduziert Kant seine Lehrtätigkeit.
Während draußen in der geistigen Welt seine Gedanken wie Blitze einschlagen, kämpfen die Hörer in den Kollegs gegen das Schlafbedürfnis. Das mag an den frühen Morgenstunden gelegen haben, doch auch daran, dass Kant, pflichtschuldig und pedantisch, nicht nur über die »heißen« Themen seines Kritizismus las, sondern sich auch enzyklopädisch über alle möglichen Gebiete des Wissens verbreitete: Geographie, Pädagogik, Sternenkunde, Kameralistik und Anthropologie in pragmatischer Absicht.
Hoffmann hat Kants Vorlesungen wahrscheinlich nie besucht. An den Geschicken dieser Philosophie hat er kaum Anteil genommen. Auch nicht, als es Mitte der neunziger Jahre zu einem großen Eklat um Kant kommt: Seine zu Ostern 1793 in Jena erschienene Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft wird wegen unzulässiger Kritik an Kirche und Offenbarungsglauben verboten. Im Sommer 1794 muss Kant sogar eine Inhaftierung befürchten und sieht sich deshalb nach einer Zuflucht um, wo er sein Leben »sorgenfrei zu Ende« bringen kann. Kant darf dann doch weiter lehren, muss aber versprechen, künftighin über Religionsdinge zu schweigen. Die theologischen und philosophischen Kollegen verpflichteten sich, die Kant’sche Religionslehre zu ignorieren. Dabei bleibt es bis zum Ende der Regierungszeit von Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1797. Mit dem Tode des Königs erlischt auch die unheilvolle Macht der Wöllner und Bischoffwerder, jene bei den Aufklärern verhassten »Dunkelmänner«, die schon Friedrich der Große »betrügerische und intrigante Pfaffen« genannt hatte. Jetzt kann man in Religionsdingen wieder frei sich äußern, was Kant dann auch tut. Diese ganze Zensuraffäre hat in Königsberg natürlich viel Aufsehen erregt, wovon sich aber in Hoffmanns Jugendbriefen nicht die geringste Spur findet. Erst nach seiner Studienzeit hat sich Hoffmann mit Kant auseinandergesetzt. Das blieb nicht ohne Wirkung.
Trotz Kant fehlte an der Königsberger Universität die bewegende Unruhe einer geistigen Auseinandersetzung. Der preußische Kultusminister, Freiherr von Zedlitz, ein Bewunderer des Philosophen, musste 1775 in gut absolutistischer Manier den Professoren in Königsberg befehlen, sich endlich mit der Kant’schen Philosophie zu beschäftigen. Ihnen wurde die »Beschränktheit« schlicht verboten. Vielleicht hätte man ihnen besser eine gute Bezahlung geboten, denn bedeutende akademische Lehrer verließen die Stadt; die Besoldung in Königsberg war doch gar zu schlecht. In Halle zum Beispiel konnte ein Professor das Mehrfache verdienen. Kant war einer der wenigen, die trotz lukrativer Angebote der »Albertina« treu blieben. Nur durch ihn sind später im Geistesleben berühmte Männer vorübergehend nach Königsberg gezogen worden: Fichte, Herder, Lenz, Moses Mendelssohn, Gentz. Vielleicht hat auch die erdrückende Autorität Kants dazu beigetragen, dass es im übrigen Lehrkörper so wenig Köpfe von Bedeutung gab. An bizarren Originalen allerdings war an der Universität kein Mangel: Ein Professor Johannes Stark etwa entwickelte ein Wahnsystem, wonach die Französische Revolution von einem Geheimbund in Ingolstadt gesteuert worden sei; und der Orientalist Johann Gottfried Hasse versuchte nachzuweisen, dass das Samland das Paradies der Bibel und der Bernsteinbaum der Baum des Lebens gewesen sei. Die rationalistischen Kollegen haben wenigstens Humor bewiesen, als sie behaupteten, nach den Resten der Arche Noah müsse man nun bei Insterburg suchen.
Hoffmann wächst in ein Zeitalter hinein, das die Leidenschaft des Lesens entdeckt. In Königsberg wirken mehrere tüchtige Verleger, es gibt Leihbibliotheken, Buchhandlungen. In den »Ressourcen«, den Wein- und Kaffeehäusern liegen Zeitungen aus. Einer der Verleger, Kanter, richtete auch eine Bücherstube ein, in der die intellektuelle Prominenz der Stadt verkehrte und dort von bildungshungrigen Gymnasiasten, die ebenfalls zugelassen waren, bestaunt werden konnte. Da dieser Treffpunkt bis Anfang der neunziger Jahre bestand, ist es sehr gut möglich, dass auch der junge Hoffmann sich unter den neugierigen Zaungästen befand.
Eine Literaturzeitschrift von einigem Rang gab es in Königsberg nicht. Es wurden zwar mehrere Versuche in diese Richtung unternommen — die Preußische Blumenlese, das Königsbergsche Wochenblatt voll Scherz und Ernst, die Laterna magica —, aber all diese Blätter blieben kurzlebig und hatten nur geringe Verbreitung. In Königsberg war eben doch eher der prosaische Geist heimisch. Als Organ der literarischen Jugend galt Das preußische Tempe: Junge Beamte, Gymnasiasten, Offiziere und feinsinnige Handwerker belieferten das Blatt mit Gedichten und Prosatexten, teils im empfindsamen, teils im rationalistischen Stil. Auch rokokohafte Idyllik wurde gepflegt. Der Geist des Sturm und Drang allerdings war hier stark herabgestimmt.
Eine moralische Wochenschrift konnte im aufgeklärten Königsberg natürlich auch nicht fehlen. Sie hieß Agathosyne und wurde von Hans Friedrich Lehmann, dem späteren Begründer des Tugendbundes, und einem Feldprediger herausgegeben. Doch sie konnte sich gegen die flächendeckende moralische Wochenblattaufklärung, die von Hamburg und Halle aus betrieben wurde, nicht durchsetzen.
Die Zeitungen und Zeitschriften spiegeln insgesamt den Geist der Zeit: Gefühlsüberschwang und Verstand, östliche Mystik und preußische Rationalität, nüchterner Alltag und Nachtseiten der Natur, galante Anakreontik und bürgerliche Idylle, Schlüpfriges und Moralisches.
Weniger kamen die politischen Strömungen der Zeit zum Ausdruck; das wusste eine Zensur zu verhindern, die in Königsberg besonders wirkungsvoll gearbeitet zu haben scheint. Für »revolutionären Schwindelgeist und politische Neuerungssucht« sei in Königsberg kein Platz, erklärten die Behörden mit Blick auf die Berichterstattung über die Französische Revolution. Doch sickerte genügend durch, um auch unter den politisch abgekühlten Königsbergern einige Erregung hervorzubringen. In Königsberg wurde kein Freiheitsbaum aufgepflanzt wie in Tübingen, keine Fensterscheiben gingen zu Bruch wie in Darmstadt und Jena, auch weiß man nichts von Revolutionären Clubs, wie sie etwa in Mainz und Frankfurt bestanden, doch immerhin: Debattiert wurde auch hier, in den Gartenlokalen, Bierschenken und natürlich an der Universität, wo der große Kant aus seiner Bewunderung für die Revolution keinen Hehl machte. Der junge Hoffmann hat sich nicht anstecken lassen. Fast trotzig blieb er kühl und desinteressiert.
Wie die politischen Leidenschaften ist auch das Theaterfieber, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts überall in Deutschland grassierte, zwar an Königsberg nicht vorbeigegangen, wird aber hier ins Moderate abgedämpft.
Seit der Mitte des Jahrhunderts hat Königsberg ein festes Theatergebäude (für 300 Personen), aber kein ständiges Ensemble. Die Räume werden an private Theaterunternehmer vermietet. Manchmal geben auch Seiltänzer, Wurmdoktoren, Taschenspieler, Dompteure und Luftspringer ihre Vorstellungen. Gelegentlich finden dort auch Maskenbälle, sogenannte Redouten, statt, bei denen die leichten Mädchen besonders reichlich vertreten waren, zum Ärger der auf Sittsamkeit bedachten Stadtverwaltung, die mehrfach, allerdings ohne Erfolg, dagegen einschritt.
Zwischen 1771 und 1787 sorgte die tüchtige Prinzipalin Caroline Schuch für die theatralische Unterhaltung der Königsberger. Wie die Neuberin in Leipzig, so vertrieb Caroline in Königsberg den Hanswurst von der Bühne. Doch musste auch sie dem Zeitgeschmack Rechnung tragen, der das »reine« Theater gern durch Gymnastik- und Zaubereinlagen aufgelockert sehen mochte. Caroline und ihr Sohn, der nach ihr 1787 die Leitung des Unternehmens übernimmt, haben viel für die Reputation des Theaters getan. Shakespeare, Diderot, Beaumarchais wurden häufig gegeben. Die Emilia Galotti führte man noch im selben Jahr auf, in dem Lessing sie in Wolfenbüttel vollendete. Goethe war als Theaterautor wenig gefragt. Erst 1815 kam der Götz auf die Bühne. SchillersRäuber glaubte man verbessern zu müssen. Ein gewisser Plümicke hat das besorgt. Man präsentierte das Stück 1785 den Königsbergern, von »Unflat« und politischem Wildwuchs gereinigt. Die Lustspiele der Königsberger Lokalmatadore Jester und Baczko waren im Spielplan reichlich vertreten. Noch reichlicher die von Kotzebue und Iffland. Wie in anderen Städten auch gaben das Theater und insbesondere seine Schauspielerinnen Anlass zu heftigen Debatten. Als zum Beispiel ein von Hippel anonym verfasstes Trauerspiel bei der Premiere abgelehnt wird, prangt schon am nächsten Morgen ein Spottgedicht am Laternenpfahl auf dem Roßgärter Markt. Einmal brannte der Sohn eines angesehenen Akzisebeamten mit einer Schauspielerin durch. Der verwitwete Vater holt die beiden zurück. Die Stadt lacht, als er wenig später die besagte Schauspielerin heiratet. Den Sohn treibt die Eifersucht in die Armee. Er stiehlt die Regimentskasse und setzt sich nach Amerika ab. Er soll dort eine Theatertruppe gegründet haben.
Nach damals üblichem Brauch war das Theaterensemble auch zuständig für die Aufführung von Opern und Singspielen. Schauspieler mussten zugleich auch Sänger sein. Die zumeist sängerisch nicht ausgebildeten Schauspieler bevorzugten deshalb das Singspiel, das geringere Ansprüche stellte. Auch beim Publikum erfreute es sich großer Beliebtheit, sehr zum Unwillen der vernünftigen Kritiker. »Was lehren uns alle diese Operetten? Welche Tugend erheben sie«, heißt es in einer Rezension von 1773. Singspiele (oder Operetten, dazwischen unterschied man nicht) waren durch Gesangspartien aufgelockerte Lustspiele mit stark reduzierter und stereotyper Handlung. Die Schauspielertruppen fertigten sie oft selbst an, sozusagen für den Hausgebrauch. Sie lieferten die »Schlager«, die in »gesellschaftlichen Zirkeln, ja selbst von der niederen Volksklasse auf öffentlicher Straße« nachgesungen wurden, wie der Königsberger Komponist Friedrich Ludwig Benda1791 schreibt. Er selbst hat auch eine große Zahl von Singspielen komponiert. Seine Louise und Fanchon, das Leiermädchen von Friedrich Heinrich Himmel waren damals die großen »Renner«: Sie wurden über dreißigmal gegeben. Zum Vergleich: MozartsDon Giovanni erlebte 1793 sechs Aufführungen. Das war für die ernste Oper ein großer Erfolg. Mit ihm wurde die langjährige Alleinherrschaft des Singspiels gebrochen. Ein Jahr später versetzte die Zauberflöte die Königsberger in Begeisterung. Hoffmann, der schon zuvor Mozart für sich entdeckt hatte, besuchte die Aufführungen. Die Mozart’schen Opern erreichten schließlich eine Popularität, wie sie bisher nur den Singspielen zuteilgeworden war. Manche Arie wurde zum Straßenlied.
Zu besonderer Berühmtheit unter den Sängerinnen brachte es 1784 die damals erst siebzehnjährige Minna Brandes, Tochter der von Lessing hochgeschätzten Schauspielerin Charlotte Brandes. Das Mädchen wurde in den Salons herumgereicht, wo die Musikliebhaber sie und ihre Stimme bewunderten. Manche der gesetzten Herren ließen sich zu Gedichten, wenn nicht zu mehr hinreißen. Sogar der Stadtpräsident Hippel, ein notorischer Junggeselle, und der würdige Universitätskanzler L’Estocq sollen sich in sie verliebt haben. Zum Stadtgespräch wurde die schöne Minna vollends, als bekannt wurde, dass sie an einer gefährlichen Krankheit litt, die ihr das Singen nicht mehr erlaubte. Sie starb 1788. Noch lange sprach man über sie, über ihre Stimme und über die heimtückische Krankheit. Sicherlich hat der junge Hoffmann davon gehört. Vielleicht ist sie das Urbild für Antonia im Rat Krespel, die auch von einer Krankheit befallen ist, die das Singen zur tödlichen Gefahr werden lässt.
Königsberg scheint damals eine sehr musikliebende Stadt gewesen zu sein. Lobend äußert sich ein Zeitgenosse im März 1800 in der hochangesehenen Allgemeinen Musikalischen Zeitung