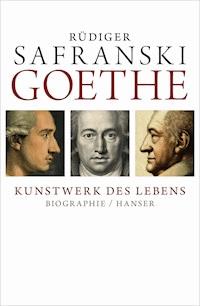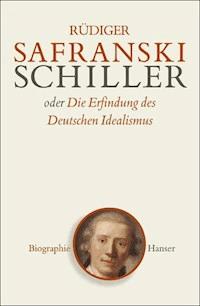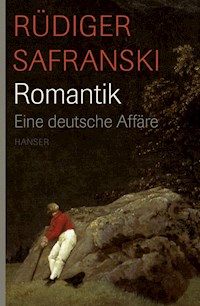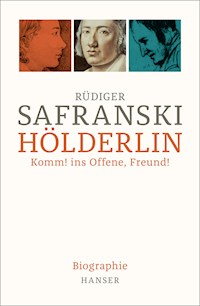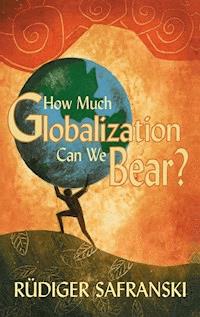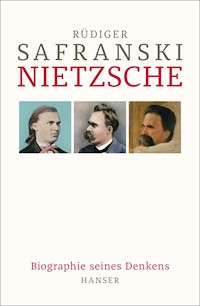
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie kaum ein Zweiter hat Friedrich Nietzsche das Denken der Moderne geprägt. Er sei Dynamit, behauptete er von sich selbst. Man kann sich sein Denken als ein Laboratorium vorstellen, in dem mit provozierenden, bisweilen riskanten Argumenten experimentiert wird. Seine Philosophie ergibt kein System, sondern lebt vielmehr von ihrer inneren Dynamik. Eine „Biografie seines Denkens“ nannte Rüdiger Safranski sein bedeutendes, höchst erfolgreiches Nietzsche-Buch, das zum 100. Todestag erschien und in viele Sprachen übersetzt wurde.
Zum 175. Geburtstag am 15. Oktober 2019 erscheint eine Neuausgabe dieses Standardwerks, erweitert um ein Nachwort, das die ungebrochene Aktualität von Nietzsches Denken herausstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Wie kaum ein Zweiter hat Friedrich Nietzsche das Denken der Moderne geprägt. Er sei Dynamit, behauptete er von sich selbst. Man kann sich sein Denken als ein Laboratorium vorstellen, in dem mit provozierenden, bisweilen riskanten Argumenten experimentiert wird. Seine Philosophie ergibt kein System, sondern lebt vielmehr von ihrer inneren Dynamik. Eine »Biografie seines Denkens« nannte Rüdiger Safranski sein bedeutendes, höchst erfolgreiches Nietzsche-Buch, das zum 100. Todestag erschien und in viele Sprachen übersetzt wurde.
Zum 175. Geburtstag am 15. Oktober 2019 erscheint eine Neuausgabe dieses Standardwerks, erweitert um ein Nachwort, das die ungebrochene Aktualität von Nietzsches Denken herausstellt.
Rüdiger Safranski
Nietzsche
Biographie seines Denkens
Carl Hanser Verlag
Es ist durchaus nicht nöthig, nicht einmal erwünscht, Partei für mich zu nehmen: im Gegentheil, eine Dosis Neugierde, wie vor einem fremden Gewächs, mit einem ironischen Widerstande, schiene mir eine unvergleichlich intelligentere Stellung zu mir.
Friedrich Nietzsche an Carl Fuchs, 29. Juli 1888
Inhaltsübersicht
Erstes Kapitel
Zwei Leidenschaften: Das Ungeheure und die Musik. Wie leben, wenn die Musik vorbei ist? Postsirenische Traurigkeit. Ernüchterung. Versuch und Versuchung.
Zweites Kapitel
Ein Knabe schreibt. Das Dividuum. Blitz und Donner. Lebensläufe finden und erfinden. Prometheus und andere. Erster Versuch mit der Philosophie: »Fatum und Geschichte«. Ideenozean und Fernweh.
Drittes Kapitel
Selbstprüfungen. Philologische Diät. Das Schopenhauer-Erlebnis. Das Denken als Selbstüberwindung. Verklärte Physis und der Genius. Zweifel an der Philologie. Der Wille zum Stil. Erste Begegnung mit Wagner.
Viertes Kapitel
Der Wirbel des Seins. Die Geburt der »Geburt der Tragödie«. Grausamkeit am Grunde. Nietzsche im Krieg. Sklaven. Moralisches vs. ästhetisches Denken. Angst vor dem Aufstand. Einblicke ins Betriebsgeheimnis der Kultur. Lichtbilder und Sichtblenden vor dem Ungeheuren. Dionysische Weisheit.
Fünftes Kapitel
Nietzsche und Wagner: Gemeinsame Arbeit am Mythos. Romantik und Kulturrevolution. Der »Ring«. Nietzsches Arbeit am Meister. Die Wiederkehr des Dionysos. Untergangsvisionen und »Verzückungsspitze«. Desillusionierung in Bayreuth.
Sechstes Kapitel
Die Geister der Epoche. Das Denken im Arbeitshaus. Die großen Entzauberungen. Die »Unzeitgemäßen Betrachtungen«. Gegen Materialismus und Historismus. Befreiungsschläge und Entgiftungskuren. Mit Max Stirner und über ihn hinaus.
Siebtes Kapitel
Abschied von Wagner. Sokrates lässt nicht los. Die Universalheilkraft des Wissens. Notwendige Grausamkeiten. Der Versuch mit der Kälte.Fallende Atome im leeren Raum. »Menschliches, Allzumenschliches«.
Achtes Kapitel
»Menschliches, Allzumenschliches«. Chemie der Begriffe. Logische Weltverneinung und Lebenstüchtiger Pragmatismus. Das Ungeheure des Sozialen. Mitleid. Heiterer Naturalismus. Kritik der Metaphysik.Das Rätsel des erkenntnislosen Seins. Kausalität statt Freiheit.
Neuntes Kapitel
Abschied vom Professor. Das Denken, der Leib, die Sprache. Paul Reé. Von »Menschliches, Allzumenschliches« zur »Morgenröthe«. Die unmoralischen Gründe der Moral. Tempelschänderische Griffe. Religion und Kunst auf dem Prüfstand. Das Zweikammersystem der Kultur.
Zehntes Kapitel
»Morgenröthe«. Wahrheit oder Liebe? Zweifel an der Philosophie. Nietzsche als Phänomenologe. Die Lust des Erkennens. Der Columbus der inneren Welt. Die Grenzen der Sprache und die Grenzen der Welt.Die große Inspiration am Surlej-Felsen.
Elftes Kapitel
Kosmisch denken in Sils Maria. Entmenschlichte Natur. Erhabene Rechnungen. Die Lehre von der ewigen Wiederkunft. Der Heilige Januar in Genua. Glückliche Tage, fröhliche Wissenschaft. Messina.
Zwölftes Kapitel
Homoerotisches. Der sexuelle Dionysos. Die Geschichte mit Lou Salomé. Zarathustra als Bollwerk. Menschliches und Übermenschliches. Das darwinistische Missverständnis. Vernichtungsphantasien. »Wie ich der tragischen Gebärden und Worte satt bin.«
Dreizehntes Kapitel
Noch einmal Zarathustra. Das Leichte, das so schwer ist. Der Wille zur Liebe und der Wille zur Macht. Vorstufen und Entfaltung. Die Gewalt und das Weltspiel. Das offene Problem: Selbststeigerung und Solidarität. Abzweigungen auf dem Weg zum ungeschriebenen Hauptwerk: »Jenseits von Gut und Böse« und »Zur Genealogie der Moral«.
Vierzehntes Kapitel
Das letzte Jahr. Über sein Leben denken. Um sein Leben denken. Das Lächeln der Auguren. Fatalität und Heiterkeit. Das Schweigen des Meeres. Das Finale in Turin.
Fünfzehntes Kapitel
Europas Edelfäule entdeckt Nietzsche. Konjunktur der Lebensphilosophie. Das Nietzsche-Erlebnis Thomas Manns. Bergson, Max Scheler, Georg Simmel. Zarathustra im Krieg. Ernst Bertram und Ritter, Tod und Teufel. Alfred Baeumler und der heraklitische Nietzsche. Anti-Antisemitismus. Auf Nietzsches Spuren: Jaspers, Heidegger, Adorno/ Horkheimer und Foucault. Dionysos und die Macht. Eine Geschichte ohne Ende.
Nachwort
Chronik
Abkürzungen
Quellen
Literatur
Erstes Kapitel
Zwei Leidenschaften: Das Ungeheure und die Musik. Wie leben, wenn die Musik vorbei ist? Postsirenische Traurigkeit. Ernüchterung. Versuch und Versuchung.
Die wahre Welt ist Musik. Musik ist das Ungeheure. Hört man sie, gehört man zum Sein. So hat Nietzsche sie erlebt. Sie war ihm ein und alles. Sie sollte niemals aufhören. Doch sie hört auf, und deshalb hat man das Problem, wie man weiterleben kann, wenn die Musik vorbei ist. Am 18. Dezember 1871 reist Nietzsche von Basel nach Mannheim, um dort Wagner-Musik, vom Komponisten dirigiert, zu hören. Nach Basel zurückgekehrt, schreibt er am 21. Dezember an seinen Freund Erwin Rohde: Alles was (…) sich gar nicht mit Musikrelationen erfassen lassen will, erzeugt bei mir (…) geradezu Ekel und Abscheu. Und wie ich vom Mannheimer Concert zurückkam, hatte ich wirklich das sonderbar gesteigerte übernächtige Grauen vor der Tageswirklichkeit: weil sie mir gar nicht mehr wirklich erschien, sondern gespenstisch. (B 3,257)
Der Wiedereintritt in die musikferne Lebensatmosphäre ist ein Problem, über das Nietzsche unablässig nachgedacht hat. Es gibt ein Leben nach der Musik, aber hält man es aus? Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum (6,64), schreibt er einmal.
Die Musik schenkt Augenblicke der richtigen Empfindung (1,456; wb), und man könnte sagen, Nietzsches ganze Philosophie ist der Versuch, sich am Leben zu halten, auch wenn die Musik vorbei ist. Nietzsche will, so gut es geht, mit Sprache, Gedanken und Begriffen musizieren. Aber natürlich bleibt ein Ungenügen. Sie hätte s i n g e n sollen, diese ›neue Seele‹ — und nicht reden! (1,15; gt), schreibt Nietzsche in der später verfassten selbstkritischen Vorrede zum Tragödienbuch von 1872. Und es bleibt auch eine Traurigkeit. In den nachgelassenen Fragmenten aus dem Frühjahr 1888 findet sich folgende Notiz: Die Thatsache ist ›daß ich so traurig bin‹; das Problem ›ich weiß nicht was das zu bedeuten hat‹ … ›Das Märchen aus alten Zeiten‹ (13,457). Er ist auf den Spuren Heines, und es kommt ihm die Lorelei in den Sinn. Nietzsche hat den Gesang der Sirenen gehört und empfindet nun Unbehagen in einer Kultur, wo die Sirenen verstummt sind und die Lorelei nur noch als Märchen aus alter Zeit herumspukt. Nietzsches Philosophie entspringt der postsirenischen Traurigkeit und möchte wenigstens den Geist der Musik hinüberretten ins Wort, ein Echo des Abschieds und eine Einstimmung auf die mögliche Wiederkehr der Musik, damit der Bogen des Lebens nicht breche (1,453; wb).
Lange Zeit war es bekanntlich die Musik Wagners, woran Nietzsche die Fülle des Glücks beim Kunstgenuss ermaß. Nachdem er zum ersten Mal, noch vor der persönlichen Begegnung mit Wagner, die Ouvertüre zu den »Meistersingern« gehört hatte, schrieb er am 27. Oktober 1868 an Rohde: jede Faser, jeder Nerv zuckt an mir, und ich habe lange nicht ein solches andauerndes Gefühl der Entrücktheit gehabt (B 2,332). Das Gefühl der Entrücktheit ist allerdings noch stärker beim eigenen Improvisieren am Klavier, dem er sich stundenlang hingeben konnte, selbstvergessen, weltvergessen. Eine berühmte und berüchtigte Szene, die der Jugendfreund Paul Deussen berichtet, hat mit solcher Entrückung zu tun. »Nietzsche«, so Deussen, »war eines Tages, im Februar 1865, allein nach Köln gefahren, hatte sich dort von einem Dienstmann zu den Sehenswürdigkeiten geleiten lassen und forderte diesen zuletzt auf, ihn in ein Restaurant zu führen. Der aber bringt ihn in ein übelberüchtigtes Haus. ›Ich sah mich‹, so erzählt mir Nietzsche am anderen Tage, ›plötzlich umgeben von einem halben Dutzend Erscheinungen in Flitter und Gaze, welche mich erwartungsvoll ansahen. Sprachlos stand ich eine Weile. Dann ging ich instinktmäßig auf ein Klavier als auf das einzig seelenhafte Wesen in der Gesellschaft los und schlug einige Akkorde an. Sie lösten meine Erstarrung und ich gewann das Freie‹.« (Janz 1, 137)
Musik, diesmal sind es nur einige improvisierte Akkorde, triumphiert über die Wollust. Dazu passt eine Notiz von 1877, wo Nietzsche ein Register der Dinge nach dem Grade der Lust aufstellt. Ganz oben rangiert das musikalische Improvisieren, gefolgt von Wagnerscher Musik, zwei Stufen darunter erst die Wollust (8,423). Im Kölner Bordell genügen einige Akkorde, um ihn in ein Anderswo entweichen zu lassen. Mit Akkorden beginnt, was am besten nie mehr endet, der Improvisationsfluss, in dem man sich treiben lassen kann. Darum auch schätzt Nietzsche die Wagnersche unendliche Melodie, die sich fortspinnt wie eine Improvisation, die beginnt, als hätte sie schon längst begonnen, und wenn sie aufhört, ist sie doch nicht mit sich zu Ende. Die unendliche Melodie — man verliert das Ufer, überlässt sich den Wogen (8,379). Die Woge, die unaufhörlich ans Ufer spült, die einen trägt und mitzieht, vielleicht auch herunterzieht und untergehen lässt — sie ist für Nietzsche auch ein Bild des Weltgrundes. So leben die Wellen, — so leben wir, die Wollenden! — mehr sag ich nicht… wie werde ich euch verrathen! Denn — hört es wohl! — ich kenne euch und euer Geheimniss, ich kenne euer Geschlecht! Ihr und ich, wir sind ja aus Einem Geschlecht! — Ihr und Ich, wir haben ja ein Geheimniss! (3,546; fw) Eines dieser Geheimnisse ist die innere Verwandtschaft zwischen Welle, Musik und dem großen Weltspiel aus Stirb und Werde, Wachsen und Vergehen, Walten und Überwältigt-Werden. Musik führt ins Herz der Welt — aber so, dass man nicht darin umkommt. Solches ekstatisches Musikerleben nennt Nietzsche im Tragödienbuch die Verzückung des dionysischen Zustandes mit seiner Vernichtung der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des Daseins (1,56; gt). Während die Verzückung andauert, ist die gewöhnliche Welt entrückt; tritt sie wieder ins Bewusstsein, so wird sie mit Ekel empfunden. Der ernüchterte Ekstatiker gerät in eine willenverneinende Stimmung (1,56), und er hat, so Nietzsche, Ähnlichkeit mit einem Hamlet, den es auch ekelt vor der Welt und der sich nicht mehr zum Handeln aufraffen kann.
Bisweilen ist das Musikerlebnis so stark, dass man um sein armes Ich fürchtet, das vor lauter Verzückung in der Musik, im Musikorgiasmus (1,134), unterzugehen droht. Deshalb ist es notwendig, dass zwischen die Musik und den dionysisch empfänglichen Zuhörer ein distanzierendes Medium eingeschoben wird: ein Mythos aus Wort, Bild und szenischer Handlung. Der so verstandene Mythos schützt uns vor der Musik (1,134; gt), die in den Hintergrund gedrängt wird, von wo aus sie nun umgekehrt den Handlungen, Worten und Bildern im Vordergrund eine solche Intensität und Bedeutsamkeit verleiht, dass der Zuschauer das Ganze hört, als ob der innerste Abgrund der Dinge zu ihm vernehmlich spräche (1,135). Man kann sich nur schwer einen Menschen vorstellen, sagt Nietzsche, der beispielsweise den dritten Akt von Wagners »Tristan und Isolde« ohne alle Beihülfe von Wort und Bild rein als ungeheuren symphonischen Satz zu percipiren im Stande wäre, ohne unter einem krampfartigen Ausspannen aller Seelenflügel zu verathmen (1,135). Wer diese Musik hört, der hat sein Ohr gleichsam an die Herzkammer des Weltwillens gelegt, und nur das plastische Geschehen im Vordergrund bewahrt ihn davor, das Bewusstsein seiner Individualexistenz gänzlich zu verlieren.
Aber ist hier nicht zuviel Pathos im Spiel? Gewiss, doch Nietzsche erlaubt der Kunst, pathetisch zu sein. Die Kunst gibt in ihren gelungenen Augenblicken immer ein Ganzes, ein Weltganzes sogar, das sich in Schönheit erleiden lässt. Wer sich dem Kunsteindruck überlässt, kann zu einem Pathetiker der universalen Resonanz werden. Wir vertragen das Pathetische nur in der Kunst; der lebende Mensch soll schlicht und nicht zu laut sein (8,441; 1877). Ein solcher schlichter Mensch betreibt zum Beispiel Wissenschaft, ganz ohne Pathos, und vermag zu zeigen, wie grundlos man sich in diese Höhe der Empfindung hineingearbeitet hat (8,428; 1877). Plötzlich sieht die Pathos-Welt ganz anders aus. Die großen Affekte und Leidenschaften enthüllen ihre unansehnlichen, manchmal auch lächerlichen Ursprünge. Das gilt auch für die Hochgefühle der Musik, die sich psychologisch und physiologisch entzaubern lassen. Musik als Organ inniger Seinsverbundenheit erscheint aus dieser Perspektive als bloße Funktion organischer Vorgänge. So rückt Nietzsche mit entpathetisierenden Argumenten seinem Pathos zu Leibe und experimentiert mit einem Denken, das die eigenen Leidenschaften verhöhnt. Der Mensch, erklärt Nietzsche, ist ein Wesen, das die thierische Schranke einer Brunstzeit (8,432) übersprungen hat, und deshalb sucht er nicht nur gelegentlich, sondern immer nach Lust. Da es aber weniger Lustquellen gibt, als seine Dauerlustbereitschaft verlangt, hat ihn die Natur auf die Bahn der Lust-Erfindung gezwungen. Das Bewusstseinstier Mensch, mit Vergangenheits- und Zukunftshorizont, ist selten von seiner Gegenwart gänzlich ausgefüllt und empfindet eben darum etwas, das wohl keinem Tier bekannt ist, nämlich — die Langeweile. Die Langeweile fliehend, sucht dieses seltsame Wesen einen Reiz, der, wenn er sich nicht finden lässt, eben erfunden werden muss. Der Mensch wird zu einem Tier, das spielt. Das Spiel ist eine Erfindung, die den Affekten etwas zu tun gibt. Das Spiel ist die Selbsterregungskunst der Affekte, die Musik zum Beispiel. Die anthropologisch-physiologische Formel für das Geheimnis der Kunst lautet also: Flucht vor der Langeweile ist die Mutter der Künste (8,432).
In dieser Formulierung ist das Pathos der Kunst nun wirklich verschwunden. Kann das sogenannte Geheimnis der Kunst trivialer sein? Sollte sich die Ekstase der Kunstbegeisterung wirklich darin erschöpfen, eine Zuflucht zu sein vor der reizarmen Wüste des Alltags? Wird Kunst hiermit nicht auf den bloßen Unterhaltungswert reduziert? Nietzsche kokettiert mit dieser entmystifizierenden und entpathetisierenden Sichtweise. Er will die Kunst, sein Heiligtum, entweihen und seine Liebe abkühlen, eine antiromantische Selbstbehandlung (2,371; ma ii), bei der sich zeigen soll, wie diese Dinge aussehn, w e n n man sie umkehrt (2,17; ma i). Es geht dabei nicht nur um eine Umkehrung der Rangfolge von moralischen Werten, sondern auch um einen Wechsel von metaphysischer zur physisch-physiologischen Sichtweise.
Doch auch die Langeweile hat ihr Geheimnis und bekommt bei Nietzsche ihr eigentümliches Pathos. Die Langeweile, vor der die Kunst eine Zuflucht gewährt, wird zum gähnenden Abgrund des Seins, etwas Entsetzliches. In der Langeweile erlebt man den Augenblick als leeres Verstreichen der Zeit. Was äußerlich geschieht, ist nicht von Belang, und auch man selbst erfährt sich als belanglos. Die Lebensvollzüge verlieren ihre intentionale Spannung, sie fallen in sich zusammen, wie ein Soufflé, das man vorzeitig aus dem Ofen geholt hat. Routinen, Gewohnheiten, die sonst Halt geben, erscheinen plötzlich als das, was sie sind: Hilfskonstruktionen. Auch die gespenstische Szenerie der Langeweile offenbart einen Augenblick der wahren Empfindung. Man weiß nichts mit sich anzufangen, und die Folge ist, dass es das Nichts ist, das etwas mit einem anfängt. Über diesem Untergrund des Nichts verrichtet die Kunst ihr Selbsterregungswerk. Das ist schon fast wieder ein heroisches Unternehmen, denn unterhalten werden müssen die Absturzgefährdeten. In dieser Perspektive ist die Kunst ein Bogenspannen, um nicht der nihilistischen Abspannung zu verfallen. Die Kunst hilft zu leben, weil das Leben sonst sich vor dem Andrang von Sinnlosigkeitsgefühlen nicht zu helfen weiß.
Die Formel der Kunst als Flucht vor der Langeweile ist bedeutungsreich, vorausgesetzt, man versteht Langeweile als eine Art Erfahrung des Nichts. Damit aber ist wieder der Wechsel vollzogen von der Physiologie der Selbsterregung zur Metaphysik des Horror vacui. Nietzsche ist ein Virtuose dieses Grenzverkehrs zwischen Physik und Metaphysik. Er versteht es, seinen physiologischen Entzauberungen einen neuen metaphysischen Zauber zu verleihen. Es gibt bei ihm nichts, was am Ende nicht doch wieder ungeheuer wäre.
Alles kann ungeheuer werden — das eigene Leben, das Erkennen, die Welt —, aber es ist die Musik, die so aufs Ungeheure einstimmt, dass man es trotz allem darin aushält. Und darum bleibt das Ungeheure Nietzsches lebenslanges Thema, sein Versuch und seine Versuchung.
Zweites Kapitel
Ein Knabe schreibt. Das Dividuum. Blitz und Donner. Lebensläufe finden und erfinden. Prometheus und andere. Erster Versuch mit der Philosophie: »Fatum und Geschichte«. Ideenozean und Fernweh.
Das Ungeheure, das sich dem jungen Nietzsche zuerst aufdrängt, ist das eigene Leben. Während seiner Schul- und Studienzeit, zwischen 1858 und 1868, verfasst Nietzsche neun autobiographische Skizzen, es wird fast immer ein Bildungsroman daraus nach dem Muster: Wie ich wurde, was ich bin. Später wird er vom epischen zum eher dramatischen Genre wechseln und das Schreiben über das eigene Leben mit dem Gestus der Verkündigung verbinden, weil ihm inzwischen sein Leben exemplarisch vorkommt. Zunächst schreibt er über sein Leben, dann mit Leib und Leben, und schließlich wird er um sein Leben schreiben.
Wer so früh damit beginnt, über sein Leben zu schreiben, ist nicht einfach selbstverliebt, muss sich auch nicht als besonders problematisch empfinden. Solche Konstellationen sind eher ungünstig, weil es dem Problemverstrickten oder dem Selbstverliebten zumeist an der nötigen Selbstdistanz mangelt. Nietzsches selbstbezogenes Schreiben setzt die Fähigkeit voraus, sich nicht nur als Individuum, als etwas Unteilbares, sondern als Dividuum (2,76; ma), als etwas Teilbares, zu erleben. Eine mächtige Tradition spricht vom ›Individuum‹ wie von einem unteilbaren Kern des Menschen. Nietzsche aber hat schon sehr früh mit der Kernspaltung des Individuums experimentiert. Über ›sich‹ schreibt, wem die Unterscheidung zwischen ›Ich‹ und ›sich‹ überhaupt etwas zu denken gibt. Das ist nicht immer und nicht bei jedem so. Neugier, überschüssiges Denken muss im Spiel sein, Selbstverliebtheit und Selbstverfeindung, es muss Brüche, Euphorien und Verzweiflungen gegeben haben, welche die Selbstzerteilung des Unteilbaren, die Dividualisierung des Individuums, begünstigen oder herausfordern. Friedrich Nietzsche jedenfalls erfährt sich zerteilt genug für ein höchst subtiles Selbstverhältnis, das er, wie er später verkündet, zur Selbstgestaltung nutzt. Wir aber wollen die Dichter unseres Lebens sein (3,538; fw). Nietzsches Entwicklung wird zeigen, dass der Dichter seines Lebens Urheberrechte an seinem Werk beanspruchen will. Die charakteristischen Züge seines Wesens sollen sein Werk sein, er will sich selbst verdanken, was er ist und wozu er sich gemacht hat. Er wird seinen Imperativ der Selbstgestaltung so formulieren: Du solltest Herr über dich werden, Herr auch über die eigenen Tugenden. Früher waren sie deine Herren; aber sie dürfen nur deine Werkzeuge neben andren Werkzeugen sein. Du solltest Gewalt über dein Für und Wider bekommen und es verstehn lernen, sie aus- und wieder einzuhängen, je nach deinem höheren Zwecke. Du solltest das Perspektivische in jeder Werthschätzung begreifen lernen (2,20; ma). Nietzsche wird sich nicht mit der Unschuld des Werdens abfinden, und auch amor fati, die Liebe zum eigenen Geschick, macht den Menschen noch nicht zum Autor seiner Lebensgeschichte. Ein intervenierendes, entwerfendes, konstruktives Denken ist gefordert, ein Denken im Übermaß und Überschuß sogar. So macht sich Nietzsche zu einem Athleten der Wachheit und Geistesgegenwart. Alle Regungen, Strebungen, Handlungen werden ins grelle Licht der Aufmerksamkeit gezogen. Sein Denken wird zur gespanntesten Selbstwahrnehmung. Er wird auch seinem eigenen Denken zusehen wollen, wobei sich ihm eine tiefgestaffelte Welt von Hintergedanken, Motiven, Selbsttäuschungen und Finten aller Art enthüllt.
Nietzsche bildet schon früh eine Meisterschaft darin aus, sich selbst auf die Schliche zu kommen. 1867, während seiner Militärzeit, notiert er: Es ist eine gute Fähigkeit, seinen Zustand mit einem künstlerischen Auge ansehn zu können und selbst in Leiden und Schmerzen, die uns treffen, in Unbequemlichkeiten und dergleichen jenen Blick der Gorgo zu haben, der augenblicklich alles zu einem Kunstwerk versteint: jenen Blick aus dem Reiche, wo kein Schmerz ist. (J 3,343)
Man kann das eigene Leben so distanzieren, dass es zum Bild erstarrt. Es hat dann wohl etwas von einem Werk, der Nachteil aber ist: es fehlt ihm das Leben. Deshalb versucht es Nietzsche mit der epischen Methode. Eine andere gute Fähigkeit ist es, alles was uns trifft als ein Bildungselement zu erkennen und an sich zu verwerthen. (J 3,343)
Als narrative Bewältigung des Lebens in einer Bildungsgeschichte unternimmt der junge Nietzsche seine ersten autobiographischen Aufzeichnungen. Es fasziniert ihn, wie das gelebte Leben sich in ein Buch verwandeln lässt. Seine erste Autobiographie von 1858 beschließt er mit dem Seufzer: Könnte ich doch recht viel solche Bändchen schreiben! (J 1,32)
Der junge Nietzsche schreibt über seine Lust beim Schreiben. Das sei bei den Kinderspielen schon so gewesen. Er erzählt, wie er sogleich alle Vorkommnisse des Spiels in einem Büchlein vermerkt und seinen Spielgefährten zum Lesen gegeben habe. Der Spielbericht war fast wichtiger als das Spiel, das zum Anlass und Material dafür wurde, um hinterherschreiben zu können. Das gegenwärtige Erleben wird unter dem Gesichtspunkt der künftigen Erzählung gesehen. So hält man das verfließende Leben fest und lässt das Gegenwärtige im Lichte künftiger Bedeutung erglänzen. Dieser Methode, dem Leben eine Gestalt zu geben, wird Nietzsche auch treu bleiben. Er wird sich nicht damit begnügen, zitierfähige Sätze zu produzieren, sondern er wird sein Leben so einrichten, dass es zur zitierfähigen Unterlage für sein Denken wird. Jeder denkt über sein Leben nach, aber Nietzsche will sein Leben so führen, dass er etwas daran zu denken bekommt. Das Leben als Experimentieranordnung für das Denken, Essayismus als Lebensform.
Nietzsche denkt ausdrücklich und mit Emphase in der ersten Person Singular, obwohl er selbst es doch war, der am Grund des Denkens eine eigenartige Anonymität aufgedeckt hat. Dass man ›Ich denke‹ sagt, hält er für eine Verführung durch die Grammatik. Das Prädikat ›denken‹ fordert, wie jedes Prädikat, ein Subjekt. Also erklärt man das Ich zum Subjekt und macht es damit im Handumdrehen zum Akteur. Tatsächlich aber ist es der Akt des Denkens, durch den überhaupt erst das Ich-Bewusstsein hervorgebracht wird. Für das Denken gilt: erst der Akt, dann der Akteur (5,31; jgb). Obwohl also Nietzsche sich durchaus ein Denken ohne Ich denken kann, gibt es keinen Philosophen — ausgenommen vielleicht Montaigne —, der so häufig ›Ich‹ gesagt hat wie er. Der Grund dafür ist, dass Nietzsche wusste, dass er Nietzsche ist. Er fühlte sich als Exempel. Es lohnte sich für ihn, er selbst zu sein. Er glaubte auch, dass es sich für uns lohnen würde, wenn wir an ihm Anteil nehmen. Seine Arbeit an sich selbst erledigte er in dem Bewusstsein, sie für das ganze Menschengeschlecht zu tun. In der Spätphase bricht dieses stolze Selbstbewusstsein ungehemmt hervor: Ich kenne mein Los, es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab, an die tiefste Gewissenskollision, an eine Entscheidung, heraufbeschworen gegen alles, was bis dahin geglaubt und geheiligt war. (6,365; eh)
Wenn Nietzsche über sich selbst schreibt, verfolgt er also gleichzeitig und nacheinander mehrere Ziele. Zunächst will er der flüchtigen Zeit haltbare und haltgebende Erinnerungsbilder abgewinnen. Seine Freunde und Anverwandten sollen an dieser Erinnerungsarbeit teilnehmen, er will sie ihnen mitteilen besonders dann, wenn sie in irgendeiner Weise mit den erinnerten Szenen zusammenhängen. Er schreibt für diese Leser, aber vor allem schreibt er für sich selbst als künftigen Leser seiner Aufzeichnungen. Er will Stoff liefern für den künftigen, das Selbstgefühl episch abrundenden Rückblick. Noch fühlt er sich im Handgemenge eines Geschehens, aber später, wenn er die Aufzeichnungen liest, wird daraus vielleicht eine Geschichte mit Bedeutsamkeit. Auf Bedeutung hat er es abgesehen. In das Dunkel des gelebten Augenblicks soll von der künftigen Sinngebung her ein Licht fallen. Er will jetzt schon, im gelebten Augenblick, einen Abglanz des künftigen Verstehens erleben. So subtil dieses Verfahren ist, so handelt es sich doch im Prinzip um Techniken der Selbstthematisierung und Selbstbeschreibung, wie sie fast jeder einigermaßen begabte Verfasser von Tagebuchaufzeichnungen handhabt. Bei Nietzsche aber wird die Überzeugung hinzukommen, dass sein Leben, Leiden und Denken exemplarischen Charakter haben und dass es sich lohnt, alle und keinen (4,9; za) daran Anteil nehmen zu lassen. Er wird sich vorkommen wie jemand, der stellvertretend als ein Atlas die Probleme der Welt — oder besser: des In-der-Welt-Seins — schultert und er wird darüber hinaus noch das Kunststück fertigbringen wollen, mit dieser schweren Last zu spielen und zu tanzen. Er wird es sich schwer machen wollen, und gleichzeitig wird er auftreten als Artist der Erleichterung. Und das alles wird nur möglich sein, weil die Sprache ihn trägt. Sie ist noch schneller und beweglicher als die Gedanken. Seine beschwingte Sprache reißt ihn mit, und mit wachsender Bewunderung verfolgt er, was sie aus ihm macht. So wird ihm die eigene Person, das dividuale Individuum, zum Schauplatz einer inneren Weltgeschichte, und wer sie erforscht, der muss mit ihm zum Abenteurer und Weltumsegler jener inneren Welt, die ›Mensch‹ heisst (2,21; ma) werden. Es ist dies aber der Mensch in seiner Zeit, und nur weil Nietzsches Zeithorizont unsere Zeit mit umgreift, können seine Erkundungen immer noch Entdeckungen für uns sein.
Kehren wir zurück zu dem vierzehnjährigen Nietzsche, der in der dunklen Wohnstube im Parterre des Hauses in Naumburg Seite um Seite mit seiner Musterschülerschrift bedeckt und sich dabei sein Leben erzählt. Er beginnt wie ein alter Mann, der sich auf längst Vergangenes besinnt. Mit Bestürzung bemerkt er, dass vieles seinem Gedächtnis entschwunden ist und dass ihm das gelebte Leben wie ein verworrener Traum (J 1,1) vorkommt. Der Knabe möchte über die Zeit triumphieren, indem er aus ihrem Verfließen Bruchstücke der Erinnerung sammelt und aus ihnen ein Werk wie ein Gemälde schafft. Doch er will nicht nur die Vergangenheit zurückholen, sondern auch die Zukunft gewinnen, denn mit Vergnügen stellt er sich vor, wie er künftig in seinen Aufzeichnungen lesen wird. Er imaginiert sich als künftigen Leser seiner selbst. Es ist etwas gar zu Schönes sich späterhin seine ersten Lebensjahre vor die Seele zu führen und die Ausbildung der Seele daran zu erkennen. (J 1,31) Er weiß, dass er im gelebten Augenblick sich selbst entgeht und erst im Rückblick sich entdecken wird. Dann erst wird er begreifen, was ihn bestimmt und unbewusst geleitet hat. Noch glaubt er, dass dabei die allmächtige Leitung Gottes (J 1,1) im Spiel ist. Er versucht, da es blinde Zufälle nicht geben darf, sinnhafte Zusammenhänge zu entdecken. Der Vater improvisierte gerne am Klavier, es ist auch seine Leidenschaft. Der frühe Tod des geliebten Vaters hat ihn einsam werden lassen, aber da er es gut bei sich aushält, betrübt es ihn nicht, wenn er alleine bleibt. Er weiß, dass er zu ernst für sein Alter ist, aber wie sollte er es nicht sein, hat er doch den Tod des Vaters, des jüngeren Bruders, einer Tante und der Großmutter zu verwinden gehabt. Den Abschied von der friedlichen Pfarrhauswelt von Röcken, als die Familie nach dem Tod des Vaters nach Naumburg zieht, erlebt er als ein Ereignis, das sein Leben in zwei Hälften auseinandergebrochen hat. Wie sollte man darüber nicht ernst werden? Er ist stolz auf seinen Ernst, auch wenn ihn die Mitschüler bisweilen necken und ihn den »kleinen Pastor« nennen, als er einmal in gemessener Haltung, wie es die Schulregel verlangt, über den Marktplatz daherschreitet — unterm Platzregen. Er jedenfalls nimmt seinen Ernst als etwas Auszeichnendes. Eine Selbstcharakteristik vom Oktober 1862 bricht mit den Worten ab: Ernst, leicht Extremen zuneigend, ich möchte sagen, leidenschaftlich ernst, in der Vielseitigkeit der Verhältnisse, in Trauer und Freude, selbst im Spiel. (J 2,120) Er kann sich von außen sehen und findet dann, als Neunzehnjähriger, das Bild: Ich bin eine Pflanze, nahe dem Gottesacker geboren… Er will aber nicht fromm und brav sein, er träumt davon, ein Schicksal zu haben, das ihn zerzaust und ihm ein wildes Gepräge gibt. Deshalb sucht er den freien Tempel der Natur (J 1,8) auf und fühlt sich dort besonders wohl, wenn es blitzt und donnert und Regengüsse vom Himmel herunter rauschen. Mit Blitz und Donner und überhaupt mit dem Wilderhabenen hat es seine Phantasie gerne zu tun. Im Juli 1861 schreibt Nietzsche in Schulpforta einen Aufsatz über den Ostgotenkönig Ermanarich, einen Text, den er noch in seiner Studentenzeit als sein bisher gelungenstes Werk ansieht. Dort schwelgt er geradezu in Bildern vom Aufruhr der Naturgewalten. Wie ein Blitz, schreibt er, fällt in den germanischen Sagen jedes Wort gewaltig und bedeutungsschwer. Das sind Textinterpretationen, es sind aber auch Träume eines pubertierenden Schülers, der bemerkt, dass man mit Sprache ins Leben schneiden kann, und der sich wünscht, auch die eigenen Worte hätten jene magischen Kräfte, die den Zuhörer niederschmettern (J 2,285). Genüßlich zitiert Nietzsche einen Vers aus dem Epos: Schön stritten wir: wir sitzen auf Leichen, / Von uns gefällten, wie Adler auf Zweigen. (J 2,289)
Die Sterbefälle in der Familie werden ausführlich geschildert, bisweilen im Ton der Passionsgeschichte wie bei seinem ersten autobiographischen Versuch, wo es bei der Schilderung der Umstände, wie er vom Tode einer Tante erfahren hatte, heißt: Mit einiger Angst harrte ich der Nachrichten. Als ich aber den Anfang gehört hatte, ging ich hinaus und weinte bitterlich (J 1,20). Den Bibelton versucht er sich bald danach abzugewöhnen, auch bei seiner lyrischen Produktion, die er häufig kommentiert, kritisiert und in Schaffensphasen einteilt. Zuerst, schreibt er im September 1858, seien seine Gedichte gedankenschwer, aber ungelenk gewesen; dann habe er den leichten Ton und den Schmuck gesucht auf Kosten des Gedankens. Am 2. Februar 1858, am Tag als die Großmutter starb, habe seine dritte Periode begonnen, in der es ihm endlich gelungen sei, poetische Beschwingtheit mit gedanklichem Reichtum, Lieblichkeit mit Kraft (J 1,27) zu vereinen. Er nimmt sich vor, jeden Abend ein Gedicht in diesem neuen Ton zu schreiben, und fertigt ein Verzeichnis seiner lyrischen Werke an. Man merkt, dass sich hier jemand darauf vorbereitet, ein Leben aus beschwingten Wörtern hervorzubringen.
Nicht nur das Werk, auch das Leben ruft nach Ordnung und Einteilung. Dem jungen Autor gliedert es sich 1864, kurz vor dem Übergang an die Universität, in drei Abschnitte. Die früheste Periode endet mit dem fünften Lebensjahr, als der Vater starb und die Familie von Röcken nach Naumburg umzog. In den früheren autobiographischen Versuchen hatte Nietzsche aus diesen Kindheitstagen einiges berichtet. Jetzt aber bezweifelt er, ob es wirklich eigene Erlebnisse waren oder nicht doch bloß eine Wiedergabe dessen, was ihm erzählt worden war. Da er die eigene Erlebnisperspektive nicht wiederherstellen kann, will er über diese Lebensperiode lieber schweigen. Für die Periode danach betont er besonders den Umstand, dass der Tod eines so ausgezeichneten Vaters ihn unter die alleinige Obhut von Frauen gebracht und ihn die männliche Aufsicht schmerzlich hat vermissen lassen. So sei es dazu gekommen, dass Neubegier, vielleicht auch Wissensdrang (J 3,67) ihm die mannigfaltigsten Bildungsstoffe in größter Unordnung zuführte. Im Alter zwischen dem 9. und dem 15. Lebensjahr habe er nach einem Universalwissen gestrebt und mit demselben fast doktrinären Eifer habe er weiterhin die Kinderspiele gepflegt und darüber säuberlich Buch geführt. Auch die entsetzlichen Gedichte aus dieser Zeit seien mit derselben Beflissenheit zustande gebracht worden. Der zwanzigjährige Nietzsche lässt durchblicken, dass er diesen zugleich beflissenen und exzentrischen Grundzug seiner geistigen Unternehmungen wohl zu deuten weiß. Ein wucherndes Talent nimmt sich unbeholfen und altklug in die Selbstdisziplin, da keine väterliche Autorität ihm diese Disziplin auferlegt. Das hat sich allerdings mit der zweiten Lebenswende geändert, als er ins Internat von Schulpforta aufgenommen wurde. Dort sorgen die Lehrer dafür, dass dieses planlose Irren ein Ende nimmt. Eine ähnliche Entwicklung vom entgrenzten Herumschweifen zur Disziplin vollzieht sich auch bei seiner schon früh erwachten Leidenschaft für die Musik und das Komponieren. In Schulpforta bemüht er sich, zuerst von Lehrern unterstützt, dann auf eigene Faust, durch ein gründliches Erlernen der Compositionslehre der verflachenden Einwirkung des ›Phantasierens‹ entgegen zu arbeiten (J 3,68).
Wenn er sich auch bei der Musik bisweilen das Phantasieren verbietet, so lässt er doch beim Schreiben, wenn es nicht gerade um das eigene Leben geht, den Wunschphantasien freien Lauf und denkt sich in Gestalten hinein, in denen er seine Leidenschaft kennenlernen und erproben kann. Er entwirft im April 1859 beispielsweise ein Prometheus-Drama in freien Versen. Prometheus, der Titan, will es nicht zulassen, dass die Menschen unter die Herrschaft des Zeus geraten. Er will sie frei haben, so wie er selbst auch frei ist. Selbstbewusst erinnert Prometheus daran, dass er es war, der Zeus auf den Thron gesetzt hat. Schon der junge Nietzsche verehrt nicht so sehr die Götter, sondern diejenigen, welche Götter machen. Die Skizze endet mit einem Chor der Menschen, die aller Welt verkündigen, dass sie sich nur solchen Göttern unterwerfen werden, die frei von Schuld sind; denn die schuldbeladenen Götter müssen sterben wie die Menschen und können darum keinen Trost spenden: wie das Rohr so sinken / Sie zum Orkus nieder / Wenn des Todesstürme / Sie umbrausen (J 1,68). Schon der junge Nietzsche ist ein reflektierender Autor, und deshalb versieht er sein Werk sogleich mit einem Kommentar. Warum ausgerechnet Prometheus, fragt er. Man will wohl die Zeiten eines Aeschylos erneuen oder giebt es keinen Menschen mehr, daß man wieder Titanen erscheinen lassen muß! (J 1,69) Tatsächlich kommt der junge Nietzsche von den Titanen nicht los. Er schildert, wenige Wochen später, zwei kühne Gemsenjäger. Hoch in einem Gebirge der Schweiz geraten sie in ein schlimmes Gewitter, aber sie kehren nicht um, die fürchterliche Gefahr verlieh ihnen Riesenkräfte (J 1,87). Es nimmt mit ihnen, wie auch mit Prometheus, ein schlimmes Ende. Noch gilt die Moral, dass Hochmut vor dem Fall kommt, aber man merkt doch schon, wie der junge Autor den Hochmut mehr schätzt als den Realismus solcher Moral. Eines Abends liest er in Schulpforta Schillers »Räuber« mit großer Erregung, denn auch dort entdeckt er einen Titanenkampf, diesmal aber gegen Religion und Tugend (J 1,37). Einstweilen jedoch fühlt er sich jenen näher, die nicht eine Religion bekämpfen, sondern eine gründen. In einer Abhandlung über »Die Kindheit der Völker« vertieft der Siebzehnjährige sich in die Genealogie der Weltreligionen. Sie seien, so schreibt er, tiefsinnigen Männern zu verdanken, die von den Schwingen ihrer ungezügelten Einbildungskraft getragen sich als Gesandte der höchsten Götter ausgaben (J 1,239).
Nach dieser im Frühjahr 1861 skizzierten Geschichte der Religion und der Religionsgründer, verfasst Nietzsche sogleich eine neue Version seiner Lebensgeschichte. Eben noch hat er sich mit der Sitten- und Geistesentwicklung der Menschheit beschäftigt, nun soll die eigene Entwicklung abermals bedacht und beschrieben werden. Aber die Umformatierung von der Menschheit zum Menschen will diesmal nicht recht gelingen, denn schon nach wenigen Sätzen gerät der Lebenslauf in religionsphilosophisches Gelände. Hatte der Lebenslauf von 1859 geendet mit der andachtsvollen Formel: aber in allen hat mich Gott sicher geleitet wie ein Vater sein schwaches Kindlein (J 1,31), so wird im Mai 1861 dieser leitende Gott einer gründlichen Analyse unterzogen. Die Vernunft der die Geschicke austheilenden Macht (J 1,277) ist undurchsichtig, schreibt er. Es gibt zuviel Ungerechtigkeit, Bosheit in der Welt, und auch die Zufälle spielen eine große, bisweilen schlimme Rolle. Liegt dem Ganzen eine blinde oder vielleicht sogar böse Macht zugrunde? Das kann nicht sein, denn der Ursprung und das Wesen der Welt kann nicht tiefer stehen als der Menschengeist, der nach Sinn und Bedeutung sucht und offen ist für das Gute. Also kann die Welt insgesamt nicht bedeutungslos oder gar von einem bösen Prinzip beherrscht sein. Der Weltgrund kann nicht willkürlicher sein als der Menschengeist, der ihn ergründen will. Es giebt keinen Zufall; alles was geschieht, hat Bedeutung (J 1,278). Der Text, der als »Lebenslauf« begann, bricht mit diesen Sätzen ab. Wenig später setzt Nietzsche noch einmal an. Aber die forcierte Suche nach Bedeutung entmutigt ihn diesmal offenbar, denn wieder bricht er die Skizze ab. Was ich über die ersten Jahre meines Lebens weiß, ist zu unbedeutend es zu erzählen. (J 1,279) Dann sogleich ein dritter Anlauf. Die Erzählung ist um den Tod des Vaters und den Abschied von Röcken zentriert. Er schildert das Ereignis wie die Vertreibung aus dem Paradies. Das war jene erste verhängnißvolle Zeit, von der aus sich mein ganzes Leben anders gestaltete. (J 1,280) Eine Wehmut ist ihm geblieben, eine gewisse Ruhe und Schweigsamkeit (J 1,281) ist über ihn gekommen, ein Gefühl von Fremdheit in der Welt jenseits des Paradieses, das Gefühl einer Verlorenheit, die Ausschau hält nach Gestalten, denen er sich geistesverwandt fühlt oder die ihn zur Selbstmächtigkeit ermuntern. Er beschäftigt sich mit Hölderlin, Lord Byron und Napoleon III.
Nietzsche muss seinen Hölderlin verteidigen gegen die Lehrer, die von den Tollhäuslergedanken (J 2,2) nichts wissen wollen. Er rühmt die Musik seiner Prosa, weiche schmelzende Klänge, unheimlichen Grabliedern gleich, aber dann wieder stolz triumphierend in göttlicher Hohheit (J 2,3). Hölderlin gilt ihm als König in einem noch unentdeckten Reich, und Nietzsche fühlt sich als sein Apostel, der das Licht in die Finsternis bringt, aber die Finsternis hat’s nicht begriffen.
Lord Byron braucht keinen Fürsprecher mehr. Um ihn zu charakterisieren, verwendet der junge Nietzsche hier zum ersten Mal jenen Ausdruck, der noch Karriere machen wird, er nennt ihn nämlich einen geisterbeherrschenden Uebermenschen (J 2,10). Wodurch wird Lord Byron in Nietzsches Augen zu einem solchen Übermenschen? Lord Byron hat sein Leben so geführt, wie man eine Geschichte erzählt. Er ist im eminenten Sinne zum Dichter seines Lebens geworden und hat die Menschen in seinem Zauberkreis so verwandelt, als wären es Romanfiguren. Nietzsche bewundert an Lord Byron diese Inszenierung des Lebens und seine Verwandlung ins Kunstwerk. Der junge Nietzsche, der auf der inneren Bühne der Tagebücher dem eigenen Leben Bedeutung verleihen möchte, bewundert jene Genies, die nicht nur nach innen, sondern auch fürs Publikum zu Darstellern ihres Selbst, zu Autoren des eigenen Lebens werden konnten. Da Lord Byron sein Leben so führte, dass die anderen Geschichten davon erzählen konnten, war er geschichtsträchtig. Und dann gibt es da noch die Figuren, die geschichtsmächtig geworden sind. Eine davon, über die der Sechzehnjährige eine Abhandlung verfasst, ist Napoleon III. In seinem Aufsatz aus dem Jahre 1862 entwickelt der junge Nietzsche den Gedanken, dass es Napoleon mit traumwandlerischer Sicherheit vermocht hat, die Wünsche und Phantasien des Volkes herauszuspüren und ihnen zu entsprechen, so dass seine kühnsten Staatsstreiche wie der Wille der ganzen Nation erscheinen (J 2,24) mussten. Es wird in diesem Aufsatz nicht ganz klar, ob hier nicht doch eher der erste Napoleon gemeint ist. Jedenfalls behauptet Nietzsche, dass auch Napoleon III. auf die Beherrschten so gewirkt habe, als sei er das von ihnen selbst gewählte Fatum der Geschichte. Bei diesen Figuren, in die sich der junge Nietzsche gerne hineindenkt, geht es also um die verborgene Macht der Ohnmacht bei Hölderlin, um die künstlerische Lebensmacht bei Lord Byron und um die Magie der politischen Macht bei Napoleon III. Macht ist in allen drei Fällen Selbstbehauptung im Wirkungskreis des Fatums.
»Fatum und Geschichte« — unter diesem Titel verfasst Nietzsche in den Osterferien des Jahres 1862 eine Abhandlung, die er als so kühn empfindet, dass er davor Angst bekommt. Ihm ist, als treibe er in die Weite eines unermesslichen Ideenozeans (J 2,55) hinaus, ohne Kompass und Führer, was eine Torheit und ein Verderben ist für unentwickelte Köpfe. Zu diesen zählt er sich nicht, er will die Resultate seines jugendlichen Grübelns so befestigen, dass er nicht von den Stürmen verschlagen wird. Nietzsche schafft eine hochdramatische Atmosphäre auf einer imaginären Bühne, ehe er mit seinen Gedanken herausrückt, die um die Frage kreisen, wie denn das Weltbild sich verändert, wenn es keinen Gott, keine Unsterblichkeit, keinen Heiligen Geist und keine göttliche Inspiration gäbe, wenn der Glaube von Jahrtausenden auf Einbildungen beruhte, wenn die Menschen über so lange Zeit hin durch ein Trugbild irre geleitet (J 2,55) worden wären. Welche Wirklichkeit bleibt übrig nach dem Abzug der religiösen Phantasmen? Der Schüler von Pforta zittert vor Mut, wenn er diese Frage stellt, und er gibt sich die Antwort: übrig bleibt die Natur im Sinne der Naturwissenschaften, ein Universum der Gesetzmäßigkeiten; und es bleibt übrig die Geschichte als Aufeinanderfolge von Ereignissen, worin Kausalität und Zufall ohne ein erkennbares Gesamtziel wirken. Denn Gott war der Inbegriff des Sinn- und Zielhaften, und wenn er verschwindet, verblassen auch Sinn und Ziel in Natur und Geschichte. Dann aber ergibt sich die Alternative: entweder man bemerkt, dass ein solcher Gesamtsinn zum Leben gar nicht nötig ist, oder man sucht ihn nicht mehr in der Transzendenz, wo ihn die Einbildungskraft so lange Zeit vermutet hat. Auf Sinn und Ziel will Nietzsche nicht verzichten, die erste Alternative scheidet für ihn also aus. Er ist aber nicht bereit, Sinn und Ziel weiterhin als vorgegeben hinzunehmen, er sieht sie vielmehr als uns aufgegeben an. Er setzt nicht auf gläubige Hinnahme, sondern auf enthusiastische Hervorbringung. In seinem Aufsatz erkundet der junge Nietzsche zum ersten Mal den Willen zur Lebenssteigerung als eine Art immanentes Transzendieren. Kein frommes Gefühl, das nach einem Jenseits Ausschau hält, ist hier im Spiel, sondern eine Leidenschaft für die schöpferische Lebensgestaltung. Wie aber kann sich diese Leidenschaft behaupten gegen das Weltbild der damals modernen Wissenschaften, wo es nur Determination und Kausalität gibt? Der junge Nietzsche ›löst‹ dieses Problem recht einfach, und zwar so, wie es die idealistische Philosophie vom Anfang des Jahrhunderts, die der Zögling von Schulpforta noch kaum kennt, auch schon ›gelöst‹ hatte. Er reflektiert nämlich den Umstand, dass die reflektierende Vernunft wenigstens so frei ist, dass sich ihr das Problem der Freiheit überhaupt stellt. Schon allein in der Frage ›Wie ist Freiheit möglich‹ bekundet sich ein freier Wille, der zwar zum Universum der Determination gehört, aber doch frei genug ist, diese ganze Welt in der Erkenntnis distanzieren zu können. Diesem freigesetzten Bewusstsein erscheint die Welt als das große Andere, eben als das Universum der Determination. Nietzsche nennt es das Fatum. Das freie Bewusstsein erfährt diese Welt als Widerstand und erkämpft sich darin seinen Spielraum und erfährt sich so als freier Wille. Frei ist dieser Wille allerdings nur in der Selbstwahrnehmung des Bewusstseins. Diesen Menschen mit Spielraum wird Nietzsche später das nicht festgestellte Tier nennen, das nach Feststellungen sucht und sie dann ›Wahrheiten‹ nennt — ›Wahrheiten‹ verstanden als Moral, welche das Handeln binden, und ›Wahrheiten‹ verstanden als Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten in Natur und Geschichte, die Orientierung im Ungeheuren geben. Solche Wahrheits-Perspektiven sind in diesem genialischen Schüler-Aufsatz natürlich noch nicht entwickelt, aber sie werden sich daraus ergeben. Das Fatum, so erklärt der junge Nietzsche, ist das Stabile, und die Freiheit ist die eigenartige Offenheit und Beweglichkeit inmitten dieser determinierten Welt. Den freien Willen nennt er die höchste Potenz des Fatums (J 2,59), das sich in seinem Gegensatz, also im Medium der Willensfreiheit, verwirklicht. Nietzsche hätte Kant, den er noch nicht kannte, zitieren können, der von der »Kausalität aus Freiheit« gesprochen hat. Nietzsche möchte vermeiden, dass ihm die Welt in einen Dualismus von Determination und Freiheit auseinanderbricht, die Einheitlichkeit soll doch irgendwie gewahrt bleiben. Sie bleibt gewahrt im polaren Spannungsverhältnis. Nur die Freiheit kann das Fatum als zwingende Macht erfahren, und nur die Erfahrung des Fatums vermag den freien Willen zur Lebendigkeit und Steigerung anzustacheln. Im Gegensatz liegt die Einheit. Nietzsche verwahrt sich ausdrücklich gegen die Interpretation des Fatums als göttliche Vorsehung, die es angeblich gut meint mit den Menschen. Nein, das Fatum ist gesichtslos, es bezieht sich nicht auf den Menschen, es ist jener blinde Zusammenhang, dem wir durch eigenes Tun erst einen Sinn abtrotzen. Den Glauben an die gute Vorsehung weist er zurück als eine entwürdigende Art der Ergebung in Gottes Willen, die es nicht wagt, dem Geschick mit Entschiedenheit entgegenzutreten (J 2,60). Das Fatum, wie es Nietzsche versteht, ist die Kontingenz, sinnferner Zufall und Notwendigkeit. Aber eine Art Ziel gibt es zuletzt doch, wenn auch der Weltprozess nicht intentional darauf gerichtet ist. Als der junge Nietzsche seine Abhandlung schrieb, lag der Entwicklungsgedanke in der Luft — der Darwinismus hatte bereits seinen Siegeszug angetreten —, und deshalb experimentiert er mit der Idee, wonach die Naturgeschichte im Menschen kulminiert und sich in ihm der Bewusstseinsschauplatz öffnet, wo das Leben sich selbst zum anschaulichen Theater wird. Die Spielmetapher hat es Nietzsche angetan. Der Vorhang fällt, schreibt er, und der Mensch findet sich wieder, wie ein Kind mit Welten spielend, wie ein Kind, das beim Morgenglühn aufwacht und sich lachend die furchtbaren Träume von der Stirn streicht (J 2,59). Die furchtbaren Träume beziehen sich auf die Vorstellung, dass man nicht lebt, sondern gelebt wird, dass man nicht bewusst handelt, sondern dass alles aus unbewusstem Handeln entspringt. Ist man aber einmal zum Bewusstsein erwacht, so kann man nicht sicher sein, ob man wirklich wach ist oder bloß den Traum gewechselt hat, und ob die vermeintliche Freiheit sich nicht doch wieder als nachtwandlerische Traumbefangenheit erweisen wird. Ich habe für mich e n t d e c k t , wird Nietzsche später schreiben, dass die alte Mensch- und Thierheit, ja die gesammte Urzeit und Vergangenheit alles empfindenden Seins in mir fortdichtet, fortliebt, forthasst, fortschliesst, — ich bin plötzlich mitten in diesem Traum erwacht, aber nur zum Bewusstsein, dass ich eben träume und dass ich weiterträumen m u s s , um nicht zu Grunde zu gehen: wie der Nachtwandler weiterträumen muss, um nicht hinabzustürzen. (3, 416; fw)
Dieser spätere Gedanke entfaltet die frühe Einsicht in das Mysterium der Freiheit verstanden als höchste Potenz des Fatums. Worauf aber läuft beim jungen Nietzsche das Ganze hinaus? Wenn das Verhältnis von Freiheit und Fatum so beschaffen ist, dass es auf den Einzelnen ankommt, wie er die beiden Sphären im eigenen Leben verbindet, dann wird jedes Individuum zu einem Schauplatz des Weltprozesses. Jeder Einzelne ist ein Fallbeispiel für die Verbindung von Fatum und Freiheit. Die beiden Begriffe verschwimmen, schreibt Nietzsche, zu der Idee der Individualität (J 2,60). Das wahrhafte Individuum steht zwischen einem Gott, der als absolute Freiheit gedacht werden müsste, und einem Automaten, der das Produkt des fatalistischen Prinzips sein würde. Das Individuum darf sich weder einem Gott beugen noch der Natur, weder darf es sich verflüchtigen noch darf es sich verdinglichen. Die falsche Spiritualität und die falsche Natürlichkeit — das sind die beiden Gefahren, vor denen schon der junge Nietzsche sich in acht nimmt.
Mit solchen Gedanken hat der siebzehnjährige Gymnasiast sich eine eindrucksvolle innere Szenerie geschaffen für das schwierige und erhebende Werk der Selbstgestaltung. Während der Osterferien des Jahres 1862 grübelt Nietzsche über Gott und die Welt, kreuzt in seinem unermesslichen Ideenozean und ahnt, wohin die Reise gehen könnte: ein Individuum müsste man werden, das sich selbst gestaltet und, seine Kreise erweiternd, sich womöglich zu steigern vermag. Selbstgestaltung in aufsteigender Linie — das ist es. In einer Schlusswendung seines Gedankengangs will er die Idee der Selbstgestaltung dann doch wieder mit dem Christentum versöhnen, das er sich zu diesem Zwecke zurechtinterpretiert. Was bedeutet es denn, dass Gott in Christus Mensch geworden ist? Es bedeutet die Gewissheit, dass es sich lohnt, ein Mensch zu sein. Aber Menschen sind wir noch nicht, wir werden es erst. Dazu bedarf es der Einsicht, daß wir nur uns selbst verantwortlich sind, daß ein Vorwurf über verfehlte Lebensbestimmung nur uns, nicht irgend welchen höheren Mächten gelten kann (J 2,63). Den Wahn einer überirdischen Welt benötigt man nicht, denn die Aufgabe, ein Mensch zu werden, ist das wahrhaft Ungeheure.
Der Schüler von Pforta muss sich, was die Wirklichkeit angeht, noch in engen Grenzen bewegen. Da gibt es das strenge Reglement des Internatslebens, in den Ferien Besuche zu Hause bei Mutter und Schwester in Naumburg, manchmal eine Reise zu den Verwandten nach Pobles, kleine Ausflüge am Wochenende, zum Beispiel nach Bad Kösen, wo er zuviel Bier trinkt, berauscht zurückkehrt und deswegen einige Tage lang von Gewissensbissen geplagt wird. Nietzsche erweitert den noch engen Spielraum der Wirklichkeit mit Hilfe der Bühne, die ihm seine Einbildungskraft eröffnet. Dort probiert er Rollen aus. Er beginnt zum Beispiel einen Lebensroman, den er von einem zynischen Nihilisten erzählen lässt, einer verruchten Figur, die von Ferne an Lord Byron oder an Tiecks William Lovell erinnert. Dieser Erzähler hat das Problem, dass es für ihn keine Geheimnisse mehr gibt, ich kenne mich durch und durch (…) Und schleppe jetzt — eine Klapper an der Tretmühle — recht behaglich langsam das Seil, das man Fatum nennt (J 2,70). In pubertären und schwerenöterischen Phantasien schwelgend, erzählt der schlimme Euphorion, wie er eine schmächtige Nonne dick gemacht habe, und ihren fetten Bruder mager — wie eine Leiche, fügt der Erzähler hinzu, damit die Pointe auch bemerkt wird. Nach zwei Manuskriptseiten endet dieser Romanversuch. Nietzsche hatte eine Figur schaffen wollen, die an zuviel Selbstdurchsichtigkeit leidet. Das ist aber nicht sein Fall. Der Zauber seines eigenen Selbstbezugs ist, dass er sich ein Geheimnis bleibt. Und er ist fest entschlossen, dass es dabei bleiben soll. Er sucht den Ausblick auf Unabsehbares, und deshalb hat bei ihm die Musik den Vorrang. Wenige Tage nach dem Abbruch des Romanprojektes bemerkt er: Unser Gefühlsleben ist uns selbst am wenigsten klar, und darum müsse man auf die Musik hören, denn sie erst bringt die Saiten unseres inneren Lebens zum Klingen, so weiß man zwar auch weiterhin nicht, wer man ist, doch wenigstens kann man sein Wesen in den Schwingungen nach fühlen (J 2,89).
Schöpferisch ist der Mensch nur, wenn er sich rätselhaft bleibt. Später wird Nietzsche sich einen Räthselfreund nennen, der sich den änigmatischen Charakter der Dinge nicht leichten Kaufs nehmen lassen will (12,144). Aber die eigene Rätselhaftigkeit bereitet ihm nicht immer Vergnügen. Im September 1863 schreibt er an Mutter und Schwester. Wenn ich minutenlang denken darf was ich will, da suche ich Worte zu einer Melodie die ich habe und eine Melodie zu Worten die ich habe, und beides zusammen, was ich habe, stimmt nicht, ob es gleich aus einer Seele kam. Aber das ist mein Loos! (B 1,153)
Silvester 1864, inzwischen ist er Student in Bonn, stöbert er in Manuskripten und Briefen, bereitet sich einen heißen Punsch, und spielt dann auf dem Klavier das Requiem aus Schumanns »Manfred«. Nun ist er eingestimmt, und es verlangt ihn danach, so die Notiz im Tagebuch, alles Fremde zu lassen und nur an mich zu denken (J 3,79). Über diese Silvesternacht berichtet er nach Hause: In solchen Stunden werden entscheidende Vorsätze geboren (…) Man ist für ein paar Stunden erhaben über die Zeit und tritt fast aus der eignen Entwicklung heraus. Man sichert und verbrieft sich die Vergangenheit und bekommt Muth und Entschlossenheit, wieder weiter seine Bahn zu gehen. (B 2,34) Der Bericht an Mutter und Schwester ist eher konventionell, auf deren Vorverständnis zugeschnitten und entspricht nicht ganz dem subtilen Geschehen dieser Silvesternacht, wie er es seinem Tagebuch anvertraut. Er schildert dort eine Art Gespensterszene. Er sitzt in der Sofaecke seines Zimmers, den Kopf auf die Hand gestützt, und lässt Szenen des vergangenen Jahres an seinem geistigen Auge vorübergehen. Vertieft in die Vergangenheit, wird er sich plötzlich wieder seiner Gegenwart bewusst. Dort auf dem Bett sieht er jemanden liegen, leise stöhnend, röchelnd. Ein Sterbender! Er fühlt sich von Schatten umgeben, sie wispern und raunen zu dem Sterbenden hin. Und plötzlich weiß er, dort stirbt das alte Jahr. Wenige Augenblicke später ist das Bett leer. Es wird wieder hell, die Wände des Zimmers weichen zurück und eine Stimme spricht: Ihr Thoren und Narren der Zeit, die nicht und nirgends ist außer in euren Köpfen! Ich frage euch, was habt ihr gethan? Wollt ihr sein und haben, was ihr hofft, worauf ihr harrt, so thut das (J 3,9). In seinem Tagebuch schildert Nietzsche diese Vision und interpretiert sie sogleich: Die röchelnde Gestalt auf dem Bett ist die personifizierte Zeit, die mit ihrem Sterben den Einzelnen auf sich selbst zurückwirft. Nicht die Zeit, sondern der eigene schöpferische Wille verwandelt und entfaltet die Person. Auf die objektive Zeit kann man sich nicht verlassen, die Arbeit an der Gestaltung des eigenen Selbst muss man selbst verrichten.
Drittes Kapitel
Selbstprüfungen. Philologische Diät. Das Schopenhauer-Erlebnis. Das Denken als Selbstüberwindung. Verklärte Physis und der Genius. Zweifel an der Philologie. Der Wille zum Stil. Erste Begegnung mit Wagner.
Dem jungen Nietzsche, der nun schon einige »Lebensläufe« und sonstige Selbstreflexionen im Tagebuch aufgezeichnet hat, konnten die Probleme solcher selbstbezogenen Aufmerksamkeit nicht entgehen. Im Jahr 1868 notiert er unter dem Titel Selbstbeobachtung die folgenden Sätze: Sie betrügt / Erkenne dich selbst. / Durch Handeln, nicht durch Betrachten / (…) Das Beobachten hemmt die Energie: es zersetzt und zerbröckelt. / Der Instinkt ist das Beste. Er hält inne, überdenkt noch einmal das Geschriebene. Stimmt das, ist die Selbstbeobachtung tatsächlich nur hemmend, zersetzend? Er beobachtet die Selbstbeobachtung und bemerkt, dass sie ihm auch geholfen hat. Selbstbeobachtung eine Waffe gegen fremde Einflüsse, schreibt er (J 4,126). Mit Hilfe der Selbstbeobachtung konnte er das Eigene und das Fremde trennen, konnte unterscheiden zwischen dem, was er selbst wollte, und dem, was die Anderen von ihm wollten. Aber nicht immer gelingt diese säuberliche Scheidung, denn zum Rätsel des eigenen Selbst gehört, dass man nicht genau weiß, was man will. Wie entdeckt man sein eigenes Wollen? Gelingt die entscheidende Bekanntschaft mit sich selbst vielleicht erst in der Entscheidung und nicht davor? Das fragt sich Nietzsche Anfang 1869, als er von seiner Berufung nach Basel erfährt und seinen bisherigen Werdegang überprüft, um herauszubekommen, wie er sich zu diesem Ruf verhalten soll. Er soll sich für die Zukunft an den Beruf des Altphilologen binden. Wie aber ist er in die Altphilologie hineingeraten? War es eine barocke Launenhaftigkeit des äußeren Schicksals? Er hat vorbildliche, inspirierende philologische Lehrer gehabt, die Atmosphäre in Pforta, sein Talent, sein Fleiß, seine Lust an Kombinationen und Konjekturen — das alles reicht nicht aus, um den eigenen Werdegang zu verstehen. Kurz vor der Übersiedlung nach Basel findet er die folgende Formel der Selbstverständigung. Er schreibt: Das Gefühl, in der Universalität nicht zum Grunde zu kommen, trieb mich in die Arme der strengen Wissenschaft. Sodann die Sehnsucht, aus den raschen Gefühlswechseln künstlerischer Neigungen sich in den Hafen der Objektivität zu retten. (J 5,250)
Die Selbstprüfung lässt ihn erkennen, dass nicht äußerer Zwang, nicht die Aussicht auf Karriere und berufliche Sicherheit, aber auch nicht Leidenschaft für die Philologie seinen Bildungsgang bestimmt haben, sondern dass er die Philologie offenbar als Disziplinierungsmittel gewählt hat gegen die Verlockung durch die ungeheueren Horizonte der Erkenntnis und der künstlerischen Leidenschaften. Die tastende Hand des Instinkts (J 5,250) hat ihn offenbar noch nicht aufs offene Meer hinausfahren lassen, sondern ihm empfohlen, sich damit zu begnügen, vom Ufer aus ins Weite hinauszublicken. Sein Gefühl hat ihn vor dem eigenen Verlangen gewarnt, und so war er bereit gewesen, sich selbstgewählten Zwängen zu beugen.
Gebeugt hatte er sich zuerst dem Wunsch der Mutter, die ihn zum Pfarrer machen wollte. Er sollte dem verstorbenen Vater nacheifern. Aber bereits nach dem ersten Semester in Bonn bricht er das Theologiestudium ab und widmet sich ausschließlich der Altphilologie. Mit dem Christentum ist er natürlich noch längst nicht fertig, doch die christlichen Dogmen von der Auferstehung, der Gnade und der Rechtfertigung durch den Glauben haben für ihn keine bindende Kraft mehr. Als er in den ersten Semesterferien im Frühjahr 1865 nach Naumburg zurückkehrt, ist die Mutter entsetzt, weil ihr Sohn sich demonstrativ weigert, zum Abendmahl zu gehen. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung mit der Mutter, die schließlich in Tränen ausbricht und von einer der Tanten getröstet wird mit dem Hinweis, es hätten alle großen Gottesmänner Zweifel und Anfechtungen zu bestehen gehabt. Sie beruhigt sich einstweilen, verlangt aber von ihrem Sohn für die Zukunft schonende Zurückhaltung. Es soll von Religionszweifel zwischen ihnen nicht die Rede sein. Ihrem Bruder Edmund schreibt die Mutter: »Mein alter lieber Fritz ist trotz unserer Meinungsverschiedenheiten ein edler Mensch, der das Leben oder vielmehr die Zeit wahrhaft ausdeutet und nur für alles Höhere und Gute Interesse hat und alles Gemeine verachtet, und doch ist mir oft sorglich um dieses mein liebes Kind. Aber Gott siehet das Herz an.« (Janz 1,147) Einstweilen will die Mutter nicht so genau wissen, wie es im Herzen ihres abtrünnigen Sohnes aussieht, der sich über die ihm auferlegte Beschränkung auf die Mitteilung äußerer Ereignisse beklagt und im Brief vom 3. Mai 1865 bittet: Erkiesen wir uns andre Briefgegenstände (B 2,51). Der Schwester gegenüber ist er offen. Ihr gibt er am 11. Juni 1865 einen Zwischenbericht über seine Denkweise in Religions- und Glaubensdingen. Es ist bequemer, schreibt er, an das zu glauben, was einen tröstet. Schwerer ist es, der Wahrheit nachzustellen. Denn das Wahre muss nicht mit dem Schönen und Guten im Bunde stehen. Der Freund der Wahrheit darf es nicht auf Ruhe, Friede und Glück abgesehen haben, denn die Wahrheit könnte höchst abscheulich und häßlich (B 2,60) sein, und deshalb werden sich die Wege der Menschen an der Frage scheiden: willst Du Seelenruhe und Glück erstreben, nun so glaube, willst Du ein Jünger der Wahrheit sein, so forsche (B 2,61). Als Student der Altphilologie leistet Nietzsche zunächst Verzicht auf die Suche nach großen Wahrheiten und begnügt sich mit den kleinen Münzen seiner Fachdisziplin, mit Erfolg. Dem Seelenleben tut es gut, denn er merkt, was für eine wohltuende Beruhigung und Erhebung des Menschen in einer fortgesetzten eindringlichen Arbeit liegt (B 2,79). Und auch die äußere Anerkennung ist beträchtlich. Der damals führende Altphilologe Ritschl in Leipzig fördert ihn, er zieht ihn früh zu Editionsarbeiten heran, lässt ihn Aufsätze verfassen für Fachzeitschriften und prämiert eine seiner Abhandlungen bei einem Preisausschreiben. Ritschl hält auch sonst mit dem Lob nicht zurück, noch nie, sagt er ihm, habe er einen solch begabten Schüler gehabt. Das altphilologische Wunderkind aber bleibt vorsichtig. Wie leicht kann man, schreibt er am 30. August 1865 seinem Freund Mushacke, von Männern wie Ritschl bestimmt werden, fortgerissen werden vielleicht gerade auf Bahnen, die der eignen Natur fern liegen (B 2,81).
Nicht von der Philologie, aber von der Philosophie wird er sich fortreißen lassen in dem Augenblick, da ihm das Werk Schopenhauers in die Hände kommt. Er hatte im Oktober 1865 in einem Leipziger Antiquariat die beiden Bände der »Welt als Wille und Vorstellung« entdeckt, gekauft und sogleich durchgelesen und war danach, wie er in einer seiner Autobiographien berichtet, einige Zeit wie im Rausch herumgetappt: die von der Vernunft, dem historischen Sinn und der Moral zurechtgemachte Welt sei nicht die eigentliche Welt, las er dort. Dahinter oder darunter braust das wirkliche Leben: der Wille. In den Briefen und Aufzeichnungen der Leipziger Jahre zwischen 1866 und dem Frühjahr 1868 bekundet sich eine Haltung der Ergriffenheit, fast könnte man es eine Bekehrung nennen. Dass das Wesen der Welt, ihre Substanz, nicht etwas Vernunftartiges, Logisches ist, sondern ein dunkler, vitaler Trieb, das leuchtete ihm sofort ein. Was aber das Wichtigste war: er fühlte sich in seiner Leidenschaft für die Musik bestätigt durch Schopenhauers Idee von der Erlösung durch die Kunst. Dass es überhaupt den Enthusiasmus für die Kunst gibt, deutet der junge Nietzsche als Triumph vom geistigen Wesen des Menschen über die Naturbefangenheit seines Willens. Wenn solcher Triumph möglich ist, dann kann man sich auch, so Nietzsche, die Heiligung und Umgestaltung des ganzen Menschenkerns (J 3,298) zum Ziel setzen. Man muss Macht über sein eigenes Leben gewinnen, was man auch dadurch beweist, dass man sich etwas verbieten kann. Nietzsche zwingt sich dazu, vierzehn Tage hintereinander immer erst um zwei Uhr nachts ins Bett zu gehen und um sechs Uhr in der Frühe wieder aufzustehen. Er verordnet sich eine strenge Diät, er schafft sich sein eigenes Kloster und lebt darin als Asket. Seiner Mutter jagt er einen Schrecken ein, als er ihr frostige Nachrichten aus seiner Asketenwerkstatt zukommen lässt. Man müsse sich entscheiden, schreibt er am 5. November 1865, ob man dumm und vergnügt oder klug und entsagungsvoll leben wolle. Entweder ist man ein Sklave des Lebens oder man ist sein Herr, was einem nur gelingt, wenn man sich der Güter des Lebens entäußert. Dann erst ist das Leben für den, der nicht in der Tierheit gefangen bleiben will, erträglich, weil seine Last immer geringer wird und uns keine Bande an dasselbe mehr fesseln. Es ist erträglich, weil es dann ohne Schmerz abgeworfen werden kann (B 2,95f.). Es ist, wie Nietzsche im Oktober 1868 an Rohde schreibt, die ethische Luft, der faustische Duft, Kreuz, Tod und Gruft (B 2,322), was ihn an Schopenhauer fasziniert, wobei Kreuz, Tod und Gruft ihn nicht deprimieren, sondern wie ein Lebenselixier wirken. Nietzsche lässt sich von der düsteren Weltanschauung geradezu sportlich herausfordern. Er nimmt sie in sich auf, um zu überprüfen, wie viel er davon aushält, ohne die Lust zum Leben zu verlieren. Vom ›Willen zur Macht‹ ist terminologisch in den frühen Aufzeichnungen im Umkreis der Schopenhauer-Lektüre zwar noch nicht die Rede, aber in der Sache experimentiert er bereits mit diesem Machtwillen, denn die Schopenhauersche Willensverneinung ist für ihn nicht Verneinung, sondern gesteigerte Bejahung, verstanden als Sieg des geistigen Willens über den naturhaften Willen.
Die Lebensmächte, die inneren und die äußeren, erscheinen ihm, aus der Schopenhauerschen Perspektive gesehen, erhaben. Über den Eindruck eines Gewitters schreibt Nietzsche am 7. April 1866: Wie anders der Blitz, der Sturm, der Hagel, freie Mächte, ohne Ethik! Wie glücklich, wie kräftig sind sie, reiner Wille, ohne Trübungen durch den Intellekt! (B 2,122) Auch den Menschen seiner Umgebung begegnet er jetzt anders. Seitdem Schopenhauer ihm die Binde des Optimismus vom Auge genommen habe, sehe er schärfer, und das Leben sei ihm interessanter, wenn auch häßlicher geworden, schreibt er am 11. Juli 1866 an Mushacke (B 2,140). Als der Freund Carl von Gersdorff vollkommen verzweifelt ist über den Tod des bewunderten Bruders, schreibt ihm Nietzsche am 16. Januar 1867: