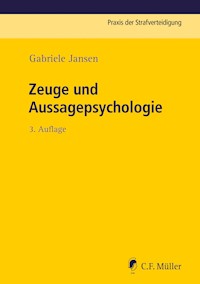
51,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Zeuge ist das häufigste Beweismittel im Strafprozess. Die Beurteilung der Aussage ist insbesondere in Fällen, in denen "Aussage gegen Aussage" steht, entscheidend für die Einstellung oder Anklageerhebung, den Freispruch oder die Verurteilung. Nach der Grundsatzentscheidung des BGH zu den Mindestanforderungen vor mehr als zwanzig Jahren hat die Aussagepsychologie im Strafprozess eine enorme Aufwertung erfahren. Das Handbuch vermittelt das notwendige Grundwissen zur Zeugenvernehmung, zur Würdigung der Zeugenaussage und zur Überprüfung aussagepsychologischer Gutachten. Dabei eignet es sich wegen der leicht verständlichen und gleichzeitig anspruchsvollen Darstellung sowohl für die fortgeschrittene Ausbildung, aber auch für die strafrechtliche Praxis ganz hervorragend. Neu u. a. in der 3. Auflage: - Aktualisierung der rechtspsychologischen Fachliteratur. Mit über 400 Veröffentlichungen im Literaturverzeichnis ein hilfreiches Nachschlagewerk! - Aktualisierung und Erweiterung der aussagepsychologisch relevanten Rechtsprechung rund um die Aussagebeurteilung. Enthalten sind z. B. Entscheidungen zur Einholung von Glaubhaftigkeitsgutachten, zu den inhaltlichen Anforderungen an die Aussagebeurteilung sowie zur Aussagetüchtigkeit. Aber auch die Rechtsprechung zu besonderen Themen wie die widerentdeckte Erinnerung, potentielle Therapieeinflüsse, Erinnerungslücken oder Erinnerungsverschmelzungen sind abgedeckt. - Behandlung der Schein- bzw. Pseudoerinnerungen in der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung und Literatur. - Darstellung "aussagepsychologischer Hinweise und Empfehlungen zur Art und Weise der Befragungen von Kindern" als wertvolle Hilfestellung zum Erkennen von suggestiven Einflüssen. - Im Anhang: Die 2017 von Psychologen formulierten "Qualitätsstandards für psychologische Gutachten".Zahlreiche Praxishinweise und Checklisten erleichtern zusätzlich die Beurteilung von Aussagen oder die Befragung von Zeugen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zeuge und Aussagepsychologie
von
Gabriele JansenRechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Köln
3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage
www.cfmueller.de
Herausgeber
Praxis der Strafverteidigung Band 29
Begründet von
Rechtsanwalt Dr. Josef Augstein (†), Hannover (bis 1984) Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Beulke, Passau Prof. Dr. Hans-Ludwig Schreiber (†), Göttingen (bis 2008)
Herausgegeben von
Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Beulke, Passau Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Alexander Ignor, Berlin
Schriftleitung
Rechtsanwalt (RAK Berlin und RAK Wien) Dr. Felix Ruhmannseder, Berlin/Wien
Autorin
Gabriele Jansen ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht in Köln. Kontakt: [email protected]
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-4174-3
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2022 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort der Herausgeber
Verlag und Herausgeber freuen sich, die auf den neuesten Stand gebrachte dritte Auflage des „Klassikers“ von Gabriele Jansen zum Zeugenbeweis in Strafsachen präsentieren zu können. Ohne Übertreibung wird man sagen dürfen, dass das Werk alles enthält, was Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger zu diesem Beweismittel wissen müssen, das in der Praxis des Strafverfahrens nach wie vor das gebräuchlichste, aber auch problematischste ist.
Seine besondere Attraktivität bezieht der Zeugenbeweis daraus, dass er den Verfahrensbeteiligten – vermeintlich – Einblicke in das Geschehen vermittelt, das aufzuklären Aufgabe des Strafverfahrens ist. Indes können diese Einblicke aus vielerlei Gründen trügerisch sein, was die Verfasserin insbesondere unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Aussagepsychologie gründlich beleuchtet. Da nicht zuletzt wegen des Diktums von der Beweiswürdigung als „ureigener“ richterlicher Tätigkeit die Möglichkeiten der Verteidigung auf die Würdigung von Zeugenaussagen durch das Gericht begrenzt sind, gehört es zu ihren Kernaufgaben, das Augenmerk zum einen auf die Beachtung der Vorschriften einer ordnungsgemäßen Zeugenvernehmung zu richten (siehe dazu Teil 2), zum anderen auf Anzeichen für eine mangelnde Erlebnisbasiertheit von Zeugenaussagen, und diese gegebenenfalls zu thematisieren. Hierfür ist das Wissen um die von der Verfasserin dargestellten aussagepsychologischen Erkenntnisse und die insoweit von der Rechtsprechung entwickelten beweisrechtlichen Anforderungen (siehe dazu Teil 1 und Teil 3) unverzichtbar.
Das Buch ist Ratgeber für die Praxis und zugleich Nachschlagewerk. Die vielfältigen gezielten Literaturhinweise nicht nur in den Fußnoten, sondern auch im laufenden Text, ermöglichen es dem interessierten Leser, sich rasch in die einschlägigen Spezialmaterien einzuarbeiten und Forschungsergebnisse in die alltägliche Arbeit einzubringen. Die Verfasserin hat in bewunderungswürdiger Weise Pfade in den Dschungel der aussagepsychologischen Fachliteratur geschlagen, die es den Leserinnen und Lesern des Buches ermöglichen, darauf zu wandeln und sich ihrer zu bedienen. Hierzu kommt die sorgfältige Analyse der gesamten einschlägigen Rechtsprechung, die mit dieser Auflage auf den neusten Stand gebracht wird.
Wir wünschen dem Buch weiterhin die Verbreitung, die es verdient.
Im November 2021
Passau
Werner Beulke
Berlin
Alexander Ignor
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
Abkürzungsverzeichnis
Einführung
Teil 1Zeugenaussage
I.Einführung in die Aussagepsychologie13 – 46
1.Historie13 – 27
2.Wissenschaftliche Grundlagen aussagepsychologischer Begutachtung28
3.Aufgabe und Zielsetzung aussagepsychologischer Begutachtung29
4.Methodisches Prüfkonzept30 – 34
a)(Nicht) erlebnisbezogene Aussage30
b)Hypothesengeleitete Begutachtung31
c)Psychologische Glaubhaftigkeitsprüfung32 – 34
5.Aufzeichnung der Originalaussage35
6.BGH-Rechtsprechung zu aussagepsychologischen Gutachten36 – 38
a)BGH 195436
b)BGH-Grundsatzentscheidung 199937
c)Nachfolgeentscheidungen38
7.Qualität aussagepsychologischer Gutachten39
8.Ausweitung des Anwendungsbereichs der Aussagepsychologie40 – 44
9.Justizirrtümer – zur Rolle der Psychowissenschaften45
10.Aussagepsychologische Fachliteratur46
II.Glaubwürdigkeit des Zeugen – Glaubhaftigkeit der Aussage47, 48
III.Höchstrichterliche Rechtsprechung zur Beurteilung von Zeugenaussagen – unter Berücksichtigung aussagepsychologischer Aspekte49 – 117
1.Die „ureigenste Aufgabe“ des Gerichts49 – 52
a)Grundwissen des Richters50, 51
b)Aussage gegen Aussage52
2.BGH-Rechtsprechung: Gutachten ist Indiz für die Glaubhaftigkeit der Aussage53
3.BGH-Rechtsprechung zur Hypothesenbildung54
4.BGH-Rechtsprechung zur Beurteilung der Aussagekompetenz55 – 65
a)Aussagekompetenz bei kindlichen Zeugen58
b)Aussagekompetenz bei psychischen Auffälligkeiten59
c)Erinnerung60 – 64
d)Erfindungskompetenz65
5.BGH-Rechtsprechung zur Fehlerquellenanalyse66 – 88
a)BGH-Rechtsprechung zur Entstehungsgeschichte der Aussage66 – 85
aa)Kindliche Zeugen67 – 72
(1)Aussageentstehung70
(2)Aussageentwicklung71
(3)Suggestion72
bb)Erwachsene Zeugen73 – 79
(1)Betäubungsmittelverfahren75
(2)Aussagen im Ermittlungsverfahren76
(3)Erpressungsverfahren77
(4)Schwurgerichtsverfahren78
(5)Beiakte79
cc)Therapieeinfluss80
dd)Mitbeschuldigter81, 82
ee)Beschuldigter – Einlassung83
ff)Beschuldigter – falsche Alibibehauptung84, 85
b)BGH-Rechtsprechung zur Aussagemotivation86 – 88
6.BGH-Rechtsprechung zur Aussageanalyse89 – 107
a)BGH-Rechtsprechung zu Merkmalen in der Aussage91 – 106
b)BGH-Rechtsprechung zur Aussagekonstanz107
7.BGH-Rechtsprechung zum Aussageverhalten108 – 113
a)Anzeigeverhalten108
b)Dritter entscheidet über Anzeige109
c)Körpersprache110
d)Eindruck von der Persönlichkeit während der Aussage111
e)„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“112
f)Eindrucksbildung113
8.BGH-Rechtsprechung zu Merkmalen in der Beschuldigtenaussage114 – 116
9.BGH- Rechtsprechung zur Entstehungsgeschichte im Familienverfahren117
IV.Gutachteneinholung118 – 162
1.Zur Beurteilung der Aussagekompetenz118 – 141
a)Eigene Sachkunde des Gerichts119
b)Hinzuziehung eines Sachverständigen120 – 136
c)Auswahl des Sachverständigen137 – 141
2.Zur Beurteilung der Aussagequalität142 – 155
a)Eigene Sachkunde des Gerichts142
b)Begutachtungsanlässe143 – 151
aa)Begutachtungsanlässe aus aussagepsychologischer Sicht143, 144
bb)Begutachtungsanlässe nach der BGH-Rechtsprechung145 – 151
(1)Kindliche Zeugen145 – 148
(2)Jugendliche Zeugen149
(3)Erwachsene Zeugen150, 151
c)Auswahl152 – 155
aa)Zuständigkeit für die Auswahl152 – 154
bb)Aussagepsychologe155
3.Leiten und Lenken des Sachverständigen, § 78 StPO156 – 162
V.Der „Rechtspsychologe“163
VI.„Besondere“ Zeugen164 – 178
2.Opferzeuge173 – 175
3.Nebenkläger als Zeuge176, 177
4.Der durch die Presse gesteuerte Zeuge178
Teil 2Zeugenvernehmung
I.Vernehmungsbedingungen186 – 201
1.Ort der Vernehmung188
2.Videovernehmung189
3.Dauer der Vernehmung190, 191
4.Anwesenheit Dritter bei der Vernehmung192
5.Hinzuziehung eines Sachverständigen zu der Vernehmung193
6.Anwesenheit des Beschuldigten bei der Vernehmung des Zeugen194 – 196
a)§ 168c StPO195
b)§ 247 StPO196
7.Ausschluss der Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung197
8.Gerichtliche Zeugenbegleitung198
9.Hilfsorganisationen 199
10.Zeugenschutzprogramme200
11.Belastungserleben von Kindern vor Gericht201
II.Durchführung der Vernehmung202 – 266
1.Vorladung203
2.Person des Vernehmenden204 – 209
a)Spezialkenntnisse205
b)Geschlecht des Vernehmenden206
c)Einstellung zum Deliktsbereich207
d)Subjektive Einschätzung des Erkennens von Täuschungen208
e)Aussagepsychologische Kenntnisse209
3.Mehrere Fragesteller bei der Vernehmung210
4.Erwartung an die Vernehmung211
5.Kommunikationsprozess zwischen Fragendem und Befragtem212, 213
6.Einzelvernehmung § 58 Abs. 1 StPO214, 215
7.Vernehmungsablauf216 – 266
a)Informatorisches Vorgespräch216
b)Belehrung zur Wahrheit § 57 StPO217
c)Angaben zur Person218
d)Belehrung nach § 52 StPO219
e)Belehrung nach § 55 StPO220
f)Unterrichtung über den Untersuchungsgegenstand221
g)Schriftliche Aussage222
h)Aufzeichnungen des Zeugen als Gedächtnisstützen223
i)Aktenkenntnis des Zeugen224
j)Zweiteilung der Vernehmung in Bericht und Befragung225 – 246
aa)Berichterstattung226
bb)Befragung227 – 242
cc)Vorhalte243 – 246
k)Wiederholte Befragung247
l)Voreinstellung des Vernehmenden248
m)Reihenfolge der Befragung des Zeugen249
n)Kinder250 – 266
aa)Wiederholtes Befragen251
bb)Autorität des Befragers252
cc)Fragerechte bei kindlichen Zeugen253
dd)Anwesenheit einer Vertrauensperson bei der Vernehmung254, 255
ee)Informatorisches Vorgespräch256
ff)Belehrung des kindlichen Zeugen zur Wahrheit, § 57 StPO257
gg)Verwandtschaftsverhältnis des kindlichen Zeugen zu dem Beschuldigten258 – 261
hh)Unterrichtung über den Untersuchungsgegenstand, § 69 Abs. 1 S. 2 StPO262
ii)Berichterstattung263
jj)Altersadäquate Befragung264
kk)Vorhalte an kindliche Zeugen265, 266
III.Inhalte der Vernehmung267 – 285
1.Aussageentstehung und Aussageentwicklung – Suggestionseffekte268 – 275
a)Erstaussage – (Erst-)Aussageempfänger272, 273
b)Vernehmung des Aussageempfängers als Zeugen274
c)Inhalt der Vernehmung zur Aussageentstehung275
2.Materiell-rechtliche Vorwürfe276 – 280
3.Alternative Erklärungen für das Zustandekommen der Aussage281
4.Aussagebestimmende Motive282
5.Identifizierung von Beschuldigten283 – 285
IV.Ausdrucksverhalten während der Aussage286 – 296
V.Dokumentation der Vernehmung297 – 318
1.Informatorisches Vorgespräch297
2.Protokollerstellung298 – 300
3.Verwendung von Vordrucken301
4.Zeitpunkt der Protokollerstellung302
5.Unterschrift auf dem Protokoll303, 304
6.Aufzeichnung auf Tonträger305 – 309
7.Videovernehmung, Videoaufzeichnung310 – 317
8.Eindrucksvermerk318
Teil 3Aussagepsychologische Begutachtung
I.Formelles320 – 372
1.Auftrag320, 321
2.Anknüpfungstatsachen322 – 336
a)Akteninhalt als Anknüpfungstatsachen322
b)Protokolle über polizeiliche Aussagen des zu begutachtenden Zeugen323 – 329
c)Vermerke von Aussageempfängern330
d)Polizeiliche Vermerke über Vernehmungen331
e)Beeinflussung des Sachverständigen durch das Aktenstudium332 – 336
3.Freiwilligkeit der Begutachtung337
4.Keine Belehrungspflicht des Sachverständigen gegenüber Zeugen338 – 340
5.Rahmenbedingungen der Begutachtung341 – 345
a)Ort der Begutachtung341
b)Häufigkeit/Dauer342
c)Entspannte Gesprächsatmosphäre343
d)Anwesenheit Dritter344
e)„Ausklang“345
6.Exploration346 – 368
a)Keine Standardisierung der Exploration350, 351
b)„Warming up“ – Rapport352
c)Hypothesenbildung353
d)Exploration zur Aussagekompetenz354 – 356
e)Exploration zur Aussageentstehung357 – 362
f)Exploration zum Tatvorwurf363 – 367
aa)Erstattung eines freien Berichtes365, 366
bb)Befragung367
g)Audio- und Videoaufnahme der Exploration368
7.Informatorische Befragung Dritter369
8.Berücksichtigung von Außenkriterien370
9.Eigene Ermittlungen371, 372
II.Unterscheidung erlebnisbegründeter von nicht erlebnisbegründeter Aussage373 – 377
1.Bewusste (intentionale) Falschaussage376
2.Unbewusste Falschaussage (Irrtum)377
III.Hypothesengeleitete Aussagebeurteilung378 – 396
1.Hypothesengeleitetes Vorgehen – Nullhypothese378 – 381
2.Ausschlussmethode382, 383
3.Relevante und eng am Sachverhalt ausgerichtete Hypothesenbildung384, 385
4.Pseudodiagnostisches Hypothesentesten – Konfirmatorische Teststrategie386 – 395
5.Hypothesenbildung ist kein abgeschlossener Prozess396
IV.Spezifizierungen der Nullhypothese397 – 473
1.Hypothese: Vollständig erfundene bewusste Falschaussage (Fantasiehypothese)398 – 438
a)Keine Wahrheitsprüfung399
b)Bewusste Falschaussage als Leistung400, 401
c)Qualitäts-Kompetenz-Vergleich402 – 408
d)Täuschung409 – 418
aa)Erkennen von Täuschungen409 – 411
bb)Täuschungsfähigkeit412, 413
cc)Täuschungsstrategien414 – 418
e)Merkmalsorientierte Inhaltsanalyse419 – 435
aa)Methodik419 – 421
bb)Glaubhaftigkeitsmerkmale422 – 432
cc)Selbstpräsentation433 – 435
f)Motivation zur bewussten Falschaussage436
g)Voraussetzung der bewussten Falschaussage437
h)Zurückweisung der Hypothese der bewussten Falschaussage438
2.Hypothese: Teilweise erfundene bewusste Falschaussage439 – 444
3.Hypothese: Übergang von der bewussten zur autosuggestiven Falschaussage445
4.Hypothese: Aggravation, Entharmlosung, Modifikation446 – 456
a)Persönlichkeitsspezifische Besonderheiten447
b)Persönlichkeitsstörungen448 – 455
aa)Borderline Persönlichkeitsstörung450 – 452
bb)Dissoziale Persönlichkeitsstörung453
cc)Histrionische Persönlichkeitsstörung454, 455
c)Jugendliche456
5.Hypothese: Übertragung457 – 459
6.Hypothese: Induktion460
7.Hypothese: Suggestion461 – 473
a)Prüfung der Suggestionshypothese461 – 463
b)Beurteilung der Suggestionshypothese464
c)Hypothese: Autosuggestion465 – 469
d)Hypothese: Bewusste/unbewusste Fremdsuggestion470 – 473
V.Die aussagepsychologische Leitfrage – fallübergreifende Analysebereiche474, 475
VI.Aussagekompetenz476 – 618
1.Wahrnehmung484 – 500
a)Aufmerksamkeit des Zeugen484, 485
b)Erwartungen des Zeugen486, 487
c)Art des erlebten Ereignisses488
d)Erfahrung489
e)Motivation490 – 492
f)Wirklichkeitskontrolle493
g)Reality monitoring – Realitätsüberwachungskriterien494
h)Wahrnehmungsfehler, -beeinträchtigungen495
i)Kindliche Zeugen496 – 498
j)Wahrnehmungsbeeinträchtigung bei Drogenkonsum, Alkoholeinfluss499, 500
2.Erinnerung/Gedächtnis501 – 564
a)Gedächtnisarten503 – 517
aa)Episodisches – autobiografisches Gedächtnis504 – 510
bb)Kurzzeit-, Arbeits- und Langzeitgedächtnis511 – 514
cc)Implizites – explizites Gedächtnis515 – 517
b)Erinnerung an das Ereignis518
c)Erinnerung an lang zurückliegende Ereignisse519
d)Erinnerung an Emotionen520
e)Sich ähnelnde Ereignisse521
f)Lücken konstruktiv schließen522, 523
g)Stress524
h)Subjektive Gewissheit525 – 532
i)Verfälschung von Gedächtnisinhalten – Nachträgliche Informationen533 – 541
aa)Falschinformationseffekt533 – 539
bb)Pseudoerinnerung – gezielte Einflussnahmen540, 541
j)Kindliche Zeugen542 – 546
k)Ältere Menschen547
l)Erinnerungsstörungen bei psychischen Störungen548 – 555
m)Vergessen/Verdrängen/Traumatische Erfahrungen556 – 560
aa)Vergessen556
bb)Verdrängen557 – 559
cc)Traumatische Erfahrungen560
n)Entstehung eines Verdachts in therapeutischen Gesprächen561 – 563
o)Erinnerungssuche – Erinnerungsarbeit – Selbsthilfegruppen – Internetforen564
3.Wiedergabe565 – 571
a)Fehler – Irrtum bei der Wiedergabe566
b)Kindliche Zeugen567 – 569
c)Erheblich intelligenzgeminderte Personen570
d)Psychische Auffälligkeiten571
4.Untersuchungsmethoden572 – 618
a)Testverfahren576 – 593
aa)Projektive Verfahren579 – 586
bb)Standardisierte Verfahren587 – 591
cc)Bildgebende Diagnostik und neuropsychologische Testverfahren592
dd)Prüfung der Übertragbarkeit der Testergebnisse auf die konkrete Aussage593
b)Überprüfung der Fantasiefähigkeit594 – 601
c)Überprüfung der Erinnerungsfähigkeit602 – 604
d)Deliktspezifische Kenntnisse des Zeugen – Sexualanamnese605
e)Suggestibilitätsprüfungen606, 607
f)Fallneutrale Exploration608
g)Begutachtungsrelevante Zeiträume609 – 613
h)Krankenakten614 – 618
VII.Qualitäts-Kompetenz-Vergleich – Erfindungskompetenz619, 620
VIII.Fehlerquellenanalyse621 – 704
1.Entstehungsgeschichte der Aussage621 – 688
a)Suggestive Einflüsse auf die Aussage des Zeugen – Feststellung und Beurteilung – 625 – 642
aa)Suggestive Einflussnahmen626, 627
bb)Induzierung von Stereotypen628
cc)Gruppen- oder Konformitätsdruck629
dd)Feedback/Reaktion des Aussageempfängers630 – 633
ee)Autorität des Befragers634, 635
ff)Extreme Mangelsituation636
gg)Ankündigung positiver oder negativer Konsequenzen637
hh)Belohnung erwarteter Antworten638
ii)Nachträgliche andere Bewertung639
jj)Änderung der Opfer-Rolle in eine aktive Zeugen-Rolle640
kk)Aufforderung zu Konfabulation641
ll)Appetenz-Aversions-Konflikt642
b)Suggestive Befragung643 – 663
aa)Offene Fragen646
bb)Fragen mit möglicher suggestiver Wirkung647 – 654
cc)Empfindungen des Vernehmenden655
dd)Voreinstellung des Befragers – Theorie der kognitiven Dissonanz – Confirmation bias656 – 663
c)Befragung als Lernprozess – Wiederholtes Befragen664 – 666
d)Befragungsprozess667, 668
e)Beeinflussung durch das Aktenstudium669, 670
f)Aufdeckungsarbeit671, 672
g)Anatomische Puppen673 – 682
h)Parteilicher Umgang mit dem Opfer durch Hilfevereine683
i)Zur Rolle ärztlicher Einrichtungen bei der Verdachtsabklärung684
j)Geständnis und Widerruf685 – 688
2.Motivationsanalyse689 – 704
IX.Realkennzeichenanalyse – Kriterienorientierte Inhaltsanalyse705 – 768
1.Anwendungsbereich705 – 707
2.Methodische Voraussetzungen708 – 714
3.Keine Anwendung bei suggerierter Aussage715
4.Zur Realkennzeichenanalyse in der Grundsatzentscheidung des BGH716
5.Validität der Realkennzeichen717
6.Spezielle Fragestellungen718
7.Simulierbarkeit von Realkennzeichen719
8.Realkennzeichen im Einzelnen720 – 757
a)Allgemeine Merkmale724 – 730
aa)Logische Konsistenz726
bb)Quantitativer Detailreichtum727
cc)Unstrukturierte Darstellung728 – 730
b)Spezielle Merkmale731 – 736
aa)Raum-zeitliche Verknüpfungen732, 733
bb)Interaktionsschilderungen734
cc)Wiedergabe von Gesprächen735
dd)Schilderungen von Komplikationen im Handlungsablauf736
c)Inhaltliche Besonderheiten737 – 747
aa)Schilderung ausgefallener Einzelheiten738
bb)Schilderung nebensächlicher Einzelheiten739
cc)Phänomengemäße Schilderung unverstandener Handlungselemente740
dd)Indirekt handlungsbezogene Schilderungen741
ee)Schilderung eigener psychischer Vorgänge742
ff)Schilderung psychischer Vorgänge des Beschuldigten743 – 747
d)Motivationsbezogene Inhalte748 – 755
aa)Spontane Verbesserung der eigenen Aussage749
bb)Eingeständnis von Erinnerungslücken750
cc)Einwände gegen die Richtigkeit der eigenen Aussage751
dd)Belastungen/Entlastungen des Beschuldigten752
ee)Unterscheidung zwischen nicht-motivationalen und motivationalen Merkmalen753 – 755
e)Deliktspezifische Aussageelemente756, 757
9.Konstanzanalyse758 – 768
a)(In)Konstanzen760 – 764
b)Präzisierbarkeit765 – 768
X.Berücksichtigung von Außenkriterien769 – 772
XI.Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Aussage773 – 781
XII.Dokumentation der Begutachtung782 – 796
1.Benennen der Anknüpfungstatsachen786
2.Benennen des Ortes der Begutachtung/der Anzahl der Explorationsgespräche787
3.Benennen der Hypothesen788
4.Benennen der Untersuchungs-, Testverfahren789 – 793
5.Trennung von Datenbericht und psychologischer Interpretation794, 795
6.Dokumentation des Explorationsgespräches796
XIII.Überprüfung des Gutachtens797 – 800
XIV.Methodenkritische Stellungnahmen801 – 803
XV.Besonderheiten804 – 815
1.Gutachten ohne Exploration804 – 806
2.Vorübergehende Vernehmungsunfähigkeit des Zeugen807
3.Zeitablauf808
4.Nur mündlich erstattetes Gutachten809
5.Antrag auf Beiziehung der Unterlagen des Sachverständigen810
6.Aufbewahrung der Untersuchungsmaterialien811
7.Vorläufiges Gutachten812
8.Begutachtung des Beschuldigten813
9.Erstattung der Gutachtenkosten
10.Haftung des Sachverständigen für ein unrichtiges aussagepsychologisches Gutachten814
11.Verhaltensauffälligkeiten815
Teil 4Prozesse
Übersicht
Vorwort
1.Einleitung
2.Definition
3.Anforderungen an psychologische Gutachten
3.1Auftragsklärung und Auftragsannahme
3.2Herleitung der Psychologischen Fragen
3.3Auswahl der Verfahren
3.4Psychologische Untersuchung
3.5Ergebnisse der psychologischen Untersuchung
3.6Aus den Ergebnissen abgeleitete Schlussfolgerungen
3.7Beantwortung der Fragestellung
4.Formale Gestaltung
5.Beurteilung des Gutachtens
6.Literatur
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A.
Auflage
Abs.
Absatz
BayObLG
Bayrisches Oberlandesgericht
Bd.
Band
BGH
Bundesgerichtshof
BGHSt
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes
BGHR
BGH-Rechtsprechung in Strafsachen, hrsg. Von Richtern des Bundesgerichtshofes (seit 1987)
BKA
Bundeskriminalamt
BT-Drucks.
Bundestagsdrucksache
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
bzw.
beziehungsweise
CAT
Children Apperception Test
d.A.
die Autorin
d.h.
das heißt
DRiZ
Deutsche Richterzeitung
et al.
und andere
e.V.
Eingetragener Verein
FamZ
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
ff.
fortfolgende
FPPK
Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie (Zeitschrift)
FPR
Familie, Partnerschaft, Recht
FS
Festschrift
gem.
gemäß
ggf.
gegebenenfalls
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
i.S.d.
im Sinne des/der
i.Ü.
im Übrigen
JGG
Jugendgerichtsgesetz
KK
Karlsruher Kommentar
Krim
Kriminalistik
LR
Löwe-Rosenberg
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
MRK
Menschenrechtskonvention
MschrKrim
Monatsschrift für Kriminologie
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR
NStZ-Rechtsprechungs-Report Strafrecht (Zeitschrift)
o.ä.
oder ähnlich(es)
OLG
Oberlandesgericht
PdR
Praxis der Rechtspsychologie
PFT
Picture-Frustration Test
R&P
Recht und Psychiatrie
Rn.
Randnummer
RG
Reichsgericht
RGSt
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RiStBV
Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren
S.
Seite/Satz
sog.
sogenannte(r/s)
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozessordnung
StraFo
Strafverteidiger Forum
StV
Strafverteidiger
TAT
Thematischer Apperception Test
u.U.
unter Umständen
UA
Urteilsausfertigung
u.a.
unter anderem
Vgl.
Vergleiche
z.B.
zum Beispiel
z.T.
zum Teil
ZStW
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
Einführung
1
Zeuge als häufigstes Beweismittel. Der Zeuge ist das häufigste Beweismittel im Strafprozess. Streitet die Aussage des Beschuldigten gegen die des Zeugen, entscheiden oft seine Angaben über Einstellung oder Anklage, Freispruch oder Verurteilung. Dann kommt es entscheidend auf die Qualität seiner Aussage an.
2
Überzeugungsgrundlage. In der Regel hat sich der Strafjurist die Beurteilung der Zeugenaussage grundsätzlich auch ohne Fachkenntnisse zuzutrauen. Hierin wird er durch jahrzehntelange gefestigte Rechtsprechung gestärkt, wonach die Beurteilung von Zeugenaussagen ureigenste Aufgabe des Tatrichters ist. Gleichwohl entsteht in der Praxis häufig der Eindruck, dass er bei der Beurteilung jedoch nicht auf wissenschaftliche aussagepsychologische Erkenntnisse zurückgreift, sondern sich vornehmlich auf seine Lebenserfahrung und Menschenkenntnis verlässt und bei der Überzeugungsbildung vor allem auch seiner Eindrucksbildung folgt. Insbesondere ist oft nicht bekannt, wie sehr z.B. die Voreinstellung des Befragers Einfluss auf die Aussage haben kann. Vielfach vollziehen Richter auch nur die Ermittlungsergebnisse nach und versuchen den Zeugen auf seine polizeilichen Aussagen festzulegen, ohne um die Bedeutung der Entstehungsgeschichte der Aussage zu wissen und diese aufzuklären.
3
Aussagepsychologische Literatur. Seit Ende der neunziger Jahre gibt es zahlreiche aussagepsychologische Fachbücher, die z.T. jedoch zwischenzeitlich vergriffen und in juristischen Bibliotheken meist nicht zu finden sind, aber auch eine Vielzahl von Neuerscheinungen, die in die 3. Auflage eingearbeitet sind.
Daneben finden sich auch zahlreiche aktuelle – in diesem Buch angesprochene – psychologische Aufsätze.
4
Strafjuristen sind bei der Suche nach Entscheidungen und strafrechtlicher Literatur an systematische Zusammenstellungen gewöhnt, die in der Aussagepsychologie so nicht zu finden sind.
Dass dem Juristen die aussagepsychologische Literatur nicht leicht zugänglich ist, ist die Idee geschuldet, für den Strafjuristen eine systematische Zusammenstellung zu fertigen, die als Nachschlagewerk auch für den Psychologen interessant sein kann.
5
Mit Blick auf die stete Ausweitung des Opferschutzes sind in dieser Auflage Hilfsorganisationen, die den „parteilichen Umgang“ mit dem Zeugen propagieren besonders in den Blick genommen worden, da diese beratend vor und nach Anzeigenerstattung tätig werden und die damit einhergehende potentielle Einflussnahme auf den Inhalt der Aussage bislang nicht hinreichend aussagepsychologisch und rechtlich diskutiert ist.
3. Auflage. Auch mehr als zwanzig Jahre nach der BGH - Grundsatzentscheidung aus 1999 zu den wissenschaftlichen Anforderungen, die an aussagepsychologische Gutachten zu stellen sind, haben sich die aussagepsychologischen Fachkenntnisse der Justiz, aber auch vieler Gutachter nicht wesentlich verbessert. Mein Eindruck ist, dass Sachverständige augenscheinlich den Anforderungen des BGH genügen wollen, tatsächlich offenbaren viele Gutachten aber mangelnde Kenntnisse einer am Sachverhalt orientierten Hypothesenbildung und ein mangelndes Verständnis von dem aussagepsychologischen Suggestionskonzept. Vor allem autosuggestive Einflüsse werden vielfach gar nicht geprüft und deshalb womöglich auch nicht erkannt. Manche Sachverständige scheitern schon an einer hinreichenden Explorationstechnik. Mit der Hypothesenbildung „steht und fällt“ das Gutachten; deshalb ist ihr seit der 2. Auflage eine ausführliche Darstellung gewidmet, die sich in Teil 3 III (Rn. 378 ff.) und IV (Rn. 397 f.) findet.
In Literatur und Rechtsprechung sind bislang die möglichen Einflussnahmen durch Mitarbeiter sog. Opferhilfeeinrichtungen, die damit werben, „parteilich für Opfer“ zu sein, zum Teil konkret Einfluss auf die Entscheidung zur Anzeigenerstattung nehmen und sich auch eine Verdachtsabklärung zutrauen, nicht diskutiert. Wegen der besonderen Bedeutung potentieller Einflussnahme auf die Zeugenaussage erfolgt in Teil 3 VIII „Fehlerquellenanalyse“ (Rn. 683 ff.) eine ausführliche Darstellung der Problematik.
In der 3. Auflage ist die Darstellung der aussagepsychologisch relevanten Rechtsprechung sowie der rechtspsychologischen Fachliteratur auf den neuesten Stand gebracht.
Im Text findet man einzelne Hinweise, die Hilfestellungen im Umgang mit aussagepsychologischen Fragestellungen geben sollen, und gegenüber der ersten Auflage wurde die Anzahl der Checklisten erweitert.
6
Das Buch gliedert sich in vier Teile.
Im ersten Teil (Teil 1 – Rn. 7 ff.) werden aussagepsychologische Gesichtspunkte zur Zeugenaussage dargestellt. Er befasst sich mit der Einführung in die Aussagepsychologie (Teil 1 I – Rn. 13 ff.), mit dem Unterschied zwischen der Glaubwürdigkeit des Zeugen und der Glaubhaftigkeit der Aussage (Teil 1 II – Rn. 47 f.), der Aussagebeurteilung in der BGH-Rechtsprechung (Teil 1 III – Rn. 49 ff.), der Gutachteneinholung (Teil 1 IV – Rn. 118 ff.), dem Rechtspsychologen (Teil 1 V – Rn. 163) und „Besonderen“ Zeugen (Teil 1 VI – Rn. 165).
Im zweiten Teil (Teil 2 – Rn. 179 ff.) geht es um die Zeugenvernehmung. Es werden die Vernehmungsbedingungen (Teil 2 I – Rn. 186 ff.), die Durchführung der Vernehmung (Teil 2 II – Rn. 201 ff.), die Inhalte der Vernehmung (Teil 2 III – Rn. 267 ff.), das Ausdrucksverhaltens während der Aussage (Teil 2 IV – Rn. 286 ff.), die Dokumentation der Vernehmung und deren Auswertung unter aussagepsychologischen Gesichtspunkten (Teil 2 V – Rn. 297 ff.) dargestellt.
Der dritte Teil (Teil 3 – Rn. 319 ff.) enthält Ausführungen zur aussagepsychologischen Begutachtung, im Einzelnen zu Formellem (Teil 3 I – Rn. 320 ff.), zur Unterscheidung zwischen erlebnisbegründeter und nicht erlebnisbegründeter Aussage (Teil 3 II – Rn. 373 ff.), zur hypothesengeleiteten Aussagebeurteilung (Teil 3 III – Rn. 378 ff.), zur Spezifizierung der Nullhypothese (Teil 3 IV – Rn. 397 ff.), zur aussagepsychologischen Leitfrage (Teil 3 V – Rn. 474 f.), zur Aussagekompetenz (Teil 3 VI – Rn. 476 ff.), zum Qualitäts-Kompetenz-Vergleich (Teil 3 VII – Rn. 619 ff.), Fehlerquellenanalyse (Teil 3 VIII – Rn. 621 ff.), zur Realkennzeichenanalyse (Teil 3 IX – Rn. 705 ff.), zur Berücksichtigung von Außenkriterien (Teil 3 X – Rn. 769 ff.), zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Aussage (Teil 3 XI – Rn. 773 ff.), zur Dokumentation der Begutachtung (Teil 3 XII – Rn. 782 ff.), zur Überprüfung des Gutachtens (Teil 3 XIII – Rn. 797 ff.), zu methodenkritischen Stellungnahmen (Teil 3 XIV – Rn. 801 ff.) und zu Besonderheiten (Teil 3 XV – Rn. 804 ff.).
Der vierte Teil (Teil 4 – Rn. 816 ff.) stellt die beiden spektakulärsten Prozesse dar, in denen aussagepsychologische Gesichtspunkte bei der Vernehmung kindlicher Zeugen und aussagepsychologischer Gutachten eine Rolle gespielt haben; das sog. Montessori-Verfahren und das sog. Wormser Mißbrauchsverfahren wie auch dem Pascal-Prozess.
Die Entscheidungen werden im Text nach dem Aktenzeichen und in der Fußnote nach den Fundstellen, die BGH-Nack entnommen sind, benannt. Neu hinzugekommene Entscheidungen werden mit dem Aktenzeichen angegeben. Inhalte der Grundsatzentscheidung des BGH zu den wissenschaftlichen Anforderungen, die an aussagepsychologische Gutachten zu stellen sind, werden wegen ihrer besonderen Bedeutung besonders hervorgehoben und farblich unterlegt. Zur einfacheren Handhabung und nicht zuletzt dem aussagepsychologischen Grundsatz folgend, dass es auf das tatsächlich Gesagte (hier Geschriebene) und nicht auf das von dem psychologischen Laien dazu Zusammengefasste, Um- und Selbstformulierte ankommt, werden die psychologischen/psychiatrischen Ausführungen in ihrem genauen Wortlaut zitiert.
Teil 1Zeugenaussage
7
Die Constitutio Criminalis Carolina war das erste deutsche Gesetz, das das Strafrecht und das Strafprozessrecht reichsgesetzlich regelte und das zwischen Haupt- und Hilfstatsachen unterschied. Damals konnte ein Beschuldigter nur verurteilt werden, wenn er geständig war oder – anders als heute – durch zwei „einwandfreie“ Zeugenaussagen überführt wurde. Da die geschichtliche Entwicklung die Untauglichkeit gesetzlicher Beweisregeln gezeigt hat, wurde mit der 1877 eingeführten Vorschrift des § 260 StPO (heute wortgleich § 261 StPO) eine deutliche und bewusste Abkehr von gesetzlichen Beweisregeln des Inquisitionsprozesses vollzogen.
8
Heute entspricht es – wenn Aussage gegen Aussage steht – gefestigter Rechtsprechung des BGH, dass ein Beschuldigter aufgrund einer einzig ihn belastenden Aussage verurteilt werden kann. Diese Aussage muss eine hochwertige Qualität aufweisen.
Eschelbach[1] erläutert: „Über Jahrtausende hinweg ermöglichte der strukturell defizitäre Beweis durch einen einzigen parteilichen Zeugen nach einer auf Erfahrungen beruhenden Vorsichtsregel alleine noch keine Verurteilung.“ Erst die Einführung des Prinzips der im Gesetzestext scheinbar schrankenlos gewährleisteten — „freien Beweiswürdigung“ (§ 261 StPO) eröffnete den Weg dazu, der aber auch erst seit der Nachkriegszeit zunehmend beschritten wurde. Die besagte Konsequenz ist die Verurteilung bestreitender Angeklagter aufgrund einer singulären Belastungszeugenaussage, die auch einzelne Defizite aufweisen kann, um danach immer noch geglaubt zu werden.
Den Strafjuristen wird vor allem die Rechtsprechung des BGH zur Aussageanalyse durch den Tatrichter interessieren.
9
In Teil 1 I (Rn. 13 ff.) wird eine Einführung in die Aussagepsychologie gegeben.
Dazu gehört die Darstellung der „Historie“ der Aussagepsychologie, der „Aufgabe und Zielsetzung aussagepsychologischer Begutachtung“, des methodischen Prüfkonzepts. Es folgt eine Befassung mit der „Aufzeichnung der Originalaussage“, der „BGH-Rechtsprechung zu aussagepsychologischen Gutachten“, der „Qualität aussagepsychologischer Gutachten“, der „Ausweitung des Anwendungsbereiches der Aussagepsychologie“ ein Überblick über die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Aussagepsychologie auf erwachsene Zeugen, Aussagen von (Mit)Beschuldigten, Ausländer und die Identifizierungsaussage.
Zuletzt folgt eine ausführliche Darstellung der aussagepsychologischen Fachliteratur.
10
In Teil 1 II wird der Unterschied zwischen der Glaubwürdigkeit der Person und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage aufgezeigt.
In ersten Phasen der Aussagepsychologie als Wissenschaft stand nicht die Beurteilung der Aussage zu dem eigentlichen Geschehen, sondern die Persönlichkeit des Zeugen im Vordergrund. Lange Zeit ist auch in der höchstrichterlichen Rechtsprechung von der Glaubwürdigkeit des Zeugen die Rede. Heute geht es nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand allein um die Qualität der Aussage.
11
In Teil 1 III (Rn. 49 ff.) ist die BGH-Rechtsprechung zu aussagepsychologischer Begutachtung, also zur Aussagetüchtigkeit und -kompetenz, zur Fehlerquellenanalyse und zur Aussageanalyse dargestellt.
12
In Teil 1 IV (Rn. 118 ff.) wird die BGH-Rechtsprechung zur Gutachteneinholung aufgezeigt, in Teil 1 V (Rn. 163 ff.) geht es um den aussagepsychologischen Sachverständigen, vor allem um den Rechtspsychologen und in VI um „besondere“ Zeugen, nämlich um Zeugen vom Hörensagen, die der Aussagepsychologe Aussageempfänger nennt, Opferzeugen, die Nebenkläger als Zeugen und mit Blick auf die zunehmende Kontaktaufnahme von Zeugen zu Pressevertretern zu dem von der Presse gesteuerten Zeugen.
I.Einführung in die Aussagepsychologie
1.Historie
13
Aussagepsychologische Gutachten werden in der höchstrichterlichen Rechtsprechung erstmalig im Jahr 1954 (in BGH [5 StR 416/54][2]) erwähnt. Danach sind Sachverständige zu bestellen, wenn die Zeugenaussagen von Kindern oder Jugendlichen die alleinigen oder wesentlichen Beweismittel darstellen. Damit sind aussagepsychologische Gutachten seit mehr als 50 Jahren als Beweismittel in Strafverfahren dem Grunde nach anerkannt.
Ausführliche Abhandlungen zu „historisch-psychologischen Betrachtungen der Zeugenaussage“ finden sich bei Kühne[3], die auf die Werke zu den Anfängen der Aussagepsychologie Anfang des letzten Jahrhunderts von Binet[4], Stern[5]und Münsterberg[6] hinweist, wie auch bei Müller-Luckmann[7], Köhnken[8] und Steller[9], Steller/Böhm[10] ziehen Bilanz über „50 Jahre Rechtsprechung des BGH zur Aussagepsychologie“.
14
Erste bis dritte Phase.William Stern[11] verstand schon 1902 die Aussage als geistige Leistung und zugleich als Verhörsprodukt. „Dieser Titel beschreibt das Konzept der Aussagepsychologie: Eine Aussage wird als Leistungsprodukt aufgefaßt, das nicht nur abhängig ist von personalen Merkmalen (geistige Leistung), sondern auch durch situative Merkmale bedingt sein kann, z.B. durch Merkmale der Befragungsumstände (Verhörsprodukt)“, erläutern Steller/Volbert[12] dazu. Nach Greuel[13] ist Glaubhaftigkeitsbegutachtung keine Integritäts- sondern Leistungsdiagnostik. Eine persönlichkeitsbezogene Betrachtung kann mithin keinen Beitrag zur Klärung der Frage liefern, ob eine konkrete Zeugenaussage glaubhaft ist oder nicht. Steller[14] resümiert zu „Vier Jahrzehnte forensische Aussagepsychologie“ wie auch Greuel[15].
16
Vierte Phase.Undeutsch forderte 1953 auf dem 19. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Köln dazu auf, die Glaubhaftigkeit der Aussage in den Mittelpunkt der Glaubwürdigkeitsbeurteilung zu stellen. Er läutete damit eine neue Phase der Aussagepsychologie ein, die heute die Glaubhaftigkeitsbegutachtung bestimmt. Die von ihm aufgestellte Hypothese lautete: Aussagen über tatsächlich Erlebtes unterscheiden sich inhaltlich systematisch von erfundenen Aussagen (von Steller 1997 als Undeutsch-Hypothese[19] benannt).
17
Undeutsch-Hypothese
Aussagen über tatsächlich Erlebtes unterscheiden sich inhaltlich systematisch von Aussagen über Erfundenes
18
Überblick über die Entwicklung der (deutschsprachigen) Aussagepsychologie
Bei Wegener[20] und Greuel[21] findet sich ein Überblick über die Entwicklung der (deutschsprachigen) Aussagepsychologie im letzten Jahrhundert:
Zeitraum
Bezeichnung
Methodischer Zugang
Publikations-Beispiele
Zentrale Konstrukte
1900 – 1930
Experimentelle Frühphase
Laborexperi-mente
Wirklichkeits-Versuche
William Stern (1902)[22]
Aussagegenauigkeit
Aussagetüchtigkeit
Aussagezuverlässigkeit
Inwieweit kann die normale Zeugenaussage als eine korrekte Wiedergabe des objektiven Sachverhalts gelten?
1930 – 1945
Abstinenzphase
–
–
–
1945 – 1980
Erfahrungs- und Entwicklungsphase
Forensische Sachverständigentätigkeit
Experimentelle Forschung
Undeutsch (1967)[23]
Arntzen (1971)[24]
Trankell (1971)[25]
Köhnken (1989)[26]
Strikte Trennung zwischen Glaubwürdigkeit der Person und Glaubhaftigkeit der Aussage
Aussagequalität Glaubwürdigkeitsmerkmale
80er Jahre
Evaluations-Studien
Validierungs-Experimente
Experimentelle Validierungs-Phase
Steller (1988)
Ceci & Bruck (1993)[27]
Volbert & Pieters (1996)[28]
Aussagequalität
Aussagetüchtigkeit
Aussagezuverlässigkeit
Merkmalsorientierte Aussageanalyse
Suggestive Beeinflußbarkeit und Verfälschbarkeit (kindlicher) Aussagen
90er Jahre
Simulationsstudien
Theoretische Modellbildungen
Integrationsphase
Greuel et al. (1998)[29]
Steller/Volbert/Wellershaus (1993)[30]
Sporer (1997)[31]
Stadler (1997)[32]
Steller & Volbert (1997)[33]
Aussagetüchtigkeit
Aussagequalität
Aussagezuverlässigkeit
19
Viele Jahre hatte die Justiz keinerlei Interesse an aussagepsychologischen Forschungserkenntnissen gezeigt. Es wird vermutet[34], dass das vor allem an der „fehlenden Lebensnähe“ der vorwiegend im Labor durchgeführten Experimente gelegen hat.[35]
Arntzen hat Anfang der neunziger Jahre die praktische Verbreitung der Aussagepsychologie gefördert.[36]
Wissenschaftliche Fortentwicklung erfuhr die Aussagepsychologie insbesondere durch Arbeiten von Professor Köhnken, Professor Steller, Professor Volbert und Professor Greuel und deren Mitarbeiter. Näheres zu deren Veröffentlichungen findet sich unter Punkt 10, Rn. 46.
20
Suggestionsforschung.Greuel[37] spricht von der Suggestionsforschung als dem aussagepsychologischen Forschungsthema ab 1980.
Die Anfänge der Suggestionsforschung gehen auf Arbeiten von Binet[38], Münsterberg[39], Stern[40] und Stern/Stern[41] Anfang des letzten Jahrhunderts zurück. Stern[42] sprach – wie schon oben erwähnt – 1902 von der Aussage nicht nur als geistiger Leistung sondern auch als Verhörsprodukt, so dass schon damals die Bedeutung der Entstehungsgeschichte der Aussage erkannt wurde.
Seit den 80er Jahren sind vor allem aus dem anglo-amerikanischen Raum zahlreiche Forschungsprojekte bekannt, die sich mit Suggestionseffekten insbesondere bei kindlichen Zeugen beschäftigen.
21
Veröffentlichungen zur Suggestionsproblematik finden z.B. bei Ceci & Bruck[43]; Goodman et al.[44]; Sporer & Bursch[45]; Volbert[46]; Volbert & Pieters[47], Yapko[48], in Greuel/Fabian/Stadler[49] und Greuel[50]. Schade[51] zeigt die Bedeutung der Aussageentstehungsgeschichte am Beispiel des Wormser-Missbrauchsverfahrens und verdeutlicht das weitreichende aussagepsychologische Suggestionskonzept anhand anschaulicher Beispiele.
22
Köhnken[52] berichtet über Forschungsergebnisse, wonach suggerierte Informationen in das Gedächtnis „implantiert“ werden können, die als tatsächlich selbst erlebt empfunden werden, wobei die beeinflussten Personen subjektiv von der Richtigkeit der Falschinformationen überzeugt sind.
23
Greuel[53] stellt in ihrer Habilitationsschrift die Grundlagen und den Stand der Suggestionsforschung sowie eine hypothesenzentrierte Auswertung empirischer Befunde dar. Es geht dabei nicht um „generelle Suggestibilität“ sondern um die Beantwortung der Frage:
„Unter welchen spezifischen Suggestionsbedingungen können Aussagen über spezifische Erlebnisrepräsentationen in welcher spezifischen (und forensisch relevanten) Hinsicht beeinflusst werden?“[54]
Im Handbuch der Rechtpsychologie ist der aktuelle Stand der Forschung in dem Beitrag von Volbert „Suggestion“ aufgezeigt, die sich in zahlreichen Veröffentlichungen mit Fragen der Suggestion und Suggestibilität befasst hat.[55]
Interessant sind auch die Beiträge zur Beeinflussbarkeit älterer Menschen[56] und zur Langzeitentwicklung suggerierter Pseudoerinnerungen bei Kindern.[57]
Beachtenswert – denn äußerst praxisnah – erscheint die von Volbert[58] aufgezeigte „Wandlung“ der bewussten Falschaussage zur Falschaussage aufgrund autosuggestiver Prozesse.
(Straf-)Juristen wissen meist nicht hinreichend um den Inhalt und Umfang des Suggestionskonzepts. Dies mag daran liegen, dass ihnen die Prüfung der Entstehungsgeschichte der Aussage nicht vertraut ist und juristische Lehrbücher sich vielfach auf die Darstellung suggestiver Frageformen beschränken.
24
Kindliche Zeugen – Jugendliche Zeugen. Lange Zeit wurde Kindern die Fähigkeit, verlässliche Zeugen zu sein, abgesprochen, weil sie Fantasiertes von Erlebtem noch nicht unterscheiden könnten, sie erhöht suggestibel seien und keine zusammenhängende und geordnete Darstellung des Geschehens erbringen könnten.[59]
Müller-Luckmann[60], Undeutsch[61], Kühne[62], Endres/Scholz/Summa[63] und Steller[64] zeigen die historische Entwicklung der Beurteilung kindlicher Zeugenaussagen seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf.
Nach einer Entscheidung des Reichsgerichts[65] konnten auch Kinder Zeugen sein, wenn von ihnen eine verständliche Aussage zu erwarten war.
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde in der aussagepsychologischen Forschung erkannt, dass in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Angaben von Kindern der Wahrheit entsprechen.[66] In einem Grundsatzurteil hat der BGH[67] 1955 klargestellt, dass „Kinderaussagen nicht häufiger unglaubwürdig sind, als die Aussagen von Erwachsenen, dass Kinder oft sogar die besten Zeugen sind“.
25
Mitte der achtziger/Anfang der neunziger Jahre gewann die Frage der Beeinflussbarkeit von Kindern wieder an Bedeutung. Auslöser waren in dieser Zeit gegründete Selbsthilfevereine, die sich die Aufdeckung des sexuellen Missbrauches zum Ziel gesetzt hatten. Die dort kreierte – höchst suggestiv wirkende – Aufdeckungsarbeit löste eine Debatte um den „Mißbrauch mit dem Mißbrauch“[68] aus.
26
Aufdeckungsarbeit. Anfang der neunziger Jahre meinten selbsternannte Kinderschutzvereine, allen voran „Wildwasser e.V.“ und „Zartbitter e.V.“, durch nicht entsprechend qualifizierte Mitarbeiter mit Hilfe anatomisch korrekter Puppen und selbst kreierter einseitig parteiisch ausgerichteter Befragungs- und Deutungsweise den sexuellen Missbrauch „aufdecken“ zu können. Verfahren wie das sog. Montessori-Verfahren in Münster und kurz danach die spektakulären Wormser Missbrauchsverfahren Mitte/Ende der neunziger Jahre haben nicht nur die Unzulänglichkeit ideologisch gesteuerter Aufdeckungstechniken deutlich gemacht. In diesen Verfahren wurde die Justiz durch Hinzuziehung wissenschaftlicher ausgewiesener Sachverständiger in dieser Ausführlich- und Deutlichkeit erstmals über die Erkenntnisse der modernen Aussagepsychologie informiert. Im Vordergrund stand damals das aussagepsychologische Suggestionskonzept.[69]
27
Eine bestimmte Altersgrenze, ab der die Zeugenkompetenz von Kindern noch nicht bzw. schon gegeben ist, lässt sich nicht festlegen. Ab dem dritten Lebensjahr steigt die sprachliche Fähigkeit und die Wirklichkeitserfassung kontinuierlich an.[70] Nach Arntzen[71] können kindliche Äußerungen in diesem Alter in der Regel Angaben von älteren Personen aber nur „stützen“. Die Grenze wird im Allgemeinen bei etwa vier Jahren angenommen. Unterschiede bestehen in der Einschätzung von Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren. Nach Arntzen[72] sind Kinder im Alter von viereinhalb Jahren nur unter günstigen Umständen aussagetüchtig. Das OLG Zweibrücken[73] sieht Kinder, die jünger als 4 ½ Jahre sind, kaum als aussagetüchtig an.
Nach Volbert/Steller[74] können Kinder zwischen drei und vier Jahren mit minimaler Unterstützung schon eine halbwegs zusammenhängende Aussage über ein vergangenes Ereignis machen, vier bis fünfjährige Kinder sollen schon über Ereignisse berichten können, die ein oder zwei Jahre zurückliegen.
Greuel[75] erläutert zum autobiographischen Gedächtnis: „In der aktuellen Diskussion wird … das Ende der Kindheitsamnesie auf dreieinhalb bis vier Jahre datiert (Malinoski, Lynn & Sivec 1998). Einschränkend muß hier jedoch darauf hingewiesen werden, daß für einen spezifischen Bereich von Kindheitserinnerungen, namentlich für trauma memories, diese Altersgrenze angezweifelt wird. So problematisieren Browne, Scheflin und Hammond (1998), daß es, eingedenk der defizitären Erkenntnisbasis bezüglich der (möglichen) Distinktheit des Trauma-Gedächtnisses, zu einfach sei, das vierte Lebensjahr generell als cut-off-point für die Kindheitsamnesie anzunehmen.“
Undeutsch[76] schreibt 1967: „Als höchst bedenklich galten von alters her ‚Mädchen um die Zeit der Geschlechtsreife‘, wenn sich ihre Aussagen auf geschlechtliche Vorgänge beziehen. Es heißt, daß um diese Zeit ihre Phantasie besonders lebhaft sei und mit Vorliebe um geschlechtliche Dinge kreise.“
Volbert[77] gibt eine grobe Orientierung nach Altersangaben (unter 4, 4-5 und ab 6 Jahre) zur Beurteilung der Aussagetüchtigkeit.
2.Wissenschaftliche Grundlagen aussagepsychologischer Begutachtung
28
1999 hat der BGH wissenschaftliche Mindeststandards formuliert, denen aussagepsychologische Gutachten zu genügen haben[78]:
BGH[1 StR 618/98]
„Bei der Begutachtung hat sich ein Sachverständiger ausschließlich methodischer Mittel zu bedienen, die dem jeweils aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand gerecht werden (Steller MschrKrim 1988, 16, 24).“[79]
3.Aufgabe und Zielsetzung aussagepsychologischer Begutachtung
29
In der gerichtlichen Fragestellung geht es bei der aussagepsychologischen Begutachtung um die Erlebnisfundiertheit der Aussage.
Aufgabe und Zielsetzung psychologischer Begutachtungen zur Glaubhaftigkeit von Aussagen – vgl. Greuel[80] – „kann aus Sicht der empirischen Wissenschaft immer nur darin bestehen, Wahrscheinlichkeitsaussagen darüber zu treffen, ob und ggf. inwieweit eine Aussage einem subjektiven Erlebnis in der Wachwirklichkeit entspricht bzw. mit diesem korrespondiert“.
4.Methodisches Prüfkonzept[81]
a)(Nicht) erlebnisbezogene Aussage[82]
30
Der Aussagepsychologe spricht nicht von „wahrer“ oder „unwahrer“, sondern von erlebnisbezogener oder nicht erlebnisbezogener Aussage.
Die erlebnisbezogene Aussage entspricht der „wahren Aussage“. Der Zeuge spricht über etwas, was er tatsächlich erlebt hat.
Die nicht erlebnisbezogene Aussage entspricht der „unwahren Aussage“. Hier irrt der Zeuge, er spricht über etwas, was er nicht bzw. so nicht oder in anderem Zusammenhang als dem geäußerten erlebt hat.
Bei der nicht erlebnisbezogenen Aussage hat sich der Zeuge die Aussage komplett oder teilweise ausgedacht (Lüge) oder der Inhalt der Aussage ist ihm von einem anderen suggeriert worden (Fremdsuggestion) oder er hat ihn sich selbst „eingeredet“ (Autosuggestion). Bei suggerierten Aussagen geht der Zeuge subjektiv – fehlerhaft – davon aus, dass das Ereignis stattgefunden hat.
b)Hypothesengeleitete Begutachtung
31
Um herauszufinden, ob die Aussage des Zeugen erlebnisbezogen ist oder nicht, bildet der Aussagepsychologe verschiedene Hypothesen. Ausgangshypothese ist die sog. Nullhypothese: die Aussage hat keinen Erlebnisbezug. Hierzu bildet er Spezifizierungen, er sucht – dem Sachverhalt nach – nach naheliegenden Begründungen für den fehlenden Erlebnisbezug: „die Aussage hat keinen Erlebnisbezug, weil …“.
Erklärungen für den mangelnden Erlebnisbezug können z.B. darin bestehen, dass die Aussage ganz oder in wesentlichen Teilen erlogen ist, oder dass sie dem Zeugen suggeriert wurde oder er sie sich selbst eingeredet hat. Vielfach wird es auch vorkommen, dass Zeugen zunächst lügen und sich die Lüge dann so lange einreden, bis sie selbst von dem erlogenen Sachverhalt überzeugt sind (Verlauf der bewussten zur autosuggestiven Falschaussage[83]).
Die jeweilige Prüfung unterliegt unterschiedlichen Prüfkriterien. So kann z.B. die Realkennzeichenanalyse nicht zwischen erlebnisbezogenen und suggerierten Aussagen unterscheiden. Hierbei kommt es entscheidend auf die Analyse der Aussageentstehung und -entwicklung an. Die Realkennzeichenanalyse findet – neben der Motivationsanalyse – bei der Unterscheidung zwischen einer erlebnisbezogenen und einer ausgedachten, also bewusst falschen Aussage, Anwendung.[84]
c)Psychologische Glaubhaftigkeitsprüfung
32
Die psychologische Glaubhaftigkeitsprüfung von Zeugenaussagen ist nach dem heutigen Stand der theoretischen Entwicklungen und der empirisch-psychologischen Forschung, wie sie auch der BGH in der Grundsatzentscheidung aufgreift, im Wesentlichen unter den folgenden Aspekten vorzunehmen:[85]
•
33
Hinsichtlich der Aussagevalidität
Dazu gehören Merkmale und Bedingungen der Aussagesituationen, die die Zuverlässigkeit und Qualität der Aussage beeinflussen können („Fehlerquellenanalyse“), wie die Entstehung und die weitere Entwicklung der Aussage sowie unter Umständen eine Analyse der „Motivationslage“ in Bezug auf die (Erst-)Aussage.
•
34
Hinsichtlich der Aussagequalität
Die konkrete(n) vorliegende(n) Aussage(n) selbst sind schließlich hinsichtlich solcher Merkmale zu untersuchen, in denen sich erlebnisbegründete Aussagen systematisch von solchen unterscheiden, denen kein selbsterlebtes Ereignis zugrunde liegt (sogenannte „Glaubhaftigkeitskriterien“ oder „Realkennzeichen“).
Dabei ist die Aussage- und Erfindungskompetenz zu beachten.
Dazu gehören solche Merkmale, die sich auf aussagepsychologische Besonderheiten des Zeugen beziehen.[86]
Ausführliche Erläuterungen finden sich z.B. bei Greuel et al.[87], Steller[88], Steller/Volbert[89], Köhnken[90]und Volbert[91]; siehe auch die Ausführungen im Teil 3 (Rn. 319 ff.).
Eine Einführung in den „psychologischen Forschungsprozess“ findet man bei Gerrig/Zimbardo Psychologie, 21. A., 2018.
5.Aufzeichnung der Originalaussage
35
Leider regelt der Gesetzgeber die Tonbandaufzeichnung der Vernehmung nicht gesetzlich verbindlich. Aussagepsychologisch kommt es entscheidend auf die Originalaussage an. Sie ist aber nur dann zu überprüfen, wenn die Fragen und Antworten überprüfbar sind.
In Verfahren, in denen Aussage gegen Aussage steht, und es oftmals mangels sog. „objektiver“ Beweismittel allein auf die Belastungsaussage ankommt, sollte der Gesetzgeber die Tonbandaufzeichnung der gesamten Aussage zur Pflicht machen. Die Aufzeichnung des Explorationsgesprächs entspricht weltweitem Standard, dahinter sollten Ermittlungsbehörden nicht zurückstehen.
6.BGH-Rechtsprechung zu aussagepsychologischen Gutachten
a)BGH 1954
36
1954 entschied der BGH[92]: „Der Grund, weshalb zur Prüfung der Glaubwürdigkeit von Kinderaussagen öfter Sachverständige hinzugezogen werden müssen, liegt darin, daß die Frage, ob ein Kind glaubwürdig ist, sich schwerer beurteilen läßt, als dieselbe Frage beim erwachsenen Zeugen. Zur Beurteilung von Kinderaussagen müssen in geeigneten Fällen Sachverständige gerade deshalb hinzugezogen werden, weil ihnen Erkenntnismittel zur Verfügung stehen, die das Gericht nicht haben kann.“
b)BGH-Grundsatzentscheidung 1999
37
Im Jahr 1999 hat der 1. Strafsenat des BGH eine Grundsatzentscheidung zu den wissenschaftlichen Mindestanforderungen, die aussagepsychologische Gutachten zu erfüllen haben, gefällt.
Die Entscheidung ist vielfach veröffentlicht worden, u.a. auch in der amtlichen Entscheidungssammlung des BGH[93].
Prof. Fiedler und Prof. Steller wurden als Sachverständige gehört. Ihre wissenschaftlichen Gutachten sind vollständig veröffentlicht, so
•
Fiedler/Schmid Gutachten über Methodik für Psychologische Glaubwürdigkeitsgutachten, PdR 1999, 5 ff. und
•
Steller/Volbert Wissenschaftliches Gutachten, Forensisch-psychologische Begutachtung (Glaubwürdigkeitsbegutachtung), PdR 1999, 46 ff.
Zu der Entscheidung gibt es mehrere erläuternde Beiträge in der Literatur, z.B.[94]:
•
Boetticher Anforderungen an Glaubhaftigkeitsgutachten, in: Barton, Verfahrensgerechtigkeit und Zeugenbeweis, 2002, S. 55 ff.
•
Jansen/Kluck Unter Kontrolle: Aussagepsychologische Gutachten, PdR, Sonderheft 1 – Glaubhaftigkeitsbegutachtung –, 2000, 89 ff.
•
Jansen Überprüfung aussagepsychologischer Gutachten, StV 2000, 224 ff.
•
Meyer-Mews Die ‚in dubio contra reo‘-Rechtsprechungspraxis bei Aussage-gegen-Aussage-Delikten, NJW 2000, 916 ff.
•
Offe Anforderungen an die Begutachtung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen, NJW 2000, 929.
•
Schade/Harschneck Die BGH-Entscheidung im Rückblick auf die Wormser Mißbrauchsprozesse, PdR Sonderheft 1 – Glaubhaftigkeitsbegutachtung –, 2000, 28 ff.
•
Schaefer Mehr Professionalität in Jugendschutzverfahren, NJW 2000, 928 f.
•
Steller/Volbert Anforderungen an die Qualität forensisch-psychologischer Glaubhaftigkeitsbegutachtungen – Das BGH-Urteil v. 30. Juli 1999, PdR, Sonderheft 1 – Glaubhaftigkeitsbegutachtung, 2000, 102 ff.
Die Grundsatzentscheidung steht in engem Zusammenhang mit der erneuten ablehnenden Entscheidung des BGH[95] zum sog. Lügendetektor.
c)Nachfolgeentscheidungen
38
Nach der Grundsatzentscheidung sind weitere Entscheidungen des BGH zu den Anforderungen, die an aussagepsychologische Gutachten zu stellen sind, ergangen, deren Inhalt stichwortartig hier dargestellt wird:
•
BGH [3 StR 301/07]
nur die realistischen Erklärungsmöglichkeiten sind zu diskutieren, methodische Grundprinzipien beschreiben den derzeitigen wissenschaftlichen Standard, Gutachter müssen nicht einheitlich dieser Prüfstrategie folgen, es ist dem Sachverständigen überlassen, in welcher Art und Weise er dem Gericht sein Gutachten unterbreitet.
•
BGH [1 StR 274/02]
Anforderungen an die Prüfung der Unwahrhypothese
•
BGH [1 StR 582/99][96]
die Befolgung einer einheitlichen Prüfstrategie, eines einheitlichen Gutachtenaufbaus, einer bestimmten Reihenfolge der Elemente der Aussagebeurteilung ist nicht erforderlich, es ist dem Sachverständigen überlassen, in welcher Art und Weise er sein Gutachten dem Gericht unterbreitet.
•
BGH [4 StR 339/99][97]
Verweis auf die Grundsatzentscheidung
Pfister[98] fasst die Rechtsprechung unter der Überschrift „Was ist seit BGHSt 45, 164 geschehen?“ zusammen und gibt einen „Überblick über die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen“.
Steller/Böhm[99] referieren – aus aussagepsychologischer Sicht – zu „50 Jahre Rechtsprechung des BGH zur Aussagepsychologie: Bilanz und Ausblick“ u.a. zur Anerkennung der aussagepsychologischen Methodik, zu Psychologen oder Psychiatern als Sachverständigen, zu aktuellen Entwicklungen in der Aussagepsychologie und Jurisprudenz, zur Begutachtung erwachsener Zeugen, zu Besonderheiten der Erinnerungen nach Traumaerleben und zur Glaubhaftigkeitsbegutachtung bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen
Hohoff[100] befasst sich mit aktuellen Fragen der aussagepsychologischen Begutachtung von Opferzeugen im Strafverfahren.
Die Nullhypothese findet auch in aktuellen BGH-Entscheidungen Erwähnung, z.B. in
•
BGH [2 StR 222/20]
Nullhypothese Beachtung durch das Gericht – Räuberische Erpressung
•
BGH [2 StR 7/20]
Nullhypothese Beachtung durch Sachverständigen
•
BGH [2 StR 338/18]
Auflistung von einzelnen Hypothesen
•
BGH [4 StR 587/17]
Suggestionshypothese
•
BGH [2 StR 63/16]
Pseudoerinnerung
•
BGH [4 StR 427/14]
Nullhypothese Beachtung durch das Gericht
7.Qualität aussagepsychologischer Gutachten
39
Ende der neunziger Jahre ergab eine Untersuchung von Busse/Volbert[101] nur eine geringe Anzahl von Begutachtungen durch Psychologen (und nicht Psychiater). Fast nie wurde der Gutachtenauftrag begründet. Inhaltlich waren „bei einem nicht unbeträchtlichen Teil der Gutachten wissenschaftliche Mindeststandards wie Nennung der gewählten Untersuchungsmethoden, Trennung von Bericht und Interpretation etc. nicht bzw. nur teilweise erfüllt“.[102] Viele Gutachten bewegten sich im „mittleren Bereich“, jedoch wurde „in beinahe der Hälfte der Gutachten ein primär persönlichkeitsorientiertes Vorgehen verfolgt …, obwohl dies dem derzeitigen wissenschaftlichen Stand nicht entspricht“[103].
Die Untersuchung ergab ferner, dass „die Fälle mit eindeutiger positiver Glaubwürdigkeits- bzw. Glaubhaftigkeitsbeurteilung in fast allen Fällen mit einer Verurteilung endeten“[104].
Mehr als zwanzig Jahre nach der Grundsatzentscheidung des BGH aus dem Jahre 1999 könnte man hoffen, die Gutachtenqualität hätte sich insgesamt verbessert. Kritisch zu sehen ist, wenn Sachverständige die verschiedenen Hypothesen stereotyp bilden und abarbeiten, diese aber nicht fallspezifisch genug entwickeln und sie auch der Suggestionshypothese nicht immer mit dem nötigen fachlichen Wissen begegnen. Der Wunsch, dem Zeugen grundsätzlich glauben zu wollen, würde sicher von jedem Sachverständigen nach außen verneint, scheint aber vielfach präsent zu sein. Gezieltes Herausfragen von Realkennzeichen, einseitige Deutung des Aussageverhaltens tragen nach wie vor zu einer Vielzahl von Gutachten schlechter Qualität bei. Oftmals ist jedoch auch mangelnde Sachkunde, fehlendes dogmatisches Verständnis dafür verantwortlich. Immer noch findet man die Bestätigung der Realitätshypothese. Eindrucksvoll ist die Liste der vielfach auftretenden Fehler, über die Köhnken[105] berichtet.
8.Ausweitung des Anwendungsbereichs der Aussagepsychologie
40
Erwachsene Zeugen.Köhnken[106] berichtet, dass Forschungsergebnisse den Schluss zulassen, dass die kriterienorientierte Aussageanalyse „auch bei erwachsenen Zeugen mit hinreichender Zuverlässigkeit zwischen erlebnisbegründeten und konfabulierten Aussagen unterscheiden kann“. Auch nach Volbert/Steller[107] gelten die aussagepsychologischen Erkenntnisse nicht nur für kindliche, sondern auch erwachsene (Opfer)zeugen.
Nach Steller/Volbert[108] ist der Schwellenwert, von der festgestellten Aussagequalität auf die Glaubhaftigkeit der Bekundung zu schließen, bei Erwachsenen höher als bei Kindern. Eine ausführliche Betrachtung findet sich bei Greuel[109].
41
Beschuldigte – Geständnis, Widerruf des Geständnisses.Steller[110] und Volbert[111] haben in der Festschrift für Eisenberg zu dem sog. Pascal-Verfahren vor dem LG Saarbrücken „Zu falschen Geständnissen in Kapitaldelikten – Praxis: Der Fall Pascal“ bzw. „Falsche Geständnisse“ veröffentlicht und dabei die Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte des Geständnisses hervorgehoben.[112]
Aussagepsychologen[113] stellen bei der Diskussion über die Anwendbarkeit der Realkennzeichenanalyse bei Beschuldigtenaussagen zutreffend darauf ab, dass sich an der Leugnung eines Vorwurfes, die nur aus einem Wort – z.B. Haben Sie die Frau umgebracht? „nein“ – bestehen kann, mangels Aussagematerials keine analytische Bewertung vornehmen lässt.
Bei einem ausführlichen Geständnis und/oder einem Geständniswiderruf wird grundsätzlich eine Analyse in Betracht gezogen[114], jedoch darauf hingewiesen, dass sich der Beschuldigte „z.B. mangels Wahrheitsverpflichtung in einer gänzlich anderen motivationalen Lage befinde“ als der Opferzeuge. Das ist rechtlich unzutreffend. Zu bedenken ist nämlich, dass der Beschuldigte im Rahmen der Aussagefreiheit zwar darüber entscheiden kann, ob er sich überhaupt und wie zu dem gegen ihn erhobenen Vorwurf äußern kann, er im Rahmen der Aussage aber einen anderen nicht fälschlich beschuldigen bzw. eine Straftat vortäuschen darf (§§ 145d, 164 StGB).[115]
42
Mitbeschuldigte. Bislang fehlen Untersuchungen zur Glaubhaftigkeit von Aussagen von Mitbeschuldigten. Jansen[116] hat in einem Beitrag in der Festschrift für Hamm die aussagepsychologische Beurteilungsmöglichkeit diskutiert.
43
Ausländer. Bei Ausländern ist die Aussagebeurteilung erschwert, wenn ihre Aussage durch einen Dolmetscher übersetzt wird. Vielfach übersetzen Dolmetscher nicht vollständig, zum Teil auch nicht korrekt, wobei auch die Besonderheiten der jeweiligen Fremdsprache und auch kulturelle Unterschiede zu beachten sind.[117]
44
Identifizierungsaussage. Identifizierungsaussagen werden in der Praxis meist unter dem Gesichtspunkt erhoben, wie sicher sich der Zeuge bei der Wiedererkennung des Beschuldigten ist, obwohl subjektive Sicherheit keinen hinreichenden Aufschluss über die Richtigkeit der Aussage geben kann. Köhnken[118] verdeutlicht, dass die Qualität der Aussage kein verlässlicher Indikator ist, jedoch die Reaktionszeit (die Dauer von der Präsentation einer oder mehrerer Personen bzw. Lichtbilder und der Äußerung des Zeugen) ein Indikator für die Richtigkeit der Aussage sein kann, da korrekte Identifizierungen „schneller als falsche … erfolgen“.
Näheres zum aktuellen Erkenntnisstand der Personenidentifizierung findet sich in den Ausführungen von Sporer[119] im Handbuch der Rechtspsychologie und Sporer/Sauerland[120].
9.Justizirrtümer – zur Rolle der Psychowissenschaften
45
Lesenswert sind die Ausführungen von Steller u.a. zu:
•
Im Namen des Volkes: Wir glauben dir alles!
•
Suggestion: Ich sehe das, was du nicht siehst.
•
Trauma: Weil ich mich an nichts erinnern kann, muss da was gewesen sein.
•
Aufdeckungseifer: Von Justiz- bzw. Psychokatastrophen nach aussagepsychologischen Begutachtungen
Steller[121] resümiert: „Die Rolle der Psychowissenschaften bei der Entstehung von Irrtümern der Justiz kann darin bestehen, dass ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten oder Sachverständige ausschließlich von der Erlebniswelt ihrer Patienten bzw. Klienten ausgehen. Sie behandeln und handeln unter der Devise, dass allein die subjektive Realität der Patienten ausschlaggebend sei. Zweifel am Wahrheitsgehalt von Opferbekundungen sind unzeitgemäß, ja unmoralisch, so denken sie. Diese Einstellung kann fatale Folgen haben.“
Richterliche (Un)Kenntnis.Eschelbach[122] verdeutlicht mangelnde richterliche Kenntnisse im Bereich der Aussagebeurteilung, vor allem bei falsch positiven Aussagen: „Schon die Aufdeckung von den vom Zeugen als wahr eingeschätzten Pseudoerinnerungen, die aufgrund von Autosuggestion, Fremdsuggestion oder sonstigen Fremdeinflüssen auf die im Gedächtnis abgespeicherte Information entstehen, ist auch für Aussagepsychologen auf dieser Grundlage nicht oder jedenfalls nicht ebenso zuverlässig zu leisten wie die Aufdeckung einer Lüge. Sie können allenfalls zum Grad der Suggestibilität des individuellen Zeugen Angaben machen, auf Alternativhypothesen zur Verdachtsannahme hinweisen und Problemzonen für die richterliche Beweiswürdigung benennen. Das ist nicht viel, aber doch deutlich mehr als reine Intuition. Aussagepsychologie kann schon viel bewirken, wenn sie nur gedächtnispsychologischen Faktoren, die hier wirksam werden können, bekannt und bewusst macht. Die intuitive richterliche Beweiswürdigung der Berufs- und Laienrichter geht daran nur allzu oft vorbei. Ob die Aussagepsychologie der intuitiv agierenden richterlichen Beweiswürdigung bei der Abgrenzung von erlebnisbezogenen und der Wahrheit nahekommenden Aussagen von Angaben über Pseudoerinnerungen allerdings im Ergebnis kategorial überlegen ist, lässt sich in Frage stellen. Eine abschließende Validitätsüberprüfung fehlt in beiden Bereichen. Letzteres geht mit dem Totalausfall einer neuen Fehlurteilsforschung seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der Tübinger Untersuchungen durch Karl Peters über „Fehlerquellen im Strafprozess“ 1970 bis 1974 einher. Die Beachtung von formalen Methodenvorgaben für die Erstellung schriftlicher Gutachten durch Aussagepsychologen über individuelle Zeugen und ihre Angaben zur Sache liefert auch keine Ergebnissicherheit, sondern nur einen — bisweilen trügerischen — Anschein dafür.“
10.Aussagepsychologische Fachliteratur
46
Arntzen hat Anfang der neunziger Jahre die praktische Verbreitung der Aussagepsychologie gefördert.[123] Seine Auswertungen stützte er – nach eigenen Angaben – auf ca. 50 000 „psychologische Gutachten über die Glaubwürdigkeit“ in der Zeit von 1950 bis 1990. Kritisch zu sehen ist, dass er die Untersuchungen im Einzelnen nicht veröffentlicht und damit einer wissenschaftlichen Diskussion entzogen hat. Arntzen sah seine Erkenntnisse durch „nachträgliche Geständnisse“ bestätigt[124], ohne erkennbar zu erwägen, dass der Beschuldigte ggf. nur aufgrund des Drucks des ihn belastenden Gutachtens ein Geständnis abgelegt haben könnte.
Wohl als Reaktion darauf, dass ideologisch ausgerichtete Aufdeckungsarbeit immer mehr Platz griff und sexueller Missbrauch zum „Modedelikt“ avancierte, erschien Mitte der neunziger Jahre das „Handbuch sexueller Mißbrauch“[125]. Wegweisend und immer noch aktuell ist der darin enthaltene Aufsatz von Undeutsch[126], der sich inhaltlich mit dem Nachweis sexuellen Missbrauchs, der Analyse des Aussageinhaltes, der Bedeutung von Geschichte und Entwicklung der Aussage, der Divergenz von Psychotherapie und Wahrheitsforschung, der Suggestibilitätsforschung und der Prüfung alternativer Hypothesen befasst.
Es folgten Veröffentlichungen in familienrechtlichen Zeitschriften.[127]
Aufsehen erregend war 1992 der Beitrag von Müther/Kluck „Vom Mißbrauch mit dem Mißbrauch“[128].
Endres/Scholz „Sexueller Kindesmißbrauch aus psychologischer Sicht“ war die erste Veröffentlichung in einer strafrechtlichen Zeitschrift zu den seinerzeit „gängigen“ Themen, so zu: Missbrauchsverdächtigungen[129], Symptomen[130], spontanen Falschaussagen von Kindern[131], aufdeckenden Psychotherapien[132], Verhaltensdeutung[133], projektiven Verfahren[134], Beeinflussungsgefahr durch suggestive Befragung und konfrontativen Befragungstechniken, dem sog. Lügendetektor und der Beurteilung der Persönlichkeit des Beschuldigten.[135]
Im Nachgang zu den genannten spektakulären Verfahren erschienen einige aussagepsychologische Fachbücher, so z.B. das Buch von Steller/Volbert „Psychologie im Strafverfahren“[136], es folgte das Standardwerk „Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage“ einer Autorengruppe zusammen mit Greuel[137].
„Psychologische Gutachten schreiben und beurteilen“ von Westhoff/Kluck ist dem Straf- und Familienjuristen zu empfehlen, der sich grundlegend mit den Besonderheiten psychologischer Gutachtenerstellung befassen will. 2014 ist es in der 6. Auflage erschienen.
Seit 2008 liegt das „Handbuch der Rechtspsychologie“[138] vor, lesenswert ist auch die 2010 von Volbert[139] veröffentlichte Abhandlung zur Erstellung aussagepsychologischer Gutachten, die die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse anschaulich und übersichtlich darstellt.
2017 haben Niehaus, Volbert und Fegert dem Strafjuristen mit dem Buch „Entwicklungsgerechte Befragung von Kindern im Strafverfahren“ das notwendige Rüstzeug zum besseren Verständnis von Kinderaussagen an die Hand gegeben.
II.Glaubwürdigkeit des Zeugen – Glaubhaftigkeit der Aussage
47
Lange Zeit wurden Zeugenaussagen nach der Persönlichkeit des Zeugen beurteilt. Hatte der Zeuge einen honorigen Beruf, genoss er allseits Ansehen, sprach viel dafür, dass er auch die Wahrheit sagte. Eine solche ausschließlich persönlichkeitszentrierte Betrachtungsweise ist durch die Erkenntnisse der modernen Aussagepsychologie in den letzten 50 Jahren abgelöst worden. Entscheidend ist allein die Aussage des Zeugen. Persönlichkeitsaspekte spielen dabei nur im Rahmen seiner individuellen Aussagekompetenz eine Rolle.
Man sprach auch von der Glaubwürdigkeit der Person und der Glaubhaftigkeit der Aussage. Damals wurde zwischen genereller und spezieller Glaubwürdigkeit unterschieden, so z.B. in der Entscheidung aus dem Jahr 1993[140]:





























