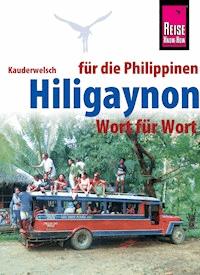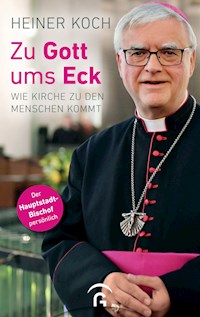
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Christentum ist keine Philosophie, keine weltanschauliche Doktrin. Es bezeichnet eine im Glauben wurzelnde Beziehung zu Gott, die eine neue Qualität in der Beziehung zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen möglich macht. In zwölf Kapiteln greift Heiner Koch Erfahrungen von und mit Menschen auf, die ihm in seiner Stadt begegnet sind. Er erzählt seine Geschichten und Erfahrungen so, dass der Mehrwert des christlichen Glaubens in einer unübersichtlichen, von Religionslosigkeit wie religiöser Pluralität geprägten Zeit deutlich wird. Ein überzeugendes und überraschend lebensnahes Glaubensbuch.
- Der christliche Glaube stiftet Heimat
- Gelebte Kirche: der Hauptstadtbischof erzählt
- Erfrischend offen und dem Leben zugewandt
- Der Hauptstadt-"Schießler" aus dem Hause Gütersloh
- Glaubens-Klartext
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Heiner Koch
Zu Gottums Eck
Wie Kirche zu den Menschen kommt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2019 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: © Walter Wetzler, Berlin
ISBN 978-3-641-24078-3V003
www.gtvh.de
INHALT
Zum Auftakt:
Hoppala, ich glaube
Kapitel 1:
Was ist eigentlich normal?
Warum man Gott im Osten anders begegnet
Kapitel 2:
Mauerfall statt Mauerbau
Warum wir kein Closed-Club sein dürfen
Kapitel 3:
An Gott (ver-)zweifeln
Warum sich die Frage nach dem Leid immer neu stellt
Kapitel 4:
Mehr »Spirit«, bitte!
Warum ich so gerne firme
Kapitel 5:
Vollkommen einmalig unvollkommen
Warum die Würde des Menschen unseren Schutz braucht
Kapitel 6:
Einen Platz bei Gott freihalten
Warum Christen auch Stellvertreter-Posten haben
Kapitel 7:
Arm-selig?
Warum Reichtum auch bei Kirchens relativ ist
Kapitel 8:
Mehr Langstrecke als Sprint
Warum in Glaubensdingen ein langer Atem nötig ist
Kapitel 9:
Hier geht’s um Wertsachen
Warum Christen sich in Politik und Gesellschaft engagieren sollten
Kapitel 10:
Wir sind auf Sendung
Warum Mission und Missionierung alles andere als antiquiert sind
Kapitel 11:
Fremdeln können Sie woanders
Warum Christentum ohne Gastfreundschaft hohl ist
Kapitel 12:
Alles geschenkt!
Warum Dankbarkeit Perspektiven verändert
Kapitel 13:
Superhelden? Fehlanzeige
Warum man die Kirche trotz ihrer Schwächen lieben kann
Kapitel 14:
Ach, ihr ewigen Bedenkenträger
Warum wir mehr Lernbereitschaft und Mut für Neues brauchen
Kapitel 15:
Heute schon ans Jenseits gedacht?
Warum Christen Menschen der Zukunft sind
Und zum Schluss:
Jauchzet, frohlocket
ZUM AUFTAKT:
HOPPALA, ICHGLAUBE
Haben Sie schon einmal über Ihren Glauben gesprochen? Mit anderen Menschen? Gar nicht so einfach, oder? Man hat da erst einmal so eine gewisse Scheu. Mit dem besten Freund, der besten Freundin spricht man über alles – aber über den eigenen Glauben, über Glaubensfragen, Glaubenssuche? Da gibt es oftmals eine Hemmschwelle. Vielleicht, weil ich selber unsicher bin: Was treibt mich da eigentlich um? Vielleicht, weil ich nicht weiß, wie mein Gegenüber darauf reagiert: Wie jetzt, du glaubst – an Gott?! Unglaublich!
Das Sprechen über den eigenen Glauben ist in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich und eher unüblich. Natürlich gibt es öffentliche Bekenntnisse von Politikern und Promis, dass sie Christen sind, dass der Glaube ihnen Kraft gibt, dass christliche Werte Maßstäbe für ihr Handeln, ihre Arbeit sind. Meist klingen diese Menschen dann sehr überzeugt. Aber wer spricht öffentlich über sein Suchen nach und im Glauben? Und ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass Sie eher unangenehm berührt waren, wenn jemand im Fernsehen über seinen Glauben ganz persönlich »auspackte«?
Es ist ein sensibles Feld. Glaube ist für viele Menschen etwas sehr Privates, geradezu etwas Intimes. Das gilt für die meisten Katholiken genauso wie für Menschen, die noch auf der Suche sind und plötzlich spüren, dass sie etwas Religiöses anspricht – eine Begegnung, ein Text, ein Ritual. Zugleich machen viele die Erfahrung: Wer sich auf ein Gespräch über den Glauben einlässt, wer sich – im geschützten Raum – traut, darüber zu sprechen, der ist in der Regel überrascht, welch tiefes Gespräch sich ergibt, mit einer ganz eigenen, positiven Dynamik.
Ich bin fest davon überzeugt, dass solche Erfahrungen für Menschen elementar sind auf ihrem Glaubensweg, wo und wann auch immer sie ihn beginnen. Mein Glaube muss nichts sein, das mir peinlich ist, über das ich nur verdruckst rede. Ganz im Gegenteil! Und ich denke, dass solche Erfahrungen darin bestärken, zum eigenen Glauben zu stehen.
Die bewusste Entscheidung für den Glauben hat Einfluss auf mein gesamtes Leben. Sie verändert die Lebensperspektive und die Lebensschritte. Der christliche Glaube ist ein Bekenntnis – und die Bindung an eine Person: Jesus Christus, den Sohn Gottes. Es gibt eine Stelle in der Bibel, in der er mit einer aus heutiger Perspektive unerbittlich kompromisslosen Radikalität von seinen Anhängern ein Bekenntnis einfordert: »Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich« (Mt 12,30). Die Botschaft dahinter: Ich kann nicht unverbindlich die Beziehung mit Christus leben. Eine mit ihm gelebte Verbindung prägt und verändert das Leben gegenüber einem Leben, das diese religiöse, transzendente Dimension und Verbindung nicht kennt oder nicht hat.
Das Bekenntnis zum Christentum hat damit immer auch eine öffentliche Komponente: Wenn mein Glaube derart Einfluss auf mein Leben und Handeln nimmt, ist er sowieso schon aus dem stillen Kämmerlein heraus. Heute ist uns das längst nicht mehr so bewusst. Das war bei den frühen Christen vor 2000 Jahren noch ganz anders: In ihrer Minderheits- und Verfolgungssituation war völlig klar, dass das Taufbekenntnis den großen Alternativpunkt in ihrem Leben bedeutete, der manche von ihnen sogar das Leben gekostet hat.
Keine Angst, heute kostet Sie das öffentliche Bekenntnis zum Christentum nicht mehr den Kopf, zumindest nicht in unserer Gesellschaft. International freilich zählen Christen immer noch zu den am stärksten verfolgten Religionsgemeinschaften. Schätzungen gehen von weltweit rund 200 Millionen verfolgten Christen aus, manche von ihnen müssen auch heute noch um Leib und Leben fürchten. Christen in den vielfältigen Verfolgungssituationen unserer Gegenwart ist klar: Ich kann mein Leben mit Christus nicht so führen wie ohne ihn. Christsein bedeutet eben immer auch, sich entschieden zu Jesus Christus zu stellen und zu versuchen, diese getroffene Entscheidung gradlinig und konsequent zu leben – auch wenn es in der Gesellschaft, in der ich lebe, dafür wenig Akzeptanz und vielleicht sogar Ablehnung gibt.
Gerade im Erzbistum Berlin, in dieser säkular geprägten Gesellschaft, ist ein klares, profiliertes Bekenntnis wichtig. Nur so wird der Glaube überhaupt öffentlich wahrgenommen. Gerade in einer Gesellschaft wie der Berliner, in der alles möglich zu sein scheint und viele Menschen verschiedene Lebensoptionen recht fragmentarisch und unverbindlich in sich zu integrieren versuchen, ist es notwendig, darauf zu achten und es erfahrbar werden zu lassen, dass der christliche Glaube eine Entscheidung verlangt.
Will der christliche Glaube in unserer Berliner Situation wahrgenommen werden und will er als eine Alternative wahrgenommen werden, so kommt er ohne ein klares Profil nicht aus. Dieses Profil brauchen die christlichen Gemeinden, Einrichtungen und Gemeinschaften. Es geht aber eben auch um das konkrete Bemühen jedes einzelnen Christen, den Glauben in seinem Leben, Alltag und Handeln sichtbar werden zu lassen. Das hat eine unglaubliche, auch ansteckende Wirkung. Wenn wir jemanden erleben, der seinen Glauben – mit allen Fragen, Herausforderungen und Chancen – glaubwürdig lebt, dann kann das beeindrucken und ermuntern, über das eigene Leben und Bekenntnis nachzudenken. In einer Gesellschaft des »Alles ist möglich« können die bewusste Entscheidung für den Glauben und das Bekenntnis dazu zur handfesten Alternative gegenüber Beliebigkeit werden, die ja in den Ernstfällen des Lebens oft nicht mehr als ein beliebiges Achselzucken bereithält.
Ich bin zutiefst dankbar, wenn ich erlebe, wie ernst viele Christen ihren Glauben nehmen und genommen haben, auch und gerade in der Zeit der DDR, in der viele deshalb massive Nachteile in ihren Lebensmöglichkeiten in Kauf nehmen mussten. Sie haben sich nicht abbringen lassen von ihrer Glaubensentscheidung und haben so mitten in der kommunistischen Diktatur die christliche Botschaft lebendig gehalten.
Die Forderungen nach einer Entschiedenheit im christlichen Glauben aber birgt eine Gefahr in sich: Die Gefahr, andere Menschen, die nicht so entschieden sind in ihrem Glauben oder eine Glaubensentscheidung für sich nicht notwendig halten, als »laue Christen« oder aber »ungläubige Atheisten« zu katalogisieren und nicht selten abzuqualifizieren. Das Bemühen um eine Entschiedenheit im Glauben kann dann schnell in eine Überheblichkeit abgleiten gegenüber den Menschen, die vielleicht einfach noch nicht so weit sind oder auch möglicherweise nie so weit kommen werden.
So sehr man sich um die Klarheit der eigenen Glaubensentscheidung und die Konsequenzen des Glaubens für das eigene Leben bemüht, so wenig darf man auf der anderen Seite die angeblich ungläubigen Menschen in Schablonen pressen. Immer wieder begegne ich in Berlin Menschen, die in einer langen Tradition ihrer Familien selbstverständlich ohne Gott aufgewachsen sind und ohne Gott leben. »Ich habe mich nie gegen Gott entschieden, Gott kam in meinem Leben bisher nie vor, nicht in der Familie, nicht in der Schule, nicht im Beruf«, so berichtete mir eine Moderatorin nach einer Diskussion. Diese Menschen sind nicht einfach ungläubig in ihrem Nicht-entschieden-Sein und ihrer oft gegebenen Unfähigkeit, sich für oder gegen den christlichen Glauben zu entscheiden, den sie nicht oder nur oberflächlich kennen.
Immer wieder spüre ich in diesen Menschen eine zaghafte, aber oft ganz feine und wirklich existierende Nähe zu Gott, auch wenn sie diese nicht in Worte fassen können oder wollen. Immer wieder empfinde ich bei Menschen, die bekennen, nicht an Gott zu glauben, doch so etwas wie eine Spur von Gottverbundenheit, die sie oftmals berührend prägt. Sie selbst freilich würden das vermutlich nicht als Gottverbundenheit bezeichnen, aber mir erscheint es doch so und ich kann es kaum anders bezeichnen.
So erinnere ich mich an eine Taufe, die ich einem neugeborenen Mädchen gespendet habe. Der Vater und seine Familie sind zutiefst katholisch. Ihm bedeutete die Taufe seiner Tochter unendlich viel. Er hat die Taufe mit frohem und gläubigem Herzen vorbereitet und seine eigene Taufe in der Taufe seiner Tochter noch einmal innerlich erneuert. Die Mutter der Kleinen und ihre Familie dagegen stehen dem christlichen Glauben völlig fremd gegenüber. Es hatte in ihrem Leben allenfalls einige intellektuelle und mediale Kontakte mit der Kirche und der christlichen Botschaft gegeben. Keine dieser Begegnungen führte zu einem Überspringen des Feuers, einem Nachdenken über oder eine Begeisterung für den christlichen Glauben. Dieser blieb für sie fremd. Man kann sie wohl als in hohem Maße »religiös unberührt« bezeichnen. Dass etwas an der Geschichte mit Gott und Jesus Christus wahr sein könnte, war nichts, wozu sie einen Zugang fanden.
Ich glaube, für die Mutter und ihre Familie war es schon eine Zumutung, dem Wunsch des Vaters zu entsprechen und ihre Tochter christlich taufen zu lassen. Nicht dass der Taufwunsch als harte Forderung im Raum stand, die junge Mutter wusste, was dieser Glaubensakt für ihren Mann und seine Familie bedeutete. Sie erahnte auch, was die Taufe von daher für ihre Tochter bedeuten könnte: dass sie nicht ein leeres Ritual bleiben würde, sondern wahrscheinlich der Beginn eines sich entfaltenden Lebens mit Gott, zu dem der Vater seine Tochter führen will.
Allein durch die lebendige Verbundenheit ihres Mannes im christlichen Glauben spürte sie, wie prägend und tragend der christliche Glaube sein kann. Aber ihr fiel die Entscheidung, der Taufe ihrer Tochter zuzustimmen, auch deshalb nicht leicht, weil sie dafür in ihrer Familie kein oder kaum Verständnis fand.
Im Taufgespräch war für mich beeindruckend, wie feinfühlig und einfühlsam die Eltern in der Erörterung des Glaubens und in den Fragen der Taufe ihres Kindes miteinander umgingen – wie sehr sie um die Wahrnehmung der Geschichte, der religiösen Gefühle und der Überzeugung des anderen besorgt waren, gerade auch weil die jeweilige religiöse Prägung so unterschiedlich war. Ich spürte deutlich, wie groß der Wunsch war, einander nicht zu überfordern, aber auch nichts von dem zu unterschlagen, was einem selbst wichtig und bedeutsam ist und was man als Eltern oder einzeln als Vater oder Mutter seinem Kind weitergeben möchte.
Wir haben im Taufgespräch lange erörtert, wie die religiös nicht gebundene Familie ehrlich und angemessen in die Feier der Taufe einbezogen werden könnte. Der von der Mutter in der Taufe geäußerte Wunsch für das Leben des Kindes und ihre Worte an ihr Kind waren für mich wie ein Gebet, auch wenn es sehr bewusst und klar so nicht formuliert war. Aus den Worten der Mutter wurde spürbar, dass es irgendwo doch die Hoffnung auf oder die Sehnsucht nach einer Größe gibt, die ihr Kind behüten und beschützen möge.
Es war eine schöne Geste, als die Mutter ihrem Kind an der Stelle in der Feier, in der Vater und Paten das Kind mit dem Kreuz zeichneten, die Hand auflegte. Jeder von uns spürte, dass dies nicht ein Rückzug auf eine immanente Welt und Beziehung war, sondern dass in dieser Geste und in ihren Worten doch eine Ahnung, wenn nicht sogar eine Hoffnung, auf jeden Fall die Spur eines Glaubens aufschien.
Diese Spur eines vielleicht noch unbewussten Glaubens an eine höhere Wirklichkeit war für mich noch tiefer erfahrbar beim Großvater der Mutter. Sie hatte mich gebeten, ob er die Taufkerze des Täuflings während der Taufe an der Osterkerze entzünden dürfe. Ich war über diesen Wunsch überrascht und habe ihr verdeutlicht, dass die Entzündung der Taufkerze für uns Christen kein funktionaler und pragmatischer Vorgang ist, sondern eine Glaubensüberzeugung, die einen Glaubensauftrag beinhaltet:
Wir glauben, dass Christus das Licht der Welt ist, dass dieses Licht uns Menschen erleuchten und das Leben des Täuflings erhellen möge. Wir bringen zum Ausdruck, dass wir, denen das Licht geschenkt und anvertraut ist, dieses Licht ergreifen und es weiterschenken wollen an die Menschen, die so oft in einer Welt von Dunkelheit und Unsicherheit leben.
Ich versuchte ihr zu verdeutlichen, dass in dieser Geste Grundzüge unseres Glaubens ihren Ausdruck finden und dass der Vollzug dieses Rituals eigentlich den Glauben dessen, der es vollzieht, voraussetzt. Die Mutter sah dies gleich ein, blieb aber dennoch bei dem Wunsch, dass ihr Großvater die Kerze entzünde, obwohl er sich selbst nicht als gläubig bezeichnet. »Diese Geste ist ihm ein Herzensanliegen«, erklärte sie mir. Er habe ja schließlich auch die Taufkerze des Kindes selbst gestaltet. Ihm liege sehr viel daran, diese Taufkerze seiner Urenkelin nun auch zu entzünden und diese für seine Urenkelin in der Hand zu halten: »Es ist nämlich schon die zehnte Taufkerze, die er mit viel Mühe, Zeit und Nachdenklichkeit gestaltet hat.«
Ich war verblüfft: »Wieso gestaltet Ihr Großvater, der eigentlich mit dem Glauben nichts anfangen kann, Taufkerzen für so viele Taufen?« Sie antwortete lächelnd: »Er hat zehn Kerzen für die Taufe unserer Tochter gestaltet. Neun Kerzen stehen fertig in seinem Zimmer – aber zu jeder dieser Kerzen hat er bislang gesagt: ›Das ist noch nicht die richtige für meine Urenkelin.‹«
Immer stärker habe er sich beim Anfertigen mit der Taufe auseinandergesetzt und immer tiefer über das Leben und den Täufling nachgedacht: »Er war schließlich fast verzweifelt, dass es ihm nicht gelingen wollte, eine angemessene Taufkerze für seine Urenkelin zu gestalten.« Als er die zehnte Taufkerze schließlich in seinen Händen hielt, sei er zu ihnen gekommen und habe gesagt: »Das ist ihre Taufkerze!«
Die Kerze war so wunderschön gestaltet, so voll tiefen Ausdrucks: das Wasser eines Flusses, der Stern über dem Fluss und das Kreuz, an dessen Seiten sich zwei Hände öffneten, die gleichsam den Täufling aufnehmen wollten. Von ganzem Herzen habe ich zugestimmt, dass der Großvater diese so besondere Taufkerze, in die er so viel für seine Urenkelin hineingelegt hatte, an der Osterkerze entzündet.
Als er die Taufkerze an das Licht der Osterkerze hielt, habe ich in seine Augen gesehen und erahnt, wie sehr ihn das Licht der Osterkerze und der Taufkerze seiner Urenkelin berührte. Und ich habe in diesem Augenblick darum gebetet, dass im Entzünden der Taufkerze doch etwas von dem Licht der Osterkerze auf ihn überspringe und zur Gewissheit werden möge. Ein Funke, der nicht verglimmt, sondern der mehr entfacht.
Den ganzen weiteren Verlauf der Tauffeier hat er die Kerze zwischen seinen Augen und den Augen des Täuflings gehalten. Zwischen den Augen und der Kerze war eine nicht auflösbare tiefe Beziehung. Plötzlich war das Geheimnis des Zuspruchs und der Gnade Gottes für dieses Mädchen in den Augen, im Willen und im Glauben des alten Mannes ganz gegenwärtig.
Am Abend bin ich noch einmal zu der Familie gefahren, habe mit ihr zu Abend gegessen und erzählt. Selten habe ich ein so tiefes Gespräch über das Leben der Menschen, den Glauben, Gott und über die Geheimnisse des Lebens geführt wie an diesem Abend. Als wir uns verabschiedeten, hielt der alte Mann meine Hand und sagte laut: »Ich habe an diesem Tag erlebt, was ich mein ganzes Leben verpasst habe.« Als ich ihn ansah, wurde mir so deutlich, wie gläubig dieser Mensch war, auch wenn er vielleicht nicht unsere klassischen Glaubenslehren teilt. Ich habe gespürt, wie sehr der Glaube Wirklichkeit sein kann, auch wenn die Worte über den Glauben schweigen, und wie sehr er in der Liebe Gottes geborgen ist.
Es ist deshalb gut und wichtig, dass wir auch bei den Menschen, die sich als ungläubig bezeichnen, sehr achtsam und aufmerksam bleiben. Wir sollten nicht meinen, wir könnten einen Menschen in seinem Glauben erfassen und begreifen. Es ist eine zutiefst christliche Überzeugung, dass der Mensch nicht erfassbar und begreifbar ist und dass er gerade in diesem seinem Geheimnis-Sein Ebenbild Gottes ist.
»Sagen Sie nie, in Berlin seien die meisten Menschen ungläubig«, sagte mir einmal ein erfahrener Lokalpolitiker. Das habe ich inzwischen auch so erfahren. Aber ich werde sie deshalb trotzdem nie vereinnahmen, auch nicht als quasi anonyme Christen. Dennoch habe ich die gute und tiefe Erfahrung gemacht, wie sehr manche vermeintlich »Ungläubige« doch eine Ahnung von jener liebenden und beschützenden Kraft haben, die wir Christen Gott nennen.
Es ist gut, dass Christen in aller Entschiedenheit ihren Glauben und die christliche Botschaft für diese Menschen wachhalten: Dass es vielleicht doch einen Gott gibt, der uns trägt, der uns liebt und der uns auch in schlechten Stunden nicht fallen lässt. Dieses klare Zeugnis sind wir Christen den Menschen und unserer Gesellschaft schuldig. Denn so kann man lernen, dass die Grenzen der Kirche und des christlichen Glaubens nicht die Grenzen des Gottgläubigseins darstellen. Und das ist ein Segen auch für uns Christen.
KAPITEL 1:
WAS IST EIGENTLICH NORMAL?
Warum man Gott im Osten anders begegnet
»Das ist doch nicht normal!« In diesem Satz, der mehr Vorwurf als Feststellung ist, schwingt gemeinhin emotionale Empörung mit. Irgendetwas, irgendwer verstößt da gerade ganz massiv gegen unser Weltbild, unsere Verhaltensvorstellungen. Im Rheinland sagt man auch gern mal: »Normal is dat nich.« In dieser Formulierung freilich schwingt schon mehr Gelassenheit gegenüber dem Andersartigen mit. Es ist mehr ein Wort gewordenes Kopfschütteln als eine emotionale Empörung. Vielleicht auch die unbewusste Erkenntnis: Was ist schon normal?
Ist es normal zu glauben? In einigen Regionen Deutschlands ist es so normal, dass man schon die Frage danach als »unnormal« empfinden würde. Aber diese Landkarte verändert sich zunehmend, das ist ebenfalls »normal«. Auch im stärker kirchlich geprägten Westdeutschland nimmt die »Glaubens-Normalität« ab. Insgesamt gehören rund 23,3 Millionen Deutsche der katholischen Kirche an. Vermutlich empfindet der Großteil der Gläubigen – in Westdeutschland – diese Zugehörigkeit als normal. Aber spätestens bei der Frage nach der Glaubenspraxis kommt man auch dort mit »normal« nicht mehr sehr weit: Früher war es normal, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Heute ist das – trotz weiterhin bestehender Sonntagspflicht für Katholiken – nicht mehr normal. Laut Statistik der Deutschen Bischofskonferenz liegt der Gottesdienstbesuch im Durchschnitt bei knapp 10 Prozent. Interessanterweise sind die Bistümer Görlitz (rund 19 Prozent) und Erfurt (knapp 17 Prozent) mit Abstand Spitzenreiter! Auch die anderen ostdeutschen Bistümer – mit Ausnahme von Berlin (gut 10 Prozent) – liegen deutlich über dem Durchschnitt. Salopp könnte man sagen: In Ostdeutschland ist es nicht normal, katholisch zu sein, aber als Katholik normaler, in die Kirche zu gehen.
Ich selber stamme aus dem Rheinland. Dort bin ich groß geworden, die Atmosphäre entlang des Rheins zwischen Düsseldorf und Bonn habe ich aufgesogen, sie hat mich erfüllt und geprägt. Vieles vom rheinischen Leben ist mir selbstverständlich, eben normal geworden. Das Rheinland ist meine Heimat. Jetzt in Berlin merke ich, wie wenig selbstverständlich vieles von dem ist, was ich dort angenommen, mit dem ich gelebt habe und das ich für »normal« gehalten habe. Die Mentalität zum Beispiel: die rheinische Unbefangenheit, mit der Kontakte angeboten und aufgegriffen werden, die unverbindliche Direktheit menschlicher Beziehungen, die Leichtigkeit, mit der man nach dem Motto lebt: »Et hät noch immer jot jejange!« Nicht nur der Karneval ist vielen Menschen in Berlin so fremd, dass sie über die, die da im fernen Westen ihre tollen Tage kriegen, bestenfalls den Kopf schütteln können.
Zur Normalität gehört im Rheinland auch das Leben im christlichen Milieu. Selbstverständlich sind die vielen kirchlichen Krankenhäuser, die unzähligen Kirchtürme, der Kölner Dom und der liebe Gott in den Karnevalswitzen und -liedern und im Schützenbrauchtum. »Ich gehe regelmäßig zur Kirche«, sagte mir einmal ein Schütze einer kirchlichen Bruderschaft: »Jedes Jahr beim Schützenhochamt bin ich dabei.« Er sagte es ganz ohne Augenzwinkern. Für ihn war das das Normale. So normal, dass ihm der seiner Antwort innewohnende Witz gar nicht auffiel.
Dass es irgendwie und irgendwo den »lieben Gott« gibt, ist für den Durchschnitts-Rheinländer sicher. Diese Zuversicht tut ihm ja irgendwie auch gut. Aber alles soll bitte »rheinisch-katholisch« bleiben, nicht zu konsequent und nicht zu verbindlich: »Der liebe Gott ist nicht so«, sagt der rheinische Katholik über einen seiner Vorstellung nach eher sehr großzügigen, also typisch rheinländischen Gott. Der Rheinländer als Atheist? Eine solche Lebensentscheidung konsequent durchzuhalten, das wäre vielen dann vielleicht doch zu lebensfern und zu anstrengend, zumal in einem so christlich geprägten Umfeld. Solch einen radikalen Bruch mit der eigenen Sozialisation würde er wahrscheinlich als unnormal empfinden. Und: Normal will er schon bleiben, der »normale« Rheinländer. Natürlich ist der Rheinländer in dieser »R(h)einkultur« ein Klischee. Auch im Rheinland wächst die Zahl der kirchlich und religiös Uninteressierten. Selbstverständlich gibt es dort überzeugte Atheisten. Wiewohl die Tendenz eher die ist, sich als Agnostiker zu bezeichnen – man weiß ja nie. Insgesamt hat es inzwischen nichts oder nur noch wenig Anrüchiges, nicht an Gott zu glauben. Aber: »Normal is dat nich!«
»Normal« ist für die Berliner etwas anderes. Normal heißt hier in Bezug auf Glauben und Religion: Es gibt keinen Gott. Erst recht nicht solch einen »komplizierten« Gott, wie ihn die christliche Botschaft verkündet – mit ihrer »Drei in Eins«-Trinitätslehre, mit ihrem Gedanken »im Tod ist das Leben«, mit diesem Jesus, der zugleich »wahrer Mensch und wahrer Gott« ist. Von Wundern, Jungfrauengeburt und anderen »Kuriositäten« gar nicht erst zu reden. Und dann ist das auch noch ein Gott, mit dem ich in intensiver Beziehung leben soll – auf den hin ich mich als gläubiger Christ ausrichte, von dem ich mich berufen weiß und vor dem ich Verantwortung für mein Handeln und Tun trage.
16 Prozent der Berliner gehören der evangelischen und gut 9 Prozent der katholischen Kirche an, im Westen sind es mehr, im Osten deutlich weniger. Normal findet für die meisten Berlinerinnen und Berliner die Welt ohne Gott statt. Für sie beginnt das Leben mit der Geburt und endet mit dem Tod – mehr gibt es nicht. Die Welt ist geworden aus einer Materie, die immer da war, und sie wird genauso wieder zerfallen ins Nichts oder in irgendetwas, was immer das auch sein mag. Auf jeden Fall gibt es nichts, was die letztlich greif- und erforschbare Dimension des Lebens übersteigt. Alles andere sind irreale Utopien, für die es in dieser Welt keinen Ort gibt. Allenfalls Träume für die, die sich mit der Wirklichkeit der Welt und der ihres Lebens nicht abfinden können, Vertröstungen für die, die mit der Trostlosigkeit ihres Lebens nicht zurechtkommen. Diese Haltung faktischer Gottlosigkeit ist hier in Berlin und in Ostdeutschland normal. Diese Normalität ist den meisten Menschen in ihrer Familie und in der sie umgebenden Gesellschaft eingeflößt worden.
Bei den Firmungen, die ich spende, nehmen oftmals auch Menschen am Gottesdienst teil, die selbst keine Christen sind, aber mit dem Firmling verbunden sind. Als ich nach einer Firmung am Ende des Gottesdienstes aus der Kirche auszog, blieb ich bei einem jungen Paar mit seinen Kindern stehen. Die Eltern hielten mir ihre beiden Kinder hin, ich gab ihnen den Segen und fragte lächelnd: »Na, wann werdet ihr denn gefirmt?« In diesem Augenblick erstarrten die Gesichter der Eltern, und die Mutter antwortete: »Niemals, wir sind gottlos, leider.« Nicht Christ zu sein, war für diese Familie, wie sich danach im Gespräch zeigte, selbstverständliche Normalität, die gegeben ist und die selbstverständlich so bleibt, wie sie ist, wie sie auch bei ihren Eltern und Großeltern war. Eine unverrückbare Realität, an der sich nie etwas ändern wird, oder besser: die zu ändern man sich nicht befähigt fühlt. Mir ist diese Begegnung nachgegangen, denn trotzdem hielten mir diese Eltern ja ihre Kinder zum Segnen hin. Und sie sagten, »leider« seien sie gottlos. Sie empfanden es doch irgendwie als Defizit und sahen zugleich keinen Weg, dies zu ändern. Empfanden sie die Kirche als »closed shop«, zu dem sie auch bei bestem Willen niemals Zugang bekämen? Ich frage mich: Was können wir als Kirche tun, um solchen Menschen die Scheu zu nehmen, um ihnen Wege zu eröffnen, die Kirche, den Glauben – auch ganz unverbindlich – kennenzulernen?
Ich habe in vielen Begegnungen in Ostdeutschland eine wichtige Erfahrung gemacht: Menschen haben sich nicht von Gott verabschiedet. So wie es jemand etwa im Rheinland täte, wenn er Atheist würde. Nein, in Ostdeutschland gab es so eine bewusste Verabschiedung nicht – denn wie soll ich jemanden verabschieden, den ich gar nicht kenne, der für mich gar nicht existiert, der in meinem Leben, in meinem Alltag schlicht nicht vorgekommen ist?
Das DDR-Regime beförderte ein solches Leben in der Gottlosigkeit mit einer Effektivität, die bemerkenswerterweise bis heute nachwirkt und den Status der Normalität nicht eingebüßt hat. Der gesellschaftliche Lebensrhythmus wurde und wird flankiert von Jugendweihen – die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen – bis hin zu gottfreien Beerdigungsriten. An wichtigen Lebensstationen, sonst Wegmarken für christliche Rituale, entstand dadurch keine Leerstelle, sondern ein anderes, gottfreies Ritual nahm selbstverständlich den Platz ein.
Inzwischen hat die Kirche darauf reagiert: So gibt es die in allen katholischen Bistümern in Ostdeutschland verbreiteten »Feiern der Lebenswende« für konfessionslose Jugendliche – als christlich geprägte Alternative zur atheistischen Jugendweihe. Der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke entwickelte das Modell vor rund 20 Jahren als Dompfarrer. Die 14-Jährigen bereiten sich über mehrere Monate gemeinsam darauf vor, absolvieren zusätzlich Sozialprojekte und gestalten schließlich zusammen die Feier in der Kirche.
Immer wieder erlebe ich es, dass Menschen, die in einer religionsfernen Atmosphäre groß geworden sind, nicht verstehen können, dass es Menschen gibt, die an einen Gott glauben: »Wie kann man nur?« Vielleicht kann man ja noch verstehen, dass Gott eine Formel ist für den Wunsch, dass das Leben irgendwie unter einem guten Stern stehen möge. An einen allmächtigen Gott zu glauben, mit dem ich in Gemeinschaft lebe und von dem ich mich herausfordern lasse, von dem ich mich in allem getragen weiß, das ist für viele eine völlig abstruse Angelegenheit. Vielleicht können viele noch akzeptieren, dass Atheismus und Christentum philosophische Weltanschauungen sind, zwischen denen der Mensch wählen kann. Für den Durchschnitts-Berliner aber spricht weit mehr für die Nicht-Existenz als für die Existenz Gottes.
Die eindrucksvollste Taufe, die ich in Ostdeutschland bislang gespendet habe, war die einer alten Frau. Niemand in ihrer Familie war getauft. Ich lernte sie beim Besuch in einem unserer katholischen Seniorenheime kennen. Sie saß im Rollstuhl und ich setzte mich zu ihr. So unbeweglich sie körperlich war, so erstaunlich beweglich war sie in ihren Gedankengängen. Sie erzählte mir, dass sie in ihrem hohen Alter ja nun sicherlich in der Nähe des Todes stehe und sich jetzt bemüht habe, alles abzuschließen, was noch zu regeln und zu erledigen sei. Aber je mehr sie damit vorangekommen sei, umso größer sei eine Frage in ihr geworden: »Ob es wohl wirklich stimmt, dass es keinen Gott gibt? Hätten die, die mich erzogen und geprägt haben, beweisen können, dass es kein Leben nach dem Tod gibt? Woher kommt diese Sicherheit, dass mit dem Tod wirklich alles aus ist?«
Sie sagte, sie habe immer mehr den Eindruck, dass jene sicheren Gottlosen ihre Unsicherheiten in diesen Grundfragen des Lebens gleichsam übertünchten, indem sie behaupteten, der Glaube an ein ewiges Leben sei doch nur eine billige Vertröstung. Mit ihrem Ehemann habe sie nie über diese Frage gesprochen: »Aber kurz vor seinem Tod hat er mich plötzlich gefragt: Ob wir uns nicht vielleicht doch nach dem Tod wiedersehen?« Das habe sie völlig verwirrt. Sie habe auch keine Antwort gewusst: »Aber seitdem lässt mich die Frage nicht mehr los.« Deswegen sei sie im Seniorenheim aus Unsicherheit und Neugierde in den Gottesdienst gegangen, was ihr früher nicht im Traum eingefallen wäre. Sie führte viele Gespräche mit dem Pfarrer und mit christlichen Mitbewohnern. Beim Ostergottesdienst sei dann plötzlich der Funke übergesprungen: »Da habe ich beschlossen, das mit Jesus einfach einmal ernst zu nehmen.« Seitdem sei sie Schritt für Schritt zum Glauben gekommen und sei sich ziemlich sicher, dass Jesus wirklich da sei und auch mit ihr gehe. »Aber«, so sagte sie mir, »ganz sicher bin ich mir eben noch nicht, deshalb zögere ich, mich taufen zu lassen.«
Wir haben uns noch einmal getroffen und ich habe ihr von meinen Unsicherheiten und Zweifeln im Laufe meines Lebens erzählt. Und von den Zweifeln der Apostel in ihren Begegnungen mit Jesus, von den Unsicherheiten großer Heiliger. Ich sagte ihr: »Wir alle können nur mit diesen Zweifeln als Menschen den Sprung des Glaubens wagen.« Kurze Zeit später rief sie mich an: »Können Sie mich taufen?«
Zu ihrer Taufe lud sie all ihre Kinder, Enkel und Urenkel ein, allesamt konfessionslos. Sie erzählte uns am Beginn des Gottesdienstes, warum sie sich im hohen Alter zu dieser Wende entschlossen hatte. Sie erzählte, wie sie auf die Spur Jesu Christi gekommen war, wie sie seine Nähe erfuhr und was es ihr bedeutete, von ihm getragen und geführt zu sein.
Ihre Familie sagte mir im Gespräch, sie könne den Schritt der alten Dame nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Und doch blieben sie achtungs- und hochachtungsvoll und gespannt vor der Entscheidung der von ihnen hoch geschätzten Mutter stehen. »Das war ein großer Sprung«, sagte einer ihrer Söhne. Und ein Enkel ergänzte: »Dass unsere Oma in ihrem Alter noch einen so mutigen Schritt wagt, hätte ich ihr nie zugetraut.« Ja, sie war mutig und entschlossen.
Und so erlebe ich auch immer wieder die Treffen mit den Menschen aus dem Erzbistum Berlin, die sich in der Osternacht in der Kathedrale taufen lassen wollen. Das zählt alljährlich zu meinen wunderbarsten Begegnungen. In meinen bisherigen Bischofsjahren in Berlin waren es jeweils deutlich mehr als hundert, vor allem Erwachsene, die dieses Sakrament in der Osternacht empfingen. Mich beeindruckt jedes Mal die Entschiedenheit, mit der sie sich auf den Weg zum christlichen Glauben begeben.