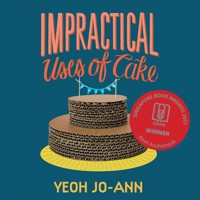19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Sukhin, 35, Single, führt ein geregeltes Leben zwischen Lesen, Arbeiten und Besuchen bei den Eltern, um deren Kartonsammlung zu hegen und zu pflegen. Er hat nur einen Freund, einen Lehrerkollegen, der ihn durch schiere Hartnäckigkeit zu einer Freundschaft gezwungen hat. Als er eines Nachmittags in Chinatown Besorgungen macht, stolpert er über eine Obdachlose, die ihn wiedererkennt. Sukhin wird durch die zufällige Begegnung völlig aus der Bahn geworfen. Als er tiefer gräbt, bricht Chaos aus, flankiert von Kuchen und Tee und stapelweise Karton. Eine wunderbar einfühlsames Porträt zweier zutiefst einsamer Individuen auf der Suche nach dem Mut, die Komfortzone zu verlassen und ihr Leben zu leben – und gleichzeitig Singapurs, wie es leibt und lebt, schmeckt und riecht, auch in Gefilden, die normalerweise im Verborgenen bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Yeoh Jo-Ann, isst kein Gemüse, trinkt viel zu viel Kaffee und macht viel zu wenig Sport. Als sie klein war, träumte sie davon, eine Katze zu werden – oder Rockstar. Stattdessen arbeitete sie acht Jahre lang in einem Verlag und wurde schließlich Herausgeberin von SPH-Magazines, eines singapurischen Zeitschriftenverbandes, bevor sie ihre Karriere aufgab und eine neue im Digital Marketing begann. Vor ihrem ersten Roman Impractical Uses of Cake, für den sie aus dem Stand mit dem Epigram Books Fiction Prize ausgezeichnet wurde, hat sie zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht. Momentan arbeitet Yeoh Jo-Ann an ihrem zweiten Roman.
Gabriele Haefs, ist eine der bekanntesten Übersetzer-innen Deutschlands (u. a. von Jostein Gaarder, Camilla Grebe, Anne Holt, Máirtín Ó Cadhain). Auszeichnungen u. a.: Gustav-Heinemann-Friedenspreis, Sonderpreis des Dt. Jugendliteraturpreises für ihr übersetzerisches Gesamtwerk, Königlich-Norwegischer Verdienstorden.
Yeoh Jo-Ann
Zweckfreie Kuchenanwendungen
Roman
Übersetzt und mit Anmerkungen von Gabriele Haefs
1. Auflage, Stuttgart, Kröner 2022
ISBN DRUCK: 978-3-520-62501-4
ISBN E-BOOK: 978-3-520-62591-5
Originaltitel: Impractical Uses of Cake
Copyright © 2019 by Yeoh Jo-Ann
Published in Singapore by Epigram Books
www.epigram.sg
ALL RIGHTS RESERVED
»Der Merlion« © 1998 Alfian Bin Sa’at; Abdruck und Übersetzungslizenz mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Dylan Thomas, Windabgeworfenes Licht, übersetzt von Andreas Lorenczuk © 1992 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München »Untitled« © 2010 Cyril Wong; Abdruck und Übersetzungslizenz mit freundlicher Genehmigung des Autors.
Supported by
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amts unterstützt durch Litprom e.V. – Literaturen der Welt
Umschlaggestaltung Denis Krnjaić
unter Verwendung eines Motivs aus shutterstock.com
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2022 Alfred Kröner Verlag Stuttgart • Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt
Für meine Eltern,dafür, dass sie den ganzen Lärm ertragen haben
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Danksagungen
Glossar
Kröner Weltliteratur
Ein Mann und eine Frau gehen durch einen Supermarkt. Sie sprechen nicht, außer um Punkte von ihrer gemeinsamen Einkaufsliste abzulesen.
»Eier, erledigt.«
»Müsli.« Die Schachtel schlägt im Einkaufswagen auf.
»Birnen.«
Sie haben fünfzehn Punkte auf ihrer Liste.
Die Frau ist tot. Sie ist heute gestorben. Der Mann weiß das, ist sich aber nicht sicher, wie er sich damit fühlt. Warum sollte sich dadurch irgendetwas ändern? Aber das muss es doch.
Sie beenden ihren Einkauf, und er fährt sie beide nach Hause. Eigentlich ist es sein Zuhause, aber er hat sich daran gewöhnt, es mit ihr zu teilen. Seine Bücher zu teilen, sein Badezimmer, seine Küche, seinen Fernseher (den nutzt sie zwar nie, aber er hätte nichts dagegen, wenn sie es täte), seinen Esstisch mit den sechs Stühlen und sein Dreisitzer-Sofa. Eines der Kissen in seinem Bett riecht nach ihr, und nach seinem Shampoo. Er hofft, dass sie nicht weggehen wird, jetzt, da sie tot ist. Ihr Tod hat irgendwo zwischen seiner Brust und seinem Bauch einen Reifen aus Besorgnis gespannt.
Sie gehen zu Bett und er nimmt sie in den Arm und fragt sich, was er sich von all dem hier erhofft. Es kann nicht vernünftig sein, sich irgendetwas zu erhoffen, und er ist ein vernünftiger Mann.
Sie lässt sich von ihm in den Arm nehmen und fragt sich, was er sich von all dem hier erhofft. Es kann nicht vernünftig sein, sich irgendetwas zu erhoffen, und er ist ein vernünftiger Mann.
I
Der Dämmerungshimmel ist übersät mit rosa Wolken, aber Sukhin geht trotzdem aus dem Haus. Keiner von den frühmorgendlichen Joggern ist zu sehen, nicht einmal der Irre aus dem Appartementhaus die Straße runter. Sukhin verspürt einen Anflug von Selbstzufriedenheit. Ha. Angst vor ein paar Tropfen Wasser. Diese Selbstzufriedenheit macht die nächsten beiden Kilometer viel erträglicher als sonst, und kurz darauf hat er schon die Hälfte der Strecke geschafft – endlich. Als die Luft um ihn herum sich schwängert mit dem Geruch des heraufziehenden Gewitters, spornt er sich selbst noch ein bisschen mehr an, zwingt sich zu größeren, schnelleren Schritten.
Sukhin hasst Joggen. Es langweilt ihn. Er fühlt sich lächerlich dabei. Dieses ganze alberne Gekeuche und Gepruste, dieses unelegante, phantasielose Pflastergetrete, das er jeden Morgen praktiziert, um von seiner Wohnung zu … seiner Wohnung zu gelangen. Null Ortsveränderung – wie blödsinnig. Aber er bleibt dabei. Es ist billig, es ist einfach und er braucht die Bewegung.
»Leute, die nicht fit sind, sind nun mal nicht produktiv«, hat er Ken vor einigen Monaten zu dem neuen Studienplaner sagen hören. »Sie ermüden schnell – ihnen fehlt einfach die Ausdauer. Es ist nicht einmal eine Frage von Arbeitswille oder -unwille.« Sie hatten in der Personalküche gestanden und Ken hatte ihm dabei direkt ins Gesicht gesehen – es war klar, dass er meinte, Sukhin sei unproduktiv, ermüde schnell und besitze keine Ausdauer, und ebenso klar, dass er ihn das wissen lassen wollte.
Es hatte eine Zeit gegeben, da hätte Sukhin darauf irgendeine Retourkutsche losgelassen, sich aufgrund irgendeines hehren Prinzips geweigert, Sport zu treiben, um nicht zugeben zu müssen, dass Ken vielleicht doch irgendwo recht haben könnte. Aber Auseinandersetzungen kosteten ihn jetzt mehr Energie als früher, als er noch jünger gewesen war, und er hatte sich dabei ertappt, dass er seinen wachsenden Bauch im Spiegel genauer unter die Lupe genommen, im Laufe des Tages immer wieder sein Energielevel überprüft, seine Schritte mit denen von Ken und Tat Meng und Dennis verglichen hatte und nach exakt einer Woche zu dem Schluss gekommen war, dass er sich mit dem Thema Sport würde auseinandersetzen müssen.
Heute Morgen, während es in Strömen regnet und er bis auf seine Einlegesohlen durchnässt wird, fragt er sich, ob er sich lieber in einem Fitness-Studio hätte anmelden sollen.
Aber die Sache mit den Fitness-Studios hat einen Haken: die Leute, die da hingehen.
Vor Jahren war Sukhin in einem Fitness-Studio. Die Leute haben ihn in den Wahnsinn getrieben. Männer vor Spiegelwänden, die versuchten, obskure Rückenmuskeln zum Vorschein zu bringen. Frauen mit kessen Pferdeschwänzen, die sich im nämlichen Spiegel musterten und davon schwärmten, wie arg doch ihre Oberschenkel nach dem Training schmerzten. Und knalliges Lycra, wohin er auch blickte. Was brachte die Leute bloß dazu, sich in knalliges Lycra zu kleiden, um sich zusammen mit anderen in knalliges Lycra gekleideten Leuten den immergleichen Übungen hinzugeben, meistens auch noch exaltiert angefeuert von einem eigens dazu eingestellten Knall-Lycra-Häuptling, der nur davon lebte, dass die Leute unfähig waren, sich selbst zu motivieren, ohne in knalligem Lycra steckend angebrüllt zu werden?
Das alles war Dennis, der ihn dorthin geschleift hatte, nicht zu vermitteln; der hatte nur die Augen verdreht und gesagt: »Reg dich ab, Süßer. Du klingst völlig irre. Schlimmer – du klingst wütend. Auf Lycra.« Und er war abgezogen, weggefedert zu seinem Spinning-Kurs, was immer das sein mochte. Sukhin war nach Hause gegangen.
Also nein. Kein Fitness-Studio. Kein knalliges Lycra.
Völlig durchweicht erreicht Sukhin seinen Wohnblock. Er ist so gut wie blind – seine Brille ist total beschlagen, der Regen klatscht ihm in die Augen – und er braucht fünf Versuche, um den richtigen Türcode einzugeben. Er würde gern losbrüllen, tut es aber nicht. Stattdessen tröstet er sich damit, durch das Foyer zu stampfen und auf den Aufwärts-Knopf einzuprügeln, auch noch, als die Fahrstuhltüren sich schon öffnen.
»Null Ortsveränderung«, knurrt er, als sich die Türen schließen und das Getriebe zu surren beginnt. »Null Ortsveränderung.« Darin steckt irgendeine Metapher, scheint ihm – er hat sie nur noch nicht entziffert.
»Siehst du? #04-03 führt Selbstgespräche.« Der Sicherheitsmann zeigt auf den Überwachungsmonitor mit der Aufschrift Lift A. Die Ablösung für die Morgenschicht hat sich soeben eingestempelt.
»Mr Dhillon? Lehrer lah.« Der Morgenmann ist älter und war früher im Stadtzentrum eingesetzt, wo er alle Arten von irren Typen gesehen und als Anekdoten für Freunde und Verwandte gespeichert hat. »Juristen, Lehrer, alles eins. Reden alle viel, spinnen alle. Hab ich dir schon mal von dem erzählt, der sich nackt ausgezogen und seine Kleider auf die Straße geworfen hat?«
Die Digitaluhr an der Wand in ihrer Dienstkammer piept zweimal. Es ist sechs Uhr.
Sukhin braucht genau siebenunddreißig Minuten, um zu duschen, sich anzuziehen und mit dem Rad zu dem Junior College zu fahren, wo er arbeitet. Er ist ungeheuer stolz auf diese Leistung. Alle zwei Monate überprüft er mit der Stoppuhr-App in seinem Telefon, ob er die Zeit hält.
Zwei Minuten, um sein Fahrrad im Gartenschuppen anzuketten und zur Kantine zu gehen. Sein Morgen-Si-Gao-Kosong-Tee steht immer schon bereit – er hat ein Arrangement mit Mrs Chan, und sie bereitet seinen Tee unmittelbar vor seinem Eintreffen um 6.45 Uhr. Vier Minuten von der Kantine zu seinem Büro, eine Minute, um seinen Computer hochzufahren, zehn lange, wunderbare Minuten für seine Tasse Tee. Dann packt er seine Bücher und Notizen zusammen und geht hinunter auf den Hof zur Morgenversammlung. Er nimmt die Hintertreppe, um keinem seiner Kollegen zu begegnen. Morgens bleibt Sukhin gern so lange wie möglich für sich.
Heute sieht er Dennis unten an der Treppe auf ihn warten. Sukhin verzieht das Gesicht.
»Gott, bist du scharf, wenn du wütend bist.«
Er wünschte, er hätte eine schlagfertige Antwort, aber bei Dennis fällt ihm nie eine ein. »Sag mir einfach, was du willst.«
»Du musst mich vertreten – ich hab in der ersten Stunde die 2SO2B, aber ich muss los und ganz schnell was erledigen.« Als er sieht, wie Sukhin die Stirn runzelt, wiederholt er: »Ganz schnell.«
»Ich könnte in der ersten Stunde auch Unterricht haben, Dennis.«
»Hast du aber nicht. Donnerstags hast du die ersten beiden Stunden frei.«
»Ah. Wie praktisch.« Sukhin geht auf – wie immer zu spät –, dass Dennis nicht einmal die Möglichkeit einer Ablehnung in Betracht gezogen hat. Während er noch nach einer bissigen Erwiderung sucht, zieht Dennis ab, winkt und formt mit den Lippen ein lautloses Liebe dich.
Auch das läuft wie immer: Dennis’ Dickfelligkeit – ein Wort, das er in seinem Kopf nur für Dennis reserviert hat – kränkt und beeindruckt Sukhin gleichermaßen. Aber natürlich wird er Dennis vertreten – das ist leichter, als ihm nachher aus der Patsche zu helfen.
Der Weg zum Naturwissenschaften-Gebäude fühlt sich irgendwie seltsam an – er hat sonst nie einen Grund, dort zu sein, und als er zuletzt in diesem Teil des Colleges war, war er selbst noch Schüler hier und hatte sich verirrt auf dem Weg zu einem Vortrag im LT6, dem kleinen, muffigen Hörsaal, den sie vor einigen Jahren eingemottet und als Kunststudio wiederbelebt haben. Nach zehn Minuten einer immer hektischeren Suche hat er die 2SO2B endlich gefunden.
Die Schüler und Schülerinnen, die auf ihren Donnerstagmorgenkurs in Mathematik für Fortgeschrittene bei Mr Yeong warten – einige von ihnen haben sich sogar darauf vorbereitet –, machen große Augen, als Sukhin reinkommt. Das genießt er dann doch. Er drückt der am nächsten sitzenden Schülerin einen Stapel fotokopierter Gedichte in die Hand und bittet sie, sie herumzugeben.
»Mr Yeong musste zum Arzt«, erzählt er den jungen Leuten und kämpft gegen den Drang an, dabei die Augen zu verdrehen. »Heute werden wir uns mit sogenannter praktischer Kritik befassen – das ist eigentlich weder praktisch noch wirklich kritisch, aber ganz spaßig, wenn ihr euch ein bisschen aufspielen wollt.«
Als Erstes liest er eines seiner alten Lieblingsgedichte von Philip Larkin vor, mit ernster, gesetzter Miene, der Tonfall trocken und pedantisch. Dieses Gedicht nimmt er in jedem neuen Kurs in jeder ersten Lyrikstunde durch, aber er genießt es noch immer, diese erste Zeile vorzutragen, dieses klagende »They fuck you up …«, die durchs Klassenzimmer hallt und das Getuschel zum Verstummen bringt. Und genau wie bei ihm selbst, als er siebzehn war und Mr Brookes dröhnendes fuck you up die stickige Nachmittagsluft durchschnitt, leuchten ihre Augen auf von etwas wie Entzücken und sie beugen sich ein wenig weiter vor. Ach, die Macht dieses Wörtchens mit vier Buchstaben in einem Singapurer Klassenzimmer! Den Rest der Stunde verbringt Sukhin damit, der Klasse so viele verlegene Antworten zu entlocken, wie er nur kann, staunt über ihren jugendlichen Elan und darüber, wie er das Fehlen von Gespür und Einfühlungsvermögen wettmacht. Er wirft mit den üblichen Prak-Krit-Fragen um sich: »Wieso fucked up, Leute? Warum nicht einfach zerstört? Oder schlecht erzogen? Lest die letzte Strophe laut – wie hört sich das an?«
Am Ende ist das hier seine Lieblingsstunde des Tages geworden – frisches Blut ist immer süßer, pflegt er den neuen Lehrern zu erzählen. Das bringt immer einen Lacher – aber neuerdings bringt er diesem Lacher ein gewisses Misstrauen entgegen, jetzt, wo Mr Narayan im Ruhestand ist und Sukhin seinen Posten als Leiter der Englischabteilung übernommen hat.
»Nennen Sie mich Ramesh«, hatte der sagenumwobene Mr Narayan an dessen erstem Tag, vor fast acht Jahren, zu Sukhin gesagt.
Sukhin hat es versucht. Aber er hat es nicht geschafft; er hat es einfach nicht geschafft, beiläufig sowas wie »Ramesh und ich spielen mit dem Gedanken, in diesem Jahr Beckett auf die Leseliste zu setzen«, einfließen zu lassen, ohne sich dabei wie ein Arschloch oder ein Bilderstürmer vorzukommen. Also hat Sukhin Mr Narayan weiterhin Mr Narayan genannt, wie er es getan hatte, als er selbst als frisches Blut bei diesem Mann im Klassenzimmer saß. Ihm war klar, dass die anderen Lehrer sich darüber lustig machten.
»Mr Dhillon sieht so gut aus … diese Augenbrauen!«
»Der ist schon ganz in Ordnung – nettes Gesicht, aber alles ein bisschen zu … spitz. Glaubst du, der hat was mit Mr Yeong?«
»Oh mein Gott, echt?«
»Das war eine Frage. Jesus.«
In der Kantine herrscht der übliche Mittagswahnsinn. Mrs Chan wimmelt eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern ab, die ungeduldig nach Kaffee und Sandwiches verlangen – »Wartet, lah! Oder kommt später nochmal!« – Besorgt hält sie Ausschau nach ihrem Lieblingslehrer, ihrem Mr Dhillon. Es ist 13.15 Uhr – er müsste längst hier sein. Seine liebevoll zurechtgemachten Sandwiches sind bereits eingewickelt und seine extragroße Tasse Si-Gao-Kosong-Tee steht bereit. Sie sieht noch einmal auf die Uhr – noch zwei Minuten, dann wird sie neuen Tee machen. Sie wird ihm nichts extra berechnen – nie im Leben würde sie zulassen, dass er mit lauwarmem Tee vorliebnehmen muss.
Ah, da ist er. Sie betüddelt ihn, so sehr sie es wagt, mahnt ihn, »mehr Wasser zu trinken, mehr zu schlafen, nicht so hart zu arbeiten«, und versucht, ihm eine Gratisbanane aufzudrängen.
Ihre Zuneigung entbehrt jeder Grundlage – sie weiß, dass Mr Dhillon nie etwas getan hat, um sie sich zu verdienen, aber ihr Wunsch, diesen düsteren, müden Mann ein wenig weniger düster und müde zu machen, ist einfach stärker als sie.
Heute dreht sie ihm eine Banane und einen Curry-Puff an – der arme Kerl sieht noch müder aus als sonst, und hat er etwa abgenommen? Arbeitet sicher bis in die Nacht. Schläft wahrscheinlich auch nicht gut. Sie seufzt, als er weggeht, beladen mit Karbos und Tee. Ach je, Mr Dhillon, muss schnell heiraten.
Eine Heirat, wenn sie dem grimmigen Mr Dhillon denn überhaupt in den Sinn käme, würde sehr schnell wieder daraus verschwinden. Es ist die heißeste Zeit des Tages und Sukhins Stimmung ist auf dem Tiefpunkt, seine Bereitschaft zur Nächstenliebe erlahmt, seine Zunge geschärft. Während er sich einen Weg durch die lärmende, unermüdliche Meute bahnt, muss er sich sehr beherrschen, um das Gesicht nicht zu verziehen. Oder laut loszubrüllen. Ganz sicher wird es der Lärm sein, der es ihm eines Tages unmöglich machen wird, weiter zu unterrichten. Eine Klasse mit Jugendlichen – alles klar. Aber die Kakophonie eines ganzen Meeres von ihnen, mit ihrem sorglosen, ununterbrochenen Geplapper und ihrer blödsinnigen, grenzenlosen Energie – da möchte er einfach um sich treten. Der Tee schwappt in dem fest verschlossenen Pappbecher herum, ein kleiner Sturm in seiner Hand, passend zu dem in seinem Kopf. Er isst ein Sandwich, schmeckt es aber nicht wirklich.
Im Lehrerzimmer ist fast niemand – die meisten anderen Lehrer essen gemeinsam in der angrenzenden Personalküche zu Mittag. In seiner Anfangszeit hat Sukhin sich verpflichtet gefühlt, sich ihnen anzuschließen. Und so hat er das Geplauder ertragen, das Gejammer und die gelegentlichen ungebetenen Vertraulichkeiten, und dann hat eines Tages jemand, als er gerade sein Sandwich ausgewickelt hatte, gesagt: »He, Sukhin, schon ein Jahr! Herzlichen Glückwunsch!« Was für ein Albtraum – er hatte im Grunde genommen ein ganzes Jahr damit verplempert, sich bei diesen Leuten anzubiedern, obwohl er mit den meisten rein gar nichts gemeinsam hatte und obwohl er den Verdacht hegte, dass sie ihn alle für zu still und eigen hielten, auch wenn er sich alle Mühe gab, umgänglich und freundlich und gesellig zu sein. Am nächsten Tag aß er sein Mittagessen an seinem Schreibtisch und las dabei Dune und fühlte sich zum ersten Mal wohl, seit er hier an diesem College angefangen hatte. Nie wieder hat er sich zur Mittagszeit in die Nähe der Personalküche gewagt.
Und jetzt isst er in dem winzigen, fensterlosen Büro, das früher Mr Narayan gehört hat und nun Sukhin, sein zweites Sandwich.
Die Tür geht auf und Ken kommt herein. Kein Klopfen, kein Hallo, nur: »Hab dich in der 2SO2B gesehen, als die eigentlich Mathe für Fortgeschrittene haben sollten. Was war da los? Wo war Dennis?« Ken hat seinen Verhörton angeschlagen – ganz tief, leicht schroff –, den Ton, mit dem er die Jungs wegen verschossener Bälle und verlegter Schläger zusammenstaucht, den, den er immer anschlägt, wenn er vermitteln möchte, dass das, worüber er gerade spricht, wirklich, wirklich wichtig ist.
»Hey. Ich hab zu tun, falls es dir nicht aufgefallen ist.« Sukhins Computerbildschirm ist schwarz, Sukhin liest Stephen Kings Christine. Er hofft, dass er unfreundlich klingt.
»Hmmm.« Ken weicht nicht von der Tür. »Du hast also seinen Unterricht übernommen, ja? Ich glaub’ ja nicht, dass das erlaubt ist.«
Sukhin widmet sich wieder seiner Lektüre. »Okay. Danke.«
»Ich sag es nicht weiter.«
»Yup. Okay.«
»Ihr schuldet mir einen Gefallen. Du und Dennis.«
Sukhin weigert sich, von seinem Buch aufzublicken. In Gedanken fängt er an, von zwanzig an rückwärts zu zählen. Bei zwölf hört er, wie die Tür geschlossen wird.
Ken ist der Leiter des Sportbereichs – von gar nichts, wenn es nach Sukhin geht. Er ist erst vor zwei Jahren zum Kollegium gestoßen und die beiden haben sich von Beginn an gegenseitig verabscheut. Sukhin hat vergessen, wie es angefangen hat, möglicherweise irgendwas mit einem falschen Zitat – aber es hat damit geendet, dass Ken sagte, niemals würde er seinen Kindern (er hat zwei) erlauben, ein »Unsinnsfach wie Englische Literatur« zu wählen, worauf Sukhin sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass irgendwer ernsthaft auf den Rat eines Sportlehrers hören würde, wenn es um wissenschaftliche Belange ginge. Seitdem fliegen regelmäßig Salven von Pfeilen und Spitzen in beide Richtungen.
Sukhin ist der Überzeugung, dass er Ken fröhlich beim Ertrinken zusehen könnte. Ken ist nicht einfach Andere Leute – Ken ist Ungeziefer! Ken muss entfernt werden, oder vernichtet … wenn Sukhin irgendwann die Energie dazu aufbringen kann.
Ken heißt nicht einmal wirklich Ken. Er heißt Kheng Joo.
Ken hat sich letztes Jahr lasern lassen.
Sukhin speichert solchen Schrott ab, wann immer er ihm über den Weg läuft. Eines Tages wird es zum Krieg kommen, und er wird ihn gewinnen, mit einem (oder allen?) dieser scheinbar unbedeutenden Details.
Ken ist allergisch gegen Penizillin. Und Macadamia-Nüsse.
»Für wen ist der Kuchen?«
»Für den eifrigen, eleganten Mr Dhillon.« Dennis arrangiert Kerzen in konzentrischen Kreisen auf einem cremestrotzenden Ungetüm.
»Hast du die gebacken?«
»Nein lah – Advocakes & Solicitarts. Ihre Yuzu-Kokos-Creme ist die beste.«
Ein Aufkeuchen, genau wie Dennis es beabsichtigt hatte. »Aber da muss man doch drei Monate im Voraus bestellen!«
Dennis grinst. »Meine Schwester kennt die Besitzerin – haben mal bei derselben Firma gearbeitet. Also konnte ich das vor drei Wochen bestellen.«
»Und die liefern?«
»Schön wär’s. Eine Konditorei wie diese hat es nicht nötig zu liefern. Ich hab sie heute Morgen ganz früh abgeholt – sie stand den ganzen Tag im Kühlschrank der Personalküche. Musste auf sie aufpassen wie ein Luchs.«
»Heute Morgen? Hattest du keinen Unterricht?«
Dennis lacht. »Hab mich von Sukhin vertreten lassen.«
Das Arrangieren der Kerzen nimmt und nimmt kein Ende.
»Wow, das sind ja ganz schön viele Kerzen.«
»Der Mann ist älter, als er aussieht. Hält sich sehr gut – trotz des vielen Stirnrunzelns.« Er tritt zurück, um seine Arbeit zu begutachten, dann macht er weiter. »Fast fertig – trommel die Leute zusammen. Wir überfallen ihn in seinem Büro.«
Sukhin schläft. Das war nicht seine Absicht – die letzte Unterrichtsstunde des Tages liegt hinter ihm und wenn er seinen Kopf vor dem Zusammenpacken nicht für einen Moment auf den Schreibtisch gelegt hätte, würde er jetzt schon heimwärts radeln. Er träumt – er läuft durch ein Feld voller riesiger Saguaro-Kakteen, alle absolut identisch, und alle recken ihre stacheligen Arme in den Himmel.
»Alles Gute zum Geburtstag, Sukhin«, sagt der nächststehende Kaktus.
Scheiße, was ist das denn?
»Sukhin! Sukhin!«
Er springt auf und ist wach. Ungefähr zwanzig Gesichter blicken auf ihn herab. Er fühlt sich bedrängt und starrt wütend zurück. Dennis stellt die größte Torte, mit der er je den Raum geteilt hat, auf seinen Schreibtisch. Sukhin ist entsetzt – die ist für ihn, geht ihm auf. Der Kaktus hatte recht. Er hat wirklich Geburtstag. Gott, so viele Kerzen!
»Alles Gute zum Geburtstag! Hast du gedacht, wir würden ihn vergessen?« Und dann, als er Sukhins erschrockene Miene sieht, begreift Dennis, dass er es ist, der ihn vergessen hat. Verrückt. Seinen eigenen Geburtstag.
Stille. Alle beäugen Sukhin. Sukhin beäugt den Kuchen. Dennis gratuliert sich selbst nochmal zu seiner Entscheidung für Yuzu-Kokos-Creme.
Dann ein tonloses Geträller, ziemlich heldenhaft angeführt von Dennis: »Happy birthday, dear Sukhin, haaaaappy …« Sukhin könnte heulen, oder kotzen. Ich bin fünfunddreißig und das ist mein Leben. Und dann, im nächsten Augenblick: Oh Gott, ich bin fünfunddreißig und kriege gleich eine Midlife-Crisis. Was für ein Klischee. Wie traurig. Er möchte nur noch so weit wie möglich weglaufen vor diesen strahlenden Gesichtern, diesem dämlichen Lied, dieser albernen Torte. Als der Gesang endlich verstummt, zwingt Sukhin sich zu einem Lächeln, zu einem Dankeschön in die Runde, um dann das Monster in kleine Stückchen zu schneiden, damit alle sich den Hals vollstopfen und dabei doch den Anschein erwecken können, gar nicht so viel zu essen. Er tut sogar so, als würde er selbst ein Stück essen. Alles, damit sie glauben, er freue sich, alles, damit sie sich so schnell wie möglich aus seinem Büro verpissen.
Irgendwann im Laufe der Nacht erwacht die Frau. Sie findet sich auf ihrer Seite wieder, mit dem Gesicht zur Wand. Hinter ihr atmet er ruhig, auf die Weise, die sie inzwischen als Zeichen dafür zu erkennen gelernt hat, dass er tief und fest schläft. Vorsichtig dreht sie sich um. Er hat sich ihr zugewandt, aber sein Gesicht ist halb in seinem Kissen vergraben, unter das er beide Hände geschoben hat. Seine Knie hat er an die Brust gezogen, so dass das Ganze aussieht wie eine komplizierte Yogastellung.
Die Frau schiebt ihre Hand unter das Kissen des Mannes und auf eine seiner Hände. Wie warm sich das anfühlt, sich zwischen seine Haut und das Gewicht seines Kissens zu schmiegen. Er bewegt sich ein wenig.
Am Morgen wird er sich an dieses Gewicht auf seiner Hand erinnern, an ihre plötzliche Kälte.
Am Morgen, wenn er fragen sollte, wird sie alles abstreiten.
II
Auf dem Zettel im Glückskeks steht: »Sei ehrlich zu allen, denen du begegnest. Für charmante Sozialkontakte.«
Sukhin stopft sich die Keksfragmente in den Mund. Was für ein grauenhafter Rat – selbst, wenn er einer wäre, der sich von einem Keks ungrammatische Ratschläge erteilen lässt. Ehrlich sein? Zu allen, denen du begegnest? Wie … unlogisch. Charmante Leute lügen – sonst wären sie doch nicht charmant? Und die Leute erwarten, belogen zu werden, und sie belügen sich selbst, indem sie sich einreden, an Ehrlichkeit zu glauben und an diesen ganzen Mist über einfach du selbst zu sein. Was, wenn du selbst zu sein bedeutet, dass du andere Leute, die sie selbst sind, nicht leiden kannst? Sukhin fallen sofort eine ganze Menge Leute ein, bei denen es durchaus eine Verbesserung wäre, wenn sie jemand anders wären. Wenn nur alle einen Neustartschalter hätten – obwohl das bedeuten würde, dass man die ganze Zeit eine Art Sicherheitsweste tragen müsste, damit niemand einfach die Hand ausstrecken und dir einen Neustart verpassen könnte, weil du etwas Fieses über seine Frisur oder sowas gesagt hast.
Hat er etwas Fieses über Veras Frisur gesagt?
Seine Gedanken wandern zurück zum Nachmittag. Er war in die Personalküche gegangen, um sich ein Glas Wasser zu holen. Dennis war gerade da und hat über irgendwas geredet – was war das noch? Irgendein neues Training, das er gerade ausprobierte. Irgendwas in der Art. Vera, die neue Geographielehrerin, die von der Methodistischen Mädchenschule hergewechselt war, kam hereingestürmt und grüßte sie. Als sie näher kam, bemerkte Sukhin erst, wie groß sie war – fast so groß wie Dennis, der nur ein bisschen größer war als Sukhin selbst. Und damit war sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, genauso groß wie er.
»Du hast was mit deinen Haaren gemacht.« Klar, dass Dennis sowas auffiel.
»Ja. Ich dachte, ich sollte sie kürzer tragen. Was meint ihr?« Sie strich sich mit der Hand über die Haare und grinste.
»Sehr schön, sehr schön. Macht deinen Hals länger.« Woher nahm Dennis nur immer diese Sprüche?
Sie wandte sich an Sukhin. »Und was meinst du?«
Er starrte ihre Haare an auf der Suche nach einer passenden Bemerkung. An den Haaren war überhaupt nichts Besonderes, Haare eben. Endlich fand er etwas, das eine Bemerkung wert war. »Sollen die so asymmetrisch sein?«
»Asymmetrisch?«
»Links sind sie länger, nur ein bisschen – hier, ungefähr einen Zentimeter.« Er zeigte auf ihr linkes Ohr.
Sie zupfte an der betreffenden Strähne. »Wirklich? Das glaub’ ich nicht.«
»Doch, Dennis, schau mal. Ist die Seite hier nicht etwas länger als die andere?« Und dann: »Sollte sich aber problemlos in Ordnung bringen lassen. Ich bin sicher, das kannst du sogar selbst.«
»Es ist nicht asymmetrisch.« Sie war ein bisschen rot geworden.
Er hatte keine Lust sich zu streiten – er hatte nicht vorgehabt, mit ihr ein Gespräch über ihre Frisur zu führen, sie hatte es ihm aufgezwungen. Von ihm aus konnte sie gern als Siegerin vom Platz gehen. »Hmmmm. Okay. Vielleicht sitzt dein linkes Ohr höher als dein rechtes? Das wäre eine Erklärung.« Er war ziemlich zufrieden mit dieser Argumentation. Sie war absolut logisch und die meisten Menschen hatten ohnehin keine symmetrischen Köpfe.
Sie bekam kugelrunde Augen. »Jetzt sind also meine Ohren asymmetrisch?«
»Nein, die sind nicht asymmetrisch. Asymmetrisch bedeutet Ungleichmäßigkeit an ein- und demselben Objekt«, erklärte Sukhin – ziemlich geduldig, wie er fand. Warum brachten die Leute das nur immer durcheinander? »Also, deine Frisur ist asymmetrisch. Ein Mund könnte asymmetrisch sein – nein, nicht deiner. Ohren sind zwei separate Objekte. Deine Ohren also – ich würde einfach sagen, die sitzen nicht auf einer Ebene. Ja, ich glaube, das wäre das Treffendste.«
»Das wäre das Treffendste?« Sie starrte ihn wütend an.
»Die treffendste Art, sie zu beschreiben.« Er versuchte, sie zu beruhigen: »Aber deine sehen ja wirklich aus wie auf einer Ebene. Also ist deine Frisur asymmetrisch – und das lässt sich viel leichter in Ordnung bringen.«
Woraufhin sie sich einfach umdrehte und verschwand.
Dennis kicherte. »Du findest sie offenbar attraktiv. Normalerweise brauchst du über eine Woche, bis du jemand Neues verschreckst.«
Nein, er hatte nichts Fieses über ihre Frisur gesagt. Er hatte nur darauf hingewiesen, dass sie asymmetrisch war – nicht ihre Schuld und nicht einmal ein Dauerzustand. Wenn seine Frisur asymmetrisch wäre, wäre er froh, wenn es ihm jemand sagte. Er würde es wissen wollen. Warum sollte jemand es nicht wissen wollen? Diese Frau hing offenbar viel zu sehr an ihrer Vorstellung davon, wie ihre Haare aussehen sollten. Illusionen von Symmetrie. Was für eine dumme Nuss.
Sukhin macht sich eine Tasse Tee und fragt sich, ob er Vera attraktiv findet.
Im zweiten Glückskeks steht: »Tief und oft atmen.«
Was für ein Blödsinn! Wer schrieb diesen Kram nur? Am Fließband produzierter chinesischer Exotismus für den schlichten Amerikaner – und jetzt den schlichten Singapurer. Dennis hatte sie in einem Laden in Chinatown gesehen und Sukhin zwei Riesenpackungen mit je fünfzig gekauft. (»Schau mal, Süßer, jetzt kannst du lesen und essen! Deine zwei Lieblingsbeschäftigungen in einem praktischen kleinen Keks. Du wirst mich lieben.«)
Vera ist nicht sein Typ. Viel zu groß. Und viel zu wenig Sinn für Symmetrie.
Als Sukhin sein altes Zuhause betritt, trifft er seine Mutter in der Küche an, wo sie Zucker in eine Kanne Kaffee rührt. Der Kaffee ist schwärzer als Tinte, komplett undurchsichtig – wenn man den Löffel sehen kann, hat sie ihm schon als Kind gesagt, ist der Kaffee nicht stark genug.
»Kaffee?«
»Schon gut, Mum. Ich mach mir einen Tee.«
Ich trinke schon seit Jahren keinen Kaffee mehr, möchte er sagten. Mum, ich trinke keinen Kaffee mehr. Statt dessen begnügt er sich damit, lauter herumzuklappern als nötig, während er den Kessel füllt und auf den Herd stellt, um dann den Tee aus dem Schrank zu nehmen.
Meistens sitzen sie schweigend da und rühren grundlos wieder und wieder in ihren Tassen herum. Aber heute scheint sie zu einem Gespräch entschlossen. Sie erzählt ihm von ihrem Morgen, von dem Schnäppchen, das sie beim Fischhändler ergattert hat, von dem Telefonat mit ihrer Schwester. Er sagt nichts, hört nur mit halbem Ohr zu, weigert sich, weitere Informationen aus ihr herauszuholen. Sie verstummt und sieht ihn erwartungsvoll an. Er starrt in seinen Becher.
»Wie war dein Tag?«
Sukhin seufzt. »Der war in Ordnung. Drei Wochen bis zu den Prüfungen. Die Lehrer sind am Durchdrehen, die Kids sind am Durchdrehen. Natürlich tun manche auch so, als sei ihnen alles egal.«
»Lehrer oder Schüler?«
»Beides.«
Sukhin sieht zu, wie seine Mutter nacheinander alle Ringe und Armreifen abstreift, sie auf dem Tisch auf einen Haufen legt, um sie dann alle wieder anzulegen. Er hat sie nie gefragt, warum sie das tut. Er fragt sie auch jetzt nicht.
Sie sitzen in der Küche, weil das Wohnzimmer niemals benutzt wird. Es muss irgendwann einmal dazu gedacht gewesen sein, darin herumzulümmeln, vielleicht sogar Gäste zu empfangen – irgendwo dort steht ein Sofa, ein Sessel, sogar ein Couchtisch.
Aber dann haben die Kartons Einzug gehalten. Die größten hocken in den Ecken und reihen sich entlang der Wände. Wachtposten, die vor Plünderern schützen sollen. In diesen Kartons: weitere Kartons, sauber ineinander geschachtelt, um den Platz optimal auszunutzen, und behutsam, damit kein Karton unbehaglich gegen einen anderen gepresst wird – kein Karton, ob groß oder klein, würde es sich gefallen lassen, gequetscht zu werden. Andere Kartons in Kartons haben sich im Laufe der Jahre zu diesen Riesen gesellt; einige balancieren ziemlich kühn oben auf ihren glatten Pappdeckeln. In der Mitte des Zimmers lümmelt sich die coole Clique auf dem ehemaligen Couchtisch. Diese Schwarzen Schafe – hexagonal, pyramidal, herzförmig, sternförmig, pandaförmig (nur einer, aber einer reicht) – passen nicht in andere Kartons und widersetzen sich allen Versuchen, sie zu ordentlichen Stapeln aufzutürmen, aber sie sind die, die am meisten geliebt werden.
Nach dem Tee geht Sukhin ins Wohnzimmer und zwängt sich in den engen Spalt zwischen einem Stapel Kartons und dem Podest der Schwarzen Schafe, um mit einem Handstaubsauger vorsichtig den Staub von jedem der seltsam geformten Kartons zu entfernen. Der Panda ist der anspruchsvollste – so viele komplizierte Klappen –, aber Sukhin macht diese Arbeit ja nicht umsonst schon seit Jahren. Er ist ein Profi, schiebt jede einzelne Lasche mit der klingenartigen Schnauze des Staubsaugers behutsam auf, um dann mit raschen, gleichmäßigen Zügen von links nach rechts zu fahren. Er arbeitet wie in Trance, vergisst, wo er ist, wer er ist, sogar, was er tut.
Einige der Kartons standen schon hier, als Sukhin noch ein Kind war – der Karton, in dem der Reiskocher geliefert wurde, der mit der ersten Mikrowelle der Familie und die Cadburydose, einst gefüllt mit Schokoladeneiern, die Tante Siew ihnen zu Weihnachten geschenkt hatte, als er noch ein Junge war und gern Süßigkeiten aß. Einer der Pappwächter hat einmal die (damals) hypermoderne Waschmaschine behütet, die jahrelang der Augenstern seiner Mutter war, weil sie bedeutete, dass sie die vielen Kleider nicht mehr mit der Hand waschen musste, um sie vor der vorherigen Waschmaschine zu bewahren, einem blasslila Monst er mit dem einzigen Lebenszweck, das Hookesche Gesetz bis an die äußersten Grenzen zu treiben. An einer anderen Stelle in diesem kubischen Meer: Kartons, die einst allerlei elektronische Geräte enthielten, Geschirr, Lampen, Spielzeug und viele andere längst verstorbene und verworfene Gegenstände.
Sowie er mit den Schwarzen Schafen fertig ist, geht er weiter zu einem der Stapel, die dieses Wochenende dran sind, dem, der fast bis zur Decke reicht. Wie immer arbeitet Sukhin höchst effektiv. Er teilt den Stapel in zwei Hälften, nimmt den oberen Teil herunter und stellt ihn in den engen Gang durch das Wohnzimmer, den die Kartons der Familie freundlicherweise gelassen haben. Dann macht er sich bei jedem Halbstapel einzeln ans Werk, macht sauber, sucht nach Feuchtigkeit und Schäden, bis jeder Karton für gut befunden wurde – und dann kehren alle zurück auf den Stapel, um auf die nächste Runde Streicheleinheiten zu warten. Sukhin macht sich an den nächsten ausersehenen Stapel.
Nicht alle Kartons schaffen es bis hierher, bis zu dem, was man als Dhillon-Familien-Altersheim-für-Kartons bezeichnen könnte – es gibt einen strengen Ausleseprozess. Um sich zu qualifizieren, muss jeder Karton mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
1. Er ist groß genug, um sich nützlich zu machen, falls sich die Familie jemals zu einem Umzug entschließen sollte. ›Groß genug‹ ist dabei eine absolut willkürliche Größe, über die allein Sukhins Vater entscheidet, Dr. Jaswant Dhillon. (Die Familie ist seit dreißig Jahren nicht mehr umgezogen, aber wenn sie sich dazu entschließen sollte, wäre sie in Bezug auf Kartons sehr gut ausgestattet).
2. Es ist ein Karton, der einmal Folgendes enthielt:
a. Etwas, das Sukhins Mutter, Doris Dhillon, als ›Meilenstein‹ in der Entwicklung elektronischer Geräte betrachtet.
b. Irgendeine Art von Set – Doris meint, dass Dinge, die als Set eintreffen, immer in dem Karton transportiert werden müssen, in dem sie geliefert wurden, denn dieser wurde schließlich eigens zu diesem Zweck entworfen.
c. Eine gute Erinnerung – eine vage, oft bemühte Kartonkategorie.
d. Ein ›erstes‹ Irgendwas.
3. Es ist ein Richtig Toller Karton. Damit ein Karton in diese Kategorie eingehen darf, muss die ganze Familie darin übereinstimmen, dass es sich wirklich um einen Richtig Tollen Karton handelt. (Der Panda hat seinerzeit für Unstimmigkeiten gesorgt – Sukhin und seine Mutter waren davon begeistert, sein Vater fand ihn zu kitschig. Irgendwann haben sie es geschafft, ihn umzustimmen – gegen ein Vetorecht in Bezug auf die nächsten beiden Richtig Tollen Kartons).
Im Laufe der Jahre hat die Familie, mit sehr bescheidenem Erfolg, versucht, ihre Sammlung zu verkleinern, auszusortieren, sich vom Überschuss zu befreien. Die meisten Versuche dieser Art werden ausgelöst durch einen drohenden Verwandtenbesuch, der letzte jedoch war die Folge eines Anfalls von Heimneid, den Doris erlitten hatte, während sie sich im Wartezimmer des Zahnarztes durch Home and Decor hindurchblätterte. Plötzlich hatte sie sich bei einem Traum von Einrichtung in skandinavischem Chic ertappt, von sanften, poetischen Kanten und leeren Wänden. Die Familie verbrachte ein trauriges Wochenende damit, darüber zu streiten, welche Kartons sie behalten wollte und welche der Karung-Guni-Mann bekommen sollte. Schließlich – erschöpft, erzürnt – gaben sie auf und schleiften alle Kartons zurück an ihre alten Plätze. Doris hat seither keine Einrichtungszeitschrift mehr eines Blickes gewürdigt.
Auf dem alten Plattenspieler, ein Relikt aus Doris’ Single-Zeiten als Studentin im London der 1970er Jahre, läuft eine noch ältere Beatles-Platte. Sukhin merkt es selbst nicht, aber unter dem beruhigenden Einfluss der Familienkartons trällert er Lovely Rita mit, ein Lied, das er verabscheut.
»Bleibst du zum Essen?«
Sukhin schaltet den Staubsauger aus. »Nein, ich muss nach Chinatown. Deko für die Mitarbeierfeier besorgen.«
Das ist nicht die Antwort, die sie sich gewünscht hat, aber sie ist nicht so dumm, noch einmal zu fragen. »Das ist schön.«
»Nein, Mum, ist es nicht. Es ist eine Qual.« Sukhin krabbelt, wie ein Krebs, zwischen den Kartons hervor. Er bemerkt die schlecht verhohlene Enttäuschung seiner Mutter nicht. »Und es ist blöd. Niemand amüsiert sich auf der CNY-Party. Alle tun nur so – es ist einfach eine große Show für die Tay. Die hätte gern, dass wir alle eine große glückliche Familie sind.«
»Aber ihr seid doch auch keine unglückliche, oder?« Doris fragt sich zum xten Mal, warum ihr intelligenter, reizbarer Sohn unbedingt Lehrer werden wollte. Vermutlich, um seinen Vater zu ärgern.
Wie aufs Stichwort fährt draußen der Wagen ihres Mannes vor. Das automatische Tor setzt sich in Bewegung und wenige Sekunden darauf schnurrt das Auto auf der anderen Seite der Wohnzimmerwand. Plötzliche Stille, als der Motor abgedreht wird, und dann kommt Dr. Jaswant Dhillon ins Haus gestürmt und lässt einen Redeschwall los, ist schon mitten im ersten Absatz, während er sich Schuhe und Socken auszieht.