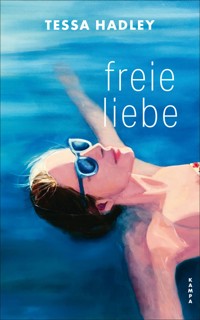Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit 30 Jahren sind sie befreundet, die stille Malerin Christine, ihr Mann Alex, der sich zum Dichter berufen fühlte und nunals Lehrer arbeitet, der erfolgreiche Kunsthändler Zachary und seine flamboyante Frau Lydia. Die vier führen in London ein gutbürgerliches Leben, parlieren über Kunst und Literatur, bekommen Kinder und fahren gemeinsam in die Ferien. Alles ist gut. Dann stirbt Zachary, vollkommen unerwartet. Lydia zieht zu Christine und Alex. Aber der Verlust des Freundes und Ehemanns schweißt die drei nicht enger zusammen. Die Vergangenheit holt sie ein, alte Wunden brechen auf. Haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen? Trifft man die je? Was ist aus ihren Sehnsüchten, den Lebensentwürfen ihrer Jugend geworden? Und was ist eigentlich damals in Venedig geschehen? Tessa Hadley hat einen wunderbar elegischen Roman über die ganz normalen Irrtümer und Missverständnisse des Lebens geschrieben, eine »comedy of manners«, in der die kleinen Gesten alles erzählen, ein Buch, dessen Lebensklugheit und feiner Ironie man sich nicht entziehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tessa Hadley
Zwei und zwei
Roman
Aus dem Englischen von Gertraude Krueger
Kampa
Für Mum und Dad
1
Sie hörten Musik, als das Telefon klingelte. Es war ein Sommerabend, neun Uhr. Sie waren mit dem Essen fertig, und Christine lauschte konzentriert, mit untergeschlagenen Beinen in ihrem Sessel sitzend; sie kannte das Stück, wusste aber nicht, was es war. Alex hatte es ausgesucht, er hatte sie nicht einbezogen, und jetzt wollte sie aus Trotz nicht mehr nachfragen – er genoss es zu sehr, etwas zu wissen, was sie nicht wusste. Er lag auf dem Sofa im Erkerfenster, ein offenes Buch in der Hand, in dem er nicht las, sondern das er über der Brust ausgebreitet hielt; er betrachtete den Himmel draußen. Ihre Wohnung war im ersten Stock, und das Wohnzimmerfenster ging auf eine breite, mit Platanen bestandene Straße hinaus. Vom Park schwirrte ein Pulk Sittiche herüber, und nebenan ragte das rotbraune Dunkel der Blutbuche, das letzte Licht verschluckend, in den türkisfarbenen Himmel. Eine Amsel, die als Schattenbild mit offenem Schnabel auf einem Ast saß, sang offenbar, wurde aber von der Musik übertönt.
Es war das Festnetztelefon, das da läutete. Es riss Christine von der Musik fort; sie stand auf und schaute sich um, wo sie den Handapparat nach dem letzten Gebrauch abgelegt hatten – wahrscheinlich irgendwo hier, zwischen den Bücher- und Papierstapeln. Oder in der Küche beim Abwasch? Alex ignorierte das Läuten, ließ nur durch ein leicht gereiztes Verziehen des Gesichts erkennen, dass er es bemerkt hatte – dieses immer bewegten, ausdrucksvollen Gesichts, fremdartig, weil die Augen so dunkel waren, scharf umrissen, als wären sie gemalt. Dieser Effekt wurde immer auffälliger, je älter Alex wurde und je mehr der Glanz aus seinen Haaren schwand, die früher die Farbe von angelaufenem dunklem Gold gehabt hatten.
Wahrscheinlich war ihre Mutter am Telefon und nicht seine – oder vielleicht ihre Tochter Isobel, und mit der wollte Christine gern sprechen. Sie gab die Suche nach dem Handapparat auf, fischte gar nicht erst mit den nackten Füßen nach ihren Espadrilles und rannte, immer zwei Stufen auf einmal nehmend – das konnte sie noch –, die Treppe hoch, zum Nebenanschluss im Schlafzimmer unter dem Dach. Unten spielte die Musik ohne sie weiter, Schubert oder so, und als Christine sich auf den Bettrand fallen ließ und sich atemlos meldete, nahm sie das liebliche Perlen einer abfallenden Tonfolge wahr. Dieses Zimmer, das sie sich unter dem spitzwinkligen Dach eingerichtet hatten, bewahrte die ganze Hitze des Tages und war von Gerüchen erfüllt – Verkehrsabgase, Geißblatt von unten aus dem Garten, Teppichstaub, Bücher, ihr Parfüm und ihre Gesichtscreme, die leichte Körpermuffigkeit der Bettlaken. Die Drucke, Fotos und Zeichnungen an den Wänden – manche davon ihre eigenen Werke – lagen im Schatten, wie ausgelöscht, und nur ihre gerahmten Formen hoben sich von der weißen Farbe ab. Durch das offene Dachfenster konnte sie jetzt die Amsel hören.
Lieblich.
»Ja?«
Am anderen Ende der Leitung war ein Wirrwarr von Geräuschen, als käme der Anruf von einem öffentlichen Ort wie einem Bahnhof, wo man nur mühsam sprechen konnte. Jemand verlangte eindringlich nach ihr. »Kannst du mich hören?«
»Bist du das, Lydia?« Christine merkte, dass sie freundlich lächelte, entgegenkommend, obwohl sie niemand sehen konnte, mit zusammengedrückten Knien auf dem niedrigen Bett sitzend. Lydia hatte wohl getrunken, was durchaus schon vorgekommen war. Sie sprach schleppend, undeutlich, als wäre in ihrer Stimme etwas zu Bruch gegangen. »Was gibt’s?«
»Ich bin im Krankenhaus«, schrie Lydia. »Es ist etwas passiert.«
»Was ist passiert?«
»Mit Zachary. Es hat ihn bei der Arbeit erwischt.«
Das Zimmer erbebte, und seine Stille richtete sich neu aus, ein paar Staubpartikel kamen von der Decke herabgetrudelt. Das hatte es noch nie gegeben, dass Zachary etwas zugestoßen war. Er stand wie ein Fels in der Brandung, er wurde nie krank. Nein, er stand nicht unbewegt wie ein Fels: Er war ein weit ausschreitender, fröhlicher Riese, berstend vor Energie. Christine sagte, sie werde sofort ein Taxi rufen, in spätestens einer halben Stunde sei sie bei Lydia. »Welches Krankenhaus? Auf welche Station soll ich kommen? Was ist mit ihm?«
»Es ist das Herz.«
»Ein Herzinfarkt?«
»Sie wissen es nicht genau«, sagte Lydia. »Aber sie glauben, es ist das Herz. Anscheinend war er eben noch in der Galerie im Büro, gesund und munter, und hat mit Jane Ogden über die neue Ausstellung gesprochen, und auf einmal ist er umgekippt. Ist auf den Tisch aufgeschlagen, alles ist durcheinandergeflogen. Vielleicht ist er mit dem Kopf aufgeprallt, als er auf den Tisch aufgeschlagen ist.«
»Und was geschieht jetzt? Wird er operiert?«
»Warum hörst du nicht zu, Christine? Ich sage doch, er ist tot.«
Auf dem Weg zu Alex blieb Christine vor der offenen Tür zu ihrem Atelier stehen, wo sich ihre Arbeit in Umrissen abzeichnete, die im Dämmerlicht getreulich auf sie warteten: Tuscheflaschen, zerquetschte Farbtuben, der chinesische Porzellantopf mit ihren Pinseln und Stiften, die Pinnwand mit Ansichtskarten und aus Zeitschriften ausgerissenen Bildern, Federn, dreckige Lappen, ausgebleichte Plastikschnipsel. Cremefarbene Bögen von dickem Papier lagen auf dem Schreibtisch ausgebreitet und warteten darauf, dass sie ihre Spuren darauf hinterließ; grundierte Leinwände waren an den Wänden aufgereiht, halbfertige Arbeiten standen auf der Staffelei oder waren auf Stellwände gepinnt. Jeden Morgen ging sie zu diesem Schauplatz ihrer Mühen wie zu einem religiösen Fest, vollführte kleine Rituale, die sie keinem Menschen gegenüber je erwähnt hatte. Inzwischen war es ihr größter Wunsch, dort zu sein und zu arbeiten – an der Staffelei zu stehen oder Kopf und Schultern konzentriert über das Papier auf dem Tisch zu beugen, in ihre Nachbildung von Formen, ihre Erfindungen vertieft. Jetzt aber löste der Gedanke an diese Arbeit – den Fixpunkt, der ihren Kurs bestimmte – Übelkeit in ihr aus. Sie kam ihr verlogen vor, das klebrige Produkt ihrer eigenen Eitelkeit. Rasch schloss sie die Tür davor. Dann machte sie sie wieder auf – im Schloss steckte ein Schlüssel, den sie manchmal umdrehte, wenn sie nicht gestört werden wollte. Sie zog ihn heraus und schloss das Atelier von außen ab, steckte den Schlüssel in ihre Jeanstasche.
Im Wohnzimmer spielte immer noch die Musik.
»War das deine Mutter?«, fragte Alex.
Ihr Herz pochte mit dumpfen Schlägen in ihrer Brust, sie wusste nicht, ob sie sprechen konnte. Es war furchtbar, mit dieser Nachricht sein Glück zerstören zu müssen, während er auf dem Sofa lag, an Kissen gelehnt, unbesorgt – oder nicht besorgter als sonst – und sie über ihm stand. »Es war Lydia.«
»Was wollte sie denn?«
»Alex, ich muss dir etwas sagen. Zachary hatte einen Herzinfarkt. Zumindest klingt es, als wäre es ein Herzinfarkt gewesen.«
»Nein.«
»Er ist tot.«
Einen Moment lang setzte Alex sich seiner Frau in seinem nackten Entsetzen aus, scharf aus dem leuchtenden Rot der Kissen hervortretend. »O nein, du machst Witze. Nein.«
Gewöhnlich schien er vollkommen in sich zu ruhen und durch nichts zu erschüttern zu sein, mit seiner federnden geballten Energie und dem kampflustigen spitzen Kinn, der wohlgeformte Kopf immer wachsam und sinnlich wie ein Cäsarenhaupt.
»Sie hat vom Krankenhaus aus angerufen, vom University College Hospital. Ich fahre jetzt zu ihr. Ich habe ein Taxi gerufen.«
Sein Buch fiel zu Boden, und er erhob sich in dem dunkel werdenden Zimmer. »Das kann nicht wahr sein. Was ist passiert?«
»Er war eben noch an seinem Schreibtisch in der Galerie und hat mit Jane Ogden gesprochen, gesund und munter, und im nächsten Moment ist er umgekippt, vielleicht mit dem Kopf aufgeschlagen, alles ist durchein- andergeflogen. Hannah hat versucht, ihn zu reanimieren, die Sanitäter haben alles Mögliche versucht. Als sie im Krankenhaus ankamen, war er schon tot. Jane musste Lydia anrufen, sie war unterwegs, einkaufen.«
»Wann war das?«
Christine wusste es nicht genau, irgendwann am späten Nachmittag oder frühen Abend.
»Ich kann es einfach nicht glauben«, sagte Alex. »Nein, das ist nicht möglich. Ich habe ihn am Wochenende getroffen, und da ging es ihm prächtig.«
»Ich weiß. Es ist nicht möglich.«
Als Christine die Musik auf dem CD-Player abstellen wollte, bat er sie, noch zu warten, das Stück war fast zu Ende. »Lass es zu Ende gehen.«
Er legte ihr die Hände auf die Schultern, wollte sie zurückhalten, wollte ihr Trost spenden. Es war eine liebevolle Geste, doch konnte Christine das nicht an sich heranlassen. Sie standen einander gegenüber. Alex war untersetzt, mittelgroß – sie war vielleicht drei Zentimeter größer als er, selbst mit bloßen Füßen, nur würde er das nie glauben. Zuerst wand sie sich in seinem Griff. »Ich muss mich beeilen. Ich weiß nicht, ob sie dort im Krankenhaus allein ist.«
»Das Taxi ist noch nicht da, warte. Hör zu.«
Es schien ihr künstlich und gezwungen zu warten, bis die Musik vorbei war. Ihre Gedanken rasten, und sie konnte die Musik nicht hören, hasste dieses Angebot von Vielfalt und Schönheit. Dann gab sie sich allmählich, unter dem beständigen Gewicht seiner Hände, der Geige, dem Klavier und dem Cello hin, die sich eilig auf das Finale zubewegten. Ihr Spiel löste etwas, was sich in Christines Innerem verkrampft hatte. Sie merkte, dass sie die Arme vor der Brust verschränkt hatte, als wollte sie sich schützen oder fest verschließen; wenigstens hatten sie die Lampen im Zimmer nicht angeschaltet. Sie hielten sich in den Armen. Alex hatte Tränen im Gesicht, er weinte leicht. Er besaß ein Talent für Zeremonien, das sie nicht hatte, ihr waren solche Feierlichkeiten peinlich. Dieser Moment nun wirkte feierlich, und ihr Bewusstsein verstummte und hielt inne. Zum ersten Mal dachte sie direkt an Zachary, seine reale Gegebenheit. Aber das war nicht zu ertragen.
»Lass mich mitkommen ins Krankenhaus«, sagte Alex. »Ich fahre dich hin.«
Christine überlegte. »Nein, es ist besser, wenn ich allein gehe. Wenn wir erst einmal nur zu zweit sind. Ich bringe sie hierher. Du könntest das Bett für sie herrichten.«
Sie hatte sich vorgestellt, dass sie durch Krankenhausflure eilen und Lydia suchen müsse, die womöglich mit Zachs Leiche hinter geschlossenen Vorhängen saß oder in irgendein den Angehörigen jüngst Verstorbener vorbehaltenes Zimmer geführt worden war. Doch kaum war Christine durch die Glastüren des Haupteingangs getreten, stand Lydia von einem der blauen Plastikstühle vor dem Empfangstresen auf, wo sie zwischen anderen Wartenden gesessen hatte. Sie hatte auch jetzt die Ausstrahlung einer missgelaunten Königin, eine hochmütige und auffällige Erscheinung in einer himmelblauen Samtjacke mit künstlichem Leopardenfell am Kragen; als Christine auf sie zulief und sie in die Arme schloss, drehten sich die Leute um und starrten sie an. Mit ihrer üppigen Figur, den honigfarbenen Locken und der prallen, schmollenden Unterlippe wurde Lydia oft für irgendeine Berühmtheit gehalten. Sie widmete ihrem Make-up und ihrer Kleidung die gebührende Aufmerksamkeit, um diesen künstlerischen, theatralischen, sexy Look zu erzielen. Ihr blasser Teint schimmerte bläulich, wie Magermilch.
»Wo bleibst du denn? Ich warte schon eine Ewigkeit!«
»Nur eine halbe Stunde. Ich musste ein Taxi rufen.«
Christine merkte, dass sie sich vor dieser Begegnung gefürchtet hatte, weil sie dachte, der Schicksalsschlag von Zacharys Tod würde Lydia irgendwie noch dominanter machen. Jetzt schämte sie sich und empfand stechendes Mitleid, denn Lydia wirkte nur fehl am Platz und verloren. Als sie die Freundin in die Arme schloss, spürte sie, wie diese sich verkrampfte, als wäre sie verletzt; Lydias schwer beringte Hände waren kalt und starr. Von nun an würde es ihre Aufgabe sein, dachte Christine, sie zu umsorgen, sie nicht im Stich zu lassen. »Ich fasse es nicht, dass sie dich hier allein gelassen haben!«
»Ich wollte allein sein. Ich habe alle weggeschickt. Jane Ogden kann ich sowieso nicht ausstehen. Es war ihr anzusehen, dass sie es gar nicht erwarten konnte, die Geschichte überall herumzuerzählen, mit ihr im Mittelpunkt des Geschehens natürlich. Ich habe gesagt, ich wolle nur dich und Alex sehen. Wo ist Alex?«
»Er ist zu Hause und richtet ein Bett für dich her.«
Christine hatte im Taxi geweint; sie hatte sich fest vorgenommen, vor Lydia nicht zu weinen, damit es nicht aussah, als würde sie deren Leid, das natürlich vorrangig war, für sich vereinnahmen. Aber jetzt fing sie wieder an, wischte sich mit einem feuchten Papiertaschentuch aus ihrem Ärmel über das Gesicht, wohl wissend, wie hässlich und dumm sie vor all diesen fremden Leuten aussah – das Gesicht rot angelaufen, der Mund hilflos offen stehend und verzogen wie bei einem Baby. »Ich kann es nicht glauben. Es kann nicht wahr sein. Bist du dir sicher?«
»Natürlich ist es wahr. Die beschissensten Sachen sind immer wahr.«
»Lyd, wo ist Zachary? Hast du ihn gesehen? War er noch am Leben, als du angekommen bist?«
»Nein, und ich will ihn auch nicht sehen. Das ist ja nicht mehr Zachary, stimmt’s? Wozu soll das dann gut sein?«
Sie sagte das ziemlich laut, und die Leute drehten sich nach ihr um. Christine beruhigte sie, sie müsse nichts tun, was sie nicht wolle. Sie wusste, dass Lydia sich vor Zacharys Leiche fürchtete, vor dem Gedanken daran zurückschreckte wie ein scheues Tier. Und es war wirklich eine schreckliche Vorstellung, dass er irgendwo allein in diesem gespenstischen, unpersönlichen Gebäude lag, das in der Nacht erleuchtet war wie ein Schiff auf dem Meer. Auch Christine fürchtete sich vor Zacharys Leiche. Beim Gedanken daran wurde ihr schlecht vor Grauen. Doch an Lydias Stelle hätte sie die Leiche wohl doch sehen, ihrer Angst eine Gestalt geben wollen. Zumindest hätte sie sich noch mehr davor gefürchtet, dass sie es hinterher bereuen würde, wenn sie es nicht getan hätte. Das war einer der Unterschiede zwischen ihnen: Lydia verhielt sich abergläubisch und ließ sich von ihren Instinkten leiten, während Christine versuchte, mit ihren Instinkten zu verhandeln.
»Lass uns hier rausgehen«, sagte Lydia.
»Musst du nicht noch irgendwelche Papiere unterschreiben?«
Sie habe bereits alles unterschrieben. Es sei eine Obduktion angeordnet worden, sagte sie.
»Und weiß Grace es schon? Wo ist sie?«
Der Gedanke an ihre Tochter versetzte Lydia in Panik. »Ich habe versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht ans Telefon. Sie ist wohl irgendwo in Glasgow unterwegs, wie das bei Studenten eben so ist. Natürlich wird sie mir die Schuld geben, du weißt ja, wie sie ihren Vater anbetet. Alles ist immer meine Schuld.«
Sie schaute Christine herausfordernd an, ob die ihre Selbstbezogenheit schockierend fand. Und Christine war wirklich schockiert: Sie war sich sicher, sie selbst hätte in so einem Fall zuerst an Isobel gedacht, hätte sie schützen wollen, hätte Isobels Verlust sogar schrecklicher gefunden als ihren eigenen. Doch zwischen Lydia und Grace hatte es in letzter Zeit Reibereien gegeben; und Lydia hatte sich schon immer halb im Scherz beklagt, sie fühle sich ausgeschlossen, weil ihr Mann und ihre Tochter so perfekt aufeinander eingespielt seien. Sie konnte sich und ihre Beziehungen nicht in einem einzigen Moment des Umbruchs neu erfinden.
»Ich dachte, vielleicht könntest du es ihr sagen«, meinte Lydia. »Du kannst so etwas besser.«
Christine wollte schon protestieren – aber du bist doch ihre Mutter –, ließ es dann aber bleiben. Wer weiß, wenn Alex etwas passiert wäre, hätte sie sich womöglich ebenso egoistisch verhalten – zum Beispiel Sandy gegenüber, Alex’ Sohn aus erster Ehe, ihr eigener Stiefsohn, den zu lieben sie sich nach Kräften bemühte. Es ist alles noch im Fluss, ermahnte sie sich. In den nächsten Stunden werden sich unsere Wahrnehmungen immer wieder rasant verändern, während wir uns auf diese neue verstümmelte Lebensform einstellen. Dabei ist es unsere ständige Pflicht, auf die von diesem Schicksalsschlag Getroffenen, auf Lydia und Grace, achtzugeben und nichts zu sagen und zu tun, was sie verletzen könnte. Dann dachte sie, aber ich bin doch auch betroffen. Wir sind alle betroffen, Alex und Isobel und ich, selbst Sandy – und die Leute in der Galerie. Ohne Zachary ist unser aller Leben in Unordnung geraten. Gerade ihn durften wir auf keinen Fall verlieren.
Auf der Rückbank des Taxis sprachen die beiden Frauen kaum ein Wort. Der Fahrer sollte nicht erfahren, was geschehen war; die Nachricht konnte noch nicht in die Welt hinaus, sie war noch in ihrem Inneren eingeschlossen, hart wie Stein. Lydia griff im Dunkeln nach Christines Hand, presste sie an ihre Samtjacke, gegen ihren Bauch, krümmte sich darüber zusammen und drückte dabei Christines Finger gegen die metallene Schnalle ihres breiten Gürtels; Christine konnte die holzigen Noten des moschusartigen Parfüms riechen, das ihre Freundin immer trug. »Hast du Schmerzen?«, flüsterte sie. Lydia nickte, ohne Christines Hand loszulassen. Sie spürten vage die Sorge des Fahrers, der dachte, sie sei betrunken und müsse sich vielleicht übergeben.
Zu Hause waren die Fenster erleuchtet, und Alex schaute nach ihnen aus. Als sie die Treppe hinaufgingen, hielt er ihnen schon die Wohnungstür auf. Er breitete die Arme aus, und Lydia wankte hinein.
»Es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein«, rief er. Lange stand er so da und streichelte ihr Haar, ebenso selbstvergessen, wie er früher Isobels Haar gestreichelt hatte, als sie noch ein Kind war, und die andere Hand streckte er nach Christine aus. »Es ist aber wahr«, sagte Lydia schließlich lapidar und machte sich frei.
Dann suchte sie nach ihrem Lippenstift, betrachtete ihre Augen in dem Spiegel aus ihrer Handtasche. »Biete ich einen grotesken Anblick? Ich sehe zum Fürchten aus.« Sie schwenkte einen Zwanzigpfundschein. »Das brauche ich jetzt, Alex, mein Schatz. Hol mir eine Schachtel Bensons.«
Er protestierte. »Lydia, Zigaretten sind nicht das, was du jetzt brauchst. Du willst dich doch nicht wieder in diese Abhängigkeit begeben, nach so vielen Jahren.«
»Du weißt nicht, was ich brauche, du mit deiner puritanischen Moral. Egal, Jane Ogden hat mir ihre gegeben, fällt mir gerade ein. Sie sind irgendwo hier drin.«
»Wir brauchen einen Drink«, sagte Christine.
Sie schenkten sich Wodka aus einer Flasche im Kühlschrank ein; mit gebrochener Stimme brachte Alex einen Trinkspruch auf ihren lieben Freund aus. Innig geliebt, sagte er, dann konnte er nicht weiterreden.
»Sei still, Alex«, sagte Christine zittrig. »Du hörst dich an wie ein Schuldirektor.«
Er konnte sich nicht setzen, wollte sich nicht setzen, als wäre er so aufgebracht, dass er unbedingt stehen bleiben müsste. Lydia zündete sich mit bebenden Händen eine Zigarette an. Sie beschwerte sich, der Wodka schmecke wie Gift. Ob sie denn keinen Rotwein hätten? Alex holte eine Flasche Wein für sie und schenkte ihr eilfertig ein. Als sie noch einmal versuchen wollte, Grace anzurufen, und wünschte, Christine würde mit ihr sprechen, war er entsetzt. Er erklärte mit Bestimmtheit, sie könnten ihr den Tod ihres Vaters doch nicht einfach am Handy mitteilen.
Lydia fügte sich, düster. »Natürlich, du hast recht.«
Er werde nach Glasgow fahren, Grace ausfindig machen und es ihr selbst sagen. Schließlich sei er ihr Patenonkel. Ihr inoffizieller Patenonkel, es war nichts Kirchliches. Wenn er jetzt losführe, wäre er am frühen Morgen da. »Zach hat ihre Adresse bestimmt irgendwo aufgeschrieben«, sagte Lydia. »Wo, weiß ich nicht. So etwas weiß immer nur er.«
Alex rief Hannah an, die Geschäftsführerin der Galerie, die mit Zachary im Rettungswagen zum Krankenhaus gefahren war. Sie sagte, sie werde in der Galerie vorbeischauen, die Adresse müsse irgendwo in Zacharys Schreibtisch liegen oder auf seinem Telefon gespeichert sein, sie werde Alex in einer halben Stunde eine SMS schicken. Hannahs Stimme war vom Weinen belegt. Alex bat sie, sich mit allen in Verbindung zu setzen, die von der Sache wussten, damit sie es unter Verschluss hielten, bis er Grace gefunden und es ihr gesagt hatte. »Stell dir vor, sie würde das auf Facebook erfahren.«
»Unter Verschluss halten«, murmelte Christine. »Ich kann’s nicht glauben, dass er das wirklich gesagt hat.«
Er schritt energisch zwischen den Lampen umher, während er das alles arrangierte; die Frauen, benommen und zusammengesunken, waren ihm im Grunde dankbar. Er war furchtlos und kompetent, er wusste, was zu tun war. Christine sollte am Morgen die Schule anrufen, an der er arbeitete, und sein Fortbleiben erklären. Bevor er aufbrach, küsste er beide Frauen, berührte ihre Gesichter auf seine vertrauliche Art mit den Fingerspitzen. Aber ihnen war auch klar, dass es ihn nach Bewegung verlangte, dass er den Gedanken nicht ertragen konnte, mit ihnen dort in der Wohnung zu sitzen, während sie über ihren Kummer nachsannen und ihn dabei weiter schürten.
Alex war tatsächlich einmal Schuldirektor gewesen, an einer örtlichen Grundschule, wo die Kinder 32 verschiedene Sprachen sprachen und zu 48 Prozent Anspruch auf ein kostenloses Schulessen hatten. Als er die Direktorenstelle bekam, schien dies das natürliche Ziel seiner Karriere als fortschrittlicher Lehrer zu sein, der die Kinder begeistern konnte und von ihnen angebetet wurde. Doch in Wirklichkeit war er auf dem Posten unglücklich gewesen, nach drei Jahren wieder zu seiner Arbeit als Lehrer einer Klasse von Neunjährigen zurückgekehrt und hatte es nie bereut. Unter seiner weltläufigen, einnehmenden Oberfläche war Alex gar kein Öffentlichkeitsmensch wie Zachary. Er war zu unduldsam, wenn er auf Widerstand stieß, und trieb seine Gegner damit in eine erbitterte Opposition. Im Grunde war er ein einsamer Denker, der an den meisten seiner Kollegen kein Interesse hatte. Selbstverständlich lief seine Vision für die Schule – der zufolge alle Kinder Denker und Künstler waren – der staatlichen Bildungspolitik zuwider. Sie widersprach der Art, wie die Welt eingerichtet war. Und im Gegensatz zu Zachary war Alex nicht überzeugt, dass Fortschritt möglich war oder dass man jede Institution dauerhaft zu einer Macht ausbauen konnte. Da war ein Widerspruch, dachte Christine, zwischen seiner leidenschaftlichen Skepsis und seinem Engagement für die Kindererziehung. Er glaubte nicht daran, dass irgendetwas besser werden konnte, und war oft der Verzweiflung nahe – und doch widmete er sich mit ganzer Kraft der Entwicklung und Förderung der kindlichen Phantasie, als hinge die Hoffnung davon ab. Manchmal, wenn sie sich über ihn ärgerte, dachte sie auch, er vergesse seine Schüler in dem Moment, in dem sie die Klasse verließen.
Wenn Lydia in Christines Wohnung war, nahm sie immer die gleiche Stellung ein, an einem Ende des Sofas, auf dem Alex vorhin sein Buch gelesen hatte. Im rosafarbenen Lampenschein lehnte sie sich so in die Kissen zurück, dass ihre sinnliche Schönheit zur Geltung kam. Zachary hatte gesagt, sie posiere wie eine Odaliske. Christine wollte sich dicht neben sie setzen, sie berühren, konnte es aber nicht: Irgendetwas hielt sie davon ab. Weil Lydia verzweifelt war, stellte sie eine übertriebene Ruhe zur Schau. »Wird das mein Ende sein?«, fragte sie, wobei sie sich eine neue Zigarette anzündete. »Hat Zachary mich definiert, bestimmt, wer ich bin? Ich glaube das nicht. Aber vielleicht muss ich jetzt umdenken. Mir vorzustellen, was ich ohne ihn wäre – die Mühe habe ich mir nie gemacht. Ich habe nie etwas ohne ihn getan, seit Jahren nicht. Ich bin überhaupt nicht kompetent. Ich weiß nicht, wie man Steuern zahlt. Ich kann nicht Auto fahren.«
»Ach, Lyd, mach dir darüber jetzt keine Gedanken«, sagte Christine. »Natürlich bist du kompetent. Das ist nicht dein Ende.«
»Warum nicht jetzt? Wir sollten jetzt über alles reden. Ich glaube, dieser Moment kommt nicht wieder. Als Nächstes wird sich alles zu seiner endgültigen Form verhärten. Wir vergessen, wie Zachary wirklich war.«
»Das vergessen wir nicht.«
»Ich fange schon an ihn zu vergessen. Etwas anderes tritt an seine Stelle: die ganze Vorstellung von seinem Tod, die so unglaublich ist. Er war nicht der Typ zum Sterben. Der Tod verdrängt bereits die wahren Empfindungen davon, was er war. Ich versuche zum Beispiel, mich an ihn heute beim Frühstück zu erinnern. Was hat er gegessen?«
»Was hat er denn normalerweise gegessen?«
»Als ich nach unten kam, noch im Morgenrock, hatte er schon Bagels gekauft, an die hundert Dinge erledigt. Du weißt, dass er morgens wie energiegeladen aus dem Bett springt, es ist so anstrengend. Er wacht auf und singt. Wenn man nicht so gepolt ist, wenn man ein Nachtmensch ist, kann das zermürbend sein. Wir hatten frische Bagels zum Kaffee. Er hat seine dick mit dieser besonderen Butter aus der Bretagne bestrichen, die er immer kauft, die mit den Salzkristallen drin, dann noch hausgemachte Marmelade vom Bauernmarkt obendrauf, hat alles im Stehen gegessen, seinen Kaffee runtergestürzt, immer in Eile. Kein Wunder, dass er einen Herzanfall hatte. Ich habe ihn gewarnt, ich habe ihn ständig gewarnt.«
Ihre Blicke trafen sich, sie waren entsetzt über die verlorene Unschuld dieses Frühstücks, als sie daran dachten, dass er jetzt für immer ruhte.
»Chris, er war so stark. Wie konnte das passieren?«
»Ja, ich weiß – ich weiß, wie stark er war.«
Wie um das Endgültige von sich fernzuhalten, begannen sie Zacharys gesamte Schwächen aufzuzählen. »Er war nicht perfekt«, sagte Lydia. »Wir dürfen nicht vergessen, dass er einfach er selbst war und kein Traum.«
»Niemand ist perfekt.«
»Er war laut und er hat viel geredet, als wüsste er über alles Bescheid – dabei war das häufig nur Bluff. Er hat zu viel getrunken, und dann war er unausstehlich; wenn er betrunken war, wurde man nicht aus ihm schlau.«
»Er hat alles Unangenehme unter den Teppich gekehrt«, sagte Christine. »Manchmal war er sentimental, er wollte alles zu hoffnungsvoll sehen.«
Lydia saß ganz still, ihr Gesicht war weiß. »Für mich war das schwierig, weißt du. Manchmal war er nämlich bequem, er wollte der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen.«
»Aber genau deshalb ergänzt ihr zwei euch so perfekt!«, beharrte Christine hitzig – als wollte sie die Ehe ihrer Freundin retten, statt sie über ihren Verlust zu trösten. Dann wurde ihr klar, dass dies für immer der letzte Tag war, an dem Zachary lebendig gewesen war, und der sollte nicht zu Ende gehen. Doch als sie auf die Uhr sah, war es schon nach Mitternacht.
»Sag mir, wenn du schlafen willst«, redete sie Lydia sanft zu. »Das Bett ist fertig gemacht. Ich setz mich zu dir, wenn du möchtest.«
»Ich kann nicht!« Lydia erschauerte. »Stell dir vor, ich wache auf, und dann das. Jetzt komme ich damit zurecht, weil ich ganz aufgedreht bin, aber ich glaube, ich kann es nicht ertragen, das alles von mir abfallen zu lassen und dann wieder von vorn anfangen zu müssen. Außerdem warte ich auf Grace. Ich muss doch für sie wach bleiben. Ich weiß ja, dass ich eine miserable Mutter bin. Ab jetzt muss ich mich bessern.«
»Aber sie ist nicht vor morgen Mittag hier, frühestens.«
Lydia rauchte eine Zigarette nach der anderen, schaute zwischen den Zügen das brennende Ende an und hustete. »Eigentlich will ich mir das Rauchen nicht wieder angewöhnen. Ich habe das nur getan, um Alex zu ärgern.«
Sie machten eine neue Flasche auf, und bald waren Lydias Lippen und Zähne vom Rotwein blau. Schließlich legte sie sich doch schlafen, und am frühen Morgen hörte Christine sie weinen und ging im Pyjama ins Gästezimmer, setzte sich zu ihr aufs Bett. Lydia ergriff ihre Hand und zog sie unter der Bettdecke wieder an ihren Bauch, der heiß, verspannt und hart war. »Ich spüre es hier drinnen«, sagte sie. »Es ist ein Schmerz, ein entsetzlicher Schmerz. Aber Liebe ist es nicht. Dir muss ich die Wahrheit sagen, sonst niemandem. Anders kann ich es nicht ertragen. Du weißt, dass es keine Liebe ist, nicht wahr?«
Grace war am Ende ihres dritten Jahrs als Kunststudentin, eine sehr begabte Bildhauerin in Stein und Holz. Alex fuhr die ganze Nacht und kam bei Tagesanbruch in Glasgow an. Er schlief eine Stunde im Auto, dann suchte er im ersten Morgenlicht die Adresse, die Hannah ihm gegeben hatte. Die Stadt wirkte auf ihn wie ein Totenreich – hinter der schwarzen Kathedrale ragte eine viktorianische Nekropole auf, in einem riesigen Krankenhaus brannten alle Lichter. Grace teilte sich mit anderen Studenten ein Haus über einem Laden an der Southside von Glasgow; vor allen Ladenfenstern waren Rollläden aus Metall heruntergelassen. Inzwischen war es sieben Uhr. Die Haustür lag neben dem Ladeneingang, die Klingel funktionierte nicht; Alex hämmerte mit der Faust dagegen, nicht laut, aber beharrlich, unnachgiebig; nach einiger Zeit hörte er drinnen auf der Treppe Schritte, und ein Junge kam zur Tür, auf Unannehmlichkeiten gefasst. Alex sagte, er müsse Grace sprechen, es sei wichtig, ein Krankheitsfall in der Familie. Grace sei vermutlich nicht da, erwiderte der Junge. Er werde in ihrem Zimmer nachsehen. Nein, sie sei letzte Nacht auf einer Party gewesen und nicht nach Hause gekommen.
»Was für eine Party? Wo?«
Alex fuhr dahin, wo die Party stattgefunden hatte – dort war Grace auch nicht. Er bahnte sich einen Weg durch eine apokalyptische Szene, in Schlafsäcken zusammengerollte Leiber zwischen dem Partymüll; ein Mädchen, das in der Küche Eier briet, erinnerte sich, dass Grace mit irgendwem von der Party weggegangen war. Sie schaute Alex zögerlich an, bevor sie ihm Näheres erzählen wollte. »Sie können sie doch auf dem Handy anrufen«, meinte sie. Er erklärte, dass jemand aus Grace’ Familie krank geworden sei und sie das umgehend erfahren müsse, er sei extra aus London hergefahren, um es ihr persönlich mitzuteilen. Dann machte er sich zu einem wieder anderen Haus auf, jemand ließ ihn herein und rief nach Grace, die im oberen Stock schlafe. Alex ging hinauf, um sie zu suchen. Es war ihm egal, was er dort sah, obwohl er zu jeder anderen Zeit Grace’ Privatsphäre respektiert hätte. Sie schlief in einem beengten kleinen Zimmer auf einer Matratze auf dem Fußboden, die Bettdecke über den Kopf gezogen; er erkannte sie an ihrem dichten schwarzen Wuschelkopf. Sie und ihr Freund von letzter Nacht schliefen, ohne sich zu berühren, einander den Rücken zugekehrt, der des Jungen von Pickeln übersät. Es stank nach ihren Körpern, nach Zigarettenrauch und Sex. Vor dem geschlossenen Fenster hing ein dicker Vorhang; Alex öffnete das Fenster und setzte sich dann neben dem Matratzenlager auf den Fußboden, um zu warten, bis Grace aufwachte. Unter seinem starren Blick schlug sie die Augen auf, ihr Atem schal vom Schlaf. Als sie ihn erkannte, setzte sie sich abrupt auf. »Was machst du denn hier, Alex?«
Sie rappelte sich auf allen vieren hoch, wich vor ihm zurück an die Wand, als wollte sie die Flucht ergreifen; sie sah ihrem Vater so ähnlich, dass es ihm fast die Sprache verschlug. Das schmutzig weiße T-Shirt bedeckte ihre Blöße nicht. Sie war knabenhaft schlank, und das borstige dunkle Schamhaar sah genauso aus wie Zacharys. Ihre Schönheit war nicht von der Art, die Alex bei Frauen begehrenswert fand, zu forsch; sie hatte diese Forschheit schon als kleines Mädchen gehabt, und das hatte einen schmerzhaften Beschützerinstinkt in ihm geweckt, da er um die Folgen ihrer Unverblümtheit und Unbefangenheit fürchtete. Zu seiner Erleichterung war seine eigene Tochter Isobel zurückhaltend und feminin, konnte gut auf sich aufpassen. Grace war groß und kräftig gebaut, muskulös durch ihre Arbeit mit harten Werkstoffen; ihre kleinen Brüste waren nur Punkte unter dem T-Shirt, und ihr Kopf war wohlgeformt, von geradezu klassischen Proportionen, fast schon androgyn; ihr drahtiges Haar wuchs sich zu einer dichten Masse von Schwarz aus. Unter normalen Umständen besaß sie einen trockenen Humor. Sie und Alex konnten meist wunderbar scherzen, wenn sie zusammenkamen.
»Wer ist das?«, fragte der Junge und streckte hilfsbereit die Hand nach Grace aus, doch sie schüttelte ihn ab, schlug nach ihm, was Alex zeigte, dass er ihr nichts bedeutete. Dieser mit der Situation völlig überforderte Junge mit dem rötlichen Stoppelbart war eindeutig ein Fehlgriff gewesen.
»Würden Sie uns bitte allein lassen?«, sagte Alex. »Ich habe ihr etwas mitzuteilen.«
Grace hielt sich die Ohren zu. »Nein, nein, sag’s mir nicht. Ich will es nicht wissen! Ich will es nicht hören!«
Der Junge war verwirrt. »Was soll das alles?«
»Es tut mir so leid, meine liebste Grace«, sagte Alex.
»Erzähl’s mir nicht!«, rief sie.
Hinterher sagte sie, sie habe es gewusst, sobald sie die Augen aufgeschlagen und sein Gesicht gesehen habe. »Du solltest dein Gesicht sehen, Alex. Es verrät alles. Und natürlich, wenn jemand anders gestorben wäre, wäre Dad gekommen, um es mir zu sagen.«
Auf der Fahrt nach Hause hielt sie ihren kleinen Rucksack auf den Knien und war ganz sie selbst: Sie schaute aus dem Fenster, nahm alles auf, stellte ihm vernünftige Fragen danach, was passiert war. Er wiederholte ihr alle schon zum Mythos werdenden Einzelheiten über Jane Ogdens neue Ausstellung, Zacharys Umkippen in der Galerie, sein Aufschlagen mit dem Kopf auf dem Schreibtisch. »Aber warum, aber warum?«, fragte Grace, wobei sie durch die Windschutzscheibe starr geradeaus sah, sich kaum wahrnehmbar vor und zurück wiegte, wie ein Kind, und den Rucksack umklammerte, den sie nicht auf den Rücksitz oder auf den Boden legen wollte. Irgendwann verkündete sie, sie sterbe vor Hunger, und sie hielten an einer Autobahnraststätte. Sie verspeiste mit allen Anzeichen gesunden Appetits ein ekelhaftes Zeug – ein komplettes englisches Frühstück; kurz darauf, als sie wieder auf der Autobahn waren, musste er schnell auf den Seitenstreifen fahren. Sie sprang aus dem Wagen und übergab sich in das mit Gänseblümchen durchwachsene hohe Gras, das in sinnlichen Wellen im Wind schwang.
»Das war melodramatisch«, sagte sie, als sie wieder neben ihm saß und sich den Mund abwischte. »Tut mir leid.«
»Melodrama ist derzeit angesagt«, antwortete er. »Tu einfach, wonach dir ist.«
Die Rückfahrt schien doppelt so lange zu dauern wie die Fahrt nach Glasgow. Grace drehte am Radio herum, fand irgendwo Popmusik, und Alex nahm das hin, denn er verstand, dass ein Gespräch für sie schwierig war. Dann holte sie ihr Handy hervor und verschickte SMS. »War das dein neuer Freund?«, fragte er.
»Um Himmels willen, nein«, sagte sie. »Nur so ein Typ, den ich auf einer Party kennengelernt habe.«
Er wollte sie ermahnen, sie solle sich von Typen fernhalten, die sie auf Partys kennenlernte, sie gehöre in eine höhere Sphäre, weil sie ein ganz besonderes, seltenes Wesen sei. Aber dafür war jetzt nicht der rechte Moment. Stattdessen sprach er von seinem eigenen Vater, der gestorben war, als Alex etwa in ihrem Alter war. Grace wiegte sich weiter in ihrem Sitz und hörte aufmerksam zu, obwohl sie vermutlich kaum einen Zusammenhang sah zwischen dem, was ihr jetzt widerfuhr und ihr Leben aus den Angeln hob, und seiner alten, von der Zeit abgeschliffenen Geschichte.
Als er endlich vor der Wohnung parkte, sah er, wie sie sich bei der Aussicht auf die Begegnung mit ihrer Mutter – oder überhaupt einem anderen Menschen – verkrampfte. Als er sie berührte, war der Muskelknoten in ihrem Nacken eisenhart. Oben in der Wohnung war es, als hätten die Frauen sich nicht von der Stelle gerührt, seit er sie verlassen hatte: Lydia an ihrem Stammplatz auf dem Sofa, Christine – die jetzt ein dunkles, marineblaues Kleid trug, vielleicht die unbewusste Wahl einer Trauerfarbe – in dem großen Sessel. Sie wich seinem Blick aus – in Ausnahmesituationen versteckte sie sich lieber hinter ihrer gewohnten Ironie. In dem dunklen Kleid wirkte ihr Gesicht eingefallen, das Fleisch schlaff. Womöglich hatte sie gar nicht geschlafen. Sie tranken nun Kaffee statt Alkohol, das war die einzige Veränderung – und Isobel war dazugekommen, sie stand am Kaminsims, ihrem Spiegelbild in dem vergoldeten Spiegel den Rücken zugewandt, und wartete ruhig und bekümmert. Als Grace hereinkam, noch immer ihren Rucksack umklammernd, ging sie direkt auf Isobel zu, die ihre Arme ausbreitete. Die beiden jungen Freundinnen verhielten sich so spontan in ihrem Leid, dass ihre Mütter daneben wie erstarrt wirkten.
Es hing eine unerträgliche Erwartung in diesem Raum, in dem Zachary eine Leere hinterlassen hatte, die nicht zu füllen war. Noch vor so kurzer, so greifbar naher Zeit hätten sie darauf warten können, dass er zur Tür hereinkam; sie konnten sich lebhaft vorstellen, konnten sich ausmalen, wie er unter lautstarken Beruhigungen hier eintrat, scherzend, ganz verwirrt von ihren bedrückten Gesichtern. Er war doch immer über alles auf dem Laufenden, hatte immer so viele Neuigkeiten zu verkünden. Es schien unmöglich, dass er nichts von dieser neuesten Nachricht wusste, seinem eigenen Tod.
»Wo ist Dad?«, fragte Grace. »Ich will ihn sehen.«
Lydia versuchte ihr das auszureden. »Das ist nur sein leerer Körper, Liebling, er selbst ist nicht mehr da.«
»Ich liebe seinen Körper. Ich will mich von ihm verabschieden.«
Dann kündigte Grace an, dass sie eine Totenmaske anfertigen wolle, damit sie später das Gesicht ihres Vaters in Stein meißeln könne. »Ich habe das auf dem ganzen Weg von Glasgow hierher geplant«, sagte sie. »Ich weiß, wo ich erfahren kann, wie man das richtig macht. Ich kenne jemanden, den ich fragen kann.«
»Als wäre das alles noch nicht grotesk genug«, sagte Lydia schaudernd.
»Wir sollten nichts überstürzen«, versuchte Alex zu beschwichtigen. »Lasst uns darüber nachdenken.«
Es werde wohl eine Obduktion geben müssen, meinte er.
»Ich würde gern bei der Obduktion dabei sein«, erbot sich Grace prompt.
»Das ist nicht möglich, mein Liebes«, erwiderte er kategorisch. »Nicht möglich und auch nicht wünschenswert.«
Christine stellte Essen auf dem Küchentisch bereit, aber alle wollten nur Kaffee, den sie tranken, bis er giftig schmeckte. Am Nachmittag begann das Telefon zu klingeln und hörte nicht wieder auf: Freunde, die etwas gehört hatten, oder Künstler, mit denen Zachary gearbeitet hatte und die sich diese Nummer besorgt hatten. Mit Zacharys Bruder hatte Lydia bereits gesprochen, aber es gab noch viele andere, die informiert werden mussten. Alex trug das Telefon nach nebenan ins Arbeitszimmer; wieder und wieder, geduldig bei jedem neuen Schock, musste er die Geschichte erzählen, wie Zachary im Büro umgekippt war und Jane Ogden und Hannah mit ihm ins Krankenhaus gefahren waren. Im Wohnzimmer konnten ihn alle hören. Während er sprach, saßen sie schweigend da, als müssten sie die Geschichte immer wieder hören, mit jedem Anrufer das Staunen neu erleben. Grace hockte, die Stirn an die Knie gelehnt, auf dem Boden; Isobel saß dicht neben ihr auf dem Sofa, die Hand auf Grace’ Haar. Die Mädchen standen sich seit ihrer Kindheit sehr nahe, obwohl sie grundverschieden waren: Grace in ihrer atemberaubenden jungenhaften Schönheit schroff und unbedacht, Isobel stets ausgeglichen und zurückhaltend. Sie hatte als Beamtin im Wohnungswesen blitzschnell Karriere gemacht. Ihre grünen Augen lagen weit auseinander, ihre Haut war rein, ihr hellbraunes Haar zu einem weichen Knoten aufgesteckt.
»Ich habe mich wegen der Maske erkundigt.« Alex hockte sich vor Grace hin und fasste ihre Hände. »Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Warte ab, wie du morgen früh darüber denkst.«
»Das meiste findet man im Internet«, sagte Grace. »Aber ich muss noch mit jemandem sprechen, der weiß, wo man den richtigen Gips herbekommt.«
»Habe ich dabei nicht auch ein Wort mitzureden?«, fragte Lydia.
»Wartet doch erst mal ab, wartet erst mal ab«, begütigte Christine.
Lydia wollte über Geld reden. Ob Zachary eine Lebensversicherung gehabt habe? Sie habe keine Ahnung, um all das habe immer er sich gekümmert. »Wie kannst du nur?«, sagte Grace. Als Lydia sich mit einer Schlaftablette in ihr Bett im Gästezimmer zurückgezogen hatte, versuchte Christine Grace zu erklären, warum sich ihre Mutter so ungeschickt benahm. »Das brauchst du mir nicht zu sagen«, erwiderte Grace und schob sich die Locken mit beiden Händen aus der Stirn, als würde ihr das beim Denken helfen, sodass sich ihre herben Gesichtszüge unverhüllt zeigten. »Ich hab’s begriffen. Ich verstehe das.«
Grace und Isobel machten sich auf den Weg zu Isobels Wohnung in Queen’s Park, wo Grace übernachten würde – es waren nur zwanzig Minuten mit dem Bus, sie beteuerten, sie wollten nicht hingefahren werden und bräuchten auch kein Taxi. »Ich will normal sein«, sagte Grace. Am Abend würden sie zum Essen zurückkommen, damit sie alle wieder beisammen wären. Als sie fort waren, nahm Christine eine Lasagne aus dem Tiefkühlfach. Dann stand sie ein paar Minuten allein unter dem schrägen Dach ihres Schlafzimmers. Nein, es war nicht wie ein Stein, dieses Leid, das über sie hereingebrochen war: Ein Stein war kalt und still, man konnte ihn einkreisen, doch dieser Schmerz schwoll in ihrem Inneren an und ebbte wieder ab, um dann erneut unkontrollierbar anzuschwellen; sie fühlte sich hilflos angesichts seiner Gewalt, ihr gewohntes Ich zerstört und verloren, das Innere nach außen gestülpt. Sie rief mit gedämpfter Stimme nach Alex, er möge nach oben kommen. Sie sprachen flüsternd miteinander. »Hast du etwas dagegen, wenn ich kurz für eine halbe Stunde rausgehe, während Lydia schläft? Hast du ein Auge auf sie? Ich muss mich bewegen.«
Er berührte mitfühlend ihr Gesicht; das Fleisch unter ihren Augen war vom Weinen und vor Müdigkeit geschwollen. In Krisenzeiten war Alex stark, und sie verließ sich auf ihn; es war eine Form von Trägheit, ein praktisches Arrangement zwischen ihnen. Und ihm war es auch recht, dachte sie, ab und zu in die Rolle des Beschützers zu schlüpfen. Weder sie noch Lydia waren konventionelle Persönlichkeiten, sie bezeichneten sich als Feministinnen, doch in ihren Beziehungen zu Männern hatten beide ein Muster gewählt, das fast so aussah wie die Ehe ihrer Mütter, abhängig und behütet; sie führten ihr heimliches Leben in dem Schutzpanzer der Weltgewandtheit und Kompetenz ihrer Ehemänner. Jetzt war Lydias Panzer aufgebrochen worden, und sie stand ungeschützt da, allein.
Christine trug nicht oft Make-up, aber heute wollte sie ihr Gesicht nicht ungeschminkt draußen zeigen. Als die Schublade ihrer Frisierkommode klemmte, bekam sie einen Wutanfall und zerrte so heftig daran, dass die Schublade herausflog und ihren blödsinnigen Inhalt verstreute. Sie sah sich das Durcheinander an, dann hockte sie sich hin, um alles aufzusammeln – die Eyeliner, Haarspangen, Lidschatten, Cremetuben, Beutel mit Enthaarungscreme, Verdauungspastillen, längst nicht mehr benötigten Verhütungsmittel – sogar ein paar alte Tampons aus der Vergangenheit, die Papierhüllen zerfleddert und schmierig. Eine schmutzige, fettige Pulverschicht vom Boden der Schublade legte sich auf den wollenen Teppich.
Auf der Straße ging es Christine besser. Sie sog die teerhaltige, verpestete Stadtluft ein, spürte die Hitze der Automotoren an den Beinen und die harten Pflastersteine unter den Füßen, betrachtete ein Schaufenster nach dem anderen in all seinen plastischen Einzelheiten: Ballen mit afrikanischen Stoffen, Reihen von bunten Lackfläschchen im Nagelstudio, Gläser voller zinnoberroter Paprikaschoten auf den Regalen des polnischen Lebensmittelladens. All das verschaffte ihr Erleichterung: die unpersönlichen festen Formen der Welt, die auch ohne Zachary bestehen bliebe, ohne Glück, ohne sie.
»Ich habe einen wirklich unpassenden Kerl gefickt«, gestand Grace Isobel im Bus.
»Wen?«
»So einen schmutzigen Typen, Dan, ein Freund von einem Freund, ich hab ihn auf einer Party kennengelernt. Als wir in seiner Wohnung ankamen, war ich schon wieder nüchtern und nicht mal scharf auf ihn, aber da hatte ich keinen Bock mehr, den ganzen Weg nach Hause zu gehen. Und rate mal, wo Alex mich gefunden hat? Ist das nicht grandios? Ich erfahre im Bett eines schmutzigen Typen, den ich nicht mal ficken wollte, vom Tod meines Vaters.«
Isobel zuckte nicht mit der Wimper; mit all ihrer Gelassenheit widmete sie sich der Aufgabe, Grace innerlich Halt zu geben, sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ihre Gedanken in die rechten Bahnen zu lenken – wobei sie sich allerdings fragte, wie viele Fahrgäste im Bus das mit anhörten. »Wenn du sagst ›schmutzig‹ …«
»Ich meine nicht schmutzigen Sex. Der Sex war nichts Besonderes, soweit ich mich erinnern kann. Ich meine richtigen Schmutz, richtig an seinem Körper. Er roch so, als hätte er sich schon eine Weile nicht mehr gewaschen.«
»Irgendwann wirst du das lustig finden.«
»O ja, saukomisch. Erzähl bloß Sandy nichts davon, ja?«
»Ich erzähle Sandy nie etwas.«
»Er darf nicht wissen, dass ich so ordinär bin.«
»Du bist nicht ordinär, du bist der am wenigsten ordinäre Mensch, dem ich je begegnet bin. Du bist einfach« – Isobel suchte nach dem passenden Wort – »eine Abenteurerin. Bei allem, was du tust. Wie ein Forscher, der sich auf unbekanntes Terrain vorwagt. Ich wünschte, ich wäre mehr wie du. Ich wünschte, ich wäre nicht so vorsichtig.«
Tränen quollen unter Grace’ Lidern hervor, als sie sich wegdrehte und aus dem Busfenster starrte; sie wirkte verzweifelt. »Weiß Sandy Bescheid?«, beharrte sie. »Ich meine, weiß er von Dad? Hat es ihm jemand gesagt? Ist er immer noch mit dieser Italienerin zusammen?«
Isobel sagte, ihre Mutter habe Sandy angerufen; vielleicht komme er am Abend vorbei. Soweit sie wisse, sei die Sache mit der Italienerin aus.
»Glaubst du, er kommt?«, fragte Grace. »Sollen wir ihn nicht anrufen? Nur zur Sicherheit?«
»Wenn er kann, wird er da sein.«
Isobel begriff, dass Grace diese altbekannte Geschichte – von ihrer langen, verzehrenden, unerwiderten Leidenschaft für Sandy, Isobels Halbbruder – vor allem deshalb aufwärmte, um nicht mehr an ihren Vater denken zu müssen. Als sie in der Wohnung ankamen, lief Grace herum und stieß bei allen Neuerungen kleine Schreie aus – Isobel hatte die Küche neu gestrichen, auf eBay ein Ercol-Sofa gekauft. Die kleine Wohnung war eigentlich nichts Besonderes – die Räume waren niedrig und die Küche ein schmaler Schlauch –, aber Isobel hatte sie so eingerichtet, dass sie luftig und behaglich wirkte. Auf dem Sofa, das auch als Gästebett diente, lagen allerlei hübsche Kissen. Grace öffnete den Kühlschrank – randvoll mit Gemüse vom Bauernmarkt – und dann den Kleiderschrank, als ob sie etwas suchte. Isobel kaufte liebend gern Kleider, aber sie hatte einen zurückhaltenden Geschmack, trug Röcke, Strickjacken und flache Schuhe. Grace trug Vintage, schlampige Armeehosen oder dramatisches Satin und wechselte ständig den Look, als wäre ihre Erscheinung eine immerwährende Kunstausstellung.
»Es ist alles so ruhig hier. Blumen auf dem Tisch. Das gibt mir Ruhe«, sagte sie und strich über die blauen Skabiosenblüten. »Mal was anderes als mein schäbiges Studentenleben.«
»Zu ruhig«, sagte Isobel. »Ich könnte einen Mann gebrauchen, der ein bisschen Unordnung macht.«
»Einen schmutzigen Mann.«
»Einen richtig schmutzigen Mann. Gracie, willst du das wirklich machen mit der Totenmaske?«
»Findest du das zu bizarr? Es ist makaber, nicht wahr? Ich schau mir mal Totenmasken auf deinem Laptop an.«
»Sei vorsichtig, sei bitte vorsichtig. Du weißt nicht, was du da zu sehen bekommst.«
Isobel wich ihr nicht von der Seite, schaute ihr über die Schulter, während Grace einige Masken – die von Oliver Cromwell und Blaise Pascal – fand, dann ein paar Websites von Bestattungsunternehmen und dann ein Foto aus dem späten 19. Jahrhundert, das die Anfertigung einer Totenmaske in einem an eine Barbierstube erinnernden Raum zeigte. Die Gesichter der lebendigen Männer auf dieser herrlichen alten, silbrigen Aufnahme waren markant und von Trauer erfüllt, verklärt in der Hingabe an ihre Arbeit. »Siehst du«, sagte Grace. »Das ist doch etwas Schönes. Es ist würdevoll.«
Isobel hatte immer noch Bedenken. »Aber ich glaube trotzdem nicht, dass du das machen könntest, nicht bei deinem eigenen Vater. Ich glaube, das ist zu persönlich.«