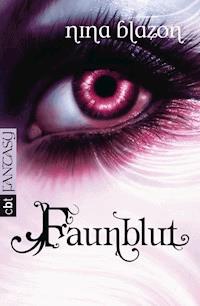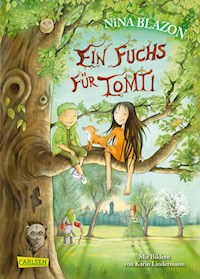7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erst stiehlt sie sein Herz, dann seine Welt ...
Der 17-jährige Jay ist in der Stadt seiner Träume angelangt – ein Jahr wird er als Austauschschüler in New York, der Heimat seines verstorbenen Vaters, verbringen. Gleich zu Beginn verliebt er sich in die geheimnisvolle Madison mit den Indianeraugen. Doch was er keinem zu erzählen wagt: Hin und wieder taucht ein anderes Mädchen auf, das außer ihm niemand zu sehen scheint. Sie nennt sich Ivy und er kann nicht aufhören, an sie zu denken. Bis sie ihn schließlich in eine verwunschene Welt entführt, die seit Jahrhunderten kein lebender Mensch betreten hat. Als auch im New York der Gegenwart die Geister und Dämonen erwachen, beginnt für Jay ein Kampf auf Leben und Tod. Der Dämon mit dem Herzen aus Eis ist ihm auf der Spur und giert nach menschlichen Seelen. Und Jay muss sich entscheiden – zwischen zwei Mädchen, zwei Leben, zwei Wirklichkeiten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Nina Blazon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2011 für die deutschsprachige Ausgabe cbt/cbj Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Hanna Hörl Designbüro München, unter Verwendung eines Motivs von Valentina KalliasKK · Herstellung: AnGLektorat: Susanne EvansSatz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-05658-2V003
www.cbt-jugendbuch.de
Teil I – New York, New York
Das Haus Der Träume
Und er atmet wirklich?«, fragte Mo.
»Wäre ziemlich seltsam, wenn nicht«, antwortete Night trocken. »Schlafende Menschen atmen für gewöhnlich. Auch wenn man es bei dem da kaum sieht.«
Sie ließ den Blick über das Lager des Jungen schweifen, dann gähnte sie und streckte sich genüsslich. Im Rechteck des Fensters konnte Mo die Silhouette ihrer Freundin vor dem Nachthimmel gestochen scharf erkennen: die kräftigen Arme und die Hände, die erst zitternd vor Spannung in der Luft verharrten und sich dann, beim Herabsinken, zu lockeren Fäusten ballten. Night bemerkte Mos Blick, drehte sich zu ihr um und grinste. Ihre schwarze Haut verschmolz mit dem Halbdunkel des Zimmers. Dafür blitzten ihre Zähne umso heller. »Brauchst keine Angst vor ihm zu haben, Mondmädchen«, sagte sie. »Zumindest nicht, solange ich in der Nähe bin.«
»Ich habe keine Angst«, erwiderte Mo leise.
Aber die ganze Wahrheit war es natürlich nicht.
»Gut, wir haben ihn uns angeschaut«, flüsterte Cinna aus der anderen Ecke des Zimmers. »Jetzt lasst uns wieder gehen Ich finde es unheimlich hier.«
Night lachte. »Im Augenblick kann er uns nichts tun.«
Mit diesen Worten ging sie geradewegs zum Bett. Ihre Finger schlossen sich um das Handgelenk des Schlafenden. Er reagierte nicht darauf, als sie seinen Arm anhob, aber Mo wich unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Du wirst ihn noch aufwecken«, zischte Cinna.
Night ließ die Hand einfach los. Sie fiel auf die Brust des Jungen und blieb dort liegen. Atemlos starrten Mo und Cinna den Schlafenden an, aber er regte sich nicht.
»Seht ihr?«, sagte Night trocken. »Wir können ihn nicht wecken. Ich wette, ich könnte sogar auf seiner Brust herumtanzen, er würde es nur für einen schlechten Traum halten. Doch vermutlich schläft er ohnehin so tief, dass er ebenso wenig träumt wie ein Toter.«
Cinna wirkte nicht so, als würde diese Vorstellung sie beruhigen.
»Na gut«, meinte Night. »Ihr habt ihn ja gesehen. Die Lektion ist einfach: Wenn ihr einen von denen da findet, haltet euch weg von ihnen und hört nicht auf die Stimmen. Sie sind gefährlicher als die Gespenster, vergesst das nicht. Keine Regel von der Ausnahme. Und jetzt lasst uns abhauen. Die anderen warten ohnehin schon auf uns.«
Sie wandte sich von dem Jungen ab, huschte zum Fenster, zog sich mit einem geschmeidigen Schwung auf das Fensterbrett und von dort aus auf einen Ast des Baumes, der vor dem Haus stand. Sie mochte drei Leben alt sein, aber beim Klettern machte ihr immer noch keiner etwas vor.
Cinna trat ebenfalls zum Fenster. Nur Mo verharrte reglos neben der Zimmertür. Der ganze Raum war erfüllt von Träumen. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie sie sogar hören – dünne Stimmen, die von Dingen erzählten, die ihr fremd waren.
»Hör nicht auf die Stimmen«, wiederholte sie flüsternd Nights Ermahnung. Aber es war kaum möglich, das verlockende Wispern zu ignorieren.
Mitschüler. Motorrad. Werkstatt. Austauschjahr.
Sie fröstelte und riss die Augen wieder auf. Cinna hatte recht. Es war unheimlich, in einem Haus zu verweilen, in dem sich Träume wie in einem Spinnennetz fingen und im Todeskampf herumzappelten. Und noch weniger durfte sie diesen Traumworten lauschen. Auch ohne Nights Warnung hätte sie gespürt, dass diese Worte besondere Kräfte hatten, sie konnten einen verführen, schläfrig und willenlos machen und ins Verderben stürzen.
Andererseits – da war immer noch dieser Junge, von dem sie sich fernhalten musste.
Im Licht des Vollmonds war die Farbe seines Haares nicht eindeutig zu erkennen. Jedenfalls war es dunkler als das von Mo. Ihres war zudem glatt, seines dagegen ungezähmt und halblang. Eine Locke berührte seine Wimpern. Vielleicht waren seine Haare im Tageslicht braun, vielleicht schimmerten sie aber auch in einem satten Rot – so wie bei ihrer Schwester Cinna.
Mo schluckte und wagte einige Schritte ins Zimmer.
Jetlag, Foto, Brüder, Zweiherz, wisperte es. Mutter, Anruf, Abschied.
Als wäre sie nun doch in das klebrige Netz fremder Gedanken getappt, konnte sie nicht anders, als stehen zu bleiben.
Selbst im Liegen fiel auf, dass der Junge groß und muskulös war. Und staunend nahm sie wahr, dass sie ihn auf eine herbe Weise hübsch fand. Spannung lag auf seinen Zügen, seine Augenbrauen waren leicht zusammengezogen und sein Mund war fest verschlossen, als wollte er ein Wort festhalten, das ihm im Traum entflohen war.
Draußen raschelte Blattwerk, Zweige knackten. Night kletterte gerade am Baum in Richtung Boden. Das letzte Stück überbrückte sie mit einem Sprung. Mo hörte einen raschelnden Aufprall, dann die tiefen, rauen Stimmen von Coy und Ban. Die beiden hatten vor dem Haus gewartet, jetzt begrüßten sie Night. Irgendwo weit entfernt bellte ein Tier.
»Kommst du endlich?« Ihre Schwester saß auf dem Fensterbrett und wartete voller Ungeduld. Die Spiegelung des Monds fing sich in ihrem rechten Auge – eine flirrende helle Insel in einem dunklen See. »Beeil dich. Es wird schon bald hell.«
Mo wollte gehorchen und setzte sich in Bewegung. Der Boden war hart und kalt, ganz anders als die federnde Erde der Wälder. Sie ertappte sich dabei, wie sie schlich, ängstlich darum bemüht, den Untergrund so wenig wie möglich zu berühren. Sie war schon fast beim Fenster, als sie nicht mehr widerstehen konnte und sich doch noch einmal umsah. Es war seltsam, aber den Jungen zu betrachten, war, wie mit offenen Augen in den Mond zu blicken. Beruhigend, sanft – und in ihrem Inneren flatterte etwas Warmes, Helles, irgendwo zwischen Brust und Kehle.
»Was denkst du, Cinna, sehen seine Augen aus wie meine? Oder hat er blaue Wendigo-Augen?«
»Warum interessiert dich das?«
»Ich … weiß nicht. Ich will es einfach wissen.«
Ihre Schwester schnaubte nur verächtlich.
»Glaubst du, er träumt vielleicht doch?«, fragte Mo weiter.
»Die träumen doch alle«, gab Cinna ungeduldig zurück. »Und wir haben dann die Gespenster dieser Träume am Hals. Am besten bitten wir Ban, ihm das Genick zu brechen, dann haben wir eine Sorge weniger.«
»Nein!« Mo wich zum Lager des Jungen zurück und stellte sich schützend vor ihn.
Ihre Schwester lachte. »War doch nur Spaß, Bernstein. Glaubst du im Ernst, der Alte würde den da anfassen wollen? Glaub mir, er hält nichts von Menschenfleisch.«
Mo schauderte dennoch. Natürlich war ihr das Schicksal von Menschen völlig gleichgültig, aber die Vorstellung, dass diesem einen hier etwas geschehen könnte, löste eine nie gekannte Unruhe in ihr aus.
»Und jetzt komm«, schnappte Cinna. »Ich hasse diese Gegend, ich kann Häuser nicht ausstehen. Und dieses hier ist eine richtige Fallgrube voller Träume. Als würde der Kerl da drüben sie einfangen und sammeln.« Jetzt konnte sie kaum noch verbergen, wie viel Furcht sich hinter ihrer Grobheit verbarg.
Aber Mo hatte sich bereits vom Fenster abgewandt und schlich auf leisen Sohlen zum Lager zurück. Der tiefe Schlaf machte den Jungen wehrlos. Und dennoch – so nah war sie noch keinem Menschen gekommen. Furcht flirrte über ihre Haut, ein sachter Schauer von Gefahr – und auch ein Hauch von Tod. Die wispernden Stimmen wurden deutlicher, raunten und lachten. Es schienen freundliche Worte zu sein.
Handy. Frühstück. Onkel. Dreamcatcher.
Mo gab ihm nach, nur einen Moment – und schon trieb sie schwerelos und staunend in diesem Strom fremden Lebens. Der Junge holte tief Luft, und Mo ertappte sich dabei, wie sie es ihm gleichtat. Ein paar Atemzüge atmeten sie im Gleichtakt und es war wie eine eigene Magie.
Ob seine Haut warm ist?
»Mo, nicht!«
Aber heute gehorchte sie der Älteren nicht. Obwohl sich alle Härchen an ihrem Körper sträubten, ließ sie sich unendlich vorsichtig neben dem Jungen nieder. Sacht, als könnte ihre Gegenwart ihn tatsächlich wecken, legte sie sich neben ihn. Der erstickte Entsetzenslaut ihrer Schwester beunruhigte sie nicht. Dafür fühlte sich seine Nähe viel zu sicher an – und auf eine fremde Weise richtig. Mutiger geworden – und natürlich auch, um Cinna noch etwas mehr zu ärgern – schmiegte sie sich an den Jungen und lehnte ihre Stirn gegen die pochende Stelle direkt unter seiner Kieferlinie. Ihr wurde so schwindelig, dass sie die Augen schließen musste. Mit leisem Rascheln fuhren ihre Wimpern über seine Haut. Es musste ihn kitzeln, aber er erwachte nicht.
Er duftete nicht nach Gewitter und sonnenwarmen Blättern, sondern nach etwas Frischem, nach Tau und Verheißung. Schatten der Träume, die durch seinen Schlaf irrten, spiegelten sich hinter ihren geschlossenen Lidern. Es waren ruhelose, grelle Erinnerungen an Tageslicht und einen blauen Himmel, an Stahl und Glas und Mädchenlachen.
Mädchen.
Das gab ihr einen Stich. Und auch diesmal wusste sie nicht, warum. »Er träumt tatsächlich«, murmelte sie verwundert. »Von einem Mädchen, das er kennt. Sie hat langes schwarzes Haar und etwas, das er Indianeraugen nennt. Er mag sie, sehr sogar. Er spielt mit anderen Menschen, um einen runden Gegenstand, es ist kein Schädel und auch kein Stein. Und da ist auch ein gelber Kojote. Nein, es ist ein … Hund? Er ruft ihn bei einem Namen. Feathers. Und er …«
»Mo, pass auf!« Der schrille Schrei schreckte sie auf.
Sie riss die Augen auf, machte sich gewaltsam aus der Umklammerung der Traumbilder los, bereit, aufzuspringen und zu flüchten. Aber es war zu spät. Ein Arm legte sich über ihre Brust, ihre Schulter. Der Junge umarmte sie!
»Night!« Panik verzerrte Cinnas Stimme. »Er ist aufgewacht und greift Mo an!«
Der Junge hörte sie nicht. Im Schlaf drehte er sich ein weiteres Stück zur Seite. Nun lagen sie Brust an Brust, Mo in seinen Armen. Sie spürte ihre Herzen schlagen – seines ruhig und stark, ihres vor Schreck flatternd wie ein gefangener Fink. Seine Lippen waren nicht länger zusammengekniffen, nein, sie wirkten sanft und schienen sogar lächeln zu wollen.
»Er wird sie töten!«, kreischte Cinna. Aber ihre Stimme klang so weit weg, dass Mo kaum noch unterscheiden konnte, was sein Traum und was ihre Welt war.
»Hör auf zu schreien, Cinna«, murmelte sie. »Er tut mir doch gar nichts, er hat sich nur im Schlaf umgedreht. Er weiß nicht einmal, dass ich da bin.«
In diesem Moment blinzelte der Junge und schlug die Augen auf.
Zweige brachen draußen unter dem Gewicht von Nights Körper. Nachtvögel flatterten auf. Aber Mo hörte nichts mehr. Sie staunte nur noch. Ihrer beider Atem vermengte sich zu einem einzigen Strom, während sie einander ansahen. Mondlicht fiel auf sein Gesicht und brachte sein rechtes Auge zum Leuchten. Es war ganz sicher kein Wendigo-Blau und auch nicht das Goldbraun ihrer eigenen Iris. Der Junge hatte helle, vielleicht grüne Augen. Er sah sie verwundert an – und dann lächelte er.
Ihr Herz machte einen Satz, doch dann begriff sie, dass er mit offenen Augen träumte. Er meint gar nicht mich, er sieht das Mädchen. Die Schöne mit den Indianeraugen.
Er schloss die Augen, der Arm glitt von ihr herunter, seine Finger strichen dabei abwesend über ihren Hals und kamen schließlich auf seinem Schlüsselbein zur Ruhe.
»Hol sie da weg, Night«, rief Cinna. »Schnell!«
Mo drängte sich näher an ihn, suchte nach seinem Herzschlag, seinem Leben, seinen Träumen.
Im nächsten Moment gruben sich starke Finger schmerzhaft in ihren Oberschenkel. Night hatte sie mit beiden Händen am Bein gepackt. Der Atem blieb ihr weg, als die Älteste sie einfach vom Lager zerrte. »Lass mich!«, fauchte sie.
»Nicht bevor du wieder zur Vernunft kommst!«
Mo trat und biss um sich, stemmte sich mit aller Kraft gegen den Griff, aber Night war viel stärker als sie. Es polterte, als Mo vom Lager glitt und unsanft auf dem harten Boden aufkam. Dann wurde sie über den Boden zum Fenster geschleift. Sie wollte gerade protestieren, als ihr die Luft wegblieb. Nights Arme schlossen sich um ihren Leib und ihren Hals. Sie riss Mo einfach hoch und hob sie über das Fensterbrett. »Nicht!«, rief Cinna entsetzt aus.
»Bist du verrückt?«, keuchte Mo. »Du kannst mich doch nicht …«
»Glaub mir, ich bin nicht halb so verrückt wie du«, gab Night zurück und ließ sie fallen.
Mo konnte nicht schreien. Viel zu tief saß der Schreck. Instinktiv versuchte sie noch im Fallen einen Zweig zu schnappen, doch sie glitt ab. Wind zerrte an ihrem Haar, sie spürte kaum, wie sie sich in der Luft drehte, verzweifelt darum bemüht, wenigstens auf den Beinen zu landen. In ihrem Augenwinkel huschte der Vollmond in einem bizarren Bogen davon – dann bremste ein weicher und doch harter Schlag ihren Fall. Alle Luft wurde aus ihren Lungen gedrückt, und ihre Stirn pochte, weil sie gegen eine Schulter geprallt war. Doch nun ruhte sie sicher in einer starken Umarmung.
»Hallo, Mo.« Bans tiefe Stimme dicht an ihrem Ohr. »Lernst du fliegen?«
Sie strampelte und trat um sich, entwand sich ihm und sprang zur Seite. Schwer atmend und mit zitternden Beinen stand sie da.
Coy musterte sie amüsiert. Sein hageres Gesicht mit den gelben Augen hatte im Mondlicht einen besonders verschlagenen Ausdruck.
»Kleiner Streit mit der Dunklen?«, meinte er. »Musst sie ja ganz schön geärgert haben, wenn sie dich gleich aus dem Fenster wirft.«
Im selben Augenblick landeten Night und Cinna im raschelnden Laub.
»Bist du wahnsinnig?«, schrie Cinna. »Mo hätte sich alle Knochen brechen können!«
»Besser ein paar gebrochene Knochen als Menschenmagie«, gab Night hart zurück. »Habe ich euch nicht gerade erklärt, wie die Regeln lauten?«
»Du wolltest ihn uns doch unbedingt zeigen«, rief Mo. »Warum schleppst du uns zu ihm, wenn du solche Angst vor ihm hast?«
Nights Augen hatten das gefährliche dunkle Funkeln bekommen, das normalerweise sogar Mo verstummen ließ.
»Ich wollte, dass ihr lernt, Grünschnäbel. Deshalb habe ich ihn euch gezeigt. Ihr solltet lernen, wann es ungefährlich ist, sich ihnen zu nähern. So, wie ich euch beigebracht habe, dass man niemals, niemals! an ihre Träume rührt.«
»Was hat sie denn getan?«, wollte Coy wissen.
»Angefasst hat sie ihn«, stieß Night hervor.
Ban richtete sich auf. Bisher hatte er die Auseinandersetzung so ruhig wie immer verfolgt, nun aber trat er neben Night. Sie war groß, aber neben ihm wirkte sie winzig. Sein rundes, gutmütiges Gesicht schien mit einem Mal fremd. Schattige Augenhöhlen, in denen etwas zu kleine dunkelbraune Augen glänzten.
»Ich berühre, wen und was ich will«, sagte Mo. »Außerdem hat Night damit angefangen.«
»Ich weiß ja auch, wie ich mit ihnen umgehe«, wies Night sie scharf zurecht. »Ich bin alt genug, um mich gegen die Träume zu schützen. Aber ihr nicht, ihr seid jung, gerade mal einen Sommer alt, ihr kennt die Gefahr noch nicht. Und außerdem«, ihre Stimme sank zu einem drohenden Flüstern. »Wenn er aufwacht, bin ich stärker als er.«
Mo schauderte. Night wusste, wie man tötete, und sie verschwendete nicht viele Gedanken an das Für und Wider. Und das, was Mo vorher lediglich als Ahnung wahrgenommen hatte, wurde plötzlich ganz klar: Sie hatte Angst um den Jungen! Und sie wollte zurück in das Zimmer, zu seinem Duft nach Tau und Verheißung.
Cinna schien diese Sehnsucht zu spüren, sie warf ihr einen irritierten Blick zu, aber dann trat sie neben Mo. Nun standen sie Schulter an Schulter und boten gemeinsam den zwei Ältesten die Stirn. So war es immer, wenn sie Streit hatten: Ban und Night auf der einen Seite, beide dunkel, beide stark und auf gefährliche Art ruhig. Auf der anderen die hellen Schwestern. Coy stand wie immer etwas abseits, abwartend und beobachtend, ohne eine Partei zu ergreifen, bevor er wusste, wer aus dem Machtkampf als Sieger hervorgehen würde.
»Das Erschreckende ist, er hätte sich gar nicht bewegen dürfen«, sagte Night. »Keine Ahnung, wie du es fertiggebracht hast, aber du hättest ihn beinahe aufgeweckt.« Und noch leiser fügte sie hinzu: »Ich weiß, dass ihr den Menschen näher steht als wir. Aber ich wusste nicht, dass ihr tatsächlich zu ihnen vordringen könnt.«
Ban blickte zum Fenster hoch. Es war ein Blick, der Mo gar nicht gefiel. »Das klingt nicht gut«, meinte er. »Wenn es so ist, müssen wir gleich dafür sorgen, dass er nie mehr …«
»Wage es nicht, ihn anzurühren«, schrie Mo. Der Zorn wallte so jäh in ihr auf, dass sogar der Mond dunkler zu werden schien.
Night und Ban starrten sie an, als sei sie nun endgültig verrückt geworden. Selbst Coy war so verblüfft, dass er sich eine spöttische Bemerkung sparte. Irgendwo in der Nähe bekämpften sich zwei Kater fauchend und jaulend.
Vielleicht bin ich ja tatsächlich verrückt, dachte Mo. Doch es fühlte sich … richtig an.
»Was ist los mit dir?«, fragte Ban.
»Nichts ist los! Ich habe nur genug von euch. Genug von dem Gerede über Gefahr. Und genug von deinen Belehrungen, Night.«
Bans Augen verengten sich und Nights Hände ballten sich zu Fäusten. Mo war sicher, dass sie gleich ein Schlag von den Beinen holen würde. Auch Cinna hielt den Atem an, aber sie wich keinen Schritt. Und obwohl Mo vor Angst bebte, war sie unendlich froh, dass ihre Schwester immer zu ihr hielt. Und nicht nur das: Cinna konnte viel besser bluffen als Mo.
»Es reicht«, sagte sie erstaunlich gelassen. »Ihr treibt sie nur in die Enge, und ihr wisst, dass ihr sie damit am wenigsten davon abhalten könnt, zu tun, was sie will.« Und zu Mo gewandt, fügte sie hinzu: »Und du gibst auch Ruhe. Wir gehen zum Fluss.«
Noch einige Sekunden starrte Ban sie nachdenklich an. Und dann war es entschieden.
»Komm«, sagte er zu Night. »Die Rote hat recht. Der Hitzkopf wird sich schon wieder abkühlen.« Er wandte den Blick ab und schickte sich an zu gehen.
Night zögerte, aber dann wich die Spannung aus ihren geballten Fäusten. Sie atmete durch und folgte Ban, der bereits fast außer Sichtweite war.
Coy stand noch eine Weile da, unschlüssig, wem er folgen sollte, dann schloss er sich natürlich den beiden Ältesten an.
»Komm«, raunte Cinna. Und Mo gehorchte.
Beim letzten Blick über die Schulter sah sie, wie Night sich ebenfalls umdrehte, als wollte sie sich vergewissern, dass die Schwestern wirklich nicht zum Haus zurückkehrten. Dann verlor sich ihre Silhouette in der Dunkelheit.
Cinna und sie nahmen den Weg in Richtung Fluss, sie liefen Schulter an Schulter, aber sie sprachen kein Wort. Erst als sich schon der Geruch von Wasser in ihren Nasen fing, blieb Cinna stehen und funkelte Mo an. »Was ist vorhin passiert? Was ist so wichtig an ihm, dass du dich mit den Ältesten anlegst und ihnen sogar drohst?«
Mo schluckte. »Ich weiß es nicht. Er … war mir so nah. Night erzählt uns immer, dass sie verwirrt und wertlos sind und nichts wissen über die Welt. Aber ich habe so vieles mit seinen Augen gesehen. Auch, dass er geflogen ist.«
»Trug! Menschen können nicht fliegen.«
»Doch. Er kam über den Himmel hierher. Er konnte wie ein Adler von oben auf das Land und auf das Meer blicken. Er stammt aus einem anderen Land, in dem die Sonne in der Nacht aufgeht und der Mond am Tag scheint. Und außerdem«, sie senkte ihre Stimme zu einem Wispern, »hattest du recht. Er sammelt Träume! In flachen, eckigen Behältern. Darin sind sie als runde silberne Mondscheiben aufbewahrt. Das Licht dieser Scheiben flackert dann über eine helle Wand. Wie Mondschein, nur bunt und hell, und mit schattenhaften, riesigen Bildern.«
Cinnas Augen wurden vor Entsetzen groß. »Er ist so was wie ein Traumfänger?«
»Vielleicht.«
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«
»Warum wohl? Weil ich nicht will, dass Ban ihm etwas tut.«
Cinna starrte sie fassungslos an. »Warum beschützt du ihn?«
Mo antwortete nicht, dennoch huschte die Erkenntnis über Cinnas Züge. Und dann die nackte Angst. »Er gefällt dir!«, brachte sie mühsam heraus.
Mo schwieg immer noch. Wie hätte sie Cinna auch sagen können, was sie selbst erst in diesem Moment begriff: Ja, und ich muss ihn wiedersehen.
»Night hat recht«, stieß Cinna hervor. »Du bist verrückt. Und du übertreibst immer! Du bist leichtsinnig, greifst nach jeder Schlange, und jede Schneeflocke, jedes Blatt lenkt dich ab, du bringst dich in Gefahr …«
»Ich war nicht in Gefahr«, beharrte Mo. »Und es kann doch nicht die Antwort sein, ihnen das Genick zu brechen. Wie können wir wissen, was es wirklich mit ihnen auf sich hat, wenn Ban und Night jeden, der wach ist, einfach umbringen?«
Ihre Schwester fluchte, dann drehte sie sich um und huschte davon. Einen Wimpernschlag später war sie im Dickicht verschwunden. Mo seufzte. Es war typisch für Cinna, die Flucht zu ergreifen, wenn die Furcht zu stark wurde.
Sie kämpfte gegen den Sog an, der von dem Jungen und dem Haus voller Träume ausging, dann aber widerstand sie und folgte ihrer Schwester.
Sie fand sie auf dem Dach eines Gebäudes, fast schon am Fluss. Es war ein würfelförmiges, altes Gebäude, ebenfalls aus braunem Sandstein, mit morschem Dach. Der Vollmond umspielte Cinnas Mondgestalt. Lange, schlanke Glieder, weiße Haut und Haar, das zwar tiefrot war, aber auch einen sanften zimtfarbenen Schimmer hatte, der Cinnamon ihren Namen gab.
Jemand, der uns heute sieht und flüchtig hinschaut, könnte uns für Menschen halten, dachte Mo. Und Cinna weiß das ganz genau. Vielleicht fürchtet sie sich deshalb so sehr?
Auf leisen Sohlen balancierte sie an der Dachkante entlang und ließ sich neben ihrer Schwester nieder. Cinna regte sich nicht, sie starrte, ohne zu zwinkern, auf die andere Seite des Flusses, aber ihr schneller Atem verriet, wie aufgewühlt sie war.
»Als er sich bewegte, dachte ich, er würde dich töten«, sagte sie nach einer Weile. Ihre Stimme bebte und das Zittern darin schien sich auf Mo zu übertragen. Manchmal, besonders in Vollmondnächten, fühlten sie einander auf diese Weise.
»Ich weiß«, antwortete Mo und musste sich räuspern.
»Jag mir nie wieder eine solche Angst ein!«
Mo senkte den Blick und nickte. Behutsam tastete sie nach Cinnas Hand. Ihre Finger fanden sich und verflochten sich ineinander, eine ungewohnte Berührung, die dennoch guttat.
»Sieh dir das an.« Cinna deutete mit einer lässigen Geste über den Fluss.
Ein seltsamer Turm erhob sich dort. Gedrungen war er und unglaublich hoch, oben verjüngte er sich und lief in eine lange Spitze aus, die von hier aus gesehen wie ein dünner Eiszapfen wirkte, der nicht nach unten hing, sondern zu den Sternen wies. Das ganze oberste Stück dieses Turmes erstrahlte vor dem Nachthimmel in einem gleißenden weißen Schein.
Eine Weile saßen sie nur blinzelnd da und bestaunten dieses auffälligste Zeichen der Menschen an diesem Ort.
»Warum gefällt das Licht ihnen nur so gut? Es schwächt den Mond und die Sterne. Die Nacht ist nicht mehr so dicht.«
»Night sagt, sie mögen die Dunkelheit nicht«, erwiderte Mo. »Sie sagt, manche können nicht einmal ertragen, wenn welche von ihnen dunkel sind. Schon dunkle Haut erinnert sie an die Nacht, vor der sie sich fürchten.«
Cinna verzog die Lippen zu einem verächtlichen Lächeln. »Sie fürchten sich vor allem, sagt man. Feiglinge.«
»Was, wenn sie gar nicht feige sind?«
»Wie meinst du das?«
Mo schluckte und leckte sich über die Lippen. Eine Geste der Verlegenheit und des Zauderns, die sie immer wieder selbst überraschte. Ich muss ihn wiedersehen. Diese Worte waren wie ein Zauber. Selbst der Turm schien noch heller zu strahlen. So, als würde die Menschenwelt ihr Einlass gewähren, sie locken und zu sich ziehen.
»Na ja, ich überlege nur … was, wenn ich ihn wirklich aufwecken und mit ihm sprechen könnte? Ihn kennenlernen und …«
»Mo!«
Wenn sie lange genug hinsah, konnte sie erahnen, dass der Turm Fenster hatte und hinter den Fenstern Menschen waren. Und der Wind schien wispernde Stimmen mit sich zu tragen, die den Namen des Turmes flüsterten: Empire State…
»Sieh nicht hin!«, befahl ihr Cinna. »Sieh mich an! Du redest wie eine Mondsüchtige.«
»Aber vielleicht haben wir beide ja die Macht dazu. Und Night und Ban ahnen nichts davon. Oder vielleicht wissen sie es ja und wollen es nur nicht wahrhaben, dass unsere Magie stärker ist als ihre und …«
Cinna schnappte nach Luft und sprang auf. Im nächsten Moment zuckte Schmerz durch Mos Wange. Empört schrie sie auf und kam auf die Beine. Der Abdruck von Cinnas Hand brannte auf ihrer Wange. Ihre Schwester packte sie bei den Schultern und zwang sie, sich von der Flussseite abzuwenden. »Hör auf damit«, schrie sie.
»Du gibst mir keine Befehle!« Mo entwand sich mit einer heftigen Bewegung, aber ihre Schwester war größer als sie und sie wusste besser zu kämpfen. Ehe Mo es sich versah, war sie zum zweiten Mal in dieser Nacht in zwei starken Armen gefangen.
»Du versprichst mir, dass du keine Dummheiten machst«, zischte Cinna. »Versprich mir, dass du nicht mehr zu dem Haus gehst. Ich spüre doch, dass du daran denkst!«
Doch dann schrie sie auf und ließ los. Auf ihrem blassen Unterarm zeichneten sich Zahnabdrücke ab, ein kleiner Kranz von Vertiefungen, die bald wieder verschwunden sein würden.
Mo sprang zurück. Die scharfe Dachkante bohrte sich in ihre Sohlen.
Cinna starrte sie fassungslos an. Dann drehte sie sich um und ließ Mo einfach stehen.
»Cinna, warte!«
Das morsche Dach knirschte unter ihren Sohlen, als Mo ihrer Schwester folgte. Auf allen vieren landete sie ebenfalls im trockenen Herbstlaub. Schwer atmend verharrte sie mit gespannten Gliedern. Für einige Momente hatte sie den Jungen vergessen, aber nun war da wieder dieses Ziehen, diese Sehnsucht. Alles in ihr drängte sie dazu, zu ihm zu laufen. Doch der andere Teil wusste nur zu genau, dass sie ihrer Schwester folgen würde. Folgen musste.
Also schloss sie nur kurz die Augen und rief sich sein Gesicht ins Gedächtnis. Den Mund, das Lächeln und die Augen, die das andere Mädchen sahen, wenn er träumte.
»Ich komme morgen wieder zu dir«, flüsterte sie. »Ich habe dich umarmt. Du gehörst mir.«
Indianeraugen
Jay hatte gedacht, er hätte den Jetlag längst überstanden, aber der schrille Piepton einer SMS belehrte ihn eines Besseren. Mühsam kämpfte er sich aus seinem wirren, flüchtigen Traum hoch. Tja, das war ganz neu: Er dämmerte jetzt also auch mitten am Tag weg, als hätte er den Zeit- und Weltensprung immer noch nicht verkraftet. Ich bin wach, alles okay. Aber das Wachsein fühlte sich nicht viel anders an als sein Minutenkoma: als wären seine Gedanken pulsierende Zerrbilder, die sich aufblähten und wieder zusammenzogen. So musste es sich anfühlen, wenn man niedergeschlagen worden war und irgendwo aufwachte, ohne die geringste Ahnung, wie man dorthin gekommen war. Womit er auch schon bei der nächsten Frage war: Wo bin ich?
Es roch nach Papier, das sprach gegen sein Zimmer. Sein Nacken war verspannt, seine Wange lag auf etwas Hartem. Als er benommen den Kopf hob, löste sich ein Blatt, das an seiner Lippe haftete, und segelte zu Boden. Linoleumboden. Ziemlich schäbiges Grau. Das Wiedererkennen kam nur langsam, ein sachliches Sammeln von Koordinaten: rechts ein Getränke-automat, daneben eine Glastür, Tische und mintgrüne Plastikstühle, die bestimmt noch aus den Achtzigern übrig geblieben waren. Ein paar Schüler an den anderen Tischen, amerikanische Satzfetzen. New York, Williamsburg, dachte Jay. Highschool, fünfter Tag. Ich sitze im Aufenthaltsraum, den sie hier »Common« nennen, und gleich beginnt meine Arbeitsstunde mit der Projektgruppe. Willkommen in meinem neuen Leben.
Ein Mädchen aus seinem Mathekurs grinste ihm vom Nebentisch aus verschwörerisch zu, während es seinen Rucksack über die Schulter hängte, aber die anderen schienen sein Minutenkoma nicht bemerkt zu haben. Zum Glück waren die Mädchen aus seinem Kurs noch nicht da. Jays Blick fiel auf die Tischplatte. Sie war total vollgekritzelt. Bestimmt zeichneten sich auf seiner Wange jetzt in Spiegelschrift die Worte Barney sucks! ab, die irgendein Schüler in die Tischplatte gekratzt hatte. Klasse. Verlegen rieb er sich über die Wange, dann bückte er sich und hob das Blatt auf. Ein Paar Sneakers kam in sein Blickfeld. Schätzungsweise Größe 48. Zumindest hier wusste er sofort, wen er vor sich hatte.
»Hi Alex«, sagte er und richtete sich auf. Alex grinste. Auch heute hätte er als Hochglanzreklame für irgendein Sportler-College durchgehen können. Manche seiner Mitschüler hätten alles dafür getan, um in sein Team zu kommen, aber Alex machte keine große Sache daraus. Eitelkeit schien ihm völlig fremd zu sein und genau deshalb mochte Jay ihn.
»Und? Bist du dabei?« Alex deutete auf die Spielerliste in Jays Hand.
Jay musste sich räuspern, so rau fühlte sich sein Hals an. Vermutlich waren das immer noch die Nachwirkungen von der Klimaanlage im Flugzeug, vielleicht lag es aber auch daran, dass Onkel Matt der Meinung war, eine funktionierende Heizung sei etwas für Weicheier.
»Klar«, brachte er dann mit heiserer Stimme hervor.
Alex grinste noch etwas breiter und beugte sich vor. »Gut. Ich hoffe, du hast Kondition. Bei mir wird nämlich richtig gespielt.«
Jay zog nur ironisch den Mundwinkel hoch.
Alex verstand die Geste – Herausforderung angenommen – und nickte. »See you, Kraut«, sagte er mit gespielter Arroganz.
Kraut – ein leicht abfälliger Begriff für Deutscher. Was fast schon wieder lustig war in Anbetracht der Tatsache, dass Jays Freunde in Deutschland ihn The Aminannten, wenn sie ihn aufziehen wollten.
»Bis dann, Bone Crusher«, antwortete er ruhig.
Alex war nur eine Sekunde verblüfft, dass Jay den Spitznamen kannte, den seine Mannschaft ihm nach dem Beinaheunfall beim letzten Spiel gegeben hatte. Dann lachte er und klopfte zum Abschied auf den Tisch.
Jay blickte ihm nach. Es tat gut, zur Abwechslung mal nicht der Einzige zu sein, der durch seine Größe auffiel. Er faltete die Liste zusammen und schob sie in die hintere Tasche seiner Jeans. Irgendwo neben ihm plärrte Musik los, ein Klingelton, der an seinen Nerven zerrte. Immer noch war es ein Gefühl wie Watte im Kopf. Genervt blickte er nach rechts und sah, wie einer der Freshmen – ein Neuntklässler – sein Handy hervorzog. Beim Anblick des leuchtenden Displays fiel Jay die SMS wieder ein. Hastig holte er sein Handy hervor. Doch sofort bereute er, das Ding nicht ausgeschaltet zu haben.
Ruf mich verdammt noch mal an!!! C.
Das Unbehagen flammte so schnell auf, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Wow, der Knopf aufs schlechte Gewissen funktionierte sogar über sechs Stunden Zeitunterschied und rund sechstausend Kilometer Entfernung. Er warf einen Blick auf die Uhr über der Tür. Kurz nach zehn. In Berlin war es jetzt also vier Uhr morgens. Allein die Vorstellung, dass Charlie jetzt wach war, machte ihn fertig. Er konnte sie vor sich sehen – bestimmt saß sie gerade in ihrem roten Bademantel auf dem Sofa, mit verheulten Augen und dem harten, wütenden Zug um den Mund, der sie so unglücklich aussehen ließ. Tja, wie weit musste man wohl fortgehen, um diesem Bild zu entfliehen?
»Schlechte Nachrichten, Jay?«
Jay steckte reflexartig sein Handy weg. Vor ihm stand seine Arbeitsgruppe aus dem Fach Geschichte. Drei Mädchen aus seiner Jahrgangsstufe.
»Alles okay«, erwiderte er. »Müssen wir schon los?«
Die Wortführerin, Jenna, ließ sich auf einen Stuhl neben ihm fallen. Wie immer trug sie Schwarz und hatte dunkel umrandete Augen, was sie ein bisschen Gothic aussehen ließ. »Der Raum ist erst um Viertel nach zehn frei. Mann, du siehst völlig kaputt aus!« Sie wuchtete einen Stapel Bücher auf die Kritzeleien. Barney sucks! verschwand unter einem Geschichtsbuch.
»Nur der Jetlag«, krächzte Jay. Seine Kehle war plötzlich noch viel trockener. Und die amerikanischen Worte schienen in seinem Hirn zu flimmern und ihm entwischen zu wollen.
Jenna grinste. »Ich habe gehört, du spielst vielleicht in Alex’ Team?«
Das hatte sich schnell herumgesprochen. Und offenbar brachte Alex ihm Pluspunkte ein. Zusammen mit der Tatsache, dass Mädchen ihn ohnehin mochten, und dem Exotenbonus, der deutsche und dazu noch einzige Austauschschüler an dieser Schule zu sein, ergab das ein ganz ordentliches Plus auf der Skala der interessanten Mitschüler. Zumindest bei Jenna und ihrer Freundin. Beide lächelten ihn erwartungsvoll an. Nur die dritte in der Gruppe, Madison, blätterte in ihren Unterlagen und beachtete ihn kaum. Was schon wieder ausreichte, um ihn nervös zu machen, und nicht gerade dabei half, sich in einer fremden Sprache besonders flüssig auszudrücken.
»Es ist nur ein Training«, erklärte er. »Und dann sehen wir weiter. Vielleicht spiele ich ja doch lieber Soccer.«
»Aber auf der Fete morgen bist du aber auf jeden Fall dabei, oder?«
Jay nickte und bemühte sich, nicht in Madisons Richtung zu blicken, aber natürlich nahm er auch heute alles gestochen scharf wahr: ihr langes schwarzes Haar, das glatt und kräftig war und nur von einigen dünnen Zöpfen durchschnitten wurde, den bronzefarbenen Hautton, die hohen Wangenknochen und die schräg geschnittenen Augen, die den Eindruck von Fremdheit noch verstärkten. Indianeraugen, dachte Jay fasziniert. Aber es war nicht nur ihr Aussehen, sondern auch die Tatsache, dass sie so sparsam mit ihrem Lächeln umging. Oder dass sie mich auch nach vier Tagen praktisch ignoriert.
Immer noch konnte er sich keinen Reim auf sie machen. Bei Facebook war sie nicht, und wenn er Jenna glauben durfte, besaß sie nicht einmal ein Handy. Allein das reichte normalerweise schon aus, um als Freak abgestempelt zu werden, aber keiner behandelte sie so.
»Hast du die Kopien gemacht?«, wollte Sally nun wissen. Neben Jennas rauchdunkler Stimme wirkten ihre Worte wie Vogelgezwitscher. Und auch sonst war Sally das genaue Gegenteil von Jenna: klein, rötlich blond, mit Sommersprossen. Wenn sie mit Jungs sprach, die sie mochte, schraubte sich ihre Stimme noch eine Oktave höher. In Jays Gegenwart hörte sie sich an wie Minnie Mouse.
Jay langte nach seinem Rucksack. Er legte den Stapel Arbeitsblätter auf den Tisch und Sally griff danach und begann sie auf dem Tisch zu sortieren. Geschichtsdaten und Jahreszahlen reihten sich vor Jay auf, das Ganze würde eine Art Referat mit Präsentation über die Sezessionskriege werden. Langweiliges Thema, aber darum war es ihm bei der Anmeldung gar nicht gegangen.
Sein Handy begann anklagend zu surren. Eine neue SMS – und gleich darauf eine zweite und eine dritte. Wenn Klingeltöne wütend klingen konnten, dann machten diese hier unmissverständlich klar, dass Charlie stocksauer war. Endlich hatte er das Handy in seiner Tasche gefunden und schaltete es hastig aus. Natürlich taten ihm die Mädchen nicht den Gefallen, darüber hinwegzugehen. Jenna und Sally starrten ihn mit unverhohlener Neugier an. Und sogar Madison hatte den Blick von ihren Aufzeichnungen gehoben und musterte ihn. Zum ersten Mal fiel ihm auf, dass ihre Augen ein wenig umschattet waren. Neben den sorgfältig geschminkten Gesichtern ihrer Mitschülerinnen wirkte ihres im gleißenden Licht sanft und seltsam entrückt.
»Da will dich aber jemand dringend erreichen!« Jenna verschränkte die Arme und ruckte mit dem Kinn herausfordernd in Richtung Handy. »Deine deutsche Freundin?«
»Nein. Das war nur meine Mutter.«
Sofort hätte er sich am liebsten geohrfeigt. Verdammt, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt? Und auch ohne Jennas feixendes Grinsen hätte er gewusst, wie das klang. Fehlte nur noch der Zahnspangenbehälter an einer Schnur um seinen Hals. Jede Wette, dass Alex keine Nachrichten von seiner Mom bekam. Und wenn, war er schlau genug, das für sich zu behalten.
»Dann hast du gar keine Freundin?«, wollte Sally wissen.
Vielleicht war es ein gutes Zeichen, dass Madison ihn nun ebenfalls fragend ansah. Obwohl ihre Miene unbewegt blieb, blitzte Interesse in ihren Augen auf.
»Nein, habe ich nicht«, sagte Jay zu ihr, nicht zu Sally, und stand auf. »Zehn nach zehn, Zeit fürs Projekt.«
Das Verrückte an diesem Freitag war, dass ihm die Zwischenzeiten zu entgleiten schienen. Den Weg zum Kursraum hatte er wie im Halbschlaf hinter sich gebracht, aber als er jetzt tatsächlich neben Madison an einem Zweiertisch saß und die Gliederung durchging, war er plötzlich so wach, als hätte er einen Kaffeerausch.
»Hier, nach diesem Abschnitt kommt deine Überleitung«, erklärte sie und tippte mit der Kulispitze auf Punkt drei der Gliederung. Sie nahm sein Schweigen wohl als Zustimmung, denn sie machte eine Notiz und redete weiter. Jay hörte ihre Stimme, aber die Worte glitten an ihm ab. Stattdessen musterte er sie verstohlen von der Seite, während er so tat, als würde er sich ebenfalls auf das Referat konzentrieren.
Eigentlich kein guter Zeitpunkt, Jay, dachte er, während er ihren Mund betrachtete und das Haar, das er gerne berührt hätte. Du schwebst im Nichts, du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Willst du es wirklich bei ihr versuchen?
Was eine blödsinnige Frage war, schließlich hatte er sich nur wegen Madison für dieses langweilige Projektthema eingetragen. Dabei machte sie ihm nicht gerade Hoffnungen, dass sie ihn überhaupt leiden konnte. Es war seltsam: Trotz ihrer kühlen, ablehnenden Art mochte er sie, und obwohl er so gut wie gar nichts über sie wusste, hatte er das Gefühl, sie hätten etwas gemeinsam. Und er wollte um jeden Preis herausfinden, was es war.
»Du starrst mich an«, sagte sie leise, ohne aufzublicken. »Überlegst du gerade, aus welchem Reservat ich stamme?«
»Was? Nein, ich …«
Sie winkte genervt ab. »Ist schon gut. Du bist nicht der Erste, der mich für eine Stadtindianerin hält. Falls du es genau wissen willst, ich habe tatsächlich Indianerblut. Aber so spannend ist die Geschichte nicht. Mein Großvater war zwar ein Lakota. Aber er lebte in New York, wie sehr viele Indianer übrigens. Meine Mum wurde in Queens geboren und mein Vater ist Halbkoreaner aus New Jersey.« Sie machte eine Pause, offenbar in der Erwartung, dass Jay etwas dazu sagte, sich vielleicht sogar entschuldigte. Aber er schwieg. Es hatte seine Vorteile, nicht zu den großen Rednern zu gehören: Man wusste genau, wie man schweigt. Und vor allem, wann.
Dass sein Instinkt ihn auch diesmal nicht trog, merkte er daran, dass sie ihm nach einer Weile einen irritierten Seitenblick zuwarf. »Du kannst dir vorstellen, dass es nicht witzig war, in jeder Thanksgiving-Aufführung in der Schule immer die Quotenindianerin zu sein«, fuhr sie fort. »Früher nannten mich sogar die Lehrer Pocahontas.« Es sollte ironisch klingen, abgeklärt, eine witzige Anekdote aus der Kindheit.
Aber er würde ganz sicher nicht in die Falle tappen und über den vermeintlichen Scherz lachen, den sie ihm so routiniert als Köder hinhielt.
»Das ist ungefähr so witzig, wie mich Kraut zu nennen«, antwortete er nur trocken. Dann wandte er sich ohne Umschweife seiner Arbeit zu. Für einige Momente war Madison verdutzt, dann legte sie den Stift hin und wandte sie ihm zu. Fast konnte er hören, wie das Eis zwischen ihnen einen ersten, hauchfeinen Riss bekam.
»Du sprichst wirklich gut«, stellte sie mit leicht gönnerhaftem Unterton fest und verschränkte die Arme. »Sogar der Akzent geht eigentlich.«
Jay zuckte die Schultern. »Meine Mutter … Charlie ist Fachübersetzerin für Englisch. Und mein Vater stammt ja aus New York. Aber das habe ich euch ja schon bei meiner Vorstellung am Dienstag erzählt.«
»New York ist groß. Aus welchem Teil kommt dein Vater genau?«
»Williamsburg, mein Onkel hat hier eine Motorradwerkstatt. Ich wohne bei ihm.«
Ihr linker Mundwinkel zuckte nach oben. Es war fast ein Lächeln. Aber nur fast. »Dann gehörst du ja wirklich zu uns Brooklynites.«
Jay schwieg wieder. Der Ball war bei ihr, und er würde warten, bis sie ihn wieder zurückspielte. Auch wenn es bedeutete, dass die Pause unangenehm lang wurde. Sie sahen sich ein, zwei Sekunden in die Augen, dann schaute Madison hastig weg. Ihr Blick fiel auf seine Unterlagen, die rechts am Tischrand lagen. Ausgefüllte Kurs- und Stundenpläne und die Anmeldungen, auf denen die steile, ungelenke Unterschrift seines Onkels prangte.
»Darf ich deinen Kursplan sehen?«
Jay nickte. Als sie sich vorbeugte, fiel ihr Haar über die Schulter, eine dunkle Strähne strich über seine Hand. Das seltsame Gefühl von Unwirklichkeit verstärkte sich wieder.
Madison ließ sich gegen die Lehne fallen und federte dagegen, während ihr Blick über das Papier glitt. Zu spät fiel Jay ein, dass es vielleicht doch keine gute Idee war, ihr die Blätter zu überlassen. In diesem Moment runzelte sie schon überrascht die Stirn.
»Du heißt gar nicht Jay?«
»Doch, es ist nur … mein zweiter Name.«
Was glatt gelogen war. Aber in Amerika konnte man problemlos auch nur den ersten Buchstaben eines Namens als Rufnamen verwenden und kein Lehrer dachte sich etwas dabei.
»Gefällt dir dein erster Name nicht?«
Nicht mehr. Nie mehr. Er ist Vergangenheit.
»Jay gefällt mir einfach besser. Außerdem nennt mich auch mein Vater so.«
Nannte. Vergangenheit. Gewöhn dich endlich daran.
Madison nickte nur und überflog seinen Stundenplan. »Modern Novels«, murmelte sie anerkennend. »Den Kurs habe ich auch gewählt und am Montag sind wir zusammen in Rhetorik. Oh, und du musst auch Romeo and Juliet lesen? Wir haben fast alle Wahlkurse gemeinsam.«
Diesmal war Jay wach genug, um nicht »ich weiß« zu sagen. Es war schwierig gewesen, etwas über Madison herauszubekommen. Nicht einmal ihre Mitschüler schienen besonders viel über sie zu wissen. Aber immerhin hatte er es geschafft, über Sally und ein paar andere Mitschüler ihre Kurse rauszubekommen – und er konnte sich anhand ihrer Wahlkurse ausrechnen, dass sie Filme mochte.
Gerade wollte er den Faden aufgreifen, als die Schulglocke scheppernd dazwischenfuhr. Er hatte sich schon an vieles gewöhnt, nur nicht an die Geschwindigkeit, mit der die Schüler am Ende jeder Stunde aufsprangen und zusammenpackten. Die wenigen Minuten, die sie zum Wechsel des Klassenzimmers hatten, liefen stets so hektisch wie eine Feuerwehrübung ab. Ehe er sich’s versah, hatte auch Madison ihre Sachen zusammengesucht und verabschiedete sich mit einem schnellen »See you«. Dann war sie verschwunden, als hätte er das Gespräch eben nur geträumt.
*
Schon seit seinem ersten Tag an der Highschool war er so darum bemüht, jede Begegnung mit Madison wie einen Zufall wirken zu lassen, dass er völlig überrascht war, ihr an diesem Nachmittag nach Schulschluss tatsächlich einfach so über den Weg zu laufen. Sie stand mit einer Gruppe von Mädchen vor der Schule. Jay blieb stehen, wandte sich halb ab und nestelte an seiner Tasche herum. Von hier aus gesehen, wirkte die Schule wie ein Bunker: rotbraun und klotzig, mit vergitterten Fenstern im untersten Stockwerk. Ein hoher Metallzaun umfasste das ganze Gelände – sowohl den alten Trakt aus Backstein als auch das neue Stück, das zwar rostrot gestrichen war, aber trotzdem nicht zum restlichen Bau passte. Die Kantine überspannte ein Dach aus Stahlstreben und Glas.
Mit einem Ohr hörte Jay, wie Madison sich von den Mädchen verabschiedete, dann sah er sie mit einer Mitschülerin davongehen. Einen Augenblick war er unschlüssig. Aber dann dachte er an seinen Vater und die Erinnerung riss ihn aus der Lethargie. Was soll’s?Wann, wenn nicht jetzt?Es spielt keine Rolle und vielleicht ist morgen schon alles zu spät.
Dank seiner längeren Beine konnte er sie mühelos einholen, ohne den Eindruck zu erwecken, er würde ihr hinterrennen. Madison schien kaum überrascht zu sein, ihn zu sehen. Ihre Freundin dagegen – eines von den farblosen Mädchen, über die Sally und Jenna sich sicher lustig machten – zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Hi«, sagte Jay. Jetzt starrte die Freundin Jay so feindselig an, als hätte er nach dem nächsten Stundenhotel gefragt.
Madison deutete im Gehen zur Straßenecke, wo das Subway-Schild vor einem Treppenabgang prangte. Sie war zwar für ein Mädchen ziemlich groß, aber dennoch musste sie zu ihm aufsehen. »Musst du auch zur Sub?«
»Nein, ich wohne hier gleich um die Ecke. Ein paar Straßen in Richtung Berry Street, Ecke dritte, Süd.«
Pause.
»Oh, tja, ich muss in die andere Richtung.« Jetzt funkelten ihre Augen doch amüsiert auf. »Falls das ein plumper Versuch sein sollte, mich zu begleiten und mich anzumachen: Das wäre in jeder Hinsicht ein Umweg für dich.«
Madisons Freundin wirkte mit einem Mal sehr erleichtert und beschleunigte ihre Schritte. Jay ballte die Hände in den Jackentaschen zu Fäusten. Danke, Madison! Du machst es mir ja wirklich leicht.
Im Film wäre es der perfekte Zeitpunkt gewesen, ihn triumphierend stehen zu lassen. »Tja, bis dann, Jay.« Und: Cut!
Aber Madison ging nicht weiter. Ihre Freundin zögerte, dann lief sie voraus. Einen Augenblick hatte Jay gute Lust, Madison stehen zu lassen. Noch hatte er nichts zu verlieren. Aber sie sah ihn immer noch herausfordernd an. Nun, wenigstens konnte er seine Ehre retten.
»Eigentlich wollte ich von dir nur wissen, wie ich zum McCarren-Park komme«, meinte er betont gleichgültig. »Da findet mein Trainingsspiel statt. Ich wollte mir das Spielfeld ansehen. Und außerdem kenne ich mich in der Gegend noch nicht aus.«
Was so nicht stimmte. Er kannte zumindest den Stadtplan von Brooklyn auswendig. Schon in Berlin hätte er jede Straße mit geschlossenen Augen aufzeichnen können. Viel zu sehr hasste er es, etwas so Wichtiges wie Wege dem Zufall zu überlassen.
Mit Genugtuung bemerkte er, dass die stolze Madison errötete, als sie die Botschaft verstand.
»Kommst du, Maddy?«, rief ihre Freundin, die bereits auf der Treppe zur U-Bahn-Station stand. Madison nickte ihr zu, dann winkte sie Jay, ihr zu folgen. »Dann nimmst du am besten die Bahn.« Das klang wieder sehr sachlich. »Ich sage dir, wo du aussteigen musst. Ich muss zufällig in dieselbe Richtung.«
Ich weiß. Sally ist weitaus gesprächiger als du und hat mir verraten, dass du hinter dem Park wohnst. Aber nach ihrem Spruch von vorhin würde er sich natürlich eher Polsternägel in die Hand hauen, als das jemals vor ihr zugeben.
»So ein Zufall«, sagte er nur. Sie ging zur Treppe. Jay machte keine Anstalten, ihr zu folgen. »Worauf wartest du? Die Bahn kommt in einer Minute!«
»Warum gehen wir nicht zu Fuß?«
»Laufen?« Madison wirkte, als hätte er vorgeschlagen, auf die Postkutsche zu warten.
Komm schon, beschwor Jay sie in Gedanken. Gib mir endlich eine Chance!
Sie biss sich auf die Unterlippe und schien zu überlegen. Das Surren und Quietschen der bremsenden U-Bahn drang bereits durch das Gitter des Lüftungsschachts.
»Maddy!«, rief die Freundin genervt. Dann schnaubte sie und verschwand im U-Bahn-Tunnel. Madison sah ihr nach. Er hätte gewettet, dass sie nun gehen würde, aber zu seiner Überraschung wandte sie sich ihm zu und sagte einfach: »Okay.«
Es war, als hätte man ein Spiel mit nur einem Wurf gewonnen – entgegen der Gesetze der Physik.
Eine Weile liefen sie nur schweigend nebeneinanderher. Der Weg führte sie nicht durch das zum Himmel strebende, junge New York, sondern durch Williamsburg, den Teil der Stadt, der sich zu ducken schien. Hier waren die Häuser nur wenige Stockwerke hoch. Zum Großteil waren sie aus rotem Sandstein erbaut, schmale Schmuckstücke mit Giebeln und Flachdächern. Kleine Läden säumten die Straßen. Bunte Kioske, wie man sie aus Filmen kannte, koreanische Lebensmittelgeschäfte und Wäschereien, die alle »Chinese Laundry« genannt wurden, obwohl oft genug Mexikaner darin arbeiteten. An einer Ecke verkaufte ein glatzköpfiger Mann Klopapier mit dem Gesicht von Osama bin Laden. Eine Straße weiter diskutierten ein paar jüdische Männer mit schwarzen Hüten und langen Schläfenlocken miteinander.
»Du hältst mich sicher für ganz schön arrogant«, sagte Madison nach einer Weile.
»Schon möglich.«
Sie warf ihm einen überraschten Seitenblick zu.
»Andererseits kenne ich dich ja gar nicht«, fügte Jay hinzu.
»Du kommst aus Berlin, nicht wahr?«, fragte sie nach einer Weile weiter. »Warum machst du ein Austauschjahr?«
Kein Austauschjahr. Ich bleibe hier. Nur weiß Charlie es noch nicht.
»Als ich zehn war, habe ich meinen Vater hier besucht. Und seitdem wollte ich einfach immer hierher.«
»Ausgerechnet nach Brooklyn?«, fragte sie spöttisch. »Als Gastschüler kannst du es dir doch aussuchen. Warum gehst du nicht in eine der besseren Schulen in Manhattan?«
»Was ist an unserer High auszusetzen?«
Sie schnaubte, als hätte er einen Witz gemacht. Jetzt wirkte sie wieder ein wenig überheblich. Aber diesmal ließ er sich nicht davon beeindrucken, sondern zeigte in Richtung East River.
»Über den Fluss hinweg sieht man das Empire State Building. Mehr Manhattan braucht kein Mensch. Auf unserer Flussseite ist es viel schöner.«
»Klar. Alte Industriebauten und abgeschabte Häuser.«
»Lach nicht. Ich meine es ernst. Schau nach oben. Hier gibt es keine Hochhausschluchten. Dafür kann man viel Himmel sehen.«
Sie folgte seinem Blick und atmete tief durch. »Stimmt«, sagte sie nach einer Weile verwundert. »So habe ich das noch nie betrachtet. Der Himmel.«
Jetzt wusste er, wie ein echtes Lächeln bei ihr aussah: Sie hatte Grübchen neben den Mundwinkeln. Diesmal schaute sie nicht verlegen weg, sondern erwiderte seinen Blick. Alles Kühle war aus ihrer Miene verschwunden. Und Jay stellte fest, dass sie ihm nicht nur gefiel, er mochte sie wirklich.
»Stimmt es, dass du kein Handy hast?«, fragte er. »Bist du in einer Art Klub – ein Jahr ohne Kommunikation oder so?«
»Nein. Zu Hause habe ich irgendwo noch eines in der Schublade, aber ich mache es nie an. Ich mag es nicht, ständig erreichbar zu sein.«
»Und ins Internet gehst du auch nicht gerne? Ich hatte versucht, dich bei Facebook und auf den anderen Plattformen zu finden.«
»Du hast nach mir gesucht?« Sie grinste. »Ich habe mich bei den ganzen Social-Media-Geschichten abgemeldet. Es muss kein Mensch wissen, welche Filme ich anschaue und in welchem Café ich gerade in der Nase bohre. Ist nur Zeitverschwendung. Außerdem habe ich keine Lust, durchsichtig zu sein.«
»Auf dem Schwarzen Brett steht, du renovierst mit ein paar anderen das alte Kinderkino am Spielplatz.«
»Aha, wenn das Internet nichts hergibt, spionierst du in der Schule herum?«
»Ja. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, irgendetwas über dich zu erfahren …«
Wenn seine Direktheit sie diesmal verblüffte, ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken. »Ich mag das Kino – als ich klein war, war ich fast jeden Sonntag dort. Und jetzt ist es mein Community Project. Du weißt, dass jeder Schüler im Halbjahr ein paar Stunden gemeinnützige Arbeit leisten muss?«
»Ich weiß, deshalb kam ich auf das Kino. Am Schwarzen Brett stand, ihr braucht noch Leute, die handwerklich begabt sind. Ich helfe in der Werkstatt meines Onkels mit. Außerdem mag ich Filme.«
Was so untertrieben war, dass es schon fast wie eine Lüge klang.
Mit einem Seitenblick auf seinen durchtrainierten Körper bemerkte Madison:
»Action-Filme? Martial Arts?«
»Auch. Aber eigentlich eher Science-Fiction – auch die Klassiker. Kennst du THX 1138?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Der erste Spielfilm von George Lucas. Wenn du gegen Internet und Überwachung bist, müsste der dir gefallen.«
»Klingt gut. Mir gefällt Avatar. Und Matrix und Gattaca.«
Wow. Gleich dreimal auf derselben Wellenlänge. Wahrscheinlich wache ich gleich auf und stelle fest, dass es nur ein Jetlag-Wunschtraum ist.
Jetzt hatte die Stille nichts Angespanntes mehr. Unmerklich passten sie ihre Schritte einander an. Es fühlte sich fast schon vertraut an.
»Da vorne ist schon die russische Kirche«, sagte sie nach einer Weile und deutete auf eine Kuppel, die sich über den Hausdächern erhob. »Wenn du an der nächsten Straße nach links und dann an der Kirche vorbeigehst, kommst du direkt in den Park.«
»Mhm«, antwortete Jay, ohne stehen zu bleiben. Und dann gingen sie einfach weiter nebeneinanderher, am Park vorbei und geradeaus weiter, über Kreuzungen und Ampeln. Sie schwiegen selbst dann noch, als Madison in eine schmale Seitenstraße abbog und vor einem schmalen Haus mit einer Treppe stehen blieb.
»Tja, dann schon mal viel Erfolg beim Training. Sei vorsichtig mit Pete. Er spielt nicht immer fair. Und wenn er ausrastet, holt er jeden von den Beinen.«
»Danke für die Warnung.«
Umständlich kramte sie ihren Hausschlüssel aus der Jackentasche. »Also dann …«
Jetzt war er so nervös, dass er sogar nach den einfachsten Worten suchen musste.
»Kommst du … eigentlich morgen auch zur Party?«
Zu seiner Enttäuschung schüttelte sie den Kopf. »Nicht meine Clique. Aber ich bin sicher, Sally freut sich auf dich.«
»Kann schon sein. Aber sie interessiert mich nicht, falls du darauf anspielst.«
Eines musste man ihr lassen, sie beherrschte ihr Pokerface wirklich gut. Seine Karten lagen auf dem Tisch, aber sie tat so, als hätte sie seine Worte nicht gehört.
»Bis Montag«, sagte sie nur und begann die Treppe hochzugehen. Er blickte ihr nach, die Hände in die Jackentaschen gekrampft. Endlich gab er sich einen Ruck und zog den roten Flyer hervor, Plan B.
»Hey, Madison! Wenn du Science-Fiction-Filme magst: Nächste Woche zeigen sie Blade Runner bei der Classic Night im Park. Freilicht-Kino, letzte Vorstellung in diesem Jahr.«
Sie blickte auf ihn herunter, wieder ganz die coole Madison, die stolz darauf war, die Außenseiterin zu spielen. »Du verschwendest wohl keine Zeit«, meinte sie spöttisch. »Aber hier bei uns gibt es bestimmte Regeln für ein Date.«
»Wie kommst du darauf, dass ich ein Date will?«
»Jemanden ins Kino einzuladen, wäre eines.«
»Ach ja? Bei uns Krautswäre es einfach ein Kinobesuch. Zwei Leute, die dieselben Filme mögen.« Und er setzte noch herausfordernd hinzu: »Bring doch deinen Freund mit, wenn du dich nicht allein mit mir in den Park traust.«
Alles auf eine Karte setzen – darin war er neuerdings wirklich gut.
Die unausgesprochene Frage schwebte in der Luft. Doch diesmal war es Madison, die nicht in die Falle tappte.
»Kein Date?«, fragte sie, ohne die Frage nach ihrem Freund zu beantworten.
Jay schüttelte den Kopf. »Nur Blade Runner.«
Sie holte tief Luft, als würde sie sich die Entscheidung wirklich schwer machen.
Dann klappte sie ihre Tasche auf und kramte darin. Sie zückte einen Stift, lief die Treppen herunter und nahm Jay den Flyer aus der Hand. Rasch kritzelte sie einige Zahlen an den Rand und riss ein viereckiges Stück aus dem Zettel. Eine Telefonnummer.
Einen elektrisierenden Augenblick lang berührten sich ihre Hände, während Madison ihm das rote Papier in die Hand drückte. Wieder hatte er das Gefühl, in der falschen Zeitzone gefangen zu sein. Gleich wache ich auf. Aber diesmal wollte er nicht aufwachen, um keinen Preis der Welt.
»Das nennt man übrigens Festnetz«, sagte Madison und tippte mit einem ironischen Lächeln auf die Edding-Zahlen. »Bevor es Handys gab, hat man sich darauf angerufen, um sich zu verabreden.« Und kurz bevor sie durch die Tür ins Haus verschwand, bekam er zum zweiten Mal an diesem Tag ein echtes Madison-Lächeln zu sehen.
Dreamcatcher
Es wurde schon dunkel, als er sich auf den Weg nach Hause machte. Vom Park aus war er auf dem Rückweg eine ganze Weile durch die Stadt gestreift wie ein Schlafwandler, in Gedanken schon beim Treffen mit Madison. Aber nun setzte ein kühler Herbstregen ein und Jay beeilte sich, zur 3. Straße zu kommen.
Das Haus seines Onkels lag etwas nach hinten versetzt, ein altes Brownstone im holländischen Stil, an dessen Fassade sich Efeu hochrankte. Im Grunde waren es zwei Häuser – doch das Nebenhaus mit der dazugehörigen Garage diente komplett als Werkstatt und Warenlager für Motorradersatzteile und die Fahrräder, die Onkel Matt verkaufte und auch vermietete.
Onkel Matts ganzer Stolz – seine italienische Laverda – stand halb auseinandergebaut in der offenen Garage. Der Fernseher plärrte in einer Ecke vor sich hin. Er lief in der Werkstatt beinahe Tag und Nacht. Im Moment waren es irgendwelche Ausschnitte aus einem Baseballspiel. Sowohl Onkel Matt als auch Jays Cousin waren Fans der New York Yankees.
Jay sprintete die breite Treppe zum Wohnhaus hoch. Kaum hatte er den Schlüssel ins Schloss geschoben, erschien hinter der Milchglastür der verschwommene Umriss von Feathers und wurde deutlicher, als der riesige Hund an der Tür hochsprang. Und wie immer gab der Anblick Jay auch heute einen Stich. Es war verrückt: Er hatte Charlie und Berlin noch keine Sekunde vermisst, aber sobald er Feathers sah, traf ihn das Heimweh mit voller Wucht. Auf den ersten Blick glich der helle Retriever seiner Hündin Zara, die er in Deutschland zurückgelassen hatte, aufs Haar. Nur das Bellen zerstörte diese Illusion. Es klang tiefer, rauer, fast heiser und ein bisschen übergeschnappt. Und natürlich hätte Zara nie so eine Show abgezogen. Kaum öffnete Jay die Tür, sprang der Hund an ihm hoch und versuchte, ihn zu Fall zu bringen. »Nein!«, rief Jay gegen das Gebell an. »Aus, Feathers!« Im Versuch, ihn abzuwehren, machte er einen Schritt zur Seite – und wäre beinahe über einen Haufen Turnschuhe und eine Lenkstange gestolpert, die aus irgendeinem Grund an der Wand lehnte. Es roch nach Gummi, Schuhen und Motoröl, in der Ecke stapelten sich Kisten voller Ersatzteile und Fahrradschlösser. Vier neue Fahrräder lehnten noch in Plastik verpackt an der Küchentür. Es war, als hätte die Werkstatt ein Eigenleben und würde versuchen, langsam in die Wohnräume zu kriechen.
»Schnauze, Feathers!«, kam es von links.
Der Hund ließ von Jay ab und fegte bellend zum Durchgang zwischen den beiden Häusern. Aidan erschien in der Tür, Jays Cousin. Auch heute trug er ein Sweatshirt, auf dem das Yankees-Emblem NY prangte. Es musste Onkel Matt gehören, denn die Schulternähte hingen Aidan auf halber Höhe seiner sehnigen Oberarme. Schwarze, verschwitzte Strähnen klebten an seiner Schläfe. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass Matt und Aidan Vater und Sohn waren. Sie sahen sich ungefähr so ähnlich wie ein magerer Windhund einem bulligen Bernhardiner.
Charlie hatte einmal boshaft gemeint, dass Matt ein gutmütiger Trottel war und sich den Sohn eines anderen Mannes hatte anhängen lassen. Aber selbst wenn es so wäre – Jay wusste, dass Onkel Matt sich keinen Deut darum geschert hätte. Er liebte, wen er liebte. Und Aidan liebte er über alles. Die fehlende äußerliche Ähnlichkeit machten sie auf anderen Gebieten mehr als wett: Die beiden bildeten eine Einheit aus trockenen Biker-Witzen, Technik-Fachbegriffen, einer Vorliebe für Steaks und gesprächigem Schweigen.
»Ach, du bist’s«, murmelte Aidan und wischte sich die Hände an einem ölverschmierten Lumpen ab. »Matt ist noch nicht da.«
»Alles klar. Ich bin dann oben.« Damit war der Dialog schon wieder am Ende. Jay wusste immer noch nicht, ob er Aidan mochte. Aber die Art, wie sein Cousin ihm nun einen abschätzenden Blick zuwarf und sich schroff von ihm abwandte, zeigte ihm nur zu deutlich, dass Aidans Entscheidung in derselben Frage schon längst gefallen war. Die Schiebetür zur Werkstatt fiel mit einem Scheppern zu, gleich darauf erklang eine überlaut dröhnende Stimme. Aidan hatte den Fernseher voll aufgedreht, als wollte er Jay endgültig ausblenden. Der Nachrichtensprecher verkündete eine Sturmwarnung und zitierte Expertenmeinungen zum Thema.
Zwei Stufen auf einmal nehmend, hechtete Jay die Treppe in den ersten Stock hoch. Sobald er die Tür zu seinem Zimmer zugemacht hatte, atmete er auf. Zu Hause.
Der Raum war zwar kaum größer als eine Abstellkammer und das Bett bestand aus zwei übereinandergestapelten alten Matratzen, aber er gehörte ihm. Und durch das Fenster konnte er die Krone des Amberbaumes im Garten sehen. New York mit Blick ins Grüne – na ja, jetzt im Herbst war das Grün der spitzfingrigen Blätter schon braun gescheckt.
Feathers hechelte die Treppen hoch und kratzte an der geschlossenen Tür. Im Grunde hatte Jay seit seiner Ankunft den Hund häufiger gesehen als seinen Onkel. Aber das war Teil der Abmachung: Hier erwartete ihn keine fürsorgliche Gastfamilie. Er war willkommen, aber er musste sehen, wie er seinen Platz fand und zurechtkam.
Sobald er die Tür öffnete, stürmte der Hund in den Raum und warf sich mit einem zufriedenen Laut zwischen Winseln und Gähnen neben dem Bett nieder.
Jay streifte seine Schuhe ab und ließ sich auf die Matratzen fallen.
Einen Moment überlegte er, ob er seine Mails abrufen sollte. Sein Laptop stand auf dem Boden, das Kabel führte durch ein Bohrloch in der Wand. Anschluss à la Aidan, aber es funktionierte.
Doch dann zückte er nur sein Handy und den roten Zettel. Der Hund horchte auf, als er das Klacken der Tasten hörte, dann legte er den Kopf auf Jays Fußknöchel ab und schloss die Augen.
Sie meldete sich schon nach dem zweiten Klingeln.
»Hi Madison, ich bin’s.«
»Du kennst die Regeln wirklich nicht. Niemand ruft gleich am selben Tag an.«
Es klang nach einem Vorwurf, aber er konnte hören, dass sie beim Sprechen lächelte.
»Gut, ich merke es mir für den Fall, dass ich hier jemals ein Date haben sollte«, antwortete er ungerührt. »Soll ich dich am Montag abholen?«
»He, langsam. Wir treffen uns direkt am Kino, klar?«
»Um sieben?«
»Ja. Und komm nicht auf die Idee, in der Schule so zu tun, als hätten wir was miteinander.«
»Warum? Hast du Angst, dein Freund versucht, mich zu verprügeln?«
»Schönen Tag noch, Jay«, sagte sie mit gespielter Arroganz und legte auf. Jay ließ sich auf das Bett zurücksinken. Für einige Sekunden war er einfach nur glücklich. Feathers blinzelte und sah Jay von der Seite an. »Siehst du?«, sagte Jay. »Kraut hat doch eine Chance bei ihr.« Doch der Hund gab nur ein gelangweiltes Stöhnen von sich und schlief ein. Jay entspannte sich und blickte zur Decke. Direkt über ihm hing ein Ring aus Weidenzweigen, überspannt von einem Spinnennetz aus Schnüren – der Dreamcatcher, den sein Vater bei seinem Besuch vor sieben Jahren für ihn gemacht hatte. Eines der wenigen Dinge, die er seit seiner Ankunft hier ausgepackt hatte. Vielleicht war es keine gute Idee gewesen, den Ring aufzuhängen. Tagsüber konnte er sich gut ablenken, aber nun zog die Erinnerung ihn runter. Morgen packe ich ihn wieder ein, dachte er und schloss die Augen.
*