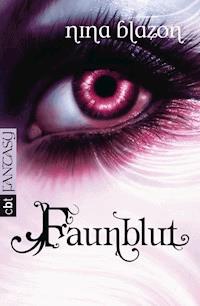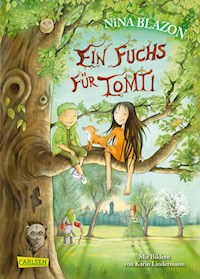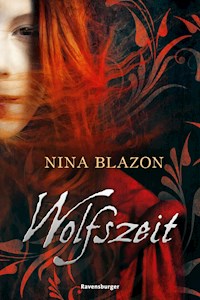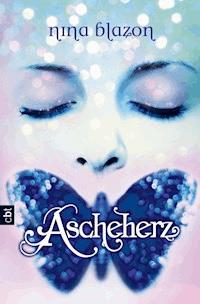Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ich war vom Himmel gefallen wie ein verglühender Stern. Und ebenso unwiderruflich.« Canda und Tian sind dazu bestimmt, eine Zweiheit zu werden: ein Paar, dessen Seelen und Gaben sich zu einer Einheit verbinden, um über die Metropole Ghan zu herrschen. Doch in der Hochzeitsnacht wird Candas Geliebter entführt – und sie selbst, die Schönste der Stadt, erkennt sich im Spiegel nicht wieder. Ihre wichtigste Gabe, der »Glanz«, ist über Nacht erloschen. Somit ist die stolze Stadtprinzessin zu einer Gewöhnlichen geworden und gilt von nun an als Geächtete.. Doch Canda will sich nicht in ihr vorbestimmtes Schicksal fügen. Zusammen mit dem Sklaven Amad flieht sie aus dem Gefängnis in Ghan, um ihren Geliebten wiederzufinden. Es ist der Beginn einer abenteuerlichen Reise durch Wüsten und Ozeane …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der dunkle Kuss der Sterne
NINA BLAZON
Text Copyright © by Nina Blazon
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlag- und Farbschnittdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-935-7
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
I. Die Stadt
Scherben und Gold
Der Falke
Mitternachtswein
Das vierte Licht
Das Haus der Gespenster
Ringe
Blutfeuer
Talisman
II. Wüstenwind
Grünes Feuer
Ring und Schlange
Dornenkreise
Herren und Diener
Rabenhaar
Spur aus Gold und Kupfer
III. Grüne Wasser
Windsbraut
Lektionen
Dornenschlange
Gewinner und Verlierer
Meerestanz
Der Schädelhafen
IV. Medasland
Straße aus Asche
Lektionen
Plünderer
Hand in Hand
Drei Tode
V. Sternenmeer
Das Lied der Scherbenblume
Ausfallswinkel
Blaue Wege
Zeit der Ketten
Köder
Das Zentrum des Netzes
Sieger und Besiegte
Der dunkle Kuss der Sterne
VI. Zeit der Lichter
Drachenpost
Für Mara und Sanja
Mögen eure Wege voller Sternenlicht sein!
Die Stadt
ZWEI TEILE EINES GANZEN
Am Morgen vor meiner Hochzeit erwachte ich, ohne zu ahnen, dass ich tot war, obwohl mein Herz noch schlug. Wie eine Katze, die aus großer Höhe gefallen und instinktiv auf allen vieren gelandet war, kauerte ich auf dem Bett. Tränen tropften auf meine Fäuste und meine Finger pochten, so fest krallte ich mich in die Seidenlaken. Ein Teil von mir schien immer noch zu schlafen, denn der Albtraum hallte in mir nach: Weinen und Schreie, verzerrte Gesichter von Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Doch das Schlimmste war das Gefühl von abgrundtiefer Einsamkeit: Eis auf meiner Seele und eine hallende Leere im Herzen.
Du hast nur geträumt, Canda, beruhigte ich mich. Träume bedeuten nichts.Und schau hin! Du bist nicht einsam – am wenigsten in der letzten Nacht deines alten Lebens.
Es erstaunte mich trotzdem, wie erleichtert ich war, die Mädchen zu sehen. Aneinandergeschmiegt lagen sie auf dem Prunkbett, das so groß war wie sechs gewöhnliche Betten. Alle drei schliefen noch: meine jüngere Schwester Vida und meine zwei besten Freundinnen, Zabina und Anib. Sie waren Zwillinge, beide geschmeidig und sehr groß, die besten Tänzerinnen in der Stadt. Nicht einmal ihre Mutter konnte die beiden auseinanderhalten, aber ich hätte jede von ihnen auch blind erkannt. Auf den goldfarbenen Laken wirkte ihre Kastanienhaut noch dunkler und das Schwarz ihrer Haare lichtlos.
Im Schlaf hatte Anib die Decke von sich geschoben, auf ihrem Körper glänzten blaue Symbole. So, wie es seit Jahrhunderten Tradition war, hatte ich um Mitternacht alle drei Mädchen mit dem Schattenblau meiner Familie gezeichnet. Mit Ornamenten, Mustern und Zeichnungen, die die Mythologie meiner Vorfahren beschworen: das Herrscherpaar, wie es den ersten Stein unserer Stadt in den Wüstensand setzte. Tana Blauhand, die einzige Figur, deren Arme bis zu den Ellenbogen ganz mit dem kriegerischen Blau ausgemalt waren, und ihr Gefährte, den man Khelid Wolfsherz nannte und der zum Zeichen seiner Grausamkeit mit einem Raubtierkopf dargestellt wurde. Über den beiden schwebten vier Sterne mit Augen, die wohlwollend auf sie herunterblickten. Es gab viel zu erzählen über meine Vorfahren, denn ich stamme aus der ältesten der fünf großen Familien Ghans. Bevor die anderen Familien zugewandert waren, hatte die Wüste uns allein gehört. Auf den Schultern und Schlüsselbeinen meiner Mädchen erhoben sich Zelte, auf den Oberarmen und Rippen prangten Pfeile und Äxte, archaische Waffen, passend zu der längst vergangenen Zeit, aus der diese verstaubte Tradition stammte.
Unendlich viele langweilige Unterrichtsstunden hatte ich als Kind damit verbracht, diese Zeichnungen zu üben – im vollen Bewusstsein, dass es nur ein altes, leeres Ritual war und mir für mein Leben nichts nützen würde. Entsprechend waren meine Zeichnungen in dieser Nacht ausgefallen: Die Zelte wirkten windschief und einer der Sterne schien zu schielen.
»Na, wenn du so herrschst wie du zeichnest, wirst du in die Geschichte deiner Familie eingehen – als Canda, die Nachlässige«, hatte Zabina gespottet.
Und Anib setzte nach: »Ja, stellt euch vor, sie wird eines Tages tatsächlich die neue Mégana und gibt sich mit Verträgen und Strategien genauso viel Mühe – dann landen wir alle wieder in der Wüste.«
Meine Schwester Vida war empört, aber ich hatte über den Spott meiner Freundinnen nur gelacht. Ich wusste, sie neideten mir und Tian nicht, dass wir die Hoffnungsträger unserer Familien waren. Und sie waren klug genug zu wissen, dass ich meine Freunde niemals vergaß – egal, wie hoch mein Geliebter und ich aufsteigen würden. Beim Gedanken an unsere Zukunft hatte mich wieder diese Woge von Glück erfasst, die mich seit Wochen immer atemlos machte – seit Tian und ich unsere Unterschriften unter den siebzigseitigen Vertrag gesetzt hatten, die letzte Hürde vor der Zeremonie unserer endgültigen Verbindung. Heute durften wir endlich das werden, wofür wir vor siebzehn Jahren geboren wurden: eine Zweiheit, ein Paar, eine Seele, ein Körper, ein Gedanke, mit aller Macht, die daraus entsprang – und aller Verantwortung. Im Gefüge unserer Familien würden wir der Metropole Ghan zu noch mehr Macht verhelfen. Jeder mit seinen Talenten und Fähigkeiten.
Aber jetzt, nach diesem Traum, schien all das so unwirklich zu sein wie Nebel.
Noch nie hatte ich mich so unvollständig gefühlt, so schutzlos und verloren. Im flackernden Schein der Papierlampe, die über dem Bett hing, schienen sich die blauen Strichfiguren auf Anibs Wangen zu bewegen und die Sterne auf ihrer Stirn starrten mich feindselig an. Ich fröstelte und wusste nicht, warum ich plötzlich wieder Angst bekam.
Tod!
Ich schrak zusammen. Es war, als hätte jemand mir dieses Wort zugeflüstert, doch niemand war hier. Es musste ein Nachhall aus diesem Traum sein, an den ich mich kaum noch erinnerte.
Meine Hände waren noch so starr, dass es wehtat, die Fäuste zu lösen. Leise glitt ich vom Bett. Vida regte sich, eine Strähne ihres Haares, von der Sonne fast weiß gebleicht, rutschte über ihre Wange. Meine Schwester und ich waren wie Tag und Nacht – sie blond wie unser Vater, mit einem runden, sanften Gesicht, dessen Weichheit gut verbarg, wie durchsetzungsstark sie war. Ich war dagegen groß und dunkelhaarig wie meine Mutter. Und meine Stärke lag nicht in der Schärfe, sondern darin, mit meiner Schönheit und meinem Gespür ungewöhnliche Wege zu finden, zu verbinden, was unvereinbar schien.
»Canda? Ist es schon Morgen?«
»Noch nicht, Floh. Schlaf noch ein bisschen.« Ich erschrak, wie fremd mir meine eigene Stimme war. Hohl und dünn, ohne das Klingen, das Menschen, die mit mir sprachen, stets zum Lächeln brachte.
Ich fiel fast, während ich vom Bett kroch, und taumelte schon beim ersten Schritt, als hätte sich das Gleichgewicht in meinem Körper über Nacht verschoben, als würde mir etwas fehlen – ein Körperteil, ein Bein vielleicht, ein Arm? Aber das war natürlich Unsinn, alles war wie immer, und gleichzeitig völlig verkehrt.
Ich erreichte die Fenster und riss den Vorhang zur Seite. Goldseide bauschte sich. Draußen scharrte der sandige Wind an den Scheiben entlang, Wirbel bildeten bizarre Figuren in der Luft. Obwohl es fast noch Nacht war, erkannte man bereits, dass es ein stürmischer Sommertag werden würde.
Ich legte die Hände und meine Stirn an die Scheibe und starrte zu dem gegenüberliegenden Gebäude. Im fernen Schimmer der Morgenröte glänzten die obersten Fenster wie blassrosa, schlafmüde Augen. Hinter den Vorhängen schliefen mein Geliebter und seine Freunde.
»Komm zum Fenster und sieh mich an!«, flüsterte ich. Ich hoffte so sehr, dass er ebenfalls aufgewacht war und meinen Ruf spüren würde. Dann könnten wir uns über den Abgrund von zwanzig Stockwerken hinweg betrachten – winzige Figuren über den silbernen, vom Sand matt gekratzten Kuppeldächern unserer Metropole. Sicher hatte Tian ebenso schlecht geschlafen wie ich, in den vergangenen Tagen hatte er zerstreut gewirkt und seltsam schweigsam, vielleicht war es ihm ähnlich gegangen wie mir heute? Es geschah oft, dass wir dasselbe dachten und Schmerz und Freude des anderen spürten. Unsere Familien waren glücklich darüber, schließlich war es der Beweis, wie sehr wir füreinander bestimmt waren. Seit wir Kinder waren, waren wir selten länger als einen Tag getrennt gewesen. Wir teilten alles, was wir hatten und waren, stimmten uns darauf ein, gemeinsam zu entscheiden, gemeinsam zu sein und für den Rest unseres Lebens im Gleichklang schwingen wie zwei Instrumente, deren Stimmen zu einem einzigen Klang verschmolzen.
Aber ausgerechnet an dem Morgen unserer offiziellen Verbindung war es, als hätte dieser Gleichklang nie existiert.
Mein Atem legte einen Schleier über die Scheibe, das Fenster im anderen Haus blieb leer, und als ich blinzelte, tropften Tränen von meinen Wimpern. Mach dich nicht lächerlich, schalt ich mich. Träume bedeuten nicht mehr als Wetterleuchten. Nur Geisteskranke schenken ihnen Glauben. Aber gleichzeitig legte sich die Angst wie eine Sandschicht auf meine Seele. Irgendetwas war passiert!
»He!«
Ich fuhr herum und musste mich mit dem Rücken an die Scheibe lehnen, sonst hätten meine Knie nachgegeben.
Meine Schwester war lautlos an mich herangetreten, stolz, aufrecht, ohne ein Lächeln. Aber jetzt, als sie mir mitten ins Gesicht sah, stolperte sie erschrocken zurück. Unwillkürlich warf ich einen Blick über die Schulter, doch hinter mir war nichts, was sie erschreckt haben könnte, nur Sandwirbel und die erste Ahnung von Helligkeit.
»Canda?«, fragte meine Schwester so verwundert, als hätte sie mich eben erst erkannt.
»Jemand ist gestorben!« Es rutschte mir einfach so heraus, mit dieser Stimme, die nicht mehr ganz die meine war. Ich erschrak so sehr, dass ich beide Hände vor den Mund schlug.
»Was … wer ist tot?«, fragte Vida.
Ich schloss die Augen. »Tian?«, flüsterte ich. Und jetzt traf mich die Panik wie ein heißer Wind, der mich von Kopf bis Fuß versengte. Meine Schwester legte mir die Hand auf die Schulter. »Canda, weinst du etwa? Beruhige dich doch! Woher willst du denn wissen, dass ihm etwas passiert ist?«
»Ich spüre es einfach!« Jetzt schrie ich. Und das erschreckte mich fast mehr als meine Schwester. Zabina und Anib fuhren aus dem Schlaf hoch, setzten sich auf und blickten verwundert blinzelnd zu uns herüber. Getrocknete Farbe rieselte von ihren Körpern auf die Seide.
Ich stieß mich von der Scheibe ab und wankte an Vida vorbei zur Tür. Dabei verlor ich fast das Gleichgewicht.
»Canda, warte doch!«
Aber ich hatte schon den Zeremonienmantel von dem Haken an der Wand gerissen und mir über die Schultern gezogen. Ich trat auf den Saum und stolperte, die Naht der Goldborte riss, doch ich achtete nicht darauf und stürzte auf den Flur. Die beiden bewaffneten Wachen, die vor der Tür warteten, sprangen von ihren Stühlen auf.
»Lasst sie durch!«, hallte der scharfe Befehl meiner Schwester durch den Flur.
Irgendein Teil von mir wunderte sich noch, warum sie den Männern befehlen musste, sich mir nicht in den Weg zu stellen, aber ich hatte genug damit zu tun, nicht zu stolpern. Ich war es nicht gewohnt, lange Kleider zu tragen, normalerweise lief ich in Hosen aus leichtem Stoff herum. Aber heute fühlte ich mich auch noch so, als wären meine Knochen zu Stein geworden und die Schultern zu schwach, um aufrecht zu bleiben.
Das Prunkzimmer, in dem ich die Nacht verbracht hatte, lag im ältesten Trakt der Stadt, hier glänzte noch Gold an den Wänden, Mosaikbilder aus Edelsteinen schmückten die historischen spitzgiebeligen Durchgänge. Alles, was hier modern war – die Aufzüge, das Licht – war nachträglich eingebaut worden. So früh am Morgen war auf den Fluren nur Personal zu sehen, das die Marmorböden wischte. Tagsüber würden diese Putzkräfte wieder in Küchen und Wäschereien verschwinden und für uns unsichtbar werden. Sie stammten aus dem dritten Ring, farblose, einfache Menschen, dazu geboren, den höheren und höchsten Familien – uns – zu dienen. Ich mochte und bedauerte sie gleichermaßen, sie waren stets schüchtern und ehrfürchtig, aber ihre besorgten Mienen hellten sich auf, sobald sie mich sahen. Und selbst der Ängstlichste von ihnen begann zu strahlen, wenn ich ihm ein Lächeln schenkte. Sie konnten gar nicht anders. Es war fast so, als würde mein Glanz ein Licht in anderen Menschen entzünden. Ich war gerne verschwenderisch mit meinem Lächeln. Meine Mutter tadelte mich dafür, aber Tian liebte genau das besonders an mir. »Du bist der strahlendste Stern der Stadt«, sagte er oft. »Und zum Glück bist du mein Stern.«
Heute hatte ich kein Lächeln für die Leute übrig, und sie starrten mich an wie eine Fremde und vergaßen sogar, sich zu verbeugen. Es war ihnen nicht zu verdenken, man sah schließlich nicht jeden Tag eine der Hohen in antikem Hochzeitsmantel und aufgelöstem Haar durch die Flure stürmen.
»Canda, bleib stehen!«
Mein keuchender Atem beschlug an der Scheibe des Aufzugs. Vidas Stimme drang nur gedämpft durch die geschlossene Tür, viel lauter hallte das Trommeln ihrer Fäuste. »Halt sofort den Aufzug an!«, schrie sie, jedes Wort eine Wolke auf dem Glas. Ich konnte nur den Kopf schütteln, dann schwebte die gläserne Kabine schon quälend langsam nach unten.
* * *
Auch die beiden Wächter vor Tians Tür sahen mir mit Befremdung entgegen. Damit hatte ich gerechnet. Natürlich konnte mir niemand verbieten, Tian zu sehen, wann immer ich wollte, aber es war ungewöhnlich, dass ich noch vor der Zeremonie zu ihm wollte.
»Sofort die Tür aufmachen!«, befahl ich ihnen atemlos.
Sie machten keine Anstalten, zur Seite zu treten, starrten mich nur mit zusammengezogenen Augenbrauen an. »Habt ihr nicht gehört! Ihr sollt …«
»Keinen Schritt weiter, Mädchen!«, bellte der Kerl, der mich um fast zwei Köpfe überragte. Er trug einen dunklen Anzug, der etwas zu eng saß und seine Muskeln nur schlecht verbarg. »Du hast hier nichts verloren.« Ein grober Stoß traf meine Schulter. Ich taumelte zurück, fassungslos. Spätestens jetzt hätte ich geschworen, dass ich immer noch träumen musste. Er hatte mich – eine Hohe – angefasst! Und was noch schlimmer war: Er sprach mit mir ohne Respekt, wie mit einer Gewöhnlichen. Meine Mutter hätte ihm sofort die Hand abhacken und die Zunge abschneiden lassen, aber ich war Canda, die Strahlende, die Liebende, und selbst jetzt, in der größten Verzweiflung, musste ich tun, was das Richtige war.
Ich schluckte die Demütigung herunter, richtete mich auf und hob das Kinn. »Dir ist wohl nicht klar, mit wem du redest«, sagte ich mit aller Schärfe, die ich aufbieten konnte. Der kleinere Wächter stutzte. Ich wusste, was er sah: Eine junge Mächtige mit vor Zorn funkelnden Augen, in all der Würde der ältesten Familie. Zum Glück war ich noch soweit bei Verstand gewesen, mir im Aufzug das Haar glattzustreichen und es im Nacken zu einem Knoten zu winden. »Macht die Tür auf! Tian Labranako ist in Gefahr!«
Der Blick des Größeren schweifte von meinem Gesicht zu dem Prunkgewand und dann wieder zurück, als versuchte er ein Puzzle zusammenzusetzen, dessen Teile nicht passen wollten. Fast tat er mir leid, denn gleich würde er erkennen, was er getan hatte. Und er würde Todesangst bekommen.
Doch stattdessen grinste er, als würde ihm plötzlich ein Licht aufgehen.
»Ich weiß sehr wohl, mit wem ich hier rede«, knurrte er. »Netter Versuch, was?«, wandte er sich an den zweiten Wächter. »Die Ähnlichkeit ist da, und passend verkleidet ist sie auch. Sogar die richtigen Sätze haben sie ihr beigebracht, damit sie uns hier die Stadtprinzessin vorspielen kann.« Und an mich gewandt bellte er wieder: »Aus welchem Bordell kommst du? Welcher von den jungen Herren hat dich ins oberste Stockwerk geschmuggelt und dich bezahlt, damit du dem Bräutigam am Zeremonienmorgen diesen Streich spielst und als seine Versprochene verkleidet in sein Bett kriechst?«
Es war das erste Mal in meinem Leben, dass es mir vollkommen die Sprache verschlug. Meine Mutter hatte mich Beherrschung gelehrt und mein Vater Verhandlungsgeschick und das Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Aber an diesem schrecklichen Tag war nichts mehr so, wie ich es kannte. Am allerwenigsten ich selbst. Ganz von selbst tat ich etwas, was gar nichts mit der Canda zu tun hatte, die ich bisher gewesen war. Ein Teil von mir beobachtete fassungslos, wie ich meine Hand zur Faust ballte und ausholte. Der Schlag brachte mich selbst aus dem Gleichgewicht und meine Hand schmerzte, so fest hatte ich zugeschlagen. Ich sah noch, wie Blut von der wulstigen Unterlippe des Wächters auf den makellosen weißen Kragen tropfte. Dann geschah alles so schnell, dass ich nicht folgen konnte. Ich hatte noch nie in meinem Leben richtigen Schmerz kennengelernt. Umso überraschter war ich, wie weh ein Hieb gegen die Rippen tat. Für einige Augenblicke tanzten nur grelle Zacken von Schmerz vor meinen Augen, die Luft schien aus meinen Lungen gesaugt zu werden. Eine Sekunde später fand ich mich zusammengekrümmt auf dem Boden kniend wieder, ein Arm über meiner Kehle drückte so fest zu, dass ich nicht einmal mehr schreien konnte.
»Du legst es also darauf an, ja?«, zischte der Leibwächter mir ins Ohr. »Loslassen«, befahl eine leise Stimme. »Sofort.«
Wie eine Marionette, deren Fäden abgeschnitten worden waren, fiel ich vornüber.
Marmor kühlte meine glühende Wange, dann hüllte eine andere Umarmung mich ein – und der vertraute Duft von Zedernholzparfüm. Vor Schock und Erleichterung begann ich zu schluchzen und klammerte mich zitternd an meine Mutter.
»Hör auf zu weinen«, befahl sie. »Los, steh auf.«
Wie immer klang ihre Stimme sachlich, die Besorgnis hörte man kaum hindurch. Meine Eltern mussten direkt von einer der nächtlichen Besprechungen aus den Konferenzsälen gekommen sein. Sie waren in geschäftliches Grau gekleidet; mein Vater hatte Tintenflecken am Zeigefinger. Ihre beiden Leibwächter – altgediente Männer, die ich schon kannte, solange ich lebte – hatten sich zwischen mir und den Türwächtern aufgestellt.
»Bist du verletzt?«, fragte meine Mutter. Ich schüttelte den Kopf, obwohl meine Rippen stachen und brannten, und würgte die restlichen Tränen herunter. Eine Moreno weint nicht, hallte mir eines der ehernen Gesetze unserer Familie im Kopf. Behutsam, aber unnachgiebig half meine Mutter mir auf die Beine. Jetzt entdeckte ich auch Vida und meine Freundinnen, hastig angekleidet drückten sie sich etwas weiter hinten im Flur herum. Vermutlich hatten sie meine Eltern gerufen.
Obwohl ich immer noch zitterte, schämte ich mich, ein solches Bild zu bieten. Mein Haarknoten hatte sich im Handgemenge gelöst, wirr hingen mir die welligen Strähnen über das Gesicht. Hastig strich ich sie mir aus der Stirn und hinter die Ohren, wischte mir die Tränen mit dem Handrücken ab und sah meine Mutter an. »Gütiger Himmel«, murmelte sie. Sie packte mein Kinn und drehte mein Gesicht hin und her. Mit einem raschen Seitenblick auf meine Freundinnen nahm sie ihr graues Schleierhalstuch ab und warf es mir über den Kopf, als wollte sie mein Gesicht verhüllen. Hatte ich von dem Kampf mit dem Leibwächter eine Schramme im Gesicht? Oder sollte einfach niemand mein verweintes Gesicht sehen?
»Dafür werdet ihr bezahlen«, sagte mein Vater sehr ruhig zu den Türwächtern. Er musterte die beiden Männer mit seinem Richterblick, der schon Unschuldigen den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hatte. »Niemand legt ungestraft Hand an eine Moreno.« Es klang wie ein beiläufig gesagter Satz, fast freundlich, aber alle wussten, dass in dem Moment, als mein Vater den Blick abwandte, zwei Leben unwiderruflich zerbrachen. Die beiden Wächter wurden so weiß im Gesicht, dass sie in ihren dunklen Anzügen wie Schwarzweißfotografien wirkten.
»Komm!« Meine Mutter wollte mich mit sich ziehen, aber endlich erwachte ich aus dem Schock und machte mich los. »Nein, ich muss zu Tian!«
»Sie hat gesagt, ihm ist etwas passiert«, kam mir Vida zu Hilfe. »Deshalb ist sie losgerannt. Sie spürt, dass ihm etwas zugestoßen ist!«
»Das ist Unsinn«, erwiderte mein Vater unwillig. »Das Zentrum ist der sicherste Ort der Welt.«
»Aber warum fühle ich ihn dann nicht mehr?«, flüsterte ich. »Es ist, als wäre die Verbindung zwischen uns … abgerissen!«
Meine Mutter begriff schneller als mein Vater. »Minas!« Mehr als den Namen meines Vaters musste sie nicht sagen. Mein Vater winkte seine Leibwächter herbei. Sie entsicherten ihre Revolver und öffneten die Tür. Ein Rechteck aus Schwärze und Stille tat sich auf. Ich wollte mich hineinstürzen, doch schon nach einem Schritt sackten meine Knie unter mir weg. Und schon waren meine Freundinnen neben mir, ergriffen meine Hände, legten den Arm um meine Taille, hielten mich aufrecht, während ich mit den Lippen nur stumm Tians Namen formte. Und in Gedanken die Worte: Bitte nicht!
Meine Mutter redete auf mich ein, aber ich hörte sie nur noch wie ein Echo aus der Ferne. Die Kraft verließ meine Beine endgültig. Glühende Motten begannen vor meinen Augen zu tanzen und der Boden wurde zu einem Mahlstrom aus Marmor.
* * *
Als ich das zweite Mal an diesem Tag erwachte, blickte ich auf Lichtflecken an der Wand. Die roten Strahlen der Morgensonne fielen durch Fensterläden aus geschnitztem, durchbrochenem Elfenbein und beleuchteten das hölzerne Relief an der Wand: das Zeichen des Augensterns, Wahrzeichen meiner Familie. Um das Relief schlang sich die rote Schlange, gefertigt aus Korallen. Das war das Zeichen von Tians Familie, den Labranakos, die vor hundert Jahren von den Perlinseln in die Stadt kamen, um Handel zu treiben und heute zum Fünfgestirn der höchsten Familien zählten.
An der Wand unter dem Doppelbild befand sich mein Kerzenleuchter aus lackiertem Schwarzholz. Vier Kerzen in meiner Lieblingsfarbe – rot – reihten sich darin auf. Ich war also zu Hause. Meine Eltern und Vida saßen an meinem Bett. Für einen Augenblick schien Tians Gegenwart so nah, dass ich erwartete, ihn ebenfalls an meinem Bett sitzen zu sehen – in den grünen Augen ein verschmitztes Lächeln, die linke Augenbraue spöttisch hochgezogen. Ich konnte seine Stimme fast hören. »So schlecht geträumt, mein schöner Stern?«
Aber dann fiel die Wirklichkeit auf mich zurück. Schmerz pulste bei jedem Atemzug durch meine Seite, dort, wo der Hieb mich getroffen hatte. Es kostete mich unendlich viel Kraft, auch nur zu flüstern.
»Ist er … tot?«
»Zumindest schläft er wie ein Toter«, antwortete mein Vater in seiner trockenen Art. »Die jungen Männer liegen friedlich und unversehrt im Bett. Die Lampe war ausgegangen, wir haben sie wieder entzündet. Und da sah ich deinen Rotschopf, das Gesicht im Kissen vergraben. Er hat friedlich geatmet und die anderen schnarchen vor sich hin. Sie schlafen immer noch ihren Rausch aus. Nichts ist ihm zugestoßen, Canda. Gar nichts.«
Ich hatte nie gewusst, wie es sich anfühlte, weiterleben zu dürfen, nachdem man gedacht hatte, man würde sterben. Wenn man geglaubt hatte, dass eine Hälfte des eigenen Ichs unwiderruflich verloren war, der Mensch, den man am meisten liebte, tot – und dann erkannte, dass alles nur ein böser Traum gewesen war. Jetzt musste ich mich beherrschen, um nicht laut und würdelos zu schluchzen, so glücklich war ich. Meinem Geliebten ging es gut, ich würde morgen neben ihm aufwachen und seine Lider sacht mit den Lippen streifen, um ihn zu wecken. Und er würde mir sein verschlafenes, verliebtes Lächeln schenken und mich Stern nennen. Ich würde ihn küssen, die Finger in seinen roten, weichen Locken vergraben, versunken in seinen Lippen und seinem Atem.
»Danke!«, flüsterte ich aus tiefstem Herzen, ich weiß nicht, zu wem.
Mein Vater stand abrupt auf und ging wortlos aus dem Raum. Noch nie hatte er sich ohne Gruß von mir abgewandt. Aber ich verstand es sogar. Ich hatte mich würdelos benommen, von Angst und kindischem Aberglauben getrieben wie eine Niedere. Für meinen stolzen Vater, dem das Ansehen unserer Familie über alles ging, gab es nichts Schlimmeres.
Ich schämte mich unendlich. Aber das Schlimmste war, dass ich auch noch zwei Unschuldige mit meinem Auftritt ins Unglück gestürzt hatte. Vermutlich hatten die Wächter mich tatsächlich nicht erkannt, ich hatte mich benommen wie eine Wahnsinnige, nicht wie eine Hohe Tochter. Vielleicht konnte ich Tians Familie davon überzeugen, die Männer wenigstens nicht zu töten.
»Es tut mir leid«, sagte ich in die Stille. »Ich verstehe selbst nicht, was in mich gefahren ist.« Meine Stimme war immer noch schwach und ohne Klang. Ich versuchte mich trotzdem an einem zaghaften Lächeln. Vida biss sich auf die Unterlippe und blickte schnell weg.
Meine Mutter schwieg immer noch, in den Händen hielt sie das graue Schleiertuch.
Draußen wirbelte der Sand mit leisem Sirren durch einen Luftschacht zwischen zwei Häusern. Das Geräusch brachte Tian zu mir. In den kühleren Sommernächten saßen wir in letzter Zeit oft auf dem Dach und lauschten gemeinsam diesem Lied des Sandes. »Warum bin ich nicht im Prunkzimmer?«, brach ich das Schweigen.
»Die Fragen stelle ich, Tochter«, erwiderte meine Mutter barsch.
Ich biss mir auf die Unterlippe. Es war nicht der Zeitpunkt, einen Streit darüber anzufangen, dass sie mich wie ein kleines Mädchen behandelte. Sie würde es auch diesmal nicht verstehen, denn so ähnlich wir uns sahen, in unserem Wesen waren wir wie Feuer und Wasser. Zu Vida war meine Mutter zärtlich und freundlich, bei mir aber kannte sie keine Nachsicht. Auf eine Art verstand ich es: Ich war die Ältere, auf mich kam es an. Die Hoffnungen meiner Familie standen und fielen mit mir. Aber als Kind hatte ich oft darunter gelitten, nie wirklich ihre Tochter sein zu dürfen. Dennoch hatte ich großen Respekt vor meiner Mutter, denn es gab keine sachlichere und unbestechlichere Richterin. Zusammen mit der Kombinationsgabe und der Autorität meines Vaters bildeten meine Eltern die höchste Richterzweiheit der Stadt. Und selbst jetzt machte meine Mutter aus der Situation ein Verhör.
»Was ist heute Nacht passiert, Canda?«
Es hatte keinen Sinn, sich herauszureden. »Ich … habe geträumt. Und ich war verwirrt davon. Ich weiß, es war dumm. Es tut mir leid.«
»Was habt ihr Mädchen heute Nacht getan? Alle Details! Haben deine Freundinnen jemanden ins Brautzimmer gelassen? Oder war jemand dort versteckt?«
»Wir haben nichts Falsches getan!«, meldete sich Vida zu Wort. »Das habe ich dir doch schon erklärt, wir …«
»Schweig! Ich rede mit deiner Schwester!«
»Und niemand war bei uns«, bestätigte ich.
»Habt ihr die Rituale verändert oder nicht ausgeführt?«
»Nein! Glaubst du, ich weiß nicht, was ich zu tun habe?«, schnappte ich.
Meine Mutter beugte sich zu mir und starrte mir prüfend in die Augen. Wenn wir uns so nahe waren, war es stets ein bisschen so, als blickte ich ein gealtertes Spiegelbild an. Ich hatte das dunkle, wellige Haar mit den goldenen Lichtern von ihr geerbt. Und auch ihre braunen Augen. Sie hatten eine ungewöhnliche Form, leicht mandelförmig, betont durch Brauen, die wie Schwalbenflügel in einem kleinen Aufwärtsschwung endeten. »Das sind die weitsichtigen Wüstenaugen unserer Vorfahren«, so hatte meine Mutter einmal voller Stolz erklärt. »Wir Morenos blicken stets voraus und wie Vögel im Flug, weiter als die anderen – bis zu den Sternen!«
Und auch wenn sie nun in ihrem eng sitzenden, modernen Kleid aus grauer Seide vor mir saß, konnte ich sie mir mühelos als Kriegerin aus lang vergangener Zeit vorstellen – eine Ahnin in Ledertracht, die mit Pfeil und Bogen schoss und die Sterne anbetete. Jetzt jagte sie der Wahrheit hinterher. Sie konnte Lügen wittern wie ein Hund die Fährte eines Flüchtenden, das war ihr Talent.
»Gut, ich glaube dir, Canda. Dann muss es eine andere Ursache geben. Was genau ist in dem Traum passiert? Woran erinnerst du dich? Jedes Detail ist wichtig, also konzentriere dich.«
Schon jetzt würde dieser Tag der seltsamste in meinem Leben sein. Aber diese Aufforderung ließ mich endgültig daran zweifeln, dass ich wirklich aufgewacht war. Meine Mutter, die strengste Richterin der Stadt, wollte etwas über Hirngespinste wissen.
»Ich erinnere mich kaum. Nur an Eindrücke. Gesichter und Schreie. Als wäre ich in einen Kampf verstrickt. Und als ich aufwachte, da … fühlte ich mich schwach und ich hatte Angst.« Ich schluckte schwer. »Es war albern. Tian geht es gut.«
Ich hörte nicht auf die leise Stimme in meinem Inneren, die mich fragte, warum dann immer noch die Leere in meiner Brust hallte, im Zwerchfell, in der Kehle. Als bestünde ich dort nur aus Rauch wie ein Geist.
Rasch senkte ich den Kopf. Mein Blick fiel auf Mutters Hände. Sie umklammerten den grauen Schleier so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. Ich weiß nicht, warum mich diese kleine Geste mehr erschreckte als alle Träume zusammen.
»Warum … bin ich nicht im Prunkzimmer?«, wiederholte ich meine Frage von vorhin.
»Weil du heute nicht heiraten wirst.«
»Was?« Mein Schrei brach sich an den Wänden.
Sie richtete sich noch etwas mehr auf, ein Bild der Beherrschtheit und Strenge. »Die Verbindung wird nicht geschlossen, bis … alles geklärt ist. Wir werden Tians Familie ausrichten, dass du krank geworden bist und dich erst erholen musst.«
»Nichts muss geklärt werden! Und ich bin nicht krank.«
»Du hast unsere Entscheidungen nicht in Frage zu stellen.«
»Es ist nicht mehr eure Entscheidung!«, schleuderte ich ihr entgegen. »Sondern die von Tian und mir!«
»Da irrst du dich. Noch seid ihr nicht verbunden. Und solange du noch unvollständig bist, hast du die Pflicht, uns zu gehorchen.«
Ich wollte aus dem Bett springen, aber Vida war mit einem Satz bei mir und fasste mich an den Schultern. »Beruhige dich doch«, bat sie mit sanfter Stimme. »Du bist noch zu schwach. Glaub mir, es ist das Beste so.«
So grob, wie ich es von mir selbst nicht kannte, schlug ich Vidas Hand weg und ignorierte dabei den dumpfen Schmerz in meiner linken Seite.
»Ich gehe zu Tian, wann ich es für richtig halte. Und zwar jetzt!«
»Du kannst nicht zu ihm.« Meine Mutter räusperte sich und zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich, wie ihre Stimme leicht zitterte.
»Ist Tian doch etwas zugestoßen?«, flüsterte ich.
»Nicht ihm«, erwiderte Vida leise. Es schien sie Überwindung zu kosten, mich direkt anzusehen. Sie schluckte dabei und ihre Augen glänzten verdächtig.
Ich tastete über meine Wangen, meine Stirn, aber ich fand keine Wunde, nicht einmal eine schmerzende Stelle.
»Schau in den Spiegel«, sagte meine Mutter. »Und dann entscheide selbst, ob du wirklich zu deinem Bräutigam gehen willst.«
* * *
Das Licht flutete über das Silber in unserem Badezimmer und das Waschbecken aus schwarzem Onyx. Ich schleppte mich zum Wasserhahn. Mit beiden Händen schaufelte ich das Nass in mein glühendes Gesicht. Die Kälte tat unendlich gut. Aufatmend hob ich den Kopf und sah mich an.
Ich musste mich am Waschbecken festhalten, um nicht zu fallen.
Von der anderen Seite des Spiegels starrte mich eine Verrückte an. Das palisanderbraune Haar klebte nass und wirr an Stirn und Schultern. Weit aufgerissene Augen glühten in einem fahlen Gesicht. Die Fremde stolperte zeitgleich mit mir vom Spiegel weg und verzog den Mund, als würde die hastige Bewegung schmerzen. Die Prellung an meinen Rippen stach.
»Wer …?«, flüsterte ich und der Spiegelmund formte sich zu diesem Wort. Und jetzt wurde mir mit einem Schlag klar, wem ich gegenüberstand. Das war eindeutig mein Mund mit dem winzigen, sternförmigen Muttermal neben dem rechten Mundwinkel. Es war mein Gesicht … irgendwie. Und auch wieder nicht. Das Mädchen im Spiegel sah zwar genauso aus wie Canda Moreno – aber sie war es nicht. Sie war hässlicher und unscheinbar, ohne dass man sagen konnte, woran es lag. Etwas Wesentliches schien zu fehlen, ich wusste nur nicht, was es genau war.
Zum ersten Mal in meinem Leben kostete es mich Überwindung, näher zum Spiegel zu treten. Kein Zweifel, es war mein Gesicht mit den klaren Zügen, die fast ein wenig scharf wirkten. Und auch meine Wüstenaugen. Normalerweise strahlten sie, als würden sich Funken darin fangen, aber heute wirkten sie … nichtssagend, wie erloschen. Auch meine Haut wirkte wie ausgewaschen, nichts schien zusammenzupassen. Das Schlimmste aber war, dass ich fast so aussah wie eine der Gewöhnlichen aus dem mittleren Ring, die im Rang so tief unter mir standen wie eine Sandkrabbe unter einem Stern am Himmel. Was hatte der Leibwächter gesagt? »Die Ähnlichkeit ist da, und passend verkleidet ist sie auch.«
Ich weiß nicht, wie ich aus dem Bad gekommen war. Ich hatte nur den blinden Gedanken, zu meiner anderen Hälfte zu flüchten. Tian würde mich wiedererkennen und auf seine übermütige Art lachen. Er würde mich küssen und diesen Albtraum vertreiben.
Vida wollte mich wieder zurückhalten, aber meine Mutter bedeutete ihr mit einer knappen Geste, dort zu bleiben, wo sie war. Sie selbst machte keine Anstalten, mich am Gehen zu hindern, und sie sagte auch nichts, als meine Hand schon auf der Klinke lag.
Es war fast eine tröstliche Erkenntnis, dass selbst im Nebel von Panik und Verwirrung ein Teil von mir nicht verschwunden war: der Teil, der begriff, worum es wirklich ging. Nicht um mich, denn alles war verbunden. Wir stiegen auf und wir fielen gemeinsam. So war es seit jeher. Hier herrschte niemand allein, nur Mann und Frau zusammen ergaben das Ganze. Aber nun war Tians und meine Zweiheit in Gefahr – auch wenn er es noch nicht ahnte. Denn irgendetwas Schreckliches war mit Canda Moreno geschehen. Das, was mich ausmachte, war einfach verschwunden. Irgendetwas hatte den Glanz von meiner Haut genommen, den Klang aus meiner Stimme, die Stärke aus meinen Knochen und den Mut aus meiner Seele.
Ich ließ die Klinke los und trat einen Schritt zurück. Wie in Trance drehte ich mich um. »Er darf mich nicht so sehen«, flüsterte ich.
Meine Mutter stand auf und strich sich den schmalen Rock glatt. Mit gemessenen Schritten kam sie auf mich zu.
»Das beruhigt mich, Canda, denn es zeigt mir, dass du trotz allem noch eine Moreno bist.«
Ich wünschte, sie hätte nicht so erleichtert geklungen.
»Ich bin gestorben«, flüsterte ich mit dieser Stimme, die mir fremder war denn je.
Und an diesem Tag, an dem nichts mehr so war wie zuvor, trat meine Mutter auf mich zu, nahm mich vorsichtig in die Arme und streichelte meinen Rücken wie einmal vor sehr langer Zeit, als ich ein kleines Mädchen gewesen war und wir uns nach einem Streit wieder versöhnt hatten.
»Scht, sag so etwas nicht«, murmelte sie in mein Haar. »Alles wird gut, Canda.«
Doch wir beide wussten, dass meine Mutter zwar die beste Richterin, aber die schlechteste Lügnerin war.
Scherben und Gold
Vida hatte alle Spiegel abgehängt und die Fensterläden geschlossen, ohne dass ich sie darum bitten musste. Ich ertrug keinen Sonnenstrahl, nicht einmal ein flüchtiges Spiegelbild in einer Fensterscheibe.
Draußen vor der Tür hörte ich aufgeregte Stimmen, schnelle Schritte, zufallende Türen. Ich konnte mir denken, was in unseren Räumen gerade vorging: Meine Eltern hatten unsere Blutsverwandten zu sich gerufen. Die meisten von ihnen bekleideten hohe Ämter in der Stadt. Die Dienstboten waren fortgeschickt worden, der Familienrat tagte im Geheimen. Seit Stunden wurden Strategien ersonnen, es wurde diskutiert und entschieden, was als Nächstes zu tun war – zum Wohle der Morenos. Nur unsere Arzt-Zweiheit – ein Cousin meines Vaters und seine Frau – hatten mich kurz besuchen dürfen. Dass meine Eltern meine anderen Verwandten nicht zu mir ließen, machte mir noch einmal schmerzhaft klar, wie schlimm es um mich stand. Aber das Einzige, woran ich denken konnte, war: Wie hatte Tian auf die Nachricht reagiert, dass ich krank war? Machte er sich große Sorgen um mich? Und warum spürte ich seine Gegenwart nicht mehr?
Ich war fast dankbar, als die Tür aufging und ein Lichtstrahl in meinen Kokon aus Düsternis schnitt. Vida schlüpfte ins Zimmer und ließ sich neben mich auf das Bett fallen.
»Haben sie schon etwas beschlossen?«, flüsterte ich. Meine Stimme konnte ich schon nicht mehr ertragen, und noch viel weniger die Furcht darin.
»Nein, vor einer halben Stunde sind sie gegangen. Aber bis zuletzt haben sie noch diskutiert, ob Tians Familie eine andere Tochter an deine Stelle setzen würde.«
Eine andere Schwester hätte mir den Kopf mit Hoffnungen gefüllt, mir versichert, dass die Hochzeit bestimmt noch stattfinden würde, aber Vida war hart im Verhandeln und ebenso hart in ihrer Ehrlichkeit. Und ich wusste es ja auch selbst: Natürlich hatten die höchsten Familien immer einen Ausweichplan, eine zweite mögliche Verbindung in der Hinterhand. Denn es kam zwar selten vor, aber es geschah: Krankheit oder Tod konnte einander Versprochene trennen, selbst in unserer Familie war es schon passiert. Je nach Nutzen wurde dann ein neuer Partner gefunden, dafür musste natürlich ein anderes Versprechen gelöst werden, was mit Geld und Privilegien teuer bezahlt wurde. Selbst wenn der neue Partner nie gut genug passte – es war besser als nichts, denn eine Zweiheit zu sein war das Wichtigste. Ich war sicher, dass auch meine Eltern hinter meinem Rücken schon in meiner Kindheit solche Abmachungen getroffen hatten – für den Fall, dass Tian starb.
Vida schmiegte ihre Stirn an meine Schulter und schniefte. Im Dunkeln tastete ich nach ihrer Hand.
»Nicht weinen, Floh!« Es tat unendlich gut, für einige Momente wieder ihre große Schwester sein zu können.
»Ich weine nicht«, kam es mit dünner Stimme zurück. Sie umklammerte meine Finger so fest, dass es schmerzte, und schniefte wieder.
»Denken sie darüber nach, deine Verbindung mit Lewin zu lösen?«
Haar rieb an meiner Wange, als sie nickte. Zarter Duft nach Rosenwasser stieg in meine Nase. »Ja, sie haben überlegt, ob ich an deine Stelle treten kann. So würde wenigstens die Verbindung der beiden Familien bestehen bleiben. Onkel Nosan und Tante Sil wollen bei den Anwälten von Lewins Familie vorfühlen, wie viel eine Auflösung unseres Versprechens kosten würde. Ich will aber nicht Tian! Er gehört zu dir und ich bleibe lieber allein, als dich unglücklich zu machen. Und ich … ich habe doch Lewin!«
Obwohl der Gedanke, einen Ersatz für mich zu bieten, völlig logisch war, kränkte mich dieser Schachzug meiner Familie. »Da haben Onkel Nosan und die alte Hexe Sil die Rechnung ohne uns gemacht, Floh. Mach dir keine Sorgen. Tian wird mich niemals aufgeben. Eher würde er sterben oder sein Dasein als Einzelner fristen, als eine andere zu nehmen. Wir sind nicht nur Versprochene. Wir lieben uns!« Diese Gewissheit war tröstend und wärmend, die letzte Sicherheit. Und gleichzeitig mein größter Kummer. Denn was auch immer mit mir passiert war – es würde uns im schlimmsten Fall beide in den Abgrund reißen.
Vidas Griff lockerte sich, aber sie ließ meine Hand nur zögernd los. »Mutter hat seinen Eltern ausrichten lassen, dass du krank geworden bist. Sie haben Tian sofort wecken und aus dem Prunkzimmer rufen lassen. Und gerade … sind sie hergekommen.«
Jetzt fühlte ich mich doch krank – wie von einem jähen Fieber ergriffen. »Tian ist hier?«
»Scht! Nicht so laut. Nein, nur seine Eltern. Sie sind sehr aufgebracht. Mutter und Vater versuchen gerade, sie wieder wegzuschicken. Aber Manja besteht darauf, dich zu sehen. Sie weint sogar!«
Der Name von Tians Mutter war wie ein Lichtstrahl. Natürlich sorgte sie sich um mich, in ihrem Herzen war ich längst schon ihre Tochter. Und wenn sie schon verrückt vor Sorge um mich war – wie ging es dann erst meinem Geliebten?
»Vater hat mich zu dir geschickt«, fuhr Vida flüsternd fort. »Ich soll so tun, als hätte ich mit den Ärzten geredet. Ich muss wieder zurück.«
Sie sprang vom Bett und eilte hinaus. Die Tür blieb angelehnt. Vida kannte mich und wusste, ich war vernünftig genug, im Zimmer zu bleiben. Nur, dass heute nichts mehr vernünftig und logisch war. Mühsam erhob ich mich und tastete mich zur Tür. Aber als müsste ich mir beweisen, dass ich trotzdem noch die kühl denkende hohe Tochter war, zog ich den Schleier über den Kopf und schlüpfte erst dann aus dem Raum.
Die palastartigen Gemächer meiner Familie lagen direkt unter der Kuppel eines der ältesten Türme. Als Kinder hatten meine Schwester und ich in dem Labyrinth aus geschnitzten Raumteilern, Flügeltüren und verborgenen Winkeln gespielt. Und mehr als einmal hatten wir aus unseren Verstecken heraus heimlich die Gespräche unserer Eltern belauscht. Jetzt führten mich die alten Schleichwege hinter Vorhängen und an Paravents vorbei zu der großen Flügeltür des Empfangsraums, der nur höchsten Gästen vorbehalten war.
Die Wände neben den Türen waren mit Mosaiken von goldenen Wüstendünen geschmückt. Davor stand eine Kommode, auf der eine Kristallvase voll roter Rosen thronte. Der Blumenduft war betäubend stark. Meine Mutter bekam Kopfschmerzen davon, aber es gehörte sich für die Höchsten, die teuersten Blumen aus den Gewächshäusern als Schmuck zu besitzen.
An der inneren Rückwand der Kommode ertastete ich das kleine sternförmige Schloss. Mein Familienring passte genau in die Form, als Kind hatte ich in Vaters Schubladen und Aufzeichnungen spioniert und dieses Geheimnis herausgefunden. Es klickte, als ein verborgener Mechanismus einen Zugang zum Mörderwinkel öffnete. So leise ich konnte, kroch ich durch die Öffnung in der Rückwand bis in die Kammer hinter der Mauer. Sie war enger, als ich sie aus Kinderzeiten im Gedächtnis hatte. Einst war das der Platz für einen Lauscher gewesen – viel öfter aber für einen Mörder.
Der Rosenduft verlor sich. Hier drinnen roch es nur nach Jahre altem Staub. Über mir befand sich die Scharte an der Wand. Dünne Lichtlinien zeichneten den Umriss der Klappe, und ich hörte bereits die Stimmen gedämpft aus dem Empfangsraum in die Kammer dringen. »Sie schläft immer noch, Hohe Mutter«, hörte ich Vida so höflich sagen, wie die Regeln es in Gesellschaft vorschrieben. »Ihr Fieber ist zwar nicht weiter gestiegen, aber die Ärzte sagen, man solle sie nicht wecken und niemand darf zu ihr. Sie versichern aber, in einigen Tagen wird es ihr besser gehen.«
Man hörte das zuversichtliche Lächeln in ihrer Stimme. Neben ihrer Autorität und ihrer Härte bei Verhandlungen war es das dritte Talent meiner Schwester, glaubhafter als jeder andere lügen zu können.
Ich schob mich an der Wand hoch, der Schleier rutschte mir vom Kopf und ich ließ ihn liegen. Auf Kehlenhöhe befand sich eine schmale Klappe, breit genug für einen Pfeil oder für den Lauf einer Pistole. In der Gründungszeit der Stadt hatte diese gut verborgene Öffnung dazu gedient, den Gesprächen im Gastzimmer zu lauschen – und die Waffe ständig auf ein Ziel gerichtet zu halten, um das Hohe Paar des Hauses zu schützen. Mein Vater sagte stets, es sei kein Zufall, dass für den Boden des Raumes roter Marmor ausgewählt worden war. So verdarb das Blut unserer Feinde keinen hellen Stein.
»Da hörst du es, Manja«, ertönte die sachliche Stimme meiner Mutter. »In ein paar Tagen geht es ihr besser.«
Lautlos schob ich die Klappe zur Seite. Auf der anderen Seite der Wand verbargen ein besonders aufwendiges Mosaik und eine kleine Nische die Scharte. Ich dagegen sah den ganzen Raum: Etwa ein Dutzend strategisch angebrachter Zierspiegel im Raum ermöglichten es mir, jeden Winkel im Auge zu behalten. Es gab mir einen Stich, Tians Eltern zu sehen. Sonst hatte Manja immer ein Lächeln im Gesicht, aber heute waren ihre Augen verschwollen vom Weinen, sie war aschfahl und ihre Lippen zitterten, nur mit Mühe hielt sie die Tränen zurück. Tians Vater, ein ernster Mann mit weichen Zügen und heller Bronzehaut, legte ihr die Hand auf die Schulter, aber sie streifte sie unwirsch ab. Rote Korallenarmreife klapperten. »Nein, Isané!« Manja schüttelte den Kopf. In einem der Spiegel sah ich, wie ihre roten, langen Locken bei dieser Geste auf dem Rücken tanzten wie Seeschlangen. »Canda ist nicht krank!«
Egal, wie zornig Manja war – ihre Stimme war immer wie ein warmer Klang, sie füllte den Raum und brachte jedes Herz zum Schwingen. Und so erschrocken ich über ihre respektlose Antwort war – irgendein kleiner, fremder Teil von mir war seltsamerweise froh darüber, dass sie die Lüge meiner Familie nicht glaubte.
Meine Mutter bekam schmale Augen. »Natürlich ist sie krank! Hast du vergessen, wie eure Wächter sie vor Tians Tür behandelt haben?«
»Wenn es Canda war«, erwiderte nun Tians Vater. »Die Wächter schwören, es war ein anderes Mädchen.«
»Du glaubst deinen Wächtern mehr als uns?« Jetzt war meine Mutter ganz Richterin, eisig, beherrscht und gefährlich, mit harten Lippen und klarem Blick. Die Luft schien um einige Grad kälter zu werden.
Aber Tians Eltern ließen sich nicht einschüchtern.
»Sagt uns endlich die Wahrheit!«, entgegnete Manja. »Wenn das Mädchen wirklich Canda war, warum habt ihr sie dann heute Morgen nicht zu Tian gelassen – sie war völlig aufgelöst und wollte doch zu ihm?«
Meine Eltern verständigten sich mit einem einzigen Blick, mit dem Gleichklang sehr inniger Paare, der mir als Kind oft das Gefühl gegeben hatte, weit außerhalb von jeglicher Bindung zu stehen, allein und unvollständig.
»Glaubt ihr im Ernst, sie hätte sich nach diesem Angriff noch in den Prunkraum geschleppt?«, sagte mein Vater so leise, wie er vorher mit den Wächtern gesprochen hatte. »Sie wurde mit der Faust niedergeschlagen! Sie stand unter Schock und konnte vor Schmerz kaum noch laufen. Sorgt ihr so für die Sicherheit und Achtung eurer zukünftigen Tochter?«
Mir war so schwindelig, dass ich die Augen schließen musste. Aber hinter meinen geschlossenen Lidern stand immer noch das Bild: zwei Familien, kurz davor, aus einem Funken Misstrauen ein Feuer aus Anschuldigungen und Feindschaft zu entfachen, das uns alle und unsere Pläne verbrennen würde. An einem anderen Tag wäre es für mich ein Leichtes gewesen, einen Weg zu finden, um sie wieder zu versöhnen, mit einem Wort, einem Lächeln, einem klugen Einwand. Sterne am Himmel, helft!, flehte ich. Wenn unsere Eltern jetzt im Streit auseinandergingen, war alles aus.
Aber Manja ging auf die Vorwürfe nicht ein. »Minas! Isané! Wir vier kennen uns doch schon seit unseren Kindertagen. Auch in schlimmsten Zeiten vertrauten wir einander und haben es nie bereut. Und jetzt teilen wir das schlimmste Unglück – und das in einer Zeit wie jetzt, in der immer mehr Sicherheiten und Bündnisse zerbrechen. Also sagt uns, was wirklich geschehen ist!«
Vater schüttelte scheinbar ratlos den Kopf. »Eine verschobene Hochzeit ist doch nicht das schlimmste Unglück.«
»Habt ihr kein Herz? Wie könnt ihr so ruhig und kalt sein! Ich spreche davon, dass unseren armen Kindern etwas Schreckliches zugestoßen ist!«
Manja brach in Schluchzen aus und die Leere in mir wurde zu einem Abgrund. Jetzt begriff ich. Tian ist dasselbe passiert wie mir!
»Was soll denn eurem Sohn Schreckliches zugestoßen sein? Ich habe ihn vor wenigen Stunden noch gesehen. Friedlich schlafend, im Kreis seiner Freunde und Brüder.« Es war Vaters Richtertonfall. Interessiert, sachlich, aber er war auf der Hut, bedacht darauf, als Erster Informationen zu erhalten, bevor er selbst seine Karten auf den Tisch legte.
Jetzt verlor auch Tians so sanfter Vater die Geduld. »Was hast du gesehen, Minas? Was?« Noch nie hatte ich ihn schreien gehört. »Seine Entführer? Warum vertuscht ihr, dass Canda auch verschwunden ist?«
Auch verschwunden? Stein glitt vor meinen Augen entlang, ich sackte zusammen. Alles bekam einen furchtbaren Sinn. Mein Traum – und das Gefühl der Leere.
»Wir wissen nicht, wovon ihr sprecht«, sagte Mutter mit einer Stimme, die so neutral war wie weißes Papier.
»Versuch nicht, uns für dumm zu verkaufen«, brüllte Manja. »Tian wurde entführt! Es muss von langer Hand geplant worden sein. Und eure Canda ist auch verschleppt worden! Was spielt ihr für ein Spiel, dass ihr es verheimlicht und …«
Irgendwo in weiter Ferne hallte ein rauer, verzweifelter Schrei. Aber erst als ich keine Luft bekam, begriff ich, dass er aus meiner Kehle gekommen war. Ich versuchte zu atmen, aber die Kammer schien sich um mich zu schließen und mich zu ersticken.
Das Nächste, woran ich mich erinnere: Holz unter meinen Fingern, blendendes Licht, die Vase, die auf dem Marmor zersplitterte. Blumenwasser und Rosenblätter, die wie Blutflecken an meinen nassen Ärmeln und meinen Händen klebten. Und dann richtiges Blut von meinen Fingern, die blind in die Scherben griffen, während ich versuchte, auf die Beine zu kommen. Die Flügeltüren öffneten sich und Manja und die anderen stürzten in den Flur. Manja entdeckte mich als Erste auf dem Fußboden, inmitten von Scherben und Blütenblättern. Sie stürzte mit einem Ausruf des Erstaunens auf mich zu und wollte mich umarmen, aber als ich den Blick hob und ihr ins Gesicht sah, prallte sie entsetzt zurück.
»Wir müssen ihn finden!«, schluchzte ich. Manja und Oné wichen zurück, als hätte ich eine ansteckende Krankheit.
Vater packte mich am Arm und zog mich hoch. Und während meine Eltern und Vida mich aus dem Flur führten, hörte ich, wie Tians Vater fassungslos murmelte: »Gütiger Himmel!«, und wie Manja flüsterte: »Das arme Kind. Sie wäre besser gestorben.«
Der Falke
Die Arzt-Zweiheit war schnell gekommen, und noch während ich schluchzend in die Kissen sank, spürte ich das kalte Brennen des Schlafmittels, das durch meine Vene den Arm hinaufkroch. Dann flossen Tag und Nacht ineinander und wurden zu einem bleiernen Grau. Die Medizin betäubte meinen Schmerz, aber sie verwandelte meinen Schlaf auch in etwas Dumpfes, Fremdes: die Träume erstarrten zu toten Bildern und Worten. Und immer wieder sah ich Tian vor mir. Er beugte sich über mich und blickte mich besorgt und zärtlich an – nein, er sah durch mich hindurch, als sei ich unsichtbar oder er auf seltsame Weise blind. Mit offenen Augen kam er näher, bis seine Lippen fast meine berührten. »Du bist nicht tot!«, brachte ich mit erstickter Stimme hervor. Ich schluchzte, oder vielleicht lachte ich auch aus Erleichterung. Ein Traum. Alles war nur ein böser Traum. Ich spürte seinen warmen Atem auf meinen Mund, als er zu mir sprach. »Wach auf, schöner Stern. Folge mir! Wir haben nicht viel Zeit …«
Am Rande meines Bewusstseins nahm ich wahr, wie meine Mutter meine Handgelenke mit Seidentüchern ans Bett fesselte, weil ich aufzustehen versuchte.
»Sie träumt immer noch! Gib ihr noch ein Schlafmittel!«
»Willst du sie vergiften, Isané?«
»Nein, aber sie ist nicht mehr sie selbst – und sie träumt, das siehst du doch!«
»Müssen wir sie morgen wirklich mitnehmen?«, fragte meine Schwester mit erstickter Stimme.
»Wir haben keine Wahl«, antwortete mein Vater. »Sie muss als Zeugin aussagen.« Und leiser fügte er hinzu: »Ich verstehe es nicht. Ich habe Tian doch gesehen. Er schlief!«
Mein Traum zerstob. Tian ist fort … und vielleicht ermordet. Ich wimmerte. Eine kühle Hand legte sich auf meine Augen. Bittere Flüssigkeit rann zwischen meine Lippen. Ich schluckte sie wie eine Verdurstende. Alles war besser, als den Verlust in seiner ganzen Wucht spüren zu müssen.
»Und jetzt hör endlich auf zu träumen«, beschwor mich meine Mutter. »Morgen musst du stark sein, Canda. So stark wie noch nie.«
* * *
Im Zentrum der Macht Ghans, im dreißigsten Stockwerk des Eisernen Turms, gab es nichts Altes, keine Winkel, keine Trennwände, die Verstecke bieten konnten. Und auch keinen Goldglanz, der einen Scharfschützen durch Reflexionen ablenken konnte. Nur Stahl, mattes Grau, zu weißes Licht und Fensterfronten aus Panzerglas. Die Klimaanlagen liefen bereits, es war kühl.
Auf jedem Flur, den wir entlanggingen, hielten die Leute inne und sahen uns nach. Meine Kehle war immer noch rau vom Schreien, meine Augen vom Weinen geschwollen, aber zumindest mein Körper hatte seine Balance wiedergefunden, ich brauchte niemanden mehr, der mich beim Gehen stützte.
Durch meinen Schleier konnte ich die Neugier in den Mienen der Schaulustigen sehen – und das schlecht gespielte Mitgefühl der Hohen, die uns nur scheinbar zufällig begegneten. Geheimnisse hüteten sich schlecht in unserer Stadt und ich wusste, keiner hatte Mitleid mit unserem Schicksal. Im Gegenteil: In den anderen Familien hielt man schon längst Sitzungen ab, um die Chancen eines neuen Paares auf den Mégantitel zu berechnen. Man überlegte bereits, wer unsere Stellen einnehmen würde. Heute war mir nichts gleichgültiger als das. Ich hatte mir stets eingebildet, besser als andere zu wissen, was Schmerz und Verlust bedeuten. Lange hatte ich geweint, als meine Tante die Traumkrankheit bekam und daran starb, und auch als eine junge Cousine ihren Verstand verlor, weil sie zu viel träumte und kein Arzt in der ganzen Stadt sie mit den stärksten Schlafmitteln gegen diese Krankheit davon abhalten konnte. Doch das war nichts im Vergleich zu Manjas Nachricht. Dort, wo mein Herz geschlagen hatte, pochte nur noch eine schwelende, siedende Wunde.
Eine Moreno weint nicht, wiederholte ich in Gedanken im Takt meiner Schritte. Sie ist stolz, nie zeigt sie ihren Schmerz und Kummer. Die Familiensätze füllten meinen Kopf, trugen mich vorwärts, jeder Gedanke an Tian hätte mich stürzen lassen und ich wäre nicht mehr aufgestanden. Aber ich musste aufrecht bleiben – ich musste zu den beiden Méganes. Sie waren die Einzigen, die ihm und mir helfen konnten. Niemals lässt sie sich in die Karten schauen, betete ich Silbe für Silbe, Schritt für Schritt, sie berechnet Chancen, blickt voraus und spricht als Letzte. Sie spinnt ihre Fäden und bringt Armeen zu Fall mit einem Wort, einem Versprechen, einer Strategie, einem Handel. Und manchmal mit einem Lächeln. Wenn es sein muss, verbindet sie Feuer und Wasser zu einem Schwert, das ihre Feinde tötet.
Vor einer bronzefarbenen Flügeltür, die ich nur zu gut kannte, blieben meine Eltern stehen. Schweigend warteten wir, bis sich die Flügeltüren öffneten. Ich machte mich darauf gefasst, einen Raum voller Menschen zu sehen – Diener höheren Ranges und Sekretäre des Mégan-Paares, Advokaten in grauen Anzügen, weitere Wächter, vielleicht sogar Tians Familie. Aber zu meiner Überraschung war der Konferenzraum leer. Allerdings musste vor Kurzem noch jemand hier gewesen sein, Papiere lagen auf dem Kupfertisch, einige Ledersessel mit den hohen Lehnen waren zu den Fenstern gedreht, als wären gerade erst Leute aufgestanden und hinausgegangen. Über dem Kopfende des Tisches hing das Wappen der Stadt, ein Schild mit den verschlungenen Symbolen für das »Zentrum«, die fünf höchsten Familien der Stadt: unser Augenstern; die Schlange der Labranakos; die Doppelaxt der Kanas; das blaue Pferd der Telemor und die Lilie der Siman. Eingefasst waren die fünf Symbole von dem Zeichen der fünfundzwanzig Familien des nächsten Rings. Und diese wiederum vom Ring der Nächstniederen. Von ihnen kannte ich nur die wenigsten Namen, Mitglieder des ersten und des dritten Rings hatten, wenn überhaupt, nur beruflich miteinander zu tun – gewöhnlich als Herren und Handlanger.
»Gerade findet noch die Anhörung der Zeugen zu Tians Fall statt«, sagte meine Mutter. »Wir gehen voraus. Du wartest hier, bis du hereingerufen wirst.«
Dein Fall, dachte ich benommen. Gestern hätte sie es noch unseren Fall genannt.
Meine Mutter zupfte mein hellgraues Zeremonienkleid zurecht. Es war bodenlang, schmal geschnitten und saß makellos. Die Schnitte von den Scherben an meinen Händen waren unter schwarzen Seidenhandschuhen verborgen.
»Mach deine Aussage, wie wir es besprochen haben, aber sag nichts über deine Träume«, raunte sie mir so leise ins Ohr, dass ich die Worte eher fühlte als hörte. Ich nickte benommen.
Meine Eltern traten zur großen Verbindungstür, die zum ersten und größten Gerichtssaal unserer Herrscher führte. Etwas Seltsames geschah: Sie zögerten kurz, und mein Vater berührte für einen Moment die Hand meiner Mutter. Sie reagierte nicht, aber an der Art, wie sie ihre Schultern straffte, erkannte ich, wie viel Mut es sie kostete, den nächsten Schritt zu tun und durch die Tür zu gehen. Dann war ich allein.
Hier hatte ich noch vor zehn Tagen vor Glück gefiebert, bis endlich Tian mit seiner Familie gekommen war, um den Vertrag zu besiegeln. Für einen Augenblick bildete ich mir ein, meinen Geliebten wieder dort am Tisch sitzen zu sehen, vorgebeugt, das Haar im Licht der aufgehenden Sonne ein Kupferstrahlen in all dem Grau. Ich hätte sogar schwören können, den Duft seiner Haut wahrzunehmen. Er roch immer ein wenig nach Meer – beziehungsweise so, wie das Meer in Büchern beschrieben wurde – nach Salz und Frische, nach lauer Sommerluft und Wolken. Ich erinnerte mich an sein nervöses Lächeln, während er unterschrieb.
Ich ging um den Tisch herum zum Fenster. Dort schlug ich den dunkelgrauen Schleier zurück und blinzelte in die plötzlich gleißend helle Weite. Unsere Stadt hatte den Grundriss eines Kreises. Wie Jahresringe trennten Stadtmauern die einzelnen Bezirke und bildeten gleichzeitig ein Bollwerk um den innersten Kreis, das Zentrum mit den höchsten und sichersten Türmen. Und auch die Nähe zum Himmel bestimmte über Rang und Namen. Die höchsten Würdenträger lebten näher an den Sternen als die Handlanger, selbst wenn diese aus denselben Familien stammten.
Unbarmherzig flirrte die Wüste, bis sie am Horizont felsiger wurde und schließlich in ein ansteigendes Gebirge überging. Keine Straße durchschnitt das Gelb, nur die Wolkenschatten huschten über die scharfen Kanten der Dünen. In der Ferne kreisten ein paar Aasvögel und irgendwo in meinem Kopf hallte ein gemeines, fremdes Flüstern: Was, wenn er dort draußen liegt, hinter einer Düne, längst Futter für die Kreaturen? Ich wandte mich brüsk ab, lehnte mich gegen das Glas. Hinter mir die Unendlichkeit des Himmels und die Tiefe. Und für einen Augenblick lang wünschte ich mir, durch das Glas zu fallen wie durch eine Wasserwand, in den Abgrund, wo es keine Angst, keine Ungewissheit und keinen Schmerz gab. »Hör auf«, flüsterte ich mir selbst zu. Mit zitternder Hand wischte ich mir über die Augen. Auf meinem Handschuh blieb die dunkle Spur einer Träne zurück.
Ein leises Schleifen riss mich zurück in die Wirklichkeit. Mein Instinkt reagierte, bevor ich begriff, was mich erschreckt hatte: eine Bewegung am Rand meines Sichtfeldes. Rasch zog ich den Schleier wieder vor das Gesicht. Ich war nicht allein. Ein Sessel an der anderen Seite des Tisches bewegte sich leicht, kaum merklich, aber deutlich genug, dass ich eine Gestalt im Schatten der hohen Lehne erahnen konnte – die Linie einer Schulter und eines Arms. Schwarzer Stoff. Für einen Moment flammte in mir die völlig verrückte Hoffnung auf, dass es Tian war, der dort auf mich wartete und dass alles nur ein schreckliches Missverständnis gewesen war. Doch dann schwang der Drehsessel mit diesem leisen, metallischen Schleifen, das mich aufgeschreckt hatte, ganz herum.
Der junge Mann war nicht älter als Tian und er trug schwarze Kleidung, aber das war auch schon die einzige Ähnlichkeit. Das scharf geschnittene Gesicht mit den hohen Wangenknochen hatte nichts von Tians sanfter Schönheit, es war hager und viel zu ernst. Aquamarinfarbene, umschattete Augen starrten mich an, ohne ein Zwinkern, ohne einen Funken Sympathie. Noch nie hatte ich in der Stadt eine solche Augenfarbe gesehen.
Er machte keine Anstalten aufzustehen, lässig lehnte er seitwärts in dem Sessel, ein langes Bein über der Lehne. Er sah nicht aus wie ein Hoher, dafür fehlte ihm unser Glanz, die Schönheit, er wirkte auf eine rohe Weise hart, fast hässlich. Aber er saß im Vorzimmer der Méganes, das kein Niederer jemals betreten durfte. Sogar die einfachsten Wächter hier stammten aus den höheren Familien des zweiten Rings. Und noch etwas war seltsam: Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen und dennoch kam er mir bekannt vor.
Immer noch musterte er mich. Mir war unbehaglich bei dem Gedanken, dass er mich schon die ganze Zeit über heimlich beobachtet hatte, ohne Schleier, verzweifelt und schwach. Was hatte er gesehen? Nicht viel vermutlich, ich stand im Gegenlicht, trotzdem zupfte ich noch etwas mehr Stoff vor mein Gesicht.
»Kein Schleier der Welt kann verstecken, was ohnehin schon alle wissen.« Seine Stimme war ein wenig rau, und ich hörte nur zu gut die Feindseligkeit darin.
»Wartest du auch auf eine Audienz?« Ich versuchte, etwas Klang in meine erloschene Stimme zu legen.
Sein linker Mundwinkel zuckte zu einem sarkastischen Lächeln hoch.
»Audienz? Ja, vermutlich schon, wenn auch aus einem anderen Grund als du, einsame Braut.«
Er wusste also genau, wer ich war. Möglicherweise bedeutete das nichts. Vielleicht aber auch alles.
»Kennen wir uns?«, fragte ich so sachlich wie möglich.
Obwohl die Sonne in den Raum schien, hatte ich das Gefühl, dass es dort, wo er saß, dunkler war – und kälter. »Ich kenne dich«, antwortete er. »Deine Karriere als zukünftige Mégana endet, bevor sie begonnen hat. Muss wehtun, Stadtprinzessin!« Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Bisher war es nur eine Ahnung gewesen, jetzt wusste ich, der Fremde hier war mein Feind.
»Zu welcher Familie gehörst du?«, sagte ich mit aller Schärfe, die ich aufbringen konnte. »Wem bist du versprochen?«
Er gab keine Antwort, sondern erhob sich so schnell und geschmeidig aus dem Sessel, dass ich zusammenzuckte. Er kam einfach auf mich zu, ohne die Grenzen des Respekts zu wahren. Direkt vor mir blieb er stehen, so nah, dass ich wie eine Maus in der Falle saß, den Rücken an das Glas gedrückt, vor mir ein Fremder, dessen Augen kaltes Glas waren. Er roch nach heißem Wüstenwind, nach Weite und ein wenig nach der Asche von Jagdfeuern. Die Härchen an meinem Nacken stellten sich auf, ich konnte die Gefahr fast sehen wie Hitzewellen, die die Luft flirren ließen.
»Du willst wirklich wissen, wem ich versprochen bin?«, fragte er leise. »Schwester Tod! Die Schönheit mit der gläsernen Haut und dem roten Haar, die uns immer einholt, wohin wir auch fliehen. Sie besucht mich jede Nacht und versucht mich im Traum zu einem Kuss zu verführen. Und jede Nacht gebe ich ihr beinahe nach. Aber nur beinahe.«
Ich glitt am Glas entlang zur Seite und brachte drei große Schritte zwischen mich und ihn. »Wag es nicht, mir noch einmal so nahe zu kommen!«