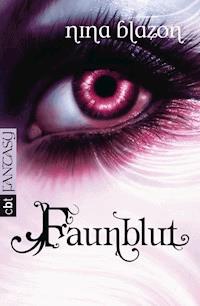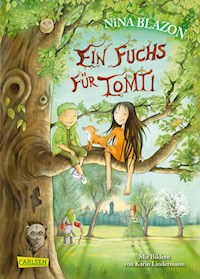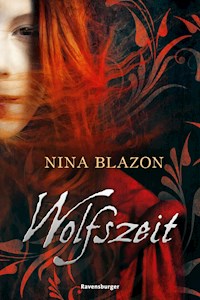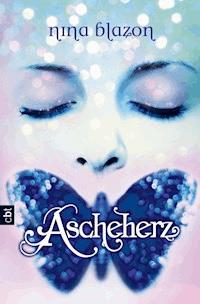12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ihre Liebe könnte sein Tod sein ...
Die 19-jährige Dee arbeitet in Helsinki als Tontechnikerin und Songwriterin. Musik ist ihr Leben! Sie hat das perfekte Gehör und eine kraftvolle Singstimme. Doch niemand darf ihren Gesang jemals hören, nicht einmal ein lauter Ruf darf ihr entschlüpfen. Denn Dee entstammt einer alten Linie von Todesfeen. Natürlich hat sie ständig Angst um ihren Freund Arvo, und ist vorsichtiger denn je. Doch sie muss bald erkennen, dass es eine Gefahr gibt, die sie nicht kontrollieren kann. Ein Geist ist Arvo auf den Fersen – mit einer perfiden Strategie: Er will ihr offenbar das nehmen, was sie am meisten liebt. Was steckt nur hinter diesen Angriffen? Und wird es Dee gelingen, ihre Liebe zu beschützen?
Inspiriert von keltischen Mythen, hochspannend und unwiderstehlich romantisch – meisterhafte Urban Fantasy von Seraph-Preisträgerin Nina Blazon.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Autorin
Nina Blazon, geboren in Koper bei Triest, las schon als Jugendliche mit Begeisterung Fantasy-Literatur. Selbst zu schreiben begann sie während ihres Germanistik-Studiums. Ihr erster Fantasy-Jugendroman wurde mit dem Wolfgang-Hohlbein-Preis und dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet. Seither haben Nina Blazons Bücher zahlreiche Preise erhalten, darunter 2016 den Seraph für »Der Winter der schwarzen Rosen«. Die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin lebt in Stuttgart.
Von Nina Blazon sind bei cbj erschienen:
Rabenherz und Eismund (31 449)
Der Winter der schwarzen Rosen (31 177)
Ascheherz (30 823)
Faunblut (30 847)
Der dunkle Kuss der Sterne (09 162)
Zweilicht (05 658)
Mehr zu unseren Büchern auch auf Instagram
NINA BLAZON
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2022 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Petra Deistler-Kaufmann
Covergestaltung: Carolin Liepins, München
Coverillustration: © Shutterstock.com (Taigi, MillaF, Peddalanka Ramesh Babu, solarseven)
MI · Herstellung: UK
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-19699-8V002
www.cbj-verlag.de
This was a song that wanted to be sung
by anyone who found their own voice within it.
(Wyndreth Berginsdóttir über ihren Song
»Savage Daughter«)
TEIL EINS
Sie weiß noch nicht, dass ihre Tage gezählt sind. Manchmal scheint sie zu spüren, dass ich ihr durch die Straßen folge. Sie zögert beim Gehen und gibt vor, ihr Handy hervorzuziehen oder eine Anzeigentafel zu betrachten, während sie in Wirklichkeit verstohlen prüft, ob jemand hinter ihr ist. Ich könnte ohne Weiteres aus dem Schatten treten und mich zu erkennen geben, sie würde mich nicht als die Gefahr ansehen, die ich bin. Nichts verrät, was hinter dem Lächeln lebt, dem sie bereits vertraut. Von all den Mädchen, die mich liebten, ist sie etwas Besonderes. Eigentümlich und auf ihre ernste Weise schön. Sie mag das Meer, weil ihre Tränen dort auch Gischt sein könnten. Der Sturm hat sie gebogen, aber nicht gebrochen. Inzwischen fürchtet sie sich nicht mehr davor, alleine zu sein. Sie liebt die Musik, aber noch ist ihr Herz verschlossen wie eine Muschel. Nichts ahnend begegnet sie mir Tag für Tag. Inzwischen kenne ich ihre Wege, verstohlen beobachte ich sie aus dem Augenwinkel oder im Spiegel von Fensterscheiben. Unter dem Vorwand, meine Nachrichten abzurufen, werde ich zum Dieb und stehle Fotos von ihrem zarten, ernsten Ich. Manchmal lese ich sogar die Bücher, die sie in der Bibliothek aus dem Regal nimmt und millimetergenau in ihre Staubschablonen zurückstellt. Und auch wenn sie es noch nicht weiß, sie ist längst dabei, ihr wundes Herz für mich zu öffnen. Bald wird sie mich lieben, genau wie die anderen. Die Mädchen lieben mich immer – früher oder später.
Und dann bis zu ihrem letzten Atemzug.
Northern Tides
Immer wenn Madlen mein Lied singt, würde ich am liebsten schreien, was in meinem Fall natürlich keine gute Idee wäre. Niemand fände es toll, wenn die Sängerin von Northern Tides im Aufnahmestudio tot umfällt. Und abgesehen davon, dass ich lieber selbst tot umfallen würde, als jemanden umzubringen, kann ich gut darauf verzichten, ausgerechnet Madlen für den Rest meines Lebens in meiner Nähe zu haben. Denn auch wenn ich die Geister, die mir folgen, zum Glück nicht hören kann, bin ich sicher, Madlen würde einen Weg finden, mir als Rache bis in alle Ewigkeit direkt ins Ohr zu schreien.
»Sag mir jetzt bitte nicht, dass du immer noch nicht zufrieden bist«, murrt Gizmo. Ich habe zwar keine Miene verzogen, aber mein Chef kennt mich lange genug. Seit Stunden sitzen wir beide hinter der schalldichten Scheibe seines Kellerstudios. Außer mir weiß vermutlich niemand, dass Gizmo in Wirklichkeit Oli heißt. In seiner Jugend hatte er noch hüftlanges Headbanger-Haar. Inzwischen ist sein Haar Vergangenheit. Lediglich seine verblassten Tattoos und seine mit Nieten bepinnte Lederjacke erinnern noch daran, dass sein Herz der Rockszene der späten Achtziger gehört. Damals – und das heißt locker zwanzig Jahre vor meiner Zeit – war er Bassist einer Band, die immerhin zweimal an den Charts gekratzt hat. Heute verdient er sein Geld als Produzent und Scout. Er zieht junge Indie-Bands, die noch unter der Wahrnehmungsschwelle der Plattenriesen dümpeln, ins Rampenlicht. Manche schaffen so den Sprung aufs nächste Level. Und ich für meinen Teil hoffe, dass Northern Tides der Newcomer ist, für den bald die erste richtig große Welle kommen wird.
»Komm schon, Dee«, sagt Gizmo genervt. »Es ist bald Mitternacht, ich sitze nur noch dir zuliebe hier.«
»Es ist kurz vor zehn«, erwidere ich. »Und ich würde ja gern Schluss machen, aber Madlen trifft den richtigen Ton für diesen Song einfach nicht.«
Gizmo haut gegen den Regler der Gegensprechanlage und beugt sich vor. »Fünf Minuten Pause«, raunzt er ins Mikro.
Ich bin immer wieder fasziniert, wie die Einheit einer Band von einer Sekunde zur anderen in einzelne Menschen zerfallen kann. Es ist, als würde die Seele ihrer Musik verlöschen wie die letzten Funken eines Feuerwerks. Madlen nimmt die Kopfhörer ab und kämmt sich das blauschwarz gefärbte Haar mit ihren manikürten Fingern zurecht. Lisa parkt die Drumsticks und widmet sich ihrem sicher schon zehnten Kaffee an diesem Tag und Matti verschwindet nach draußen, um eine zu rauchen. Unser Neuzugang, ein Amerikaner namens Rick Cavell, löst das Kinn von der E-Geige, lockert seinen Nacken und zückt dann sein Handy, das er eigentlich gar nicht in den Aufnahmeraum mitnehmen sollte. Und Arvo?
Arvo stellt ohne Eile seine Bassgitarre ab und blitzt mir dabei ein Lächeln zu, das absolut jede Stunde in diesem Bunker wettmacht.
Gizmo hackt auf seine Tastatur ein und startet die Wiedergabe. Im Regieraum erklingt, nur für Gizmo und mich hörbar, zum x-ten Mal an diesem Tag Madlens Part. Ohne Verstärker und Instrumente wirkt ihre klare, kraftvolle Stimme nackt und ein wenig verloren.
»Hörst du es?«, sage ich. »In der letzten Strophe, genau bei der Zeile A broken heart have I ….«
»Weiß nicht, was du meinst«, murrt Gizmo. »Für mich klingt das genau so, wie es klingen soll.«
»Nein, abgesehen davon, dass sie die Blue Notes nicht sauber singt, liegt sie auch in der Emotionalität daneben! Zwar nur noch eine Nuance, aber trotzdem verfälscht es die Seele des Liedes völlig.«
»Seele«, wiederholt Gizmo mit einem Augenrollen. Er schüttelt den Kopf und deutet auf die Tonspur am Monitor, die aussieht wie die Aufzeichnung eines unregelmäßigen Herzschlags. »Technik lügt nicht«, erklärt er. »Und was deine Blue Notes betrifft: Maddie schneidet das Strophen-Intro nun mal gerne auf ihre eigene Art an, sie interpretiert. Das ist ihr Stil. Den musst du ihr schon lassen.«
»Aber …«
»Nichts aber, Dee«, weist mich mein Meister zurecht. »Ja, du könntest sogar hören, ob eine Hundepfeife verstimmt ist. Aber weißt du noch, was ich dir über das Songschreiben gesagt habe? Sobald du ein Lied in die Welt entlässt, gehört es dir nicht mehr. Dein Lied ist jetzt Maddies Song. Und das hier ist ihre Version von Willow. Also: Ende der Vorstellung.« Damit lehnt er seinen Kopfhörer ans Reglerboard und steht auf.
»Komm schon, Giz, nur noch einen Versuch! Vielleicht kriegt sie es ja noch hin.«
»Sie kriegt es hin?« Er lacht fassungslos auf. »Wow! Hör zu, Dee: Maddie weiß genau, was sie mit ihrer Stimme macht, und sie beherrscht den schrägen Sirenenblues, den das Stück braucht. Die Leute werden es lieben. Ich kann das beurteilen, schließlich bin ich dreißig Jahre länger im Geschäft als du.«
»Das weiß ich«, erwidere ich ungeduldig. »Aber das, was für dich Sirenenblues ist, klingt für mich nun mal, als würde sie blind nach dem richtigen Ton stochern, ohne ihn jemals zu treffen!«
»Hey!«, klingt plötzlich Madlens zornige Stimme aus dem Lautsprecher. »Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, Dee, ich kann hier drin jedes Wort hören!«
Oh, verdammt.
»Shit!«, murmelt auch Gizmo. »Hast du den Lautsprecher wieder hochgedreht?«
»Was? Nein!«
»Bada-Boum!«, hören wir Lisa in ihrer trockenen Art sagen. »Das war es dann wohl für heute.«
»Entschuldige bitte, dass ich nie gut genug für dich bin«, faucht Madlen mich hinter der Scheibe der Sprecherkabine an. »Aber weißt du was, Dee? Wenn du so verdammt genial bist, wie du immer tust, warum kommst du nicht hier rein und stellst dich selbst ans Mikro? Ach ja, richtig, jetzt fällt es mir wieder ein: Du darfst ja gar nicht singen. Schon praktisch, wenn man eine Ausrede hat und nie beweisen muss …«
»Maddie, hör auf!«, unterbricht Arvo sie. »Das ist nicht fair.«
»Ist schon in Ordnung, Arvo«, sage ich hastig ins Mikro. »Madlen, entschuldige, ich meinte es nicht …«
»Ach, erzähl doch keinen Mist!« Madlens Stimme, die überlaut aus der Gegensprechanlage gellt, überschlägt sich. »Du meinst jedes Wort von dem, was du sagst! Und du hackst nur deshalb auf mir herum, weil du es nicht ertragen kannst, dass jemand anders deinen Scheißsong singen kann – und sicher besser, als du es je hinkriegen würdest. Falls du überhaupt jemals singen konntest und nicht nur behauptest, dass du …«
Giz langt blitzschnell zum Board und stellt das Studio auf stumm. Madlens Ausbruch wird zu einer Pantomime, ihr Mund bewegt sich stumm hinter der Scheibe. Aber man braucht nicht viel Fantasie, um trotzdem jedes Wort zu verstehen. Mein Gesicht glüht und mein Herz schlägt bis zum Hals, während ich den Meltdown hinter Glas verfolge. Rick, der als Einziger von uns kein Finnisch spricht, schaut nur ratlos drein. Lisa schnappt sich ihren Kaffee und verschwindet eilig aus der Schusslinie. Arvo und Matti versuchen zu retten, was zu retten ist, und reden auf Madlen ein. Doch sie kanzelt beide zornig ab und stürmt schließlich aus dem Studio. Arvo folgt ihr, ohne zu zögern. Von draußen hören wir schnelle Schritte auf der Treppe und Arvos Ruf, dass Madlen warten soll. Gleich darauf fällt oben die Tür zum Hinterhof donnernd ins Schloss.
»Dein Glück, dass eine bruchsichere Scheibe zwischen euch war«, bemerkt Gizmo. »War mein Fehler. Ich muss mit dem Kopfhörer aus Versehen an den Regler gekommen sein. Sorry.«
»Schon gut«, murmle ich. Es ist ja nicht so, dass zwischen Madlen und mir nicht öfter die Luft brennen würde. Und ich weiß, dass Gizmo recht hat, was meinen Song betrifft. Er gehört mir nicht mehr allein. In Momenten wie diesen wünschte ich, ich könnte wirklich aus meiner Haut.
»Wir nehmen den letzten Take«, bestimmt Gizmo. »Schluss, Aus, Ende.« Damit greift er zu seiner Jacke und steht auf.
»Du gehst jetzt einfach?«
»Tja, ich habe es zwar mit dem Lautsprecher verbockt, aber du bist es, die bei Maddie zu Kreuze kriechen und sich entschuldigen muss.« Er verzieht den Mund zu einem mitleidigen Grinsen und gibt mir zum Abschied einen gönnerhaften Klaps auf die Schulter. »Auch das gehört zum Business. Bring Maddie irgendwie wieder runter. Und vergiss nicht, auch den B-Verstärker vom Netz zu nehmen, wenn du gehst. Heute Morgen war er nämlich noch an.«
Das Leder seiner Jacke knarzt, Schlüssel rasseln, dann geht das Hauptlicht im Regieraum aus, die Tür klappt hinter mir zu und ich bleibe im Schein der Stehlampe zurück, zittrig, mit schlechtem Gewissen und flatternden Nerven. Immer noch gellt Madlens Stimme in meinem Kopf. Und aus der Scheibe vor mir schaut mich meine eigene Spiegelung an wie ein Geist – halb durchsichtig, mit müden Augen, das schulterlange, weißblonde Haar in wirren Wellen. Als wäre ich gar nicht richtig hier, denke ich. Ein Gespenst ohne Stimme.
Eine Bewegung im Studio schreckt mich aus meiner Spiegeltrance. Rick ist als Einziger nicht gegangen. Die langen Beine lässig ausgestreckt, sitzt er immer noch an seinem Platz im Aufnahmeraum und sieht mich stirnrunzelnd an. Alles okay?, formen seine Lippen.
Ich nicke und ziehe das Mikro wieder auf. »Ja, danke, Rick«, antworte ich auf Englisch. »Wir sehen uns morgen beim Konzert im Loose. Schönen Abend.«
Er rührt sich nicht, sondern schaut mich durch die schalldichte Glasscheibe nur weiter irritierend intensiv an. Rick ist erst seit gut einer Woche dabei, als »Springer« und Ersatzmann für Joey, der sich den Arm gebrochen hat. Es war reines Glück, dass wir so kurz vor unserem wichtigsten Auftritt noch jemanden bekommen haben, der Joeys Part übernehmen kann. Lisa hatte Rick zufällig in einer Bar kennengelernt. Bisher mag ich ihn ganz gern. Er spielt wirklich gut Geige, führt sich nicht als Künstlerdiva auf und spricht nicht viel, und mir fällt auf, dass ich ihn zwar ständig bei den Proben sehe, aber noch nie richtig wahrgenommen habe. Zum Beispiel hätte ich bis eben nicht sagen können, welche Farbe seine Augen haben. Sie sind braun, aber in dem künstlichen Licht wirken sie fast schwarz.
»Ist noch was?«, frage ich freundlich.
»Nein.« Er schüttelt lächelnd den Kopf und beginnt seine Geige einzupacken.
Lisa und Matti drücken sich an der Treppe herum, beide in eine Aura von Zigarettendunst eingehüllt. »Schön, dich gekannt zu haben, Dee«, sagt Matti.
»Sehr witzig«, murmle ich.
Lisa gibt ihrem Freund einen Ellenbogenstoß in die Rippen. »Du kennst doch Maddie«, sagt sie und grinst mir aufmunternd zu. »Sie explodiert verdammt schnell, aber spätestens beim Auftritt morgen ist alles wieder vergessen.« Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn Lisa so etwas sagt, glaube ich ihr jedes Mal.
Im Hinterhof wirbelt mir der schneidende Ostseewind Schneeflocken entgegen. Selbst für finnische Verhältnisse ist der Mai in diesem Jahr noch extrem kalt. Arvo und Madlen stehen vorne am Durchgang zur Straße und diskutieren. Madlens glattes, hüftlanges Haar bauscht sich im Wind wie schwarze Seide. Als sie mich quer über den Hof kommen sieht, verschränkt sie die Arme und hebt das Kinn. Nicht, dass sie das müsste, um auf mich herabzuschauen. Schon ohne ihre hohen Schuhe ist sie einen Kopf größer als ich. Und auch sonst sind wir in jeder Hinsicht Gegensätze. Schneeweißchen und Rosenrot, wie Lisa uns gerne nennt. Ich finde, Feuer und Wasser trifft es besser. Madlen ist ganz und gar Temperament und sticht in jeder Hinsicht aus der Menge hervor – von ihrer schillernden Art, sich zu kleiden, bis hin zu ihrem lauten, mitreißenden Lachen. Mich dagegen kennt man nur als stilles Wasser, das sich im Hintergrund hält.
»Hey, Madlen«, sage ich leise. »Können wir reden?«
»Wenn du es erträgst, dabei meine Stimme zu hören?«, gibt sie spitz zurück.
»Ich hole schon mal deinen Mantel, Maddie«, sagt Arvo. Er wirft mir einen wohltuend langen Blick zu und geht zurück in den Keller. Madlen und ich bleiben im fahlen Licht der Parkplatzbeleuchtung stehen.
»Es tut mir aufrichtig leid, Madlen«, beginne ich ohne Umschweife. Ich meine es wirklich so. Es stimmt, was Gizmo sagt: Maddie ist eine fantastische Sängerin. Es liegt nicht an ihr, dass ich ihre Art zu singen kaum ertrage. Es liegt an mir. Und an Tagen wie diesen wünschte ich, ich hätte kein Gehör, das wie ein Seismograph Erschütterungen wahrnimmt, die nicht einmal Gizmos Technik aufzeichnet.
»Es sollte dir auch leidtun!«, fährt sie mich an. »Ich habe verdammt noch mal keine erstklassige Gesangsausbildung gemacht, um da unten stundenlang nach deiner Pfeife zu tanzen und mir dann noch anzuhören, dass ich nicht gut genug bin. Und Gizmo hat völlig recht – es ist nicht mehr dein Song!«
Es kostet mich einiges, ruhig zu antworten. »In Ordnung. Ab jetzt halte ich mich raus. Versprochen. Dein Song, deine Interpretation.«
Madlen bekommt schmale Augen. Sie traut mir nicht und zu einem gewissen Teil liegt sie damit genau richtig. Ich würde einiges dafür geben, jetzt einfach nur gehen zu können. Aber so läuft es zwischen Madlen und mir leider nie. »Es tut mir leid, Madlen«, wiederhole ich mit Nachdruck. »Aufrichtig. Es war ein blöder Spruch von mir.«
»Er war mehr als blöd«, braust Madlen auf. »Ich lasse mir nicht sagen, dass ich die Scheiß-Bluestöne nicht treffe! Und schon gar nicht von einem zwanghaften Kontrollfreak wie dir!« Sie funkelt mich an und für ein paar Sekunden genieße ich es sogar, das Feuer ihres Zorns zu spüren. »Du klebst an jeder verdammten Note und der Interpretation, die du im Kopf hast!«, wettert sie weiter. »Alles andere gilt für dich nicht. Aber wenn du und Gizmo wollt, dass es zwischen uns funktioniert, dann solltest du endlich lernen zu akzeptieren, dass ich hier die Sängerin bin und nicht du!«
Wie sehr du dich irrst, Madlen, denke ich. »Was willst du noch von mir hören, Maddie?«, antworte ich leise. »Dass es stimmt, was du vorhin über mich gesagt hast? Ja, es ist wahr. Ich komme wirklich nicht gut damit klar, dass du den Song singen kannst und ich nicht. Und es war nicht okay, meinen Frust darüber an dir auszulassen.« Zur Abwechslung ist das die reine Wahrheit: Madlen ist all das, was ich nicht sein darf. Und in Momenten wie diesem fühlt es sich mehr denn je wie eine Niederlage an.
Sie hatte bereits Luft geholt, um zum nächsten Angriff überzugehen, aber jetzt beißt sie sich auf die Unterlippe. Und als würde meine Aufrichtigkeit ihren Zorn abkühlen, fröstelt sie in einem Windstoß und reibt sich die Arme. »Verdammt, Dee«, murmelt sie. »Mit dir zu streiten ist so, als würde man gegen offene Türen treten.« Sie seufzt genervt und streicht sich das Haar zurück. »Weißt du, ich verstehe dich ja. Es ist schlimm, seine Stimme zu verlieren. Glaub mir, niemand kann das besser nachfühlen als ich. Aber deine Art kann einen echt zur Weißglut treiben. Ich hasse es, wenn du immer so verdammt beherrscht tust. Ich wünschte, du würdest einfach mal richtig explodieren. Manchmal ist es besser, es knallt, aber dann weiß man wenigstens, woran man bei dir ist.«
Glaub mir, das willst du nicht, denke ich bei mir.
»Du bist hier die Frau für das Feuerwerk und die große Bühne«, gebe ich zurück. »Ich bin die Frau hinter den Kulissen, die eure ›Scheißsongs‹ schreibt. Vielleicht sollten wir uns beide gegenseitig akzeptieren?«
Diesen Seitenhieb kann ich mir nicht verkneifen. Madlen sieht mich misstrauisch an, aber dann schluckt sie. »Okay, tut mir auch leid«, sagt sie widerwillig. »Ich bin ebenfalls zu weit gegangen. Und … es ist alles andere als ein ›Scheißsong‹. Aber das weißt du ja.«
»Schon gut. Dann … sind wir wieder quitt?«
Madlen zögert. »Von mir aus«, antwortet sie schließlich. »Entschuldigung angenommen.« Wieder reibt sie sich unbehaglich die Arme. Auch mir ist kalt geworden, obwohl gar kein Wind mehr geht. Vielleicht ist es einfach so, dass es zwischen Madlen und mir nur Feuer oder Eiszeit gibt, denke ich. Meine Finger pochen, als ich die verkrampften Fäuste in den Taschen meines Hoodies löse. Die Fingernägel haben sich schmerzhaft fest in meine Handflächen gedrückt. So sieht es nämlich wirklich mit meiner »verdammten Beherrschtheit« aus. Es kostet mich viel, das stille Wasser zu sein, das die anderen für mein wirkliches Ich halten.
Bevor die Pause zwischen uns noch angespannter wird, taucht endlich Arvo wieder auf und reicht Madlen ihren roten Mantel. »Maddie und ich gehen noch was trinken«, wendet er sich an mich. »Kommst du später nach?«
Ich schüttle den Kopf. »Heute nicht. Ich habe noch zu tun.«
Madlen wirkt ganz und gar nicht so, als wäre sie unglücklich darüber. »Dann bis morgen, Dee«, sagt sie schon im Gehen. »Ich hole meinen Wagen, Arvo.«
Wir warten, bis sie im Durchgang zur Straße verschwunden ist, dann erst finden sich unsere Hände. Es wäre naiv zu glauben, dass niemand in der Band merkt, was seit einigen Wochen zwischen uns läuft, aber weder Arvo noch ich tragen es nach außen. Ehrlich gesagt liebe ich es, dass unsere Küsse immer noch nach Geheimnis schmecken. Und als er mich nun an sich zieht, fühlt es sich auch heute so an, als müsste ich fürchten, gleich aufzuwachen. Aber er ist wirklich hier, denke ich. Und er gehört mir. Sein glattes Haar fällt ihm schräg in die Stirn. Schneeflocken haben sich in den schwarzen Strähnen verfangen. Und wie jedes Mal, wenn er mich anlächelt, spüre ich keine Kälte mehr.
»Alles gut?«, fragt er sanft.
»Natürlich.«
»Wirklich?« Er dreht meine Handflächen nach oben. Beim Blick auf die Abdrücke der Nagelmonde in meiner Haut verschwindet sein Lächeln. »So schlimm?«
»War kein guter Tag heute.«
Er streichelt leicht mit den Daumen über meine Hände. Für einen Moment schließe ich die Augen. »Arvo?«, frage ich leise. »Bin ich ein Freak?«
Er lacht. »Du bist mein Freak.«
»Ich meine es ernst!«
»Du bist eine Musikerin«, antwortet er, ohne zu zögern. »Die beste, die ich kenne. Und du bist hart und zart und wild und wunderbar.« Es sind Zeilen aus Poems for Julia, der erste Song, den Arvo und ich zusammen geschrieben haben – ich die Melodie, er die Lyrics. Ich sage nie »Text«. Das, was Arvo über die Welt, das Dunkel und die Liebe zu sagen hat, ist nichts anderes als Poesie.
»Hast du auch Worte für mich, die du nicht aus unseren Songs stiehlst?«, frage ich.
Arvo öffnet den Reißverschluss seines Parkas. Dann zieht er mich an sich und hüllt mich in die Jacke und seine Wärme ein. Und als er auf mich herunterschaut, fühle ich mich wie eines der Groupiemädchen, die ihm Liebeserklärungen schicken und alles tun würden, um jetzt an meiner Stelle zu sein. Arvos Augen sind von einem kühlen Blaugrau, das mit Sprenkeln von Bernstein vergoldet ist. Seine feinen Züge mit den hohen Wangenknochen geben seinem Lächeln etwas Sinnliches und Sehnsüchtiges, das seine Fans bis in die Träume verfolgt.
»Minä rakastan sinua«, raunt er mir zu. »Sind diese Worte gut genug für dich?«
Genau das ist Arvos Magie. Mit ihm fühlt es sich so an, als gäbe es auf der Welt nur uns zwei. Und aus seinem Mund klingt sogar das finnische Ich liebe dich wie ein Satz, den er nur einmal im Leben und nur für mich sagt.
»Im Ernst?«, gebe ich mit zärtlicher Ironie zurück. »Die Worte, die du nur für mich allein findest, sind die Standard-Liebeserklärung aus jedem Schlager?«
Er grinst. »Gib mir sieben Noten für ein Intro, dann schreibe ich einen Song nur für dich. Ein Lied über ein Mädchen mit Haar wie Meerschaum und Augen aus Rauch und Seide. Klingt das besser, merenneito?«
Meerjungfrau. So nennt er mich gern, wenn wir alleine sind. Weil ich unergründlich wie das Meer bin, sagt er. Und vielleicht auch, weil er intuitiv spürt, dass ich nicht ganz zu seiner Welt gehöre.
»Manche Meerjungfrauen haben keine Stimme, um ihrem Prinzen zu sagen, dass sie ihn lieben«, flüstere ich.
Arvo wird ernst, doch sein Blick bekommt etwas Weiches. Er streicht mir das Haar aus der Stirn und betrachtet mein Gesicht. »Du hast eine Stimme, Deirdre! Sie klingt in jedem deiner Songs. Und ich höre dich singen – hier drin.«
Er nimmt meine Hand und legt sie auf seine Brust. Sein Herz pocht unter meinen Fingerspitzen. Ich liebe Arvos Gesten, jedes seiner Worte und die Bilder, die darin schwingen. Aber noch mehr liebe ich, dass er mich immer nur Deirdre nennt und niemals Dee, wie es alle anderen tun. Und als er mich nun küsst, vergesse ich um ein Haar sogar all das, was nicht sein darf.
»Du fehlst mir jetzt schon«, raunt er mir zu. »Irgendeine Chance, dass du nachher noch zu mir kommst und … endlich mal übernachtest?«
Es kostet mich viel, ein Kopfschütteln anzudeuten. Denn nichts würde ich lieber tun als einfach nur Ja zu sagen. »Ich … kann nicht, Arvo. Ich habe Shay versprochen, dass wir morgen im Café Engel frühstücken. Sie ist dreizehn geworden und wir haben noch nicht mal gefeiert.«
Arvo versucht gar nicht erst zu verbergen, dass er enttäuscht ist. »Tja, gegen dreizehnjährige Cousinen habe ich keine Chance«, sagt er mit einem Augenzwinkern. »Bringst du sie am Abend zum Konzert mit?«
»Ja, das wird ihr Geburtstagsgeschenk. Mit Backstage-Pass für meine beste Band …«
In einer Seitenstraße röhrt ein Automotor auf. Sofort gehen wir auf Abstand. Aber es ist nicht Madlen. Das Auto gibt noch mehr Gas und braust davon. Arvo lacht auf. »Langsam sollten wir wirklich aufhören, uns wie ertappte Klosterschüler zu benehmen.«
»Morgen vielleicht«, erwidere ich. Auch das liebe ich an ihm: dass er die Augen schließt, als ich mir nun einen Kuss stehle. Doch gerade als unsere Lippen sich berühren, streift etwas meinen Nacken. Ich zucke zusammen und sehe mich um.
»Was ist?«, höre ich Arvo sagen.
»Ich weiß nicht.« Mein Blick schweift über den Hof, nach links, nach rechts, doch alles, was ich wahrnehme, sind die Umrisse der Mülltonnen und am Rand meines Blickfelds ein vertrautes weißes Leuchten. Wie ein Mondstrahl, der Form annimmt, betritt mein Wolf den Hinterhof und verharrt zehn Meter von uns entfernt. Er beachtet mich nicht, sondern starrt zu dem Studiogebäude. Seine Augen reflektieren das Licht wie zwei silberne Spiegel. Sein weißes Fell ist im Nacken gesträubt. Ich folge seinem Blick und spähe ebenfalls zu den Fenstern. Da ist nichts, beruhige ich mich. Es war nur der kalte Wind, der mich gestreift hat. Aber immer noch habe ich Gänsehaut von der Berührung. Sie war kühl und flüchtig und doch so real wie fremde Fingerspitzen.
»Deirdre?«, fragt Arvo. »Alles okay?«
»Ja. Ich … dachte nur, ich hätte da hinten etwas gehört. Wahrscheinlich nur eine Katze bei den Mülltonnen.«
Ich fasse ihn am Arm und ziehe ihn beiläufig aus dem Licht in den Schatten neben der Durchfahrt. Arvo legt mir den Arm um die Schultern. »He, du zitterst ja!«
»Es ist kalt hier draußen. Ich sollte reingehen. Madlen wartet sicher schon auf dich.«
Wie auf ein Stichwort hin ertönt von der Straße ein ungeduldiges Hupen. Doch Arvo lässt mich nicht los. »Soll ich lieber hierbleiben?«
»Nein!«, antworte ich etwas zu harsch.
Sogar im Schatten, der nun auf sein Gesicht fällt, nehme ich wahr, wie er die Brauen zusammenzieht. »Sicher?«
»Sehe ich aus, als hätte ich plötzlich Angst, nachts im Studio zu arbeiten? Außerdem weißt du genau, dass ich beim Songschreiben für mich allein sein muss.« Ein zweites ungeduldiges Hupen erklingt. »Besser, du gehst jetzt«, sage ich. »Es reicht, wenn Madlen auf einen von uns beiden sauer ist.«
Arvo zögert, aber als ich mich von ihm löse und die Schlüssel hervorziehe, seufzt er und gibt nach. »Ruf mich nachher noch an, okay? Und nimm dir ein Taxi für den Heimweg.«
»Das mache ich doch immer.« Und zwar nicht zu meiner eigenen Sicherheit, setze ich in Gedanken hinzu. Während Madlen ein drittes Mal hupt, küsst Arvo mich zum Abschied und eilt davon, ohne zu bemerken, wie er dabei so knapp an einem Polarwolf vorbeiläuft, dass er den Atem des Tieres an der Hand spüren könnte – wenn dieser weiße Wolf noch atmen würde.
Ich lausche auf das Zuschlagen der Autotür und warte, bis das Motorengeräusch in der Ferne verklungen ist, erst dann wende ich mich langsam dem Gebäude zu. Wie ein leiser Taktgeber klicken Krallen auf dem Asphalt, dann ist der Wolf an meiner Seite. Ich weiß nicht, warum ich seine Schritte hören kann. Normalerweise sind Geister stumm wie Schattenspieler aus einer anderen Welt. Ich spüre sein Fell nicht, unter meinen Fingerspitzen erahne ich nur eine Kühle wie von frischem, fedrigem Schnee. »Ich habe dich vermisst, Lumi«, flüstere ich. »Wo warst du heute den ganzen Tag?« Lumi ist das finnische Wort für Schnee. So nenne ich die Wolfsseele, die mir folgt, der Himmel mag wissen, warum. Als Antwort schüttelt Lumi nur sein Mondfell, dann spitzt er die Ohren und starrt wieder zum Haus. Ich kneife die Augen zusammen und suche die Fenster der Büros im ersten und zweiten Stock ab. Sie sind dunkel. Und natürlich ist dort niemand. Aber warum fühle ich mich dann trotzdem beobachtet?
Willow
W ie immer, wenn ich alleine im Studio bleibe, vergewissere ich mich zweimal, ob ich die Hintertür auch wirklich fest verriegelt habe. Überlaut klirren die Schlüssel im Takt, während ich die Treppe hinunterspringe. Der Zigarettendunst von Matti und Lisa hängt immer noch in der Luft, aber ihre Sachen sind weg. Das heißt, sie haben das Gebäude durch das Haupttor verlassen. Ich kann nur hoffen, dass sie die Vordertür diesmal ausnahmsweise richtig zugemacht haben. Gerade will ich hinaufgehen und es überprüfen, als ich es wieder wahrnehme: die Berührung von etwas, das anders ist als ein gewöhnlicher Luftzug. Dichter, kälter – und spürbar wie das Knistern von aufgeladener Luft, das mir Schauer über den Rücken jagt. Ich schließe die Hand so fest um die Schlüssel, bis das Eisen in meiner Handfläche mit meinem Herzschlag pulsiert. Vorsichtig schaue ich mich um und atme erleichtert auf, als ich hinter mir nur die leere Treppe sehe. »Hör auf herumzuspinnen«, ermahne ich mich leise. »Du weißt, dass es nicht sein kann.« Doch als ein Schleifen und Rascheln ertönt, als würde jemand eine Zeitung umblättern, rast mein Herz noch schneller. »Lumi?«, flüstere ich. Aber mein Wolf ist nirgendwo zu sehen. Da ist nur der leere Flur. Neben dem Stehtisch, der vor abgelaufenen Flyern und Tourprogrammen überquillt, liegt Gizmos zerfledderte Boulevardzeitung. Offenbar ist sie vom Tisch gerutscht– und zwar Blatt für Blatt, als hätte ein Windstoß sie sacht heruntergeweht. Nur, dass es hier unten definitiv nicht zieht. Die Schlagzeile des Tages springt mir in reißerisch roten Lettern entgegen: Wann schlägt Romeo wieder zu? Darunter steht: Genanalyse bestätigt: Tote von Lajasaalo ist die vermisste Studentin. Garniert ist der Artikel mit einem unscharfen Porträt, das vielleicht aus einem Jahrbuch abfotografiert wurde. Laura B. wurde nur 19 Jahre alt steht darunter.
»Soll das etwa eine Warnung sein, Lumi?«, flüstere ich in die Leere. »Sei bitte nicht albern.«
»Führst du Selbstgespräche?«
Ich fahre herum – und stehe Auge in Auge mit Rick. Er lehnt an der offenen Tür zum Aufnahmeraum, die Hände tief in den Taschen seines langen Mantels vergraben.
»Nur, wenn ich alleine bin«, gebe ich zurück. »Und du? Schleichst du dich immer so an?«
»Oh, habe ich dich erschreckt? Tut mir leid.« Er versucht sich an einem entschuldigenden Lächeln, das ihm nicht so recht gelingt. Ehrlich gesagt wirkt er ziemlich nervös. »Sorry, ich wollte nicht lauschen – ich verstehe sowieso kein Finnisch, wie du weißt. Oder … welche Sprache du da immer gesprochen hast.« Bei den letzten Worten hebt er fragend die Brauen.
»Was machst du noch hier?«, entgegne ich, anstatt zu antworten.
»Ich musste noch telefonieren. Aber gerade wollte ich zusammenpacken und gehen.« Er grinst verlegen und verschwindet im Aufnahmeraum. Eine Minute später ist er mit seinem Geigenkoffer zurück. Doch in der Tür bleibt er wieder stehen und beißt sich auf die Unterlippe, als würde ihm noch etwas auf der Seele liegen. »Ich … habe es auch gehört«, sagt er plötzlich.
»Was gehört?«
»Den falschen Ton, den Maddie reinbringt. Du hast völlig recht. Sie verhaut den Refrain mit ihrer Art, die Blue Notes zu singen. Und bei den Worten broken heart liegt sie sogar leicht neben der Melodie.«
»Wirklich?«, sage ich nur. Denn um den Missklang in Madlens Gesang wahrzunehmen, müsste er schon jemand wie ich sein.
Rick nickt und erklärt mit lässigem Stolz: »Ich wäre ein schlechter Jazz-Musiker, wenn ich so was nicht heraushören würde. Und es ist schön, zur Abwechslung mal mit jemandem wie dir zu arbeiten.«
»Gizmo und ich sind froh, dass du dabei bist. Dein Stil passt gut zur Band. Brauchst du noch etwas aus dem Studio? Wenn nicht, bringe ich dich noch zum Vordereingang. Ich muss abschließen.«
Wie ich schon sagte: Ich mag Rick ganz gern. Aber erstens bin ich kein Fan von Smalltalk und zweitens will ich endlich, endlich die Tür zusperren und nach diesem Tag mit mir alleine sein. Oder zumindest so alleine, wie es in meinem Fall möglich ist.
»Oh, klar«, sagt Rick. »Ist wirklich spät geworden heute.« Er schließt die Tür zum Aufnahmeraum und zieht sich seine Handschuhe an. »Du … schreibst übrigens echt gute Songs, Dee. Willow ist großartig! Auf den ersten Blick einfach, aber in Wirklichkeit tiefgründig und komplex, voller Seele. Das könnte für die Band der Durchbruch werden.«
»Danke!«, antworte ich überrascht. Ich erwidere sein Lächeln. Denn ehrlich gesagt tut es gut, diese Worte zu hören. Und trotzdem ist da wie immer dieser schmerzhafte Stich, weil niemand Willow jemals so hören wird, wie ich das Lied wirklich gemeint habe.
»Schreibst du alle Lieder für Northern Tides?«
»Nein. Ich bin für die Tontechnik zuständig, da bleibt zum Komponieren kaum Zeit.«
»Nimm es mir nicht krumm, wenn ich das sage, aber anfangs hätte ich dir beide Jobs nicht zugetraut. Auf den ersten Blick dachte ich, du seist die Praktikantin. Du hältst dich immer im Hintergrund. Und du wirkst … sehr jung …«
»Zwanzig ist in unserer Branche nicht besonders jung.«
Ricks Lächeln wird ein wenig starr, verliert seine Wärme. Ich frage mich, ob ich etwas Falsches gesagt habe. Doch dann nickt er. »Stimmt. Entweder man schafft es, bis man siebenundzwanzig ist, oder gar nicht. The famous die young, nicht wahr?«
»Was du auch tust, stirb bitte nicht vor dem Konzert morgen, klar?«
Arvo hätte jetzt gelacht. Aber Rick schaut mich nur irritiert an. »Finnische Redewendung«, lege ich schnell nach. »Vergiss es. Hier entlang!«
Die Neonbeleuchtung springt per Bewegungsmelder an, während wir durch abgeschabte Flure und über nackte Betontreppen nach oben gehen. »Parkhaus-Barock«, wie Lisa es nennt.
»Deirdre Faye«, sagt Rick nach einer Weile im Gehen. »Ist das … ein Künstlername?«
»Auch, wenn er sich so anhört: Nein.«
»Der Name klingt irisch. Hast du familiäre Wurzeln dort?«
Und was für welche!, denke ich. »Ja. Ich komme aus Dublin.«
»Sogar eine gebürtige Irin also! Aber die Sprache, die ich vorhin mitbekommen habe, klang nicht nach Akzent. Es klang nicht mal ansatzweise englisch.«
»Das war Gälisch. Meine Muttersprache.«
»Wow, ungewöhnlich.« Rick wirkt ehrlich beeindruckt.
Ich stelle mir vor, was er wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass ich zwar irischer als Guinness-Bier bin, aber in einer verschneiten Hütte in dem Teil von Lappland auf die Welt kam, wo im Winter die Sonne nicht scheint und sich nur noch ein paar einsame Polarfüchse und Rentiere Gute Nacht sagen.
»Und was hat dich ausgerechnet nach Helsinki verschlagen?«, will Rick wissen.
»Was verschlägt einen Amerikaner wie dich ausgerechnet hierher?«, kontere ich.
Aus dem Augenwinkel nehme ich sein Schulterzucken wahr. »Das Übliche. Der Job. Als freier Musiker bin ich selten länger als sechs Monate an einem Ort. Sogar hier in Helsinki war ich schon mal, allerdings ist das eine Weile her. Letztes Jahr war ich um diese Zeit in Frankreich. Das war eine Glanztour: Free Jazz. Liegt mir mehr als der vorgestanzte Elektro-Rock, für den ich sonst angefragt werde. Tja, der Fluch der Vielseitigkeit.« Er wirft mir einen prüfenden Blick zu, ganz so, als wollte er sehen, ob mir sein Talent und sein Künstler-Vagabundenleben imponieren.
»Dann sind wir also aus demselben Grund in Helsinki gelandet«, sage ich nur. »Der Job.«
Ich spüre, wie er mich von der Seite mustert. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendetwas beunruhigt mich, ohne dass ich sagen könnte, was. Verstohlen schaue ich mich nach Lumi um, aber mein Wolf ist uns nicht gefolgt.
»Weißt du, seit ich bei euch eingesprungen bin, frage ich mich, was dich zu Willow inspiriert hat«, fährt Rick fort. »Ein so düsteres Lied über Schmerz und Verlust …«
Ich ahne, was für ein Bild er sich gerade von mir macht. Das zarte, zerbrechliche Mädchen, das sich seinen Liebeskummer von der Seele schreibt. Tja, stille Wasser laden dazu ein, die Spiegelungen auf der Oberfläche für die Wirklichkeit zu halten.
»Es ist nicht autobiografisch, falls du das vermutest. Der Text stammt aus einer irischen Ballade aus dem Spätmittelalter. Ich habe das Ganze lediglich vertont.«
Aber dann überrascht Rick mich doch noch. »Den Text meinte ich auch nicht«, sagt er leise. »Sondern die Melodie. Der Schmerz darin ist echt, nicht wahr? Du hast ihn wirklich gefühlt.«
Ich bleibe stehen und wende mich ihm zu. Er ist so groß, dass ich den Kopf in den Nacken legen muss, um ihm in die Augen zu sehen. »Was soll das hier werden, Rick? Die Psycho-Sprechstunde?«
So, wie ich ihn bisher kennengelernt habe, hätte ich erwartet, dass er meinem Blick ausweicht oder verlegen lacht. Aber diesmal ist es anders. Er sieht mich nur schweigend und so intensiv an, als versuchte er in meinem Gesicht zu lesen. Und zum ersten Mal fällt mir auf, dass er trotz seiner Brille, seiner lockeren Art und dem jungenhaft zerzausten Haar gar nicht so jung ist, wie er wirkt. Bisher hätte ich ihn auf höchstens Mitte zwanzig geschätzt, aber hier, im harten Neonlicht, erkenne ich, dass er sicher schon über dreißig ist.
»Es hat mich einfach interessiert«, antwortet er. »Als ich Lisa vorhin fragte, was Maddie zu dir gesagt hat, habe ich erfahren, warum du nie selbst singst. Ich konnte dir ansehen, wie viel dir Maddies Worte ausgemacht haben.«
Es kommt selten vor, dass mir keine schlagfertige Antwort einfällt. Aber gerade weiß ich nur, dass mir kalt ist und dass sich das hier ganz und gar nicht gut anfühlt. »Und du glaubst, weil ich seit einer verpfuschten Stimmband-OP gesangsbehindert bin, schreibe ich tragische Songs? Hör zu, Rick. Für Gespräche dieser Art kennen wir uns wohl kaum gut genug. Abgesehen davon wäre ich eine schlechte Songwriterin, wenn ich nicht jedes Gefühl in Noten fassen könnte – egal, ob es mein eigenes ist oder nicht.« Und dann kann ich mir einfach nicht verkneifen, noch hinzuzufügen: »Gerade ein Jazz-Musiker sollte das wissen.«
Treffer, versenkt. Rick zieht die Brauen zusammen.
»Entschuldige, ich wollte nicht unhöflich sein«, murmelt er. »Und du hast recht. Wir kennen uns kaum. Aber … das lässt sich ja ändern. Hast du Lust, etwas essen zu gehen?«
Endlich wird mir klar, warum er sich so viel Mühe gibt, mich auszufragen und sich als Jazz-Genie zu präsentieren. Er hat vorhin nicht telefoniert, sondern gewartet, bis er alleine mit mir sprechen konnte. Doch selbst wenn ich Arvo nicht hätte und auf der Suche nach einem Date wäre, stünde Rick so ziemlich als letzter Kandidat auf der Liste. Er sieht zwar ganz gut aus, aber ich verliebe mich nicht in schlaksige, große Kerle, die Nerdbrillen tragen und zu langes, wirres Haar haben.
»Nein, danke«, erwidere ich freundlich, aber bestimmt. »Ich habe keinen Hunger.«
»Dann lass mich dich wenigstens nach Hause fahren. Du wohnst doch in Merihaka, das liegt genau auf meinem Weg.«
Ich stutze. »Woher weißt du, wo ich wohne?«
»Ich … habe es aufgeschnappt. Irgendjemand von der Band hat es erwähnt.«
Wirklich?
»Mein Auto steht nur zwei Straßen weiter«, fügt er hinzu. »Also?«
»Danke für das Angebot, Rick. Aber ich habe hier noch zu tun.«
»Hier? Ich meine … ganz allein in diesem Bunker? Mitten im Industriegebiet?«
Die Band ist ihm gegenüber wohl doch nicht so gesprächig, wie er eben behauptet hat. Jeder weiß, dass ich immer die Letzte bin, die geht. Und die Tatsache, dass ich den Schlüssel zum Studio habe, ist der eigentliche Grund, warum ich für Gizmo arbeite.
»Hast du keine Angst?«, setzt Rick hinzu.
»Ich fürchte mich nicht vor Gespenstern.«
Er schaut mich an, als würde er überlegen, ob ich einen Scherz mache. »Ich rede auch nicht von Gespenstern«, sagt er mit Nachdruck. »Sondern davon, dass Mädchen wie du zur Zeit nachts besser nicht alleine unterwegs sein sollten.«
»Mädchen wie ich?«
»Du weißt, was ich meine.«
Ja, ich weiß es. Romeo steht auf stille Schneeweißchen, nicht auf schillernde Sirenen wie Madlen. »Selbst wenn die Vermutungen stimmen, wäre dieser Mörder wohl ziemlich dumm, ausgerechnet in einer der verlassensten Gegenden Helsinkis nach einem neuen Opfer zu suchen, statt durch die vollen Clubs zu ziehen.«
»Darüber reißt man keine Witze, Dee!«, sagt Rick verärgert. »Und ich will dir wirklich keine Angst machen, aber hier draußen hört dich niemand, wenn du in Schwierigkeiten bist! Wenn ich dein Freund wäre, würde ich dich hier jedenfalls nicht alleine lassen.«
»Du bist aber nicht mein Freund«, kontere ich. »Ich brauche niemanden, der mich beschützt oder vor Serienkillern rettet, okay?«
Ich wende mich ab und will in den Gang zum Foyer einbiegen. Aber Rick fasst mich allen Ernstes am Arm und hält mich zurück. »Dee, warte …«
»Hey!«, sage ich leise, aber so scharf, dass er mich sofort loslässt. Doch immer noch ist er viel zu nah – in mehr als einer Hinsicht. Und mit einem Mal weiß ich, was mich schon die ganze Zeit irritiert: Von Rick strahlt etwas Kühles ab, als würde ihn ein Kokon von kalter Luft umgeben. So, als wäre er gerade eben noch draußen durch den Schneewind gewandert. Unwillkürlich weiche ich zurück.
»Weißt du was? Ich gebe dir einfach meine Nummer«, fährt er resolut fort. »Ich wohne hier ganz in der Nähe. Ruf mich an, wenn du fertig bist, ich hole dich ab …«
»Rick, die Antwort ist Nein! Ich gehe nicht mit dir aus. Ich rufe dich nicht an. Und ich suche auch kein Date.«
Ein Schatten fällt über seine Miene. Zum ersten Mal sehe ich in seinen Augen Ärger aufblitzen. »Verstehe«, sagt er sehr langsam. »Dann habe ich deine Signale wohl falsch gedeutet?«
»Ich wüsste nicht, welche Signale das sein sollten.«
Er schnaubt. »Komm schon, Dee! Ich habe dich beobachtet. Matti und Arvo würdigst du kaum eines Blickes, aber mir hast du zugelächelt. Und nicht nur einmal. Ich dachte, es hätte etwas zu bedeuten.«
Okay, das wird jetzt wirklich schräg. »Umso besser, dass wir dieses Missverständnis nun geklärt haben«, sage ich betont sachlich. Damit lasse ich ihn endgültig stehen und gehe voraus Richtung Foyer. Doch erst am Ende des Flurs höre ich an den Schritten, dass er mir zum Vordereingang folgt. Genau wie das gesamte Gebäude, hat auch die zerkratzte Tür aus Stahl und Panzerglas schon bessere Zeiten gesehen. Das metallene Quietschen der Angel hallt in der leeren Straße.
»Tja dann«, murmelt Rick. »Ich hoffe für dich, dass du wenigstens klug genug bist, dir für den Nachhauseweg ein Taxi zu nehmen. Wobei … selbst das ist keine Garantie. Von Romeo gibt es ja nicht mal ein Phantombild – so gesehen könnte es jeder sein. Sogar der nette Uber-Driver von nebenan.«
Es gibt diese Männer, die pampig werden, wenn man kein Interesse an ihnen hat. Ich hatte allerdings nicht gedacht, dass Rick einer von denen ist. Und bin selbst überrascht, wie sehr mich das enttäuscht.
»Wirklich, Rick?«, gebe ich mit müdem Spott zurück.
Er presst die Zähne so fest aufeinander, dass seine Züge härter wirken. Spätestens jetzt kann er nicht mehr verbergen, dass er gar nicht so nett ist, wie er sich gibt. »Ich wollte einfach nur freundlich sein. Es war keine Anmache, wenn du das denkst. Du hast nur so einsam gewirkt und ich dachte, du wirst ja sicher nicht so oft angesprochen.«
Ja, stille Wasser sind Spiegel. Und manche werfen Steine in sie hinein, weil sie ihr eigenes Spiegelbild nicht ertragen.
»Bis morgen im Loose«, sage ich kühl. »Neunzehn Uhr ist Soundcheck. Sei pünktlich.«
Rick schnaubt, aber endlich geht er. Ich schaue ihm noch eine ganze Weile nach, wie er die Straße entlangläuft, eine große, hagere Gestalt mit hochgezogenen Schultern, den Geigenkasten unter den Arm geklemmt. Und ich weiß nicht, warum, aber ich atme tatsächlich auf, als er in den Schatten verschwunden ist. Diese seltsame Kühle scheint immer noch den Raum zu füllen. Aber wahrscheinlich ist es nur die ungewöhnlich kalte Mailuft, die durch den Türspalt ins Gebäude dringt. Ich drücke die Tür ins Schloss, drehe den Schlüssel zweimal um und lasse ihn von innen stecken. Das Risiko, dass Gizmo vielleicht etwas vergessen hat und plötzlich unangemeldet im Studio steht, darf ich nicht eingehen.
Und dann streife ich diesen missglückten Tag endgültig von mir ab und gehe zurück ins Studio. Im Regieraum stelle ich die Kabine auf stumm und hole meine eigene Gitarre, die immer neben dem Pult wartet. Noch einmal prüfe ich, ob wirklich alle Regler auf schalldicht stehen. Zur Sicherheit stelle ich auch noch die Stehlampe vor die abgeschlossene Tür. Selbst wenn sie sich allen Gesetzen zum Trotz öffnen sollte, sehe ich in der Kabine sofort, wenn draußen die Lampe umfällt, und kann rechtzeitig verstummen.
So ist das nämlich, wenn man von den irischen Banshees abstammt. Ja, genau, die Todesfeen, die nachts klagend und herzzerreißend schreiend um die Häuser streichen und damit ankündigen, dass bald jemand sterben wird. Manche sagen, sie waschen beim Jammern und Klagen blutige Kleidung, andere Überlieferungen beschreiben sie als weiß gewandete Frauen mit langem Geisterhaar. Ich trage am liebsten schwarze Jeans und falle auch sonst nicht durch blutige Accessoires auf. Aber Schreien, Rufen und leider auch Singen ist für mich tabu, wenn ich nicht will, dass Menschen durch meine Stimme sterben.
Die Sprecherkabine zu betreten, ist ein Schritt über die Schwelle in mein eigentliches Sein. Schon bevor ich die letzte Tür hinter mir schließe, spüre ich die Vorfreude wie Gänsehaut auf meiner Seele.
Ich beginne immer auf dieselbe Weise: Erst stecke ich meine Gitarre ein und wecke sie mit Strom und ein paar zarten Strichen über die E-Strings. Ironischerweise ist es eine E-Gitarre der Marke Banshee. Ich habe sie allerdings nicht wegen des Namens ausgesucht, sondern weil meine Stimme ihre Saiten auf eine Art mitschwingen lässt, die meinen Songs den perfekten Klangteppich bietet. Mit einem harten Fingerschlag bringe ich die Saiten wieder zum Schweigen, atme bis zum tiefsten Punkt aus und verharre. Hier, am Scheitelpunkt der Stille, löse ich die Fessel. Langsam lasse ich die Luft in meine Lunge strömen, bis die Sehnsucht mich völlig ausfüllt. Ich sammle die Spannung in meinem Zwerchfell. Und aus dem tiefsten Grund meines Sehnens lasse ich aus dem Bauch den ersten Ton aufsteigen. Ich schließe die Augen und gebe ihn frei. Die ersten Noten kommen noch leise, vorsichtig, als würde das Gitarrenspiel sie nur langsam aus ihrem Versteck locken. Doch mit jedem neuen Atemzug entfessle ich meine Stimme mehr, bis mein ganzer Körper schwingt und … ich singe! Ich genieße das Vibrieren in meiner Kehle, die ganze Kraft meines Atems und meines Herzens. Und dann kommt der Moment, wenn ich nicht mehr Deirdre bin – ich bin nur noch Musik. Ich bin Willow und Poems for Julia und all die anderen Lieder, die sich in mir entfalten. Blind fliegen meine Finger über den Steg und die Saiten. Die Stimme meiner Gitarre ist schneidend und hoch, meine eigene dagegen kraftvoll, klar und rau zugleich. Eine gute Sängerin hat einen Stimmumfang von zweieinhalb Oktaven. Ich beherrsche mühelos dreieinhalb. Doch der Klang, der meine Seele füllt, ist der Refrain von Willow – tief, herzzerreißend und klagend wie ein melodisches Wolfsheulen. Es hat nichts gemein mit Madlens zahmer Interpretation. Das hier ist echt. Es ist Wildheit, Abgrund und Tod. Ich singe, so laut ich kann, mit all dem Feuer und aller Leidenschaft, die in mir sind, und genau auf die Art, wie ich den Song meine und fühle. Die letzte Note verklingt und lässt mich leer, aber unendlich glücklich zurück.
Als ich die Augen öffne, liegt Lumi zu meinen Füßen. Hinter der Scheibe sehe ich meine anderen Geister in der Regiekabine. Die alte Frau hat ihre Lesebrille bis zur Nasenspitze geschoben und strickt. Ich weiß nicht, wie sie in Wirklichkeit heißt – beziehungsweise hieß, als sie noch lebte. Ich nenne sie Áila, weil es ein samischer Name ist. Áila gehört zum Volk der Samen. Bis ich sie aus dem Leben riss, lebte sie im nördlichsten Teil von Lappland. Als sie starb, war sie wohl gerade dabei, eine Mütze zu stricken. Der Größe nach zu urteilen, ist es die Mütze für ein Kind, vielleicht für einen Enkel. Immer noch arbeitet sie daran, ohne jemals auch nur eine Masche mehr hinzuzufügen. Ich frage mich, ob es ihr bewusst ist oder etwas ausmacht, dass die Mütze immer halb fertig ist. Und ob Áila weiß, dass ihr Enkelkind von damals inzwischen schon erwachsen ist. Als hätte sie meinen Blick gespürt, schaut sie kurz auf und schenkt mir ein flüchtiges Lächeln, dann arbeitet sie weiter. Es gibt Geister, die grollen, aber Áila gehört nicht dazu. Sie verfolgt mich nicht, sie ist einfach nur da, sobald ich alleine bin. Und auf eine Weise werde ich sie wahrscheinlich vermissen, wenn sie eines Tages verblasst und schließlich verschwinden wird wie die anderen. Zwei dieser schwindenden Geister erahne ich ebenfalls hinter der Scheibe – zwei Männer in Outdoorkleidung, die sich heute nur als Schattenrisse zeigen. Touristen, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Ich nenne sie nur die Wanderer. Sie starren mich feindselig an, aber ihre zornige Aura, die mir als Kind vor Angst den Schlaf raubte, ist im Lauf der Jahre zu einem fahlen Leuchten verblasst.
Mag der Himmel wissen, wo Menschen nach ihrem Tod normalerweise hingehen und was sie dort tun. Alle, die von einer Banshee rechtmäßig ins Grab geschrien wurden, bleiben dort auch. Schließlich sind unsere Ahninnen für diese Menschen nur die Erfüllerinnen eines Schicksals, das ihnen ohnehin blühte. Banshees bringen nicht den Tod, sie kündigen ihn nur an. Für diese Menschen tickte die Uhr, ihre Zeit lief ab. Das Problem sind diejenigen, die uns »Bansheenys« zum Opfer fallen. So nennen uns unsere irischen Ahninnen. Es klingt nett – so, als wären wir die niedliche Pfadfinder-Ausgabe echter Todesfeen. Aber so freundlich ist es nicht gemeint. »Sheeny« bedeutet zwar glänzend oder silbrig. Und in den Zeitdekaden der Todesfeen sind wir auch noch glänzend und neu wie frisch geprägte Centmünzen. Aber »sheeny« hat auch eine andere, gar nicht so nette Bedeutung: Für unsere Ahninnen sind wir diejenigen, die nicht dazugehören, die in ihren Augen minderwertig sind, halbseiden, zwielichtig, auf jeden Fall verdächtig. Uns ist nicht zu trauen, denn wir sind etwas, was es nach den Gesetzen der Magie nicht geben dürfte: Nachkommen einer Todesfee und eines Menschen. Anders als unsere Ahninnen sind wir nicht Teil des Schicksalsrades, das über Tod, Leben und Vergeltung entscheidet. Man könnte sagen, wir sind die magische Mutation, die niemand haben will.
Das Tolle daran, eine Bansheeny zu sein, ist unsere Fähigkeit, im Notfall jeden Serienkiller, der uns auf den Fersen ist, mit einem Schrei aus dem Weg räumen zu können. Selbst wenn mir um zwei Uhr morgens Romeo persönlich auflauern würde – bevor er überhaupt begreifen würde, dass er sich die Falsche ausgesucht hat, könnte ich ihn mit einem einzigen Ton ins Grab befördern. Nicht, dass ich so etwas tun möchte. Und nicht, dass ich morgens um zwei Uhr je allein in finsteren Ecken unterwegs wäre. Eigentlich ziehe ich nicht einmal freiwillig über Partymeilen oder durch Clubs. Ich will auf keinen Fall in Gefahr geraten, zu schreien oder auch nur zu laut zu rufen. Gelegenheit macht Gräber, würde meine Mutter sagen. Richtiger müsste es allerdings heißen: Gelegenheit macht Geister. Jede aus meiner Familie hat solche Groupies, die nie vergessen, uns daran zu erinnern, dass wir der Grund für ihre Existenz ohne Herzschlag sind.
Und das ist das absolut Blöde daran, eine Bansheeny zu sein.
Shaylee
Es ist schon nach Mitternacht, als ich aus dem Taxi steige. Manche sagen, Merihaka sei das hässlichste Wohngebiet in Helsinki. Dabei gibt es keinen schöneren Ort, um direkt am Meer zu wohnen. Die Luft riecht nach Salz und Wolken und auf der schwarzen Haut der Ostsee spiegeln sich die Lichtreflexe vereinzelter Hochhausfenster. Früher am Abend ist es immer »ein Meer aus Feenlichtern«, wie Shaylee es andächtig ausdrückt. Das ist Shay: Sogar an einem schmucklosen Ort voller grauer Plattenbauten findet sie Poesie. Im obersten Stockwerk des Hochhauses, in dem wir wohnen, flackert das bläuliche Leuchten des Fernsehers. Vielleicht ist meine Mutter noch wach. Wahrscheinlicher ist aber, dass Shay sich aus ihrem Zimmer geschlichen hat und heimlich eine ihrer geliebten Romance-Serien schaut.
Mit einem metallenen Zähneknirschen setzt sich der Fahrstuhl in Bewegung. Und mit jedem Meter, den er sich ächzend nach oben schiebt, fühle ich mich, als würde das Gewicht des Tages Schicht um Schicht von meinen Schultern gleiten.
Wie ich vermutet habe, ist es Shaylee, die im Pyjama auf dem Sofa vor dem Fernseher lümmelt. Sie hat sich meinen besten Kopfhörer aus meinem Zimmer geholt und sich unter einem Berg von Decken eingekuschelt. Das Sofa ist übersät mit Süßigkeitenpapierchen, Chipskrümeln und Modezeitschriften. »Dee«, ruft sie mir flüsternd entgegen und nimmt die Kopfhörer ab. »Ich bin extra aufgeblieben und habe auf dich gewartet.«
»Und du hast extra den Fernseher eingeschaltet, um dir bis zu meiner Rückkehr die Zeit zu vertreiben?«, antworte ich mit einem Lächeln. »Dieses Opfer weiß ich wirklich zu schätzen.«
Shay wird rot und kichert. Wie zwei Verschwörerinnen schauen wir beide zum Durchgang, der in den langen Flur führt. Ganz am Ende befindet sich das Schlafzimmer meiner Mutter.
»Sie ist heute früh schlafen gegangen«, wispert Shay. »Weil sie Kopfschmerzen hatte. In der Küche hat sie dir einen Zettel hingelegt. Sie hat gesagt, ich darf ihn nicht lesen. Hat bestimmt was mit meinem Geburtstagsfrühstück zu tun.«
Das ist typisch meine Mutter. Warum ein Handy benutzen, wenn man Nachrichten auch mit einem Füller auf Papier schreiben kann? »Schon möglich«, erwidere ich ausweichend und ziehe meine Jacke aus. »Wie war es heute in der Schule?«
Shays Strahlen verlischt so abrupt, als hätte der Wind eine Kerzenflamme ausgeblasen. »Im Volleyball bin ich schon wieder als Letzte in die Mannschaft gewählt worden«, antwortet sie bekümmert. »Dabei bin ich im Fangen echt gut! Und in den Pausen stand ich mal wieder ganz alleine herum. Irgendwie will niemand so richtig mit mir sprechen.« Sie seufzt und verzieht den Mund zu einer unglücklichen Grimasse.
»Kopf hoch, Kleine«, sage ich sanft. »Das ging uns anfangs allen so. So ist es eben, wenn man erst mit zwölf oder dreizehn in eine neue Klasse kommt. Die anderen kennen sich oft schon seit dem Kindergarten. Aber bald werden sie sehen, dass du jemand bist, den man unbedingt in jeder Mannschaft haben muss.«
Shay versucht zwar noch, betont bekümmert dreinzuschauen, aber in ihren Mundwinkeln zuckt bereits ein Lächeln. »Hast du mir MakuLaku mitgebracht?«
So heißen die gefüllten Lakritzdrops, die Shay liebt. Mich und meine Mutter kann man mit dem seltsamen Geschmack jagen, aber Shay verschlingt voller Begeisterung sogar das salzige Lakritzeis, das nur die ganz harten Finnen essen. Doch wahrscheinlich fände sie auch Oktopusgelee mit Kirscheis köstlich, wenn es zum Leben in der großen, verheißungsvollen Stadt gehören würde. Ich hole die Tüte aus meiner Umhängetasche. »Fang auf, Süßmaul.«
Shay schnappt die Süßigkeiten geschickt aus der Luft und reißt die Tüte sofort auf. Und als sie mich kauend anstrahlt, wallt in mir die ganze Zärtlichkeit auf, die ich für sie empfinde. Shay erinnert mich in ihrem Wesen an frisch gefallenen Schnee. Alles hier ist für sie neu und schillernd, eine Expedition in das Leben, von dem sie bisher nur träumen konnte. Auf den ersten Blick würde niemand glauben, dass sie eine von uns ist. Die meisten Nachkommen der Banshees sind hellhäutig, manche sogar totenblass. Üblicherweise haben sie auch auffallend helles Haar und Augen in Farbnuancen von Lichtgrau bis zu einem wasserhellen Blau. Oder seltener – wie bei mir – Augen von einem farblosen, transparenten Braun, das an Rauchglas erinnert. DieFeen-Gene setzen sich immer durch, wie meine Mutter sagt. Aber Shaylee schlägt zu neunzig Prozent nach ihrem menschlichen Vater und damit völlig aus der Art. Man könnte sagen, sie ist die Mutation der Mutation. Ihr Haar ist lockig und dick und glänzt in einem satten Kastanienton. Ihre Augen sind dunkelbraun ohne jede Spur von Transparenz und ihr olivfarbener Teint wird im Sommer bronzegolden.
»Was schaust du da?«, will ich wissen. »Die zehnte Staffel von Broken Love?«
»Hab ich längst durch«, nuschelt Shay mit vollem Mund. Sie rutscht zur Seite und klopft neben sich aufs Sofa. Meine Schritte sind völlig lautlos, unter dem Teppich liegen Schallschutzmatten und lassen nicht das geringste Geräusch zu den Nachbarn unter uns dringen. Auch die dicken Betonwände zwischen den Wohnungen verschlucken jeden Laut, selbst wenn wir hier drin lachen oder ein wenig lauter reden als draußen unter Menschen. Mit einem Blick vergewissere ich mich, dass die gedämmten Fenster verschlossen sind, dann ziehe ich auch noch den Hoodie aus und lasse mich neben Shay aufs Sofa fallen. Sie lächelt, als sie bemerkt, dass ich unter meinem üblichen Schwarz das pinkfarbene T-Shirt trage, das sie mir geschenkt hat. Darauf prangt ein silberner Porträtdruck von Taylor Swift. Tja, was tut man nicht alles für kleine Cousinen.
»Du riechst gut«, sagt sie und kuschelt sich an mich. »Nach Schnee. Und deine Arme sind ganz kalt.«
»Dafür, dass wir Frühling haben, ist es draußen noch mal ziemlich winterlich geworden.«
»Das nennst du winterlich?« Sie blitzt mir ein Lächeln zu. »In Werhojansk hat es gerade zwanzig Grad minus. Mama hat mir Fotos geschickt. An unserer Hütte hängen meterlange Eiszapfen. Und auf der Jagd hat sie heute ein Rudel Wölfe gesehen.« Shay schmiegt sich an mich und erlaubt sich ein kleines Heimweh-Seufzen. Und ich frage mich, ob sie dabei die Augen schließt und sich vorstellt, sich gerade an ihre Mutter Brianna zu kuscheln.
Unhörbar für uns läuft der Fernseher weiter. Eine rothaarige Frau mit ernster Miene erklärt etwas. Wie fernes Radiosurren dringt nur eine Ahnung ihrer Stimme aus den Kopfhörern auf Shays Schoß. »Lydia Berger, Kriminalpsychologin« wird als Banner eingeblendet. Dann erscheint ein schwarz-weißes Tatortfoto. Es zeigt eine Wiese und ein helles Tuch, unter dem man die Umrisse eines liegenden Körpers erahnen kann. Nummerierte Tatortmarkierungen der Polizei stecken ringsherum im Gras.
»Du bist von Liebesgeschichten auf True Crime umgestiegen?«
Ich spüre Shays Nicken an meiner Schulter. »Ist spannend. Und ziemlich gruselig.«
»Du meinst, noch gruseliger als das Make-up dieser Highschool-Barbie aus Broken Love?«
Shay fährt hoch und knufft mich empört in die Seite. »Über Ariana Starling darf nur ich lästern, klar?«
Wie immer, bringt sie mich mit ihrer Art zum Lachen. Aber dann stutze ich. Bei Shays abrupter Bewegung ist ein Notizbuch vom Sofa gerutscht und liegt nun aufgeklappt auf dem Boden. Fundort: Lajasaalo hat Shay in ihrer runden Mädchenschrift notiert und mit Glitzermarker unterstrichen. Darunter hat sie die Schlagzeilen aufgeschrieben, die heute in jeder Zeitung zu finden waren.
»Was machst du da, Shay?«
Sie hebt das Buch auf und schlägt es hastig zu. »Nichts.«
»Aber das sind Infos zum Romeo-Fall. Warum schreibst du dir das auf?«
Shay wirft einen schnellen Blick zum Flur, dann senkt sie die Stimme noch mehr. »In der Schule haben heute alle darüber geredet. Hast du es auch mitbekommen?«
»Nur ein paar Schlagzeilen aufgeschnappt. Warum?«
In Shays Augen entzündet sich ein Leuchten, das meiner Mutter vermutlich sofort Sorgen machen würde. »Sie haben das vermisste Mädchen gefunden«, wispert sie aufgeregt. »Zwei Jahre lang lag sie am Rand eines Wohngebiets, unter Geröll und Steinen. Kannst du dir vorstellen, wie viele Leute in dieser Zeit ahnungslos an ihrem Grab vorbeigegangen sind? Und gefunden hat man sie jetzt nur, weil immer wieder ein Mann beobachtet wurde, der nachts dort auftauchte. Einmal lag an der Stelle eine Rose. Als ein Spaziergänger die Blume aufgehoben hat, fiel ihm eine Haarsträhne auf, die zwischen dem Geröll hervorschaute.«
»Hört sich ja makaber an.«
»Ja, nicht wahr?« Shay hebt vielsagend die Brauen. »Das war Romeo! Es war eine gelbe Rose, die er hingelegt hat – Lauras Lieblingsblume. Und niemand sonst konnte wissen, dass sie genau dort vergraben ist. Viele Täter kommen zum Ort ihres Verbrechens zurück, weißt du?«
»Und dann legen sie Rosen ab, damit man ihre Opfer auch garantiert findet? Wenn du mich fragst, hört sich das eher nach erfundener Sensationsstory an.«
»Aber es wurde wirklich ein Mann beobachtet, der nachts immer wieder dort war!«
»Und das heißt sofort, dass dieser Mörder wieder aufgetaucht ist?« Ich schüttle den Kopf.
Shay rückt ein wenig von mir ab und zieht die Beine an den Körper, schlingt ihre starken Arme um die Knie. »Mit Laura hat er insgesamt vier Mädchen auf dem Gewissen!«, sagt sie mit Nachdruck. »Und wenn er jetzt zwei Jahre nichts getan hat, dann liegt es nur daran, dass ihn jemand daran gehindert hat.« Sie deutet zum Fernseher. »Lydia Berger sagt, wenn ein Serienmörder plötzlich aufhört zu morden, dann gibt es meist drei Möglichkeiten. Erstens: Der Kerl ist tot. Zweitens: Er ist in ein anderes Land ausgewandert und taucht in der Kriminalstatistik seines üblichen Umfelds nicht mehr auf. Oder drittens: Er sitzt wegen eines anderen Vergehens gerade im Gefängnis.«
Unter anderen Umständen hätte ich darüber gelächelt, wie eifrig meine kleine Cousine Fakten aufzählt, als hätte sie sie für die Schule auswendig gelernt. Aber Shay meint es offenbar ernst, sehr ernst. Und es ist nicht schwierig zu erraten, was ihr im Kopf herumspukt. »Und weil jedes Boulevardmagazin gerade die Angst schürt, dass Romeo wieder aufgetaucht sein könnte, denkst du nun darüber nach, ob nicht eine Bansheeny ihm das Handwerk legen könnte?«, frage ich ganz direkt.