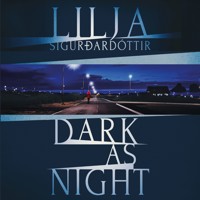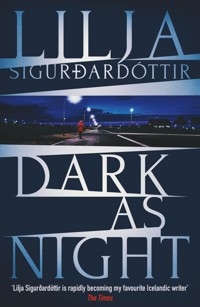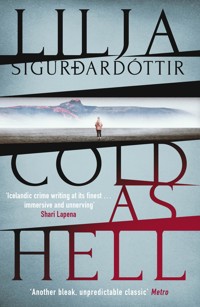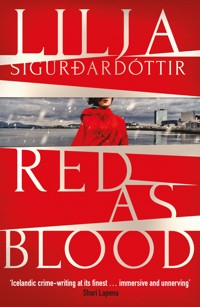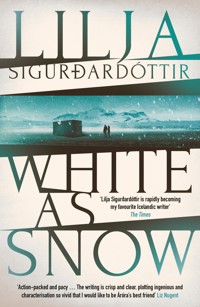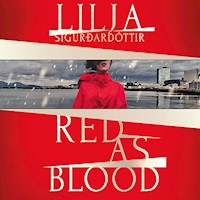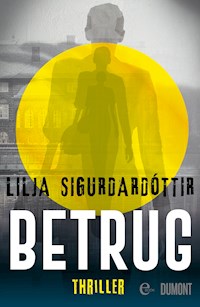7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Im hohen Norden wird viel getrunken. Und viel gemordet. Den Alkoholentzug hat er gerade hinter sich. Jetzt will Magni sein Leben wieder in den Griff bekommen und vor allem seine Ex-Frau Iðunn zurückgewinnen. Iðunn ist Kriminalkommissarin in Reykjavík und ermittelt in ihrem ersten Mordfall – aus dem bald eine bestialische Mordserie wird. Beunruhigenderweise entstammen alle Opfer dem Milieu der Anonymen Alkoholiker. Und der Täter bewegt sich Schritt für Schritt, Mord für Mord auf Magni zu … «Spannung vom Feinsten, geschickt konstruiert und anspruchsvoll.» (Morgunblaðið)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Ähnliche
Lilja Sigurðardóttir
Zwölf Schritte
Thriller
Aus dem Isländischen von Ursula Giger und Angela Schamberger
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Er erwacht von dem Schmerz in seiner Seite und schreit, bis er zur Besinnung kommt. Ihm ist übel. Seine Hände und Füße sind festgebunden. Schweiß läuft ihm übers Gesicht, und er kann nur mühsam die Augen öffnen. Er versucht zu begreifen, warum er von oben auf sein Wohnzimmer hinabblickt, als er mit Entsetzen das Blut entdeckt – sein ganzer Körper scheint blutüberströmt. Er hebt den Blick und schaut sich um, da begreift er: Er ist mit Absicht in Szene gesetzt worden, sodass er zum Bestandteil seiner eigenen Architektur wird. Der große Spiegel, der quer über der Küchenwand hängt und die Abendsonne im Wohnzimmer reflektiert, ist nun genau gegenüber von ihm, und er sieht sich selbst als Heiland in einer Imitation der Kreuzigungsszene. Das Kreuz wirkt wie ein Gemälde, und einen Augenblick lang erfreut er sich an der vollkommenen Harmonie der Inszenierung. Bis ihm bewusstwird, dass er mutterseelenallein ist.
Erstes Kapitel Ohnmacht
Die tiefstehende Februarsonne scheint mir direkt ins Gesicht, als ich auf den Parkplatz vor dem Haupteingang der Klinik trete. Auch wenn es in der Klinik hell ist, schmerzt die Umstellung beim ersten Schritt in das gleißende Winterlicht. Das ist nicht verwunderlich, denn zehn Tage lang habe ich nur durch eine schützende Front aus getöntem Fensterglas hinausgeblickt. Es kommt mir vor, als ob die Augen symptomatisch mein körperliches Befinden widerspiegeln. Die Welt hier draußen ist hart und reizt empfindliche Nerven: eine durchdringende Hupe auf der Straße, das Quietschen abgenutzter Bremsen, der beißende Frost und dieses aufdringliche Tageslicht, das die Konturen aller Dinge so scharf und die Luft so leicht und durchsichtig erscheinen lässt. Es ist ein unbehagliches Gefühl. Unangenehmer, als ich erwartet hatte, und ich spüre, wie sich eine Angst in meinem Magen breitmacht. Wie soll ich die realen Probleme des Lebens nüchtern bewältigen, wenn mich schon auf dem Parkplatz vor der Entzugsklinik Vogur solch eine starke Beklommenheit überfällt? Doch nach nur wenigen Minuten gewöhnen sich die Augen an das Tageslicht, und als sich der Knoten im Bauch aufzulösen beginnt, nimmt ein neues Gefühl überhand: die kribbelnde Vorfreude, was das neue Leben wohl mit sich bringen wird. Diese Vorfreude hat mich bereits heute Morgen erfasst, als sie mich anrief, um mir zu sagen, dass sie mich abholen wird. Obwohl ich mir aus Vernunft einrede, mir bloß keine falschen Hoffnungen zu machen, lässt mich die Frage nicht los, weshalb sie ausgerechnet jetzt den ersten Schritt unternimmt, nachdem sie mich ein halbes Jahr lang wie die Pest gemieden hat. Vielleicht ist es der Entzug – sie hat ja immer gesagt, dass unsere Ehe eine Zukunft hat, wenn ich bloß mit dieser Sauferei aufhöre. Das ist allerdings schon eine Weile her, und tief in meinem Inneren weiß ich, dass es zu spät ist und ich schon längst alle Chancen verspielt habe, die sie mir eingeräumt hat. Durch den Alkoholentzug ist mir vieles klargeworden, was ich vorher, von Bierrausch oder Katerstimmung benebelt, nicht erkannt habe. Zum Beispiel hatte ich immer das Gefühl, dass meine Frau mich nicht versteht. Ich dachte ständig, dass sie die Welt mit meinen Augen sehen und verstehen müsste, dass sie bei mir mit Beschimpfungen oder harten Forderungen nichts erreichte. Ich dachte, ich sei aufgrund meiner empfindlichen Seele auf mehr Liebe und Nachsicht angewiesen. Im Entzug, unter all den empfindlichen Seelen, die niemand verstehen wollte, erkannte ich schließlich, dass sie schon längst ihre ganze Gutmütigkeit und Liebe aufgebracht und ich ihr dafür nichts zurückgegeben hatte, abgesehen von den immer wiederkehrenden Enttäuschungen.
Während ich auf dem Parkplatz vor der Klinik auf sie warte, ziehen vor meinem inneren Auge Bilder aus unserer Ehe vorbei. Wir lernten uns in jungen Jahren auf einer Studentenfete an der Uni kennen. Sie war im zweiten Jahr ihres Jurastudiums, ich hatte gerade begonnen, Literaturwissenschaft zu studieren. Der Alkohol gab mir damals Mut, mich an die Mädchen heranzuwagen und selbstsicher aufzutreten. Sie lachten, weil sie mich witzig fanden, und bewunderten mein komisches Talent, das bis zum fünften Glas unterhaltsam war, dann aber mit jedem weiteren Drink wie die sonstigen Hirn- und Körperfunktionen zusehends nachließ. Unsere Beziehung begann damit, dass Iðunn mich auf dem Nachhauseweg stützte und mich ins Bett verfrachtete, wo ich, betrunken wie ich war, sofort einschlief. Als ich am nächsten Morgen völlig verkatert und zitternd erwachte, lagen wir beide angezogen nebeneinander, und sie war so unendlich schön und unschuldig mit ihrem dunklen, zerzausten Haar und ihrer bis auf die Wangen verschmierten Schminke. Ich stand leise auf, duschte, nahm ein paar Schmerztabletten und erwachte allmählich zum Leben. Dann braute ich starken Kaffee, toastete Brotscheiben und brachte ihr das Frühstück ans Bett. Wir lagen den ganzen Tag plaudernd im Bett und liebten uns den ganzen Nachmittag so leidenschaftlich, wie ich es bisher noch nicht erlebt hatte. Bald schon verbrachte sie fast jede Nacht bei mir, und innerhalb von zwei Monaten zogen wir zusammen. Die ersten Wochen unseres Zusammenlebens waren wie ein Glückstaumel – vermischt mit dem schlechten Gewissen, dass ich das Studium vernachlässigte. Nach und nach löste sich das Gefühl wegen der Alltagsprobleme in nichts auf. Alles drehte sich darum, wie wir das Geld für die Miete, Rechnungen, Essen und das Nachtleben zusammenbekamen. In meinem letzten Jahr auf dem Gymnasium hatte ich nebenher Liebesromane für einen kleinen Buchverlag übersetzt, der die Groschenromane an Kiosken und in Supermärkten vertrieb. Nachdem ich die Uni geschmissen hatte, übersetzte ich im Monat zwei Romane, und nach einem Jahr verabschiedete ich mich von meinem Traum, Schriftsteller zu werden, und übersetzte stattdessen monatlich drei Romane. Wir kauften uns eine Dreizimmerwohnung in einem alten Haus in der Innenstadt. Nun waren wir nicht mehr so häufig auf Studentenfeten, sondern führten ein ruhigeres Leben, und wahrscheinlich trank ich zu dieser Zeit am wenigsten und war bei weitem am glücklichsten. Bis Baldur geboren wurde. Iðunn war im letzten Jahr ihres Jurastudiums schwanger geworden, und im April kam unser kleiner Junge zur Welt. Eine Woche später starb er an einem Herzfehler. Sein Herz war einfach zu groß für seinen kleinen Körper, und man konnte nichts für ihn tun. Es ist unmöglich zu beschreiben, wie es sich anfühlt, sein neugeborenes Kind im Arm zu halten und zu spüren, wie das Leben aus ihm entweicht. Es ist, als ob sich die eigene Zukunft in Luft auflöst, als ob die Liebe zum Leben in der Brust erlischt. In den ersten Monaten waren wir ganz benommen vor Trauer und bewegten uns wie ferngesteuert. Iðunn wollte nicht mehr an die Uni zurück, um ihr Studium abzuschließen, und nahm einen Bürojob bei der Bezirksverwaltung an. Ich übersetzte weiterhin Liebesromane, ohne länger irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen mir und den Romanfiguren zu erkennen, die alle zum Schluss ihr Glück fanden. Nach einigen Monaten wich die Taubheit und das Gefühl der Unwirklichkeit allmählich einem schneidenden Schmerz, der jedes Mal, wenn die Gedanken zu unserem kleinen Jungen abdrifteten, wie eine ätzende Flüssigkeit durch den Körper floss. Dazwischen aber gab es immer wieder Glücksmomente, wenn uns etwas leichter ums Herz wurde und wir uns in die Augen schauen konnten, ein wenig lachten oder uns liebten. Ich kann fast auf den Tag genau sagen, wann ich aufgehört habe zu trinken, um mich zu amüsieren, und wann ich angefangen habe zu trinken, um den Schmerz zu betäuben.
Ein Rettungswagen fährt auf dem Parkplatz vor, und ein Mann wird auf einer Tragbahre in die Klinik getragen. Obwohl eine Decke über ihm ausgebreitet und er mit zwei Gurten festgezurrt ist, kann ich deutlich erkennen, wie der schmächtige Körper darunter zittert und zuckt. So schlimm war es bei mir nicht. Meine Trinkgewohnheiten unterschieden sich nicht wesentlich von denen anderer, außer dass ich ein bisschen mehr und ein bisschen häufiger trank. Nachdem unser kleiner Junge zur Welt gekommen und gestorben war, hatte ich keine Lust mehr, auszugehen und unter Leuten zu sein, sondern saß lieber zu Hause vor dem Fernseher, nippte an meinem Bier und besoff mich mit Wodka, bis ich auf dem Sofa wegdämmerte. So verliefen die Wochenenden, und manchmal war es auch unter der Woche so. Am Anfang weckte mich Iðunn noch und schleppte mich ins Bett, doch zu guter Letzt gab sie auf, und ich erwachte mitten in der Nacht auf dem Sofa, mit einer Bierdosensammlung vor mir auf dem Tisch und einer Heidenangst in der Brust, dass sie vielleicht nicht im Bett lag, sondern aufgegeben und mich verlassen hatte. Ich verspürte eine tiefe Dankbarkeit, wenn ich sie auf ihrer Seite des Bettes liegen sah, und ich schwor mir – und manchmal sogar ihr –, mit der Sauferei aufzuhören.
Während ich den Rettungssanitätern zuschaue, wie sie mit der Trage durch das Eingangsportal von Vogur eilen, verspüre ich eine unendlich große Erleichterung darüber, dass ich, im Gegensatz zu dem Mann auf der Trage, die zehn Tage bereits hinter mir habe. Vor zehn Tagen hätte ich zwischen diesem Mann und mir keine Gemeinsamkeiten entdeckt, aber jetzt empfinde ich eine Art Solidarität und begreife, dass uns lediglich das Ausmaß voneinander unterscheidet, nicht die Gesinnung. Ich könnte genauso enden, es ist nur eine Frage der Zeit und der Gelegenheit. Die Ohnmacht dem Alkohol gegenüber ist dieselbe.
Iðunn hält dicht am Gehsteig, und mir fällt auf, dass sie den Wagen wahrscheinlich nicht mehr gewaschen hat, seit sie mich verlassen hat. Es war immer meine Aufgabe, das Auto zu waschen. Wir begrüßen uns ziemlich ungeschickt mit einem Kuss auf die Wange, und ihr Lächeln ist irgendwie so vertraut und warm, dass ich mich erst wieder besinne, als ich mit der Hand durch ihr dunkles Haar fahre, das sie jetzt schulterlang trägt. Sie rutscht für einen Moment auf dem Sitz hin und her, bevor sie losfährt. Offensichtlich ist ihr diese Berührung unangenehm, also ziehe ich meine Hand zurück und sage:
«Vielen Dank, dass du mich abholst.»
«Keine Ursache», antwortet sie und lächelt. «Wie fühlst du dich?»
«Ganz gut! Etwas gestresst und unsicher, aber auch zuversichtlicher als vorher.»
«Gut so», meint sie und lächelt erneut, ohne den Blick von der Straße abzuwenden, und ich spüre, dass sie etwas sagen will. Zwischen uns gibt es mit Sicherheit noch viel Unausgesprochenes, aber ich hoffe, dass sie mir einige Tage Zeit lässt, um mich zu sammeln, bevor ich mich den Sünden der Vergangenheit stellen muss. Sie fährt mich direkt nach Hause, und dort angekommen, frage ich, ob sie auf eine Tasse Tee mit reinkommen will. Ich hoffe insgeheim, dass sie ablehnt, da ich die Wohnung nicht gerade in aufgeräumtem Zustand zurückgelassen habe – die meisten Kisten stehen ein halbes Jahr nach dem Umzug noch immer herum, und überall liegen Bierdosen, wenn ich mich richtig erinnere. Trotzdem will ich nicht, dass sie gleich wieder geht.
«Ich wollte dich um einen Gefallen bitten», sagt sie.
«Selbstverständlich», antworte ich, «ich schulde dir eine Menge.»
«Ich ermittle in einem Mordfall und wollte dich bitten, mir ein wenig zu helfen.»
Einen derartigen Gefallen habe ich nun wirklich nicht erwartet, und ich kann mein Erstaunen kaum verbergen.
«Wie in aller Welt soll ich dir denn bei einer laufenden Mordermittlung helfen?»
«Mit deinen Fachkenntnissen. Ich brauche etwas mehr Zeit, um dir das alles genauer zu erläutern, und heute ist dein erster Tag nach dem Entzug. Ich hab gedacht, wir könnten uns vielleicht morgen treffen, und dann erkläre ich dir die Sache?»
«Ja, klar, kein Problem», antworte ich total verwundert und biete ihr an, morgen zu mir zum Tee zu kommen. Bis dahin werde ich die Wohnung aufräumen.
Ein fauliger Gestank schlägt mir entgegen, als ich die Wohnungstür öffne. Mich überkommt ein Würgegefühl. Ich stelle die Tasche ab, öffne alle Fenster und mache mich sogleich daran, mich auf die einfachste Art und Weise von den Gespenstern der Vergangenheit zu befreien: Ich packe sämtliche Bierdosen und Weinflaschen in schwarze Plastiktüten und bringe den Müll raus, der sich in den letzten zehn Tagen in etwas im wahrsten Sinne des Wortes Organisches verwandelt hat, da ich damals nicht in der Lage gewesen bin, ihn rauszubringen. Die Dosen schmeiße ich weg, anstatt sie zum Recycling zu bringen. Es kommt für mich nicht in Frage, Pfand dafür zu kassieren – als ob Recycling ein Symbol für meine Sparsamkeit und mein Umweltbewusstsein wäre. Ich will, dass dieser saure und aufdringliche Gestank der fauligen Bierreste mich daran erinnert, dass ich ihn bei mir zu Hause nicht mehr dulde. Als ich die Tüten die Treppe runtertrage, holen mich die Selbstzweifel wie alte Bekannte ein: Es ist fast schon angenehm, vertraute Sätze über das eigene Elend und die eigene Ohnmacht in sich hineinfließen zu lassen wie heißen Brei, von dem einem fast schlecht wird, den man aber doch immer wieder isst. Ich muss es schaffen, diese Gedanken von mir fernzuhalten und sie durch eine positivere Einstellung zu ersetzen. In Gedanken erstelle ich eine Einkaufsliste der Dinge, die ich anschließend im Supermarkt besorgen will, und überlege mir, was ich tun könnte, damit die Wohnung morgen etwas gemütlicher aussieht.
Im Supermarkt schraube ich den Verschluss von allen Putzmitteln ab, rieche daran und wähle das Produkt mit dem intensivsten Duft. Außerdem kaufe ich Duftkerzen und ein weinrotes Papiertischtuch für den Sofatisch, damit das Wohnzimmer nicht so kahl wirkt. Anschließend suche ich mir mein Abendessen zusammen, Hähnchen vom Grill und dazu Salat. Ich lege Cola, Orangensaft, Mineralwasser, Sprite und Ananaskonzentrat in den Einkaufskorb, damit bin ich bestens mit Getränken versorgt und werde das Bier nicht vermissen. Außerdem kaufe ich zwei Sorten Eis, Eiswaffeln und Schokosauce. «Lieber dick als vollgesoffen», hat jemand beim Entzug gesagt, was ich mir als Motto für die kommenden Tage eingeprägt habe, zumindest so lange, wie ich mir keine Sorgen um meine Linie machen muss. Während ich in der Kassenschlange stehe, schweift mein Blick über die Titelseiten der Zeitungen. Ich erstarre. Die Schlagzeile nimmt eine halbe Seite ein: «Polizei sucht Mörder!», und darunter steht in kleineren Buchstaben: «Der letzte Woche in Grafarvogur aufgefundene Tote ist ermordet worden.» Ich packe die Zeitung zusammen mit dem Morgunblaðið in den Einkaufskorb, ich will wissen, was in der Welt vor sich geht.
Als Erstes staubsauge ich die gesamte Wohnung und schrubbe den Boden mit einer ordentlichen Menge parfümiertem Putzmittel. Dann trage ich alle Kisten in das Zimmer nebenan und staple sie dort an der Wand, sodass das Wohnzimmer auf einmal geräumig und ganz ansehnlich wirkt. Ich breite das Papiertischtuch über den Sofatisch, stelle ein paar Duftkerzen auf einen Teller und wühle in einigen Kisten herum auf der Suche nach irgendwelchem Kram, den ich zur Dekoration aufstellen könnte. Beim Umzug damals habe ich den Überblick verloren, deswegen liegt jetzt in den Kisten alles durcheinander: Bücher, Bilder, Geschirr, alte Briefe, CDs und Kleinkram. In einer Kiste liegt ein Stapel mit Fotos von unserem kleinen Jungen. Zweihundert Fotos in einer Woche, und doch nicht genug. Ich spüre, wie sich mein Herz zusammenzieht und der alte Schmerz wie siedend heißer Tee aus einer übervollen Tasse schwappt und den ganzen Körper überflutet. Als Reaktion auf diesen Schmerz verspüre ich plötzlich ein starkes Verlangen nach Alkohol: Ein eiskaltes Bier würde diesen brennenden Stich in der Brust im Nu lindern. Ich schließe die Fototasche, weil ich merke, dass ich etwas zu dünnhäutig bin, um mir ausgerechnet jetzt – ohne Bier und in diesem haltlosen Zustand – Bilder von ihm anzuschauen. Ich erinnere mich an die Worte, die ich auf einem Meeting im Rahmen des Entzugs gehört habe, atme tief durch und warte ruhig ab, ohne irgendeine Entscheidung zu treffen, und rede mir selber ein: «Auch das geht vorbei.» Und tatsächlich ist die Lust auf Bier nach wenigen Augenblicken beinahe wie weggeblasen, und ich wühle weiter nach Nippes und Bildern, die ich auf das Fensterbrett und die Regale stelle. Bei der Aussicht auf ein besseres und angenehmeres Leben fühle ich mich ganz beschwingt.
Während ich den Salat mische, Balsamico-Dressing und geröstete Pekannüsse darübergebe, höre ich mir die Nachrichten im Radio an. Es wird berichtet, dass der Mann aus Grafarvogur vor zehn Tagen in seiner Wohnung ermordet aufgefunden wurde, ungefähr zur selben Zeit, als ich den Entzug begann. Die Obduktion hat ergeben, dass er vierundzwanzig Stunden vorher gestorben ist, was mit den Informationen aus den Zeitungen übereinstimmt. Als ich mich frage, ob das die Mordermittlung ist, von der Iðunn gesprochen hat, erklingt schon ihre Stimme im Radio, und Iðunn Baldursdóttir, Kriminalbeamtin und Leiterin der Ermittlungen, bestätigt, dass die Untersuchungen in vollem Gange seien und gut vorankämen. Nach zwei Jahren bei der Bezirksverwaltung hat sie sich an der Polizeischule beworben, wurde aufgenommen und ist in wenigen Jahren zur Kriminalbeamtin aufgestiegen. Sie war insbesondere für Einbruch- und Diebstahlsdelikte zuständig, was zur Folge hatte, dass sie Fingerabdrücke in Kindergärten und Apotheken, in denen eingebrochen worden war, abnehmen musste und auf der Suche nach dem Dieb die geläufigen Schlupflöcher polizeibekannter Gauner durchforstete. Mich befällt ein Schaudern bei dem Gedanken, dass sie nun Leichen untersucht und Mördern nachstellt. Welche Hilfe kann sie nur in so einer Mordermittlung von mir erwarten? Fachkenntnisse, hat sie gesagt. Ich verfüge über keine speziellen Kenntnisse außer in Bezug auf englische Liebesromane der leichteren Art. Sie wird ja wohl kaum in diesem Bereich Nachforschungen anstellen. Je mehr ich darüber nachdenke, umso absurder erscheint mir der Gedanke, dass ich zu diesen Ermittlungen irgendetwas von Nutzen beitragen könnte. Bei diesen Untersuchungen geht es vermutlich um Fingerabdrücke, DNA, Mikropartikel, Gewebeproben oder wie auch immer diese Dinge heißen, über die sie sich auf Seminaren im Ausland ständig weiterbildet. Ich esse den Salat und das halbe Hähnchen und stehe hastig auf, um zu einem Meeting zu gehen, wo ich hoffentlich Ruhe vor dem Verlangen nach Alkohol finden kann, das immer größer wird, je mehr ich über diese Mordermittlung nachdenke.
Ich blättere den Veranstaltungskalender der Anonymen Alkoholiker durch und wähle ein Meeting in der Nähe aus, mitten in der Innenstadt, das um acht Uhr beginnen soll. Mit zügigen Schritten nähere ich mich dem Versammlungsort und genieße es, die frostkalte Luft in den Lungen zu spüren. Ich betrete atemlos und keuchend das alte Holzhaus, wo das Meeting gerade vorbereitet wird. Allem Anschein nach ist die Versammlung ziemlich gut besucht. Ich wähle einen Platz in den hinteren Reihen und schätze die Anzahl der Leute, die sich begrüßen, plaudern, sich Kaffee einschenken und sich hinsetzen, auf ungefähr dreißig. Um Punkt acht verstummt das Stimmengewirr im Saal, als ein großgewachsener Mann mit der Begrüßung beginnt. Im Entzug bin ich zu jedem Meeting gegangen, das angeboten wurde und wo immer dasselbe passiert: Wie durch einen wundersamen, stillen Zauber beruhigen sich meine rastlosen Gedanken, bis auch die überreizten Nerven Entspannung und Ruhe finden – um diesen Zustand zu erreichen, war ich vorher immer auf Alkohol angewiesen. Nach den Begrüßungsworten schildert der Hüne in kurzen Sätzen sein Leben, wie der Alkoholismus ihn um das Beste in seinem Leben gebracht und der Heilungsprozess ihm allmählich dazu verholfen hat, nach und nach wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen und einen Teil des Verlustes wettzumachen. Mit einigen Aspekten seiner Lebenserfahrung spricht er mir direkt aus der Seele, und ich verstehe nun viel besser, dass ich mir mein Selbstmitleid über mein unglückliches Leben hätte ersparen können, dass ich selbst in mein Unglück gerannt bin. Der Riese gibt mir Hoffnung, dass ich eines Tages mit erhobenem Kopf dastehen und von mir behaupten kann, glücklich zu sein. Im Anschluss an seine Rede ergreifen andere das Wort und sprechen über unterschiedliche Themen. Jeder strahlt diese innige Dankbarkeit aus, Teil dieser Versammlungen zu sein, die es ihnen ermöglicht, sich täglich mit den Schwierigkeiten des Lebens auseinanderzusetzen, ohne den Mut zu verlieren und im Suff Erlösung zu suchen. Zum Schluss stehen alle auf, nehmen sich an den Händen und sprechen ein kurzes Gebet, das mich mit einem Gefühl erfüllt, als ob die gebündelte Kraft aller Anwesenden durch meine Arme in meinen Körper strömt und mich nicht nur berührt und aufwühlt, sondern auch ruhig werden lässt und zufrieden macht.
«Bist du zum ersten Mal bei einem Meeting?», fragt mich eine blonde junge Frau, die sich zu mir durchdrängt, als ich nach Beendigung der Versammlung ratlos in der Menge stehe. Obwohl ich hier niemanden kenne, möchte ich diese Atmosphäre der Geborgenheit auf keinen Fall verlassen.
«Ja», antworte ich, «das war ein gutes Meeting.»
«Einige von uns gehen anschließend noch in ein Café, ein bisschen quatschen», sagt sie aufmunternd und zeigt auf eine nicht genauer definierte Gruppe von Leuten hinter ihr. «Kommst du mit?» Ich möchte am liebsten ja sagen, doch mir fallen die Ratschläge aus dem Entzug wieder ein, Situationen zu umgehen, in denen man vorher getrunken hat, und mich beschleichen Zweifel.
«Ich bin gerade erst heute aus dem Entzug gekommen, und ich weiß nicht, ob das so schlau ist.»
«Dann bist du in bester Gesellschaft!», erwidert sie lachend, und in ihrem Lachen steckt eine erfrischende Leichtigkeit. Doch dann fügt sie etwas ernsthafter hinzu, dass sie in ein Lokal gehen, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird.
Weil ich immer Schwierigkeiten gehabt habe, ohne Alkohol einzuschlafen, und es einem im Entzug nahegelegt wird, abends Koffein zu meiden, bestelle ich im Café einen Kräutertee. Die Gruppe besteht aus acht Leuten, die sich ganz offensichtlich gut kennen, ich fühle mich wohl und habe überhaupt nicht das Gefühl, ein Außenseiter zu sein. Sie stellen sich alle vor, doch der einzige Name, der mir im Gedächtnis bleibt, ist der der blonden Frau, die mich ins Café eingeladen hat. Sie heißt Fríða, und ich suche wie von selbst immer wieder den Blickkontakt mit ihr. Sie hat ein breites Gesicht, hohe Wangenknochen, und ihre blauen Augen sind leicht schräg.
«Bist du Egills Bruder?», fragt sie plötzlich, und als ich es bejahe, lacht sie herzlich und meint, dass sie den Gesichtsausdruck erkannt habe. Die Frage erinnert mich daran, dass ich Egill versprochen habe, mich bei ihm zu melden, sobald ich aus dem Entzug komme, und so trinke ich meine Tasse leer und danke der Gruppe für den netten Abend.
Es macht mir Spaß, kreuz und quer durch die engsten Straßen und Gassen der Altstadt zu streifen, und ich bewege mich in einem verworrenen Zickzackkurs fort, bis ich endlich zu Hause ankomme. Es herrscht eine frostige Stille, und auf dem Asphalt glitzern Tausende winzig kleiner Eiskristalle im Schein der Straßenbeleuchtung wie Sterne. Das Zentrum von Reykjavík würde in Bezug auf seine städtebauliche Planung oder sein architektonisches Design niemals einen Preis verliehen bekommen, aber es verfügt über einen eigenen unvergleichlichen Liebreiz, der sich eher durch Charme als durch Eleganz auszeichnet. Einzelne dreistöckige Steinbetonhäuser in uneinheitlichen Baustilen überragen die ansonsten ein- oder zweigeschossigen Holzhäuser, die sich aneinanderkuscheln, als ob sie Schutz vor der Winterkälte suchten. In den meisten Fenstern ist ein Licht zu erkennen: ein flackernder Fernseher, eine Kerze auf dem Tisch oder eine Lampe auf dem Fensterbrett werfen ihren Schein auf das Wellblech des benachbarten kleinen Holzhauses. Die meisten Isländer gehen spät ins Bett, was praktisch ist, da ich Egill ja noch anrufen muss und es schon fast elf ist.
Eigentlich hat Egill mich dazu gebracht, einen Entzug zu machen. Nicht nur dass wir mit einem saufenden Vater aufgewachsen sind, auch die ungünstige Erbanlage hat uns Brüder anfällig für den Alkohol gemacht. Wobei Egill schon immer das schwarze Schaf war, von dem alle wussten, dass er trank, und zwar nicht zu knapp. Seit seiner Jugend konsumierte er jegliche Drogen, die er nur kriegen konnte, und in den letzten Jahren hat er eigentlich auf der Straße gelebt. Alle, die ihn vorher schon kannten, verriegelten ihre Türen und hielten ihre Brieftasche geschlossen. Das reichte allerdings nicht aus, denn er stahl ohne Skrupel. Im Vergleich zu Egill verhielt ich mich geradezu vorbildlich. Egal, wie viel ich soff, er trank noch heftiger, und ich benutzte ihn als eine Art Rechtfertigung, um an meiner Sauferei festzuhalten. Doch dann hörte Egill vor ein paar Monaten mit dem Trinken auf. Er bedrängte mich sofort und hielt mir lange Standpauken über die Notwendigkeit, dass auch ich mit der Zecherei aufhören müsse, und die Gründe, die er aufführte, klangen tatsächlich überzeugend: Meine Frau hatte mich verlassen, ich trieb mich jeden Abend sturzbetrunken in der Stadt herum, wobei sich die Rechnungen unangenehm häuften, da ich wegen meines Alkoholkonsums nicht gerade viele Übersetzungen zustande brachte. Die Standpauken taten ihre Wirkung. Ich trank mit immer schlechterem Gewissen, und an schwierigen Tagen dachte ich ernsthaft daran, mit dem Trinken aufzuhören. Den endgültigen Entschluss, mir Hilfe zu suchen, fasste ich aber erst, nachdem sich Egills Freund Aðalsteinn zu Tode gesoffen hatte. Auch wenn Aðalsteinn bloß ein Bekannter von mir gewesen war, den ich nie richtig gemocht und der in meinen Augen einen schlechten Einfluss auf meinen kleinen Bruder gehabt hatte, so war es doch eine erbärmliche Tragödie, im Vollsuff unter einer Hecke zu erfrieren. Egill war nach dem Tod seines Freundes sehr niedergeschlagen, besonders weil es ihm kurz vorher noch gelungen war, ihn zu einigen Meetings mitzuschleppen, und er war voller Hoffnung gewesen, dass Aðalsteinn ebenfalls mit der Sauferei aufhören würde. Drei Tage nach einem Meeting fand ein Hund beim Spaziergang mit seinem Herrchen im Park Miklatún die hartgefrorene Leiche, die sich an eine angebrochene Flasche klammerte. Das versetzte mir einen derartigen Schock, dass ich mich endlich dazu durchrang, einen Entzug zu machen.
Egill ist froh, von mir zu hören, und schlägt vor, dass wir morgen zusammen zu einem Meeting gehen und anschließend etwas kochen. Ich grinse vor mich hin, da ich weiß, was es bedeutet, mit Egill zu kochen: Ich koche, während er drauflosplappert und andauernd aus den Kochtöpfen nascht. Ich freue mich darauf, mit ihm Zeit zu verbringen, jetzt wo wir beide trocken sind. Als ich mich von meinem kleinen Bruder verabschiede, wird mir ganz warm ums Herz vor Zuneigung.
Ich genehmige mir eine Riesenportion Eis mit Sauce und Waffeln. Im Entzug habe ich mich daran gewöhnt, nie hungrig zu sein, und will mir die neu erworbene Gepflogenheit bewahren, mich abends mit etwas Leckerem zu verwöhnen. In gewisser Weise überraschen mich meine neuen, seltsamen Angewohnheiten, da es für mich vorher nichts Selbstverständlicheres gegeben hat, als es mir mit einem Sixpack auf dem Sofa bequem zu machen und dort einzunicken. Jetzt verhätschle ich mich wie ein kleines Kind, genehmige mir im Schlafanzug ein abendliches Betthupferl, bürste mir anschließend die Zähne und lese im Bett ein Buch. Ich lese über die Ohnmacht, sie zu erkennen macht es überhaupt erst möglich, sich allmählich zu bessern. Genau wie bei anderen Alkoholikern bestand meine Ohnmacht darin, inbrünstig das Versprechen abzulegen, am Abend nicht mehr zu trinken, oder nächstes Wochenende oder irgendwann einmal, obwohl es nicht in meiner Gewalt stand, diesen angeblichen Entschluss durchzuhalten. Die Sucht ist ein starker Gegner, der nur zu besiegen ist, indem man sich ins Zeug legt und sich seine eigene Schwäche eingesteht. Schon bevor ich in den Entzug ging, hatte ich über die Ohnmacht nachgedacht, und ich glaube, dass ich den ersten Schritt der Lehre ganz gut im Griff habe. Ich murmle ihn immerzu vor mich hin, um mit ihm in Gedanken einzuschlafen.
Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind – und unser Leben nicht mehr meistern konnten.
Zweites Kapitel Glaube
Ich starre auf die Fotos der Leiche und kann nicht glauben, dass das die Überreste eines Mannes sein sollen, der vor kurzem noch gelebt hat. Es kommt mir vor, als hätte ich ein Foto einer Theaterkulisse oder einer Installation im Nýlistasafn, dem Museum für zeitgenössische Kunst, vor mir. Der Mann ist an ein riesengroßes Holzkreuz an der Wand geschlagen, der Kopf hängt über der Schulter, die Beine sind verschränkt, und Nägel bohren sich durch Hände und Füße. Er trägt nur eine Unterhose, am Oberkörper klafft an der Seite eine Wunde, ein Kranz aus Stacheldraht thront auf seinem Kopf, Blut ist über sein Gesicht, über seinen Körper und die weiße Wand geflossen. Ein großes Gemälde von Tolli neben der Leiche lässt die Inszenierung noch unwirklicher erscheinen. Auf dem Gemälde ist ein Berg zu sehen, umgeben von einem stillen Himmel mit vereinzelten Wolkenfetzen. Es hat den Anschein, als hätte jemand diese Wanddekoration mit höchster Präzision angebracht, um sich an der Vollkommenheit der Darstellung zu erfreuen. Uns ist der Appetit vergangen, und die Brötchen, die ich heute Morgen in der Bäckerei geholt habe, liegen unberührt auf dem Tisch. Iðunn nippt von Zeit zu Zeit an ihrem Tee, mein Kaffee dagegen wird kalt.
«Das ist mein erster Mordfall», sagt sie, und ich kann nicht erkennen, was in ihrer Stimme überwiegt, Stolz oder Angst.
«Was für ein Mensch macht so was?», sage ich und stöhne auf. Während ich mir die Fotos anschaue, empfinde ich statt Mitleid mit dem Toten nur noch Ekel und Befremdung. Als ob meine Seele betäubt wäre und der Körper die Aufgabe übernähme, die Reaktionen angesichts dieser unendlichen Grausamkeit zum Ausdruck zu bringen, die dafür verantwortlich war, dass einem Menschen derart übel mitgespielt wurde. Mir wird schlecht.
«Ich muss herausfinden, was passiert ist», sagt Iðunn. «Im Moment haben wir keine Hinweise.» Sie nimmt die Bilder und steckt sie wieder in die braune Mappe. Ich bin erleichtert, dass ich sie nicht länger betrachten muss, und nehme einen Schluck kalten Kaffee.
«Ich bin für dich da, wenn ich dir irgendwie helfen kann», sage ich und hoffe, dass sie mir mit ihrer Bitte gestern im Auto signalisieren wollte, dass sie jemanden braucht, dem sie vertrauen und mit dem sie reden kann, vielleicht braucht sie auch eine Schulter, um sich auszuheulen.
«Danke. Ich benötige tatsächlich deine Hilfe», sagt sie und holt tief Luft. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sie keine Schulter zum Ausheulen braucht, und ich spüre, wie mir ein Angstschauer über den Rücken läuft.
«Das Opfer war ein trockener Alkoholiker und Mitglied der Anonymen Alkoholiker. Er war seit fünf Jahren abstinent und besuchte einmal die Woche ein Meeting. Ich wollte dich bitten, zu den Versammlungen zu gehen und Augen und Ohren offen zu halten», erklärt sie, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt.
«Aber Iðunn, ich bin erst gestern aus dem Entzug entlassen worden!», antworte ich erregt, ich bin verwirrt. «Ich bin erst bei einem einzigen Meeting gewesen! Du findest bestimmt jemand, der erfahrener ist als ich, oder du gehst einfach selber hin. Du brauchst ja nichts zu sagen.»
«Erstens muss es ein Mann sein, da er viele Männermeetings besucht hat, zweitens bringt es nichts, wenn jemand dort herumschnüffelt, von dem alle wissen, dass er Polizist ist, und drittens musst du sowieso zu diesen Meetings. Das hält dich bei der Stange.»
Ich würde sie am liebsten anschnauzen und ihr sagen, dass es nicht gerade angebracht ist, bei diesen Meetings an etwas anderes zu denken als an seine eigene Genesung, aber ich halte den Mund. Das Gefühl, dass ich ihr etwas schuldig bin, ist zu stark, diese Art von Egoismus kann ich mir nicht leisten.
«Ich bin kein Geheimagent, Iðunn. Du weißt, dass ich nicht der Typ bin, der Leute verhört, und zudem habe ich keine guten Nerven, wenn Gefahr droht.»
«Du sollst dich nicht in Gefahr begeben, mein lieber Magni, sondern lediglich die Augen offen halten und mich wissen lassen, ob dir ein oder mehrere Verdächtige auffallen oder dir Gerüchte zu Ohren kommen.» Die Worte mein lieber Magni lassen jeglichen Widerstand dahinschmelzen, und als ob sie es spürt, fügt sie sofort hinzu: «Aber der Hauptgrund, warum ich zu dir komme, ist, dass ich dir vertrauen kann.»
«Sind das anerkannte Arbeitsmethoden bei der Kriminalpolizei, ehemalige Partner in die Ermittlungen mit einzubeziehen?», frage ich schließlich, ohne jegliche Hoffnung, dass dieser letzte Strohhalm mir aus der Klemme helfen könnte.
«Ja, wir arbeiten mit Informanten und anderen Leuten zusammen, die uns behilflich sein können, und mein Vorgesetzter hat diese Maßnahme gutgeheißen.»
Informanten. Was für eine seltsame Berufsbezeichnung. Sie ist offensichtlich davon ausgegangen, dass ich zusagen würde, denn sie hat eine Schweigepflichterklärung vorbereitet, in der es heißt, dass ich zur Verschwiegenheit verpflichtet bin in Bezug auf das, was ich während der Zusammenarbeit mit der Polizei erfahre. Obwohl mich meine innere Stimme zur Vernunft aufruft, unterschreibe ich. Ich weiß nicht, ob ich es aus schlechtem Gewissen Iðunn gegenüber tue, da ich mich ihr gegenüber verpflichtet fühle, oder ob ich einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer in meiner Brust verspüre, weil ich nun Gelegenheit habe, sie häufiger zu sehen.
Das Haus ist eines dieser neumodischen Häuser mit schrägem Dachfirst, es erinnert mich an ein Schiff und ist riesengroß. Die eine Hälfte besteht aus zwei Stockwerken, während die andere über eine doppelte Raumhöhe verfügt. Küche und Wohnzimmer bilden einen großen Raum, in der Mitte steht eine offene Küchenkombination. Der gekreuzigte Mann war offensichtlich nicht nur stinkreich, sondern auch ein Kenner der neuesten Trends im Bereich Innenarchitektur. Die Farbe Weiß dominiert das Innere des Hauses, sodass es zum Teil an eine Arztpraxis erinnert, aber ein wohlplatziertes Gemälde, eine Skulptur in der Ecke und eine Pflanze am Fenster schaffen eine warme Atmosphäre.
«Es scheint nichts gestohlen worden zu sein», sagt Iðunn und steigt unbefangen über die gelben Absperrbänder und die Kreidestriche auf dem Boden.
«Wie wollt ihr das wissen, wenn der Besitzer tot ist?», frage ich.
«Wir haben von der Versicherungsgesellschaft eine Liste über die Wertsachen im Haus erhalten, und zudem haben wir mit seinem Freund, genauer gesagt dem Liebhaber des Verstorbenen, gesprochen.»
«Dann war er also schwul?», frage ich, und auf einmal erhält die Kreuzigung eine neue Bedeutung.
«Ja, wir haben den Liebhaber überprüft. Er steht nicht unter Verdacht. Er war im Ausland und ist am Boden zerstört. Er wollte nichts davon wissen, dass der Tote irgendwelche Feinde hatte oder mit jemandem im Streit lag.»
«Wie hieß der Verstorbene?»
«Er hieß Jón Ágúst Karlsson, war sechsunddreißig Jahre alt und Architekt.»
Im selben Augenblick betreten wir das Wohnzimmer, und ich erblicke die Wand, die ich heute Morgen schon auf den Fotos gesehen habe. Die unmittelbar zu greifende Realität dessen, was in diesem Haus geschehen ist, dringt in mein Bewusstsein, und ich verspüre einen schmerzenden Stich im Hals. Das Ganze wird irgendwie noch konkreter, wenn man den Namen des Mannes kennt. Jón Ágúst ist ein derart geläufiger Name, dass man nicht wirklich versteht, warum jemand einen Mann töten sollte, der einen solch alltäglichen Namen trägt. Einen kurzen Augenblick fühle ich mich, als ob ich gleich in Ohnmacht falle, und ich frage Iðunn schnell, ob es in Ordnung ist, wenn ich mich in einen Stuhl in der Wohnzimmerecke setze.
«Ja, kein Problem, die Ermittlungen im Haus sind schon lange abgeschlossen», antwortet sie und fischt aus ihrer Tasche ein Bonbon und reicht es mir. «Das erhöht den Blutdruck», sagt sie. Ich zerkaue energisch das Bonbon und überlege, ob ich in ihren Augen eine totale Memme bin. Die Leiche ist entfernt worden, aber an der Wand hängt immer noch das riesige Holzkreuz aus dicken, grobgehobelten Balken, das mit einer Betonschraube oben an der Wand direkt unter dem hohen Dachfirst befestigt ist. Es reicht bis zum Boden. Das Blut sieht im Tageslicht beinahe schwarz aus und ist über das gesamte Kreuz und zu beiden Seiten über die Wand gelaufen. Links vom Kreuz hängt das Gemälde von Tolli. Die Blautöne und die Tiefe treten stärker hervor als auf den Fotos. Rechts vom Kreuz, etwas nach unten versetzt, hängt ein kleines Gemälde, das ich auf den Fotos nicht bemerkt habe. Es ist ein klassisches Landschaftsbild, offensichtlich eine isländische Landschaft: ein blauer Fjord, eine Landspitze in grüner Umgebung und im Vordergrund graue Steine. Als das Ohnmachtsgefühl verschwunden ist, stehe ich auf und versuche die Signatur zu entziffern, kann aber den Künstlernamen nicht ausmachen.
«Weißt du, wer dieses Bild gemalt hat?», frage ich Iðunn, und sie schüttelt den Kopf.
«Warum fragst du?» Sie kommt zu mir und bemüht sich ebenfalls, die Unterschrift zu entschlüsseln.
«Ich habe mich einfach gefragt, weil er schwul war, ob ihr die Symbolik der Kreuzigung etwas genauer unter die Lupe genommen habt», erwidere ich und versuche, mir die Meldungen über die Beziehung zwischen den Homosexuellen und der Kirche in den letzten Jahren in Erinnerung zu rufen.
«Hm, das meinst du», sagt Iðunn. «Ich werde nachschauen, ob auf der Versicherungsliste aufgeführt ist, von wem das Gemälde stammt.»
Vom Wohnzimmer aus machen wir einen Rundgang durch das Haus, es wirkt aufgeräumt, und es sind keine Anzeichen eines Kampfes zu sehen. Die Matratze im Schlafzimmer ist abgezogen, und ich schaue Iðunn fragend an, die mir aufgrund meines Dilettantismus beinahe schroff erklärt, dass die Bettwäsche ins Labor geschickt worden sei, das Bett jedoch sauber gewesen sei und die einzigen Spuren in der Wäsche vom Opfer herrühren würden. Auch das Bad, das an das Schlafzimmer grenzt, ist sauber, aber nach der letzten Reinigung offensichtlich noch benutzt worden, da auf dem Waschbecken ein Rasierer mit vertrockneten Schaumflecken liegt und über dem Badewannenrand ein Handtuch hängt. Unten befinden sich ein Fahrradraum und eine ausgebaute Garage sowie ein Fernsehzimmer und ein großzügiges Büro. Am Fenster erblicke ich einen hohen Zeichentisch, der dazu gedacht ist, im Stehen zu arbeiten, und an der Wand befindet sich ein gewöhnlicher Schreibtisch mit ein paar Unterlagen, ordentlicher gestapelt, als ich es gewohnt bin. Rechnungen, die Einladung zu einer Gemäldeausstellung, Schmierzettel, die mit der Arbeit zu tun haben. Besonders ein Gegenstand auf dem Schreibtisch weckt mein Interesse: ein gefalteter Veranstaltungskalender der AA. Der Kalender ähnelt meinem eigenen, blaugrau und auf Kreditkartengröße zusammengefaltet, damit er gut in die Brieftasche passt, doch in diesem Exemplar sind mindestens zwei Versammlungen am Tag mit verschiedenfarbigen Kugelschreibern, Filzstiften und Bleistiften unterstrichen. Ich fuchtle mit dem Kalender vor Iðunns Gesicht herum.
«Willst du, dass ich zu all diesen Meetings gehe?»
«Das wäre von Vorteil», meint sie, «aber wahrscheinlich müssen wir herausfinden, welche Meetings er regelmäßig besucht hat, dann haben wir einen Ansatzpunkt.»