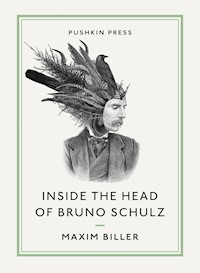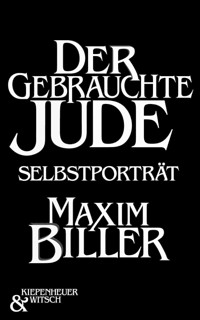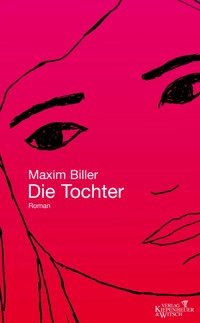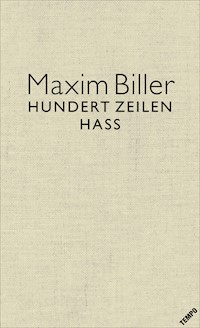
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tempo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Hass, damit das endlich klar ist, bedeutet Wahrheit – und etwas mehr Ehrlichkeit.« Niemand in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur hasst virtuoser, fundierter und zugleich liebevoller als der Schriftsteller Maxim Biller. Mit der Kolumne »100 Zeilen Hass« begann er seine Karriere als Journalist beim Magazin TEMPO, bevor er sich dann auch als Erzähler und Dramatiker einen Namen machte. Über 100 Mal begab er sich zwischen 1987 und 1996 Monat für Monat auf die Suche nach Wahrheit und Ehrlichkeit. Bis 1999 wurde die Kolumne im ZEIT-Magazin fortgesetzt, bis heute ist ihr Ruf legendär. Erstmals erscheinen hier sämtliche Texte unverändert als Buch. Jede Kolumne ist ein pointierter Indizienprozess im Dienst nur einer Sache: dem Kampf für das Gute und gegen alles Schlechte. Mit einem Vorwort von Hans Ulrich Gumbrecht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Maxim Biller
Hundert Zeilen Hass
Mit einem Nachwort von Hans Ulrich Gumbrecht
TEMPO
Inhalt
Mickey Rourke, der Arschfisch
Stürzt die Gräfin!
Schluss mit dem neuen Jahr!
Lang lebe Waldheim!
Osti go home!
Optischer Brechreiz
Das nervende Nervenbündel
Stil, *1.1.1980, †10.6.1988
Schafft den Sommer ab!
Philosemitismus und kein Ende
Bernie go home!
Die Abschussliste
Krieg im Kaffeehaus
Zum Heucheln!
Enkel Tom
Zerbröselt
Wehret den Anfängern!
Mein Gott, Walters!
Die Globetrottel
Monaco Fratze
An meine Völker
Grün vor Wut
Eine Schmierseife namens Ulrich
Nieda mit der StiWa!
Es muss nicht immer Galle sein
So wahr uns Krenz helfe
Die Schwätzerin der Nation
Der Kläffer seines Herrn
Der warme Krieg
Wiedervereinigung
Sexy Gysi
Sklaverei macht frei
Die getürkten Deutschen
Schweigen für Deutschland
Das temporäre Phänomen
Liebes Leid
Aufwachen!
Der diensthabende Dichter
Alte Idioten, junge Idioten
An meine rechten Freunde
Das postmoderne Mittelalter
Die Renate
Strohmausfall
Sex im Schlussverkauf
Tofu-Terror
Teures Vaterland
Die Berlin-Kanaille
Unser Waldheim
Meine herbste Zeit
Dumm Dumm Deutschland
Der Zwerg-Schnauzer
Kannibalen des Realen
Die Schwarze-Armee-Fraktion
Deutschstunde
Deutscher Frühling
Hunde, wollt ihr ewig leben!
Keine Versöhnung mit der RAF!
Geisterstadt
Feigheit vor dem Feind
Der Medien-Mabuse
Kollege Bildungshuber
Feiglinge ohne Moral
Aufstand schaffen ohne Waffen
Am Ende ein Patriot
Guten Morgen, Poptrottel!
Alle meine Feinde
Alle Rechten werden Brüder
Der Zweitweizsäcker
Der Dorftrottel
Brillemsen
Sex, Lügen, Videoclips
Kriegslust der Zivilisten
Unternehmen Elfenbeinturm
Biedermeier, Baby!
Andreas-Hofer-Gefühle
Statt-Führer
Die Schwester der Nation
Der ach so typische Held
Schindluders List
Falsche Feinde
Kinkmichels Träume
Geliebter Lügner
Der Müll, das Volk und die Politik
Mehr Geld
Unter Wilden
Die Waschlappen und ihr Heros
Tante Karl
Der Negerschläger
Popspiesser im Stahlgewitter
Happy Birthday, Holocaust!
Der rasende Essayist
Die Welt ist krank, peng pang
Grünschiss
Die Selbstverliebten
Warum hast du den Krieg verloren, Großvater?
Kommando Thomas Strittmatter
Wenn ich einmal blau wär’
Träumt weiter, Genossen
Fakten, Fakten, Fakten
Rabin und die Deutschen
Wer glättet Martin Walsers Falten?
Esst Schwarzbrot, rettet die Welt!
Schmidt, Schnauze!
Kolumnistisches Manifest
Heiliger Holocaust
Liebe in Zeiten der Inline-Skates
Kommando Ulrike Meinhof
Kauft nicht bei Goethe!
Lieben Sie Rossini?
Das Biller-Prinzip
Weiße Nigger
Ich will Kunst!
Sie nannten ihn Krieg
Verpisst euch!
Gib Gas, Jan!
Popismus
Wer stinkt hier so?
Wir Idioten
Antichrist vermisst
General Harfouch
Herzog, ein Lügenmärchen
Nur Speer wollte mehr
Triumph des Brüllens
Angst essen Grüne auf
Land der Verklemmten
Der Ball ist dumm
Der König der Affen
Bärbel privat
Kritik der reinsten Unvernunft
Zum Totlachen
Feiglinge
O Pannenbaum!
Generation HJ
»Es tut uns leid«
Weiter so, Schröder!
Ihr Memmen!
Das Buch Joschka
Schwarzer Sommer
Gib Frieden, Palästina!
Opas Enkel
Warum Maxim Biller keine Stimme hat, Glücklicherweise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Editorische Notiz
Über Maxim Biller
Impressum
Mickey Rourke, der Arschfisch
Viele Wege führen zu Mickey RourkeRourke, Mickey. Diesen Monat macht er als rothaariger IRA-Terrorist in Mike HodgesHodges, Mike Film Auf den Schwingen des Todes unseren Mädchen schöne Augen und weiche Schöße. Eine kleine Zwischenmahlzeit nur. Der nächste große Rourke-Braten wird im Januar serviert, wenn er als versoffener Sexstrolch in Barbet SchroedersSchroeder, BarbetBukowskiBukowski, Charles-Verfilmung Barfly so richtig vom Leder ziehen darf. Hoffentlich ist dann wenigstens schon Alan ParkersParker, AlanAngel Heart aus den Kinos verschwunden, der heimliche Renner dieses Herbstes, ebenfalls mit Mickey RourkeRourke, Mickey in der Hauptrolle.
Das Schlimmste an diesen Mickey-Rourke-Festspielen: Alle finden diesen Kerl mit dem Unschuldsgrinsen, der weichen Lippe, dem harten Blick und der sicher noch viel härteren Hose »stark« oder einfach nur »wahnsinnig«. Besonders unsere Ray-Ban-501-Cherrycoke-Freundinnen seufzen wehmütig, wenn sie an ihn denken. Weshalb das Wort Arschloch gut zu ihm passt. Vielleicht aber ist Mickey RourkeRourke, Mickey in Wahrheit ein Arschfisch, ein seltsames Wort, zugegeben, und möglicherweise habe ich mich auch nur verhört. Jedenfalls bilde ich mir ein, dass Mickey RourkeRourke, Mickey in Angel Heart von einem Polizisten so tituliert wird. Vielleicht hat er aber auch »Arschisch« oder »Arschficker« gesagt, aber mir gefällt der Arschfisch gut.
Er passt zu Mickey RourkeRourke, Mickey. Nicht nur, weil er unlängst das Geheimnis seines IQs mit folgendem Satz preisgab: »Ich habe nicht viel Ahnung von Politik, ich bin nicht Bob GeldofGeldof, Bob.« Auch, weil man ihn nur antippen muss, um eine Lawine von schweinischen Beschimpfungen loszubrechen, nicht gegen irgendwen, sondern gegen das böse, böse Hollywood-Establishment, jene reichen Leute also, denen er sonst, als disziplinierter Profi, in Treu und Glauben dient. Ausdrücke wie Schwanzlutscher und Wichser lässt er gegen die Cannon-Jungs und andere Produzenten vom Stapel. Worte, die über Hollywood so gut wie gar nichts verraten, aber über Mickey Arschfisch fast alles.
Mickey RourkeRourke, Mickey tut immer so, als sei er noch Boxer und Rocker, als interessiere ihn Film nicht und Geld nicht und gar nichts und als sei ihm nichts so egal wie die Anweisung eines Regisseurs. Insofern ist es aufschlussreich, dass Alan ParkerParker, AlanRourkeRourke, Mickey als »extrem kooperativ« beschreibt, woraus sich schließen lässt, dass Mickey Arschfisch auch noch ein Vortäuscher ist. Und damit ein typischer Held unserer Zeit. Warum?
Zum einen kann man Mickey RourkeRourke, Mickey nichts glauben, weil er offensichtlich viel lügt, vor allem, wenn er den Aufrührer markiert. Außerdem ist er als Pretender das perfekte Filmmannequin, ein verschissener Postmoderner, der sich nicht nur seine Gesten und Blicke von Marlon BrandoBrando, Marlon und Kirk DouglasDouglas, Kirk zusammengestohlen hat, sondern auch seine innere Haltung. In Angel Heart bekommen wir von Mickey Arschfisch – wie schon in 9½ Wochen und Im Jahr des Drachen – Folgendes geboten: verknautschte Tweedmäntel, Tweedjacketts, Baumwollhemden, Brillantinehaare – den ganzen 50er-60er-Jahre-Dreck mit der dazugehörigen unrasierten 80er-Jahre-Visage.
Die Frage nach dem Erfolgsrezept RourkesRourke, Mickey ist auch die Frage nach der Machart von Angel Heart. Nicht umsonst spielt RourkeRourke, Mickey in einem Film die Hauptrolle, der, historisch betrachtet, wie eine stolze Fregatte die Armada der zeitgenössischen Musik- und Spielfilm-Videoclips anführt. Nicht zufällig holte sich ParkerParker, Alan, der The Wall- und Birdie-Verbrecher, Mickey Arschfisch für diesen seinen ultimativen 80er-Jahre-Filmstreich. Und nicht zufällig kam Alan ParkerParker, Alan einst von der Werbung zum Film. Auch ein Arschfisch?
Natürlich verdient Alan ParkerParker, Alan für seine filmische Sinfonie in sinnentleertem Ästhetizismus ein paar hinter die Ohren. Aber unser Hass gebührt zuallererst jenem Mann, der diese hübsche Hohlheit verkörpert: Mickey Arschfisch eben.
Nichts von dem, was des Weiteren über die 80er Jahre und ihre Attribute gesagt werden sollte, wird hier ausgebreitet werden, denn jeder weiß, was gemeint ist. Nur so viel: Angel Heart bedeutet für die 80er Jahre den Anfang vom Ende. Und an diesem Ende ist Mickey Arschfisch maßgeblich beteiligt. Deshalb nämlich ging es vorhin explizit um seine Verlogenheit. Falsches Rebellentum gehört zu unserer Dekade, die schon Mitte der letzten begann, wie die Cannes-Rolle, das graue T-Shirt, Face und Norbert BlümBlüm, Norbert.
In den 50er Jahren hatte man ehrlich getwistet und rebelliert, in den 60ern ehrlich gekifft und rebelliert, in den 70ern ist man ehrlich verlottert. Wir aber haben keine Ehre mehr im Leib. Genauso wie Mickey RourkeRourke, Mickey. Wir legen uns Sachen an, an die wir nicht glauben. Wie er. Die Bartstoppeln, den Tweed, das Revoluzzertum, den Zorn.
Ein Arschfisch kommt selten allein.
November 1987
Stürzt die Gräfin!
Was hat das Hamburger Wochenblatt Die Zeit mit der Republik Tunesien gemeinsam? Inzwischen wohl nichts mehr. Denn der altersschwache Präsident BurgibaBurgiba, Habib ist von den eigenen Leuten abgesetzt worden. Die 78-jährige Marion Gräfin DönhoffDönhoff, Marion Gräfin dagegen – Zeit-Herausgeberin, graue Eminenz und personifiziertes Redaktionsgewissen – darf nach wie vor die Spalten ihres Blattes füllen.
Frau DönhoffDönhoff, Marion Gräfin appelliert seit über vierzig Jahren auf dieselbe gönnerhafte Weise an unsere Vernunft und Freiheitsliebe. Ihre Leitartikel sind moralische Tagesbefehle, Belehrungen und Bekehrungen – immer von oben herab, aber nie aus geistiger Höhe, wie von der Kanzel also und somit Predigten gleich. Dass über ihren sprachlichen Stil selbst DönhoffDönhoff, Marion Gräfin-Freunde lachen, sei nur am Rande erwähnt. Die große Pfäffin DönhoffDönhoff, Marion Gräfin schreibt wie ein Kind: naiv, uninspiriert und schematisch.
Schwacher Aufbau, schlechte Worte – aber die richtigen Ansichten. Mit einer Penetranz, die einfach nervt. Frau DönhoffDönhoff, Marion Gräfin gilt als nahezu unmenschlich integer und liberal. Kunststück. Sie fasst nichts an, womit sie sich die Hände schmutzig machen könnte. Das Widersprüchliche ist nicht ihr Metier. Unbequeme Gedanken, die Grundvoraussetzung jedes intellektuellen Diskurses, meidet sie wie der Teufel das Weihwasser. Ihre Artikel kreisen ausschließlich um Themen, zu denen sich vorfabrizierte Allgemeinplätze aus der ethischen Schwarz-Weiß-Schublade verbreiten lassen. Man muss sich nur das Dönhoffsche Repertoire der vergangenen Monate anschauen: Südafrika, die Berliner 750-Jahr-Feier, Abrüstung und Entspannung, Menschenrechte, BarschelBarschel, Uwe-Affäre und dann gleich noch mal Südafrika, weil Neger immer für ein paar humanistische Bonmots gut sind. Ein Langweiligkeitskatalog ersten Ranges. Unerträglich wird die Lese-Ödnis, weil Frau DönhoffDönhoff, Marion Gräfin stets einen Standpunkt vertritt, den garantiert jeder teilen kann. Sie ist so sehr darauf bedacht, recht zu haben, dass nichts mehr stimmt. Das Gewicht ihrer Worte überwiegt jede Haltung. Sie ist für MandelaMandela, Nelson, für GorbatschowGorbatschow, Michail und Glasnost, für ein freies Berlin und vor allem für Meinungen, die sie immer schon vertreten hat. Und natürlich ist sie gegen Aufrüstung, Gewalt und die Boulevardpresse. Sie ist offen gegen Apartheid und verschämt-versteckt gegen Israel, und sie ist gegen deine Dummheit. Doch der miese BarschelBarschel, Uwe steht außen vor, weil er ja tot ist …
Aber ganz so unoriginell, wie es scheint, ist Frau DönhoffDönhoff, Marion Gräfin nicht. Als erklärte Liberale hat sie ein geschultes Sophistenhirn, denn sie muss sich viel hin- und herwinden. So hat sie etwa über BlümsBlüm, Norbert Chilereise eine Menge Positives zu sagen, aber drei Absätze vor Schluss erklärt sie plötzlich, dass ein Außenstehender nicht gegen Folter in anderen Ländern eintreten solle, weil solcher Eifer oft nur das Gegenteil bewirke. Einen ähnlichen Salto, nur andersherum, schlägt sie in einem Artikel über Südafrika: Nicht die Schwarzen seien verantwortlich, wenn sie sich gegenseitig bestialisch lynchten, sondern die Situation, in der sie steckten. So gesehen überrascht es auch nicht, dass Frau DönhoffDönhoff, Marion Gräfin der Meinung ist, man hätte Rudolf HeßHeß, Rudolf schon vor Jahren aus Spandau entlassen sollen, dann hätten wir uns den ganzen unnötigen Tanz nach seinem Tod gespart. Die Deutschen seien sowieso keine Nazis mehr, die Franzosen hingegen wählten mit über zehn Prozent den Faschisten Le PenLe Pen, Jean-Marie, und überhaupt sei HeßHeß, Rudolf in Nürnberg zu Unrecht verurteilt worden. Nachzulesen in der Zeit vom 28. August 1987. Aber wer liest die Artikel der Frau DönhoffDönhoff, Marion Gräfin überhaupt?
Vielleicht die eigene Redaktion. Den Zeit-Mitarbeitern ging das salbungsvolle, tolerant-intolerante Standesbewusstsein ihrer Chefin letzten Monat dann doch zu weit. Im Fall BarschelBarschel, Uwe ereiferte sich die Gräfin alkaldenhaft über das Wühlen der Stern-Reporter im Hotel Beau-Rivage, um im gleichen Atemzug brustschlagend die Verdienste des eigenen hehren Blattes herauszustreichen. Aber einen Dolch zum fälligen Tyrannenmord zückte trotz redaktionsinternen Unmutes keiner. Da haben sie lieber vor zwei Jahren Fritz J. RaddatzRaddatz, Fritz J., ihren besten Kulturressortleiter, hingerichtet, weil er sich eine kleine Lüge erlaubt hatte, indem er GoetheGoethe, Johann Wolfgang von, die Frankfurter Buchmesse und die Eisenbahn in eine Epoche transportierte. Natürlich schrieb die Alte zu Raddatz’Raddatz, Fritz J. Exekution die Musik. Öffentlich rügte sie ihren Feuilletonchef für seine Phantasie und setzte somit einen vorläufigen Schluss-Strich unter seine Karriere. Die Steigerung von liberal ist scheißliberal.
Frau DönhoffDönhoff, Marion Gräfin sollte endlich ihren ehrwürdigen Hintern aus unserer Presselandschaft wegbewegen. Damit die Zeit endlich das gute Blatt werden kann, das es seit Jahrzehnten zu sein nur verspricht.
Nicht erdolchen, Palastwache – fortjagen reicht!
Dezember 1987
Schluss mit dem neuen Jahr!
Das Jahr 1988 wird richtig mies werden. Ein Glück, dass ich kein Terrorist bin und auch nicht der Arbeitgeberverband, denn diese Leute sind immer die Ersten, die sich über schlechte Nachrichten freuen. Was im neuen Jahr Schlimmes passieren wird? Nichts. Nur dass Ute LemperLemper, Ute weitere zwölf Dutzend Mal bei Galas, Talkshows und Betriebsfesten auftreten wird, wobei die Conferenciers bei dieser Gelegenheit immer wieder betonen werden, dass sie nur ein einfaches Mädchen ist, das Karriere machte. Auch Steffi GrafGraf, Steffi wird unermüdlich in der Öffentlichkeit herumhampeln und die Nation verzücken, weil ihr das Gute-Simple-Doofe ins ehrliche Gewinner-Gesicht geschrieben ist.
Sehen wir weiter, sehen wir fern: Der fahnenmastgroße GottschalkGottschalk, Thomas-Angeber wird bei jeder Wetten, dass..?-Sendung monologisierend in neue Dispute mit seinen vermeintlichen Kritikern verfallen und beim Publikum noch beliebter sein, weil er ständig erklären wird, wie froh er ist, vor der Kamera endlich normal sein zu können. Und auch der ewig-natürliche, weil mal flapsige, mal seriöse Hans-Joachim KulenkampffKulenkampff, Hans-Joachim (Kuli), als dessen Enkel sich GottschalkGottschalk, Thomas kohlhaft betrachtet, wird uns trotz des provinziell-bombastischen EWG-Abschieds erhalten bleiben. In seinen Nachtgedanken wird er uns Abend für Abend, Sendeschluss für Sendeschluss, strickjackig und lesebrillig gute Nacht wünschen, damit wir wissen, dass auch morgen wieder alles okay ist.
So werden also die alten Stars die neuen Stars sein, und das ist schon schrecklich genug. Noch schlimmer ist aber, dass sie das einzige Thema sein werden, das uns beschäftigen wird.
Es wird eben nichts okay sein, KuliKulenkampff, Hans-Joachim (Kuli), und wir Idioten werden es wieder mal nicht kapieren, und unsere Ignoranz und Beklopptheit wird 1988 einen neuen Höhepunkt erreichen.
Denn es wird ein besonders tragisches Jahr: Zigtausende werden im Ruhrgebiet aus ihren Jobs fliegen, und das wird nur das Fanal für eine kolossale, ökonomische Arbeitslosen-Dollar-Aktien-Rezessions-Krise sein, die sich für immer in den Kapitalismus wie ein dialektisches Fragezeichen hineinfressen wird. 1988 beginnt das Ende der Glückseligkeit. Denn die glorreichen 80er Jahre werden vorbei sein und mit ihnen die Anything-goes-Option für jeden Schwachkopf, der nur bis fünf zählen kann. Ronald ReaganReagan, Ronald wird nicht wieder gewählt werden können, und das wird sehr schade sein, denn er war der letzte große Politiker, der durch seine offensichtliche Deplatziertheit und ehrenwerte Schauspielerei kontrastierend auf den Schmutz seines Gewerbes hinwies und dies auch dem Unpolitischsten unter uns bewusst machen konnte. Auf ihn folgt, gewiss, ein smarter US-Gorbatschow.
Ja, GorbatschowGorbatschow, Michail. Wird er nicht, nach seinem INF-Coup, definitiv zeigen, was für ein hinterhältiger Fuchs er ist? Er könnte 1988 endlich seine Truppen aus Afghanistan abziehen, aber nicht aus antiimperialistischer Räson, sondern weil er weiß, dass dann auch dort die Mullahs-Ajatollahs die Macht übernehmen werden. Das wird Teheran stärken, denn die iranischen und afghanischen Fundis könnten sich verbünden, um gemeinsam den Irak zu vernichten und gleich nach Jerusalem weiterzumarschieren. Das wiederum würde das Gleichgewicht im Nahen Osten derart durcheinanderbringen, dass der gute Westen nicht mehr wissen würde, wo ihm der Kopf steht: zwei zu null für den Generalsekretär.
1988 werden schließlich die Wissenschaftler beginnen, der Öffentlichkeit behutsam zu erklären, dass wir eine wahre Virenplage zu gewärtigen haben, eine moderne Pest.
In Tschernobyl werden nach wie vor Unfälle vertuscht, und die französischen Atomreaktoren werden leckschlagen, und der Rhein wird sich violett oder rot oder grün verfärben, für immer und ewig. Die Leute werden wegen Aids noch weniger Sex haben, meine Freundin wird alle ihre Silvestervorsätze brechen, die Grünen werden immer noch nicht gespalten sein, und Helmut KohlKohl, Helmut wird zufrieden auf seinem Kanzlerstuhl thronen.
Es graut mir vor alledem, und besonders davor, dass wir all dies in unseren TV-Sesseln nur verschwommen und Tagesschau-geglättet wahrnehmen werden, um uns stattdessen darüber zu freuen, wie normal und sympathisch unsere Fernsehhelden geblieben sind.
1988 wird wie 1987, Freunde, und das ist auch schon die Schlusspointe. Glücklich, wer da keinen Hass bekommt.
Januar 1988
Lang lebe Waldheim!
Es ist nicht egal, dass Kurt WaldheimWaldheim, Kurt hässlich ist wie die Nacht. Dass seine abstehenden Ohren und seine lange Nase in bester Nosferatu-Manier sein Äußeres dominieren. Dass seine Augen feige-kalt leuchten und ihn überhaupt eine recht gespenstische Hofburg-Aura umgibt. Das ist, im Gegenteil, gut! Noch besser ist, dass ihn Eingeweihte für ein aufgeblasenes Nichts halten, für einen Kriecher, einen Nach-unten-Treter, einen Repräsentationsgeilen. Am allerbesten aber ist das Theater, das um den österreichischen Bundespräsidenten gemacht wird, weil es so viel über ihn, seine historische Rolle und das Verhältnis Österreichs zum Dritten Reich verrät. Schade nur, dass Deutschland nicht auch so einen WaldheimWaldheim, Kurt-Zombie hat, irgendeinen unsympathischen Kerl, einen echten Nazi-Jenseitigen, der die Leute permanent an »damals« erinnern würde. Der Höfer wusste schon, warum er so schnell abtrat.
Mitte Februar erwartet uns das Urteil einer internationalen Historiker-Kommission, die der österreichische Außenminister Alois MockMock, Alois eingesetzt hat, um WaldheimWaldheim, Kurt von allen Nazi-Vorwürfen reinzuwaschen. Das Ergebnis wird zwiespältig sein. Leider kann man die »Akte WaldheimWaldheim, Kurt« nicht ganz mit den Prozessen gegen BarbieBarbie, Klaus und DemjanjukDemjanjuk, John vergleichen, die von vornherein genügend Stoff bieten, um den ehrlich Spätgeborenen ein letztes Mal an lebenden Beispielen zu zeigen, was eine echte Nazi-Harke war. Denn Kurt WaldheimWaldheim, Kurt hat keine Juden deportiert, keine jugoslawischen Zivilisten beseitigt, keine englischen Kriegsgefangenen gefoltert. Er hat aber von diesen Vorgängen während seiner Zeit als Wehrmachtsoffizier auf dem Balkan gewusst. Das aber leugnet er bis heute, dieser armselige Feigling und Konformist.
Nun ist Wissen selten Macht, meistens aber Ohnmacht. Wie seinerzeit eben, als die Nazis die halbe Welt mit ihrem Totalkrieg heimsuchten und die Juden umbrachten. Das Wissen um das, was geschah, hatten alle. Und wie WaldheimWaldheim, Kurt stritten es hinterher alle ab. Womit ich zum Kern meiner Lieblingsidee komme: zur Kollektivschuld, die es eben doch gibt.
Ich muss da persönlich werden, weil ich weiß, dass das zieht: Jeder verknöchert-verklemmte Deutsche, jeder gottverdammte charmante Österreicher, der sich durchs Dritte Reich wurschtelte und keine Anstalten machte, die große Tragödie zu verhindern – jeder Einzelne trug die volle Verantwortung dafür, dass zum Beispiel meine Antwerpener und Kiewer Verwandten wegen ihres Judeseins ausgerottet wurden. Wer Verbrechen toleriert, ist selbst kriminell. Wer »Hurra!« schreit, meint nicht »Aua«.
Kurt WaldheimWaldheim, Kurt ist der Prototyp des schuldig gewordenen Mitläufers. Indem er zum Medienereignis wurde, bekam der kleine, anonyme Dritte-Reich-Opportunist endlich ein Gesicht. Noch besser aber ist, dass WaldheimWaldheim, Kurt in Österreich die alten, versteckten Kräfte wieder freigesetzt hat: Antisemitismus, Nationalismus, Fremdenhass. Der dabei aufgekommene kleinbürgerliche Fanatismus ist das Missing Link zwischen »damals« und heute, zwischen Mitmachen und Schweigen, Dulden und Honorieren – es ist, wie bei WaldheimWaldheim, Kurt, die Miesheit und Feigheit kleiner Leute, Faschismus eben.
Natürlich gibt es auch gute Österreicher, WaldheimWaldheim, Kurt-Gegner. Diese Minderheit sei von hier aus herzlich gegrüßt. Und daneben gibt es noch die mittelguten Österreicher. Es sind, zumeist, Sozialdemokraten oder besonnene Mitglieder der konservativen ÖVP, jener Partei, die WaldheimWaldheim, Kurt als parteilosen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt hatte. Sie möchten WaldheimWaldheim, Kurt aus realpolitischem Kalkül weghaben, weil er dem Ansehen seines Landes schadet. Doch sie wissen, dass ihn sein Rücktritt bei seinen Anhängern zum Märtyrer machen würde. Deshalb wäre den Mittelguten, wie man es des Öfteren hört, ein hübscher Autounfall oder ein Flugzeugabsturz mit WaldheimWaldheim, Kurt an Bord am liebsten. WaldheimWaldheim, Kurt tot – die gnädigste Lösung.
Ich aber will keine gnädige Lösung. Die haben meine Antwerpener und Kiewer Verwandten auch nicht bekommen. WaldheimWaldheim, Kurt muss bleiben, diese Amtszeit und die nächste und die übernächste und so fort. Sie sollen ihn wieder wählen, die Schlechten, wenn sie ihn verdienen. Damit er als politisches Lackmuspapier die Dummen von den Klugen unterscheiden hilft. Damit alle Welt sehen kann, wie sehr das scheinheilige Wir-waren-doch-nur-Opfer-Österreich bis heute vom Nazi-Braun verpestet ist. Und vielleicht haben wir in Deutschland Glück: Vielleicht kriegen wir auch noch mal einen WaldheimWaldheim, Kurt. Er muss ja nicht gar so hässlich sein.
Februar 1988
Osti go home!
Eines Tages, und zwar bald, mache ich aus Stephan KrawczyksKrawczyk, Stephan Gitarre einen Trümmerhaufen. Ich springe während eines Konzerts auf die Bühne und stopfe dem Sänger-Immigranten zunächst mit einer Coladose seinen zu einem expressionistischen Leidens-O aufgerissenen Mund. Dann packe ich sein Instrument, zerschlage es an seinem demonstrativ-asketischen Holzstuhl und schleudere mit aller Kraft die Splitter und verdrehten Saiten ganz weit weg. Mal sehen, vielleicht lasse ich sie bis zur Mauer fliegen. Schließlich fahre ich KrawczykKrawczyk, Stephan mit einer zärtlichen Drohgebärde über die stoppelige Ali-Ağca-Frisur und sage: »Überall Ärger, was?«
Doch halt: Sollte man diesen Mann nicht respektieren, auf die Schultern heben, ihn für seinen Mut im Kampf gegen ein ausländisches Unfair-Regime bedingungslos bewundern?
Nein, man sollte nicht, wenn man nicht will. Wieso, erklärt folgender Einschub:
Verehrte DDR-Dissidenten in Ost und West, liebe Sympathisanten von der FAZ, der SPD und den Grünen – bei allem Respekt: Hier ist Westdeutschland. Hier sind wir. Hier ist einiges anders. Hier gelten, unberufen, andere Wertvorstellungen und Qualitätsmaßstäbe als jenseits des Stacheldrahts. Deshalb kann man bei uns einen Stephan KrawczykKrawczyk, Stephan im Klo hinunterspülen, wenn man möchte, und es ist okay. Nicht etwa, weil es bei uns Demokratie gibt, sondern weil es Dekadenz gibt. Und Dekadenz darf alles, will alles, kann alles. Ende des Einschubs.
Was ist eigentlich so schlecht an KrawczykKrawczyk, Stephan, seinen DDR-Kombattanten und dem, was sie verkörpern? Vor allem die künstlerischen Leistungen, mit denen KrawczykKrawczyk, Stephan in seiner Heimat Zigtausende fesselte und die ihn dort zu einem Helden werden ließen. Dass seine Musik sanftes WeillWeill, Kurt- und BiermannBiermann, Wolf-Epigonentum ist, allzu durchsichtig und bemüht schräg, ist schon schlimm. Aber erst seine Texte! »Lang genug auf Eis gelegen, lang genug umsonst geheult, muss die starren Glieder regen, eh’ der Frost ins Herz sich beult.« Seine faulen Witze! »Für die Friedenslaufstafette springt selbst Oma aus dem Bette.« Seine Bonmots! »Das ist ein Grund, den Pullover auszuziehen, denn das Thema ist so heiß.« Seine überladenen Metaphern! »Ich verkoch auf kleiner Flamme, angebrannt und ungewürzt. Das Gefühl, dass ich schon tot bin, das gibt mir den Lebensstoß. Gut, heut Nacht werd ich verdauen, aber morgen geh ich los!«
Ganz klar: Hier kämpft einer mit Pinten-Kalauern und pubertärer Poesie-Lyrik gegen die Nomenklatura stalinistischer DDR-Betonköpfe. Dürfen Dissidenten blöd sein?
Offensichtlich ja. Vor allem, wenn sie gleich an zwei Götter glauben: an den christlichen und den der Kommunisten. Stephan KrawczykKrawczyk, Stephan – ebenso wie Freya KlierKlier, Freya, Vera WollenbergerWollenberger, Vera (geb. Lengsfeld)Lengsfeld, VeraWollenberger, Vera und all die anderen – ist stets bemüht, darauf hinzuweisen, dass seine Kritik am Sozialismus ideologie-immanent ist, also links, so wie er selbst, so wie seine Idole BrechtBrecht, Bert und MarxMarx, Karl und Rosa LuxemburgLuxemburg, Rosa. Zugleich feierte er seine großen Protestkonzert-Erfolge nur in Kirchen. Regimegegner versammeln sich inzwischen nur noch im häuslichen und ideologischen Schutz der Kathedralen. Längst ist es Brauch, für inhaftierte Bürgerrechtler Bittgottesdienste abzuhalten, murmelnd Kerzen anzuzünden und sozialistisch-christliche Gebetsbastarde gen Himmel zu stoßen: »Herr, wir bitten dich um die Kraft, die Freiheit Andersdenkender zu respektieren.« Und Rosa LuxemburgLuxemburg, Rosa rotiert dazu im Grab!
Die Folgen dieser heiligen Allianz: Die Kirche ist – zumindest zu meinem Entsetzen – plötzlich wieder auf dem Vormarsch, die sogenannten Linken Ostdeutschlands gerinnen durch ihre Macht zu fad-spießigen DDR-Müslis. Sie werden zu Ökopaxen, die sich von Mystagogie und protestantischem Fanatismus einlullen lassen.
Stephan KrawczykKrawczyk, Stephan steht für diese Leute, von denen in letzter Zeit so viele in den Westen entlassen wurden. Doch wie links, wie gut kann in Wahrheit eine solche Bewegung sein? Sie glauben an Christus und MarxMarx, Karl, an die Internationale und das Kruzifix, und sie lieben die schlechten Lieder und Agitprop-Plattitüden ihres Stephan KrawczykKrawczyk, Stephan. Was sagt Gott dazu? Gott lacht.
Nein, sie werden bei uns mit ihrem Pseudo-68er-Hippie-Esoterik-Umwelt-Christen-Quatsch kein Glück haben, werden sich nach ihrer gutgläubigen, naiven, ehrlich-strengen und undekadenten Heimat sehnen. So wie Stephan KrawczykKrawczyk, Stephan, der sofort nach seiner Ausweisung erklärte, er wolle schnellstmöglich zurück.
Ja – so soll es sein. Das wäre, glaube ich, die gnädigste Lösung. Für ihn und für uns.
März 1988
Optischer Brechreiz
Es gibt Leute, die hängen sich einen Spiegel übers Bett und schauen sich dann dabei zu, wie sie es miteinander treiben. Nicht mehr ihr Tun berauscht und erregt diese abgekämpften Sexualsportler, sondern nur noch das Abbild ihres Tuns. Zum Teufel mit ihrer verklemmten Lust! Und zum Teufel mit unserer modernen Existenz, denn sie funktioniert nach exakt demselben Prinzip!
Wir schauen uns nur noch zu. Im Kino, im Fernsehen, auf Plakatwänden und in Zeitschriften sehen wir ununterbrochen Schauspieler, Popstars und Fotomodelle, die uns spielen: Wir lassen unser Leben darstellen. Ob Modefotografie, Musikvideos oder Horrorfilme, ob Soap-Operas, cineastische Meisterwerke oder Werbespots – es ist ein permanentes Trommelfeuer der Bilder. Eine Welt, die endgültig ist, denn Bilder sind immer endgültig, kategorisch, nicht zu deuten. Bilder sind Droge – autoritär, totalitär und somit undemokratisch.
Die Nazis und die Sowjets wussten schon, warum sie den Film als das wirkungsvollste Propagandamittel einsetzten. Denn mit Bildern kann man jeden Schwachsinn, jede Lüge als Wahrheit ausgeben – und es fällt keinem auf. Bilder sind die erklärten Feinde des Geistes – Geist ist gut! – und des abstrakt-analytischen, des kritischen Denkens. Zu ihren Verbündeten erkläre ich hiermit die Schrift und das Wort.
Ohne Schrift hätten die zerstreuten Juden als Religions- und Geistesgemeinschaft keine 5000 Jahre überstanden. Statt der Bibel ein Comicstrip – und sie wären heute genauso vergessen wie Tauriner und Hethiter. Schrift hat Kraft. Und Schrift bedeutet ungezügelte Phantasie, kreativen Irrsinn, philosophische Genialität. AristotelesAristoteles, GrimmelshausenGrimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von, JoyceJoyce, James, KafkaKafka, Franz und MalamudMalamud, Bernard – sie waren, die sie waren, weil sie schrieben. Es lebe das Alphabet.
Doch wir leben in einer Zeit, die Bilder millionenfach produziert. Am meisten Beachtung und Verachtung verdienen die Videoclips, die Spitzenreiter unter den Bildermedien. Ihre Regisseure arbeiten nach einer perfiden Ästhetik. Sie wissen, dass die Macht der Videos darin besteht, kleinliche und belanglose Geschichten kurz und plakativ zu erzählen. Die Übermacht der Optik besiegt den Inhalt, denn sie befreit ihn von dem Zwang, schlüssig zu sein.
Wozu noch Geschichten erzählen? Wir sehen doch, wie stolze Männer Autos zu Schrott fahren, Fäuste ballen, Tänzchen tanzen und Gitarren ablecken. Wir sehen, wie kleine Jungs, noch lange nicht geschlechtsreif, aber immer rothaarig und sommersprossig, von zu Hause weglaufen, weil sie kleine, flachbrüstige Mädchen lieben. Wir sehen, wie lächerliche Pappmaché-Androiden mit ihren Menschensklaven im Chor singen. Manchmal beobachten wir auch Neureiche, wie sie segeln, Cocktails trinken oder in Swimmingpools fallen.
Nun hat mich der berechtigte Bilderstürmer-Eifer gepackt, und ich muss mir jene Sorte von Zeitschriften vornehmen, zu denen, nolens volens, auch TEMPO gehört.
Mit ihren Bild-beherrscht-den-Text-Layouts, mit ihren allmächtigen Artdirektoren, den gleißenden Fotostrecken und den tänzelnden Grafik-Kapriolen formieren sich die modernen Magazine, einen Schritt hinter den Videoclips, zur zweiten Angriffswelle in der Bilderphalanx. Es gibt genügend Leute, die eine solche Zeitschrift in Windeseile durchblättern und dann meinen, sie hätten verstanden, was drinsteht und worum es geht.
Die Bilderflut ist nicht einfach nur ein kulturelles Phänomen. Als Symptom zeigt sie eine Entwicklung, die böse ist, weil sie dumm ist: die Wiederkehr des Analphabetismus. Seit die Bilder regieren, ist er nicht mehr aufzuhalten.
Es ist ein selbstbewusster Analphabetismus. Der Tagesschau-B-Picture-Videoclip-Barbar muss nicht mehr lesen und schreiben können. Er erfährt trotzdem alles, was in der Welt und in seiner Stadt los ist. Aber wie? Verzerrt, ausgehöhlt, eindimensional – visuell eben.
Das ist, man muss es sagen, Pop in Reinform. Das Wort und die Abstraktion sind entmachtet und mit ihnen der klassische mitteleuropäische Intellektuelle. Information, Kunst, Philosophie – alles ist für alle da. Aber wie? Absolut banalisiert, aufgeblasen, vergröbert. Nicht mehr die Elite hat das Wort, sondern das Volk. Das Volk hält sich an die gebotenen Bilder. Es hat ja nichts anderes mehr. Die Wirklichkeit ist ersetzt worden. Doch wer bietet dem Volk die Bilder? Der neue Intellektuelle, der Volksintellektuelle. Der Optiker.
Das soll gut sein? Es ist ekelhaft.
April 1988
Das nervende Nervenbündel
Es soll Leute geben, die Woody AllenAllen, Woody wirklich mögen. Sie bewundern ihn, weil er lieber in einem New Yorker Jazzlokal Klarinette spielt, als zu seiner eigenen Oscar-Verleihung zu gehen. Sie finden es toll, dass er gegen die nachträgliche Kolorierung alter Schwarz-Weiß-Filme mit der Vehemenz eines protestantischen Glaubensfanatikers kämpft und sich nicht in Werbespots vermarkten lässt. Sie beten ihn an, weil er die Natur hasst, Manhattan nie verlässt, Palästinenser gegen Israelis verteidigt und Regisseure wie Steven SpielbergSpielberg, Steven und George LucasLucas, George für infantile Idioten hält. Ja, sie bejubeln seine Leidenschaft für skandinavische Melodramen und stehen auf seine Professoren-Kordhosen und seinen neurotischen Penis. So einer muss einfach klug, gebildet und aufrecht sein. Und lustig ist er auch noch.
Ist er nicht. Nicht mehr. Und nicht nur, weil er seinen neuen Film September als ernsthafte Tragödie angelegt hat. In Wirklichkeit ist dieses Werk ohnehin nur ein lebloser Bastard aus falsch verstandenen TschechowTschechow, Anton-, StrindbergStrindberg, August- und BergmanBergman, Ingmar-Motiven, voller Geseufze, Geraune und Pathos, angereichert mit zirpenden Art-TatumTatum, Art-Klängen als Tribut an die »Moderne« und einer randlosen Psycho-Märtyrer-Brille für Mia FarrowFarrow, Mia als Hinweis darauf, dass es Brillenträger im Leben besonders schwer haben. Kein Zweifel: September ist – nach Innenleben – Woody AllensAllen, Woody zweiter Versuch, ins ernste Fach zu wechseln. Er hätte genauso gut Wassermelonen verkaufen können.
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Hier wird nicht um den Komiker Allan Stewart KonigsbergKonigsberg, Allan Stewart siehe Allen, Woody gerungen, sondern gegen ihn. Obwohl das gar nicht nötig wäre. Woody AllenAllen, Woody löst sich nämlich selbst auf. Sein Humor verschwindet nicht allmählich, sondern auf einen Schlag – in der Retrospektive. Wer sich Woody AllensAllen, Woody »große« alte Filme vom Stadtneurotiker über Manhattan bis Hannah und ihre Schwestern noch einmal ansieht, wird den Kopf schütteln: »Darüber haben wir einmal gelacht?«
Bei Woody AllenAllen, Woody geht es immer nur um das eine: um sexuelle Kränkungen, triebhaften Intellektualismus, aufgesetzte Minderwertigkeitskomplexe und das Mode-Accessoire »Bildung« als substanzielles Smalltalk-Element in einem endlosen kulturellen Namedropping. Durchsetzt ist diese narzisstische Selbstbespiegelung des beleseneren Teils der Herrschaftsklasse mit einer routinemäßigen Selbstironie, die das alles einst so lustig und lieb und menschlich gemacht hat. Doch plötzlich versagt die Ironie. In unseren fortgeschrittenen End-80er-Tagen kann sie nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass Woody AllensAllen, Woody Filme in eine ferne historische Epoche gehören und heute ebenso wenig tragisch oder komisch sind wie die Spiele im römischen Circus Maximus, das Hambacher Fest oder ein Abonnement der Gartenlaube. Woody AllenAllen, Woody ist ein Held der 70er Jahre. Seine Witze über Impotenz, emanzipierte Lesbierinnen und nervöse Akademiker sind 70er-Jahre-Witze, die keinen Menschen mehr zum Lachen bringen. Heute beschäftigen uns die Neostrukturalisten, Aids, die Perestroika und die Neue Familie. Darüber muss man heute Komödien schreiben, nicht über attitüdenhaft verklemmte Linksintellektuelle mit Potenzschwierigkeiten. Modethemen haben es eben an sich, dass sie eine Weile modern sind und dann wieder nicht mehr. Punkt.
Woody AllenAllen, Woody hat es – im Gegensatz zu seinen erklärten Vorbildern BergmanBergman, Ingmar, IbsenIbsen, Henrik und DostojewskiDostojewski, Fjodor Michailowitsch – nicht geschafft, eine Epoche zeitlos und kategorisch festzuhalten. Stattdessen ist er der simplifizierende Gag-Writer geblieben, der er von seinem 16. Lebensjahr an war: ein halbgebildeter kleiner TV-Autor, der nach der allerhöchsten Hochkultur strebte, aber nur ein paar aufgemotzte Kulturmilieu-Soap-Operas schuf, edle Klatschgeschichten von edlen Intellektuellen aus einer toten, überwundenen Zeit.
Natürlich gibt es noch Leute, die über Woody AllenAllen, Woody lachen. Es sind dumme Leute. Es sind die, von denen zu Anfang die Rede war. Sie neigen zu frecher Halbbildung, intellektueller Selbststilisierung und pseudoneurotischem Narzissmus. Sie schmeißen mit Namen von Regisseuren, Schriftstellern und Philosophen um sich wie Faschingsnarren mit Konfetti. Sie können lesen. Sie können schreiben. Sie sind wie Woody AllenAllen, Woody, ihre alibiträchtige Identifikationsfigur. Sie nerven uns als Filmkritiker, Germanisten und VHS-Lehrer. Sie sind nicht nur ewiggestrig – sie sind unsympathisch.
Meidet sie, und sie werden euch meiden. Und mit Woody-Allen-Filmen haltet es ebenso!
Schon mal was von Billy WilderWilder, Billy gehört?
Mai 1988
Stil, *1.1.1980, †10.6.1988
Im Herzen Münchens lebt der Schwabinger. Er ist attraktiv, klug, vorzüglich gekleidet und ausgesprochen originell. Er spielt die Rolle des Schnösels perfekter als jeder andere. Dafür muss man ihn lieben. Denn es macht ihn zum wandelnden Klischee, zur Symbolfigur des luxusgeilen deutschen Großstädters, des Edel-Lackaffen.
Der Schwabinger hat einen natürlichen Feind: den Neuperlacher. Der dümpelt an der äußersten Betonsilo-Peripherie der Stadt vor sich hin, was durchaus metaphorisch zu verstehen ist. Er ist nicht schön, nicht intellektuell, nicht kreativ – aber chamäleonhaft-gewitzt. Der Neuperlacher will nur eines: so sein wie der Schwabinger. Auch er also ein Prototyp.
Niemand kann den Neuperlacher wirklich leiden, nicht einmal er sich selbst. Er äfft den Schwabingerus vulgaris seit jenem Tag nach, an dem irgendein genialer Kopf die Gleichheit aller Menschen propagierte und das alte, »gottgegebene« Standesgefüge kräftig in Bewegung geriet. So kupfert der Neuperlacher nun schon seit über hundert Jahren alles ab, was ihm der Schwabinger an Stil, Mode und manchmal auch an Kultur vorlebt. Dass seine miserablen Kopien auch den Wert der Originale mindern, sei ihm nur am Rande vorgeworfen. Schließlich soll hier niemandem in versnobter, antidemokratischer Manier der modische Inquisitionsprozess gemacht werden – und wenn, dann nur ein bisschen. Es geht hier vielmehr um die Frage, welche Funktion und welchen Wert Moden heute haben.
Anfang der 80er Jahre war das klar: Die Rückbesinnung auf Stil und Mode sollte uns aus der hässlichen, ideologisch verkrusteten 70er-Jahre-Sackgasse führen. Motto: Wenn Inhalte totgedacht sind, machen wir die Form zum Inhalt.
Und heute? Was kann die Mode noch? Was hat sie bewegt? Um das zu beantworten, muss man zunächst herausfinden, was den Neuperlacher in seinen Nachahmungswahn treibt. Na, was wohl: der Wunsch, sich den Privilegierten, Wohlhabenden und Gebildeten, den Schwabingern also, gesellschaftlich anzunähern. Dieser Wunsch entspringt allerdings nicht seiner revolutionären Gesinnung, sondern kleinbürgerlicher Sozialmimikry und Selbsttäuschung. Der Neuperlacher, der mit aller Macht die Moden und Lebensgewohnheiten des Schwabingers imitiert, will zwar die sozialen Schranken nach oben überwinden, aber das gelingt ihm bestenfalls äußerlich. Denn durch die ewige Schlacht um die ästhetische Angleichung an den Schwabinger verliert er die Ziele des Klassenkampfes aus den Augen. Auf diese Weise werden die wahren gesellschaftlichen Probleme elegant vertuscht, ganz im Sinne alter sozialdemokratischer Tradition. Hand aufs Herz, Schwabinger: Was macht es, wenn der Vorstadtprolet die gleiche 501 trägt wie du, solange er das ewige, sich schwindlig rackernde Acht-bis-fünf-Uhr-Maloche-Arschloch bleibt?
Die Hatz nach Trends ist also nichts anderes als eine moderne Version der alten römischen Brot-und-Spiele-Strategie. Dass die Unterprivilegierten darauf hereinfallen, muss man ihnen mehr verübeln, als dass sie den oberen Hunderttausend die Freude an B & O, Yamamoto und Paul SchraderSchrader, Paul nehmen.
Denn die Schwabinger können uns ohnehin kreuzweise. Wir verachten sie genauso wie ihre selbstzerstörerischen Trabantenstadt-Antagonisten. Sie haben noch immer nicht begriffen, dass es keinen Grund mehr gibt, die ewige Avantgarde zu spielen. Sie machen sich mit ihrer Jagd nach Hypes zu Idioten, zu Zeitgeist-Clowns. Fest steht: Nach Alden-Schuhen, PrincePrince, Helmut-JahnJahn, Helmut-Häusern, Wodka sour, Tweedjacketts, Tropfenbrillen, Jeff KoonsKoons, Jeff und Martin AmisAmis, Martin kommt nichts mehr. Weil es keinen Sinn mehr macht, sich durch immer neue modische Tricks vom ärmeren (oder älteren oder spießigeren) Rest der Welt abzugrenzen. Das hat uns gerade die Postmoderne gelehrt. Ihre totale Form-und-Inhalt-Libertinage hat uns klargemacht, dass nicht die Oberfläche zählt, sondern die Dinge hinter den Dingen. Daraus ließe sich jetzt eine spätkapitalistische Metaphysik entwickeln – doch Metaphysik hat etwas von Angeberei und Leere.
Argumentieren wir deshalb ein letztes Mal auf altgewohnte 80er-Jahre-Weise: Die große Hipness-und-Stil-Partie ist ausgereizt, der Stil als Modephänomen ist tot. Was? Mode soll plötzlich doch nur Mode sein? Ja, bestimmt. Und was kommt nach Mode? Nicht-Mode. Was? Aber klar, zieh dich aus und spring nackt auf den Kilimandscharo! Was? Ach, halt den Mund: Nichts geht mehr!
Juni 1988
Schafft den Sommer ab!
Gleich nach MöllemannMöllemann, Jürgen, Tele 5 und Franz BeckenbauerBeckenbauer, Franz kommt – natürlich – der Sommer. Denn Sommer ist so ungefähr das Widerlichste, was man sich denken kann: eine ethologische Fälschung, ein klimatisch bedingtes Enthemmungsmodell. Im Winter, im Frühjahr, im Herbst – da sind wir so, wie wir sind: warm eingepackte und seriöse germanisch-slawische Mitteleuropäer, introvertiert-griesgrämig, fleißig und nachdenklich und irgendwie verklemmt. Beträgt die Außentemperatur aber mehr als drei Tage lang über 20 Grad Celsius im Schatten, fährt ein schrecklich fremdes Locker-Flocker-Getue in die Leute, und sie werden zu geistlosen Bestien.
Es ist die Zeit des Verrats an den pragmatisch-prüden Idealen des Abendlandes. Frauen und Mädchen geben sich kaum mehr Mühe, in Straßenbahnen und Supermärkten Brüste und Schenkel zu verbergen. In Parks und Freibädern sind sie völlig entblößt, und dort gesellen sich manchmal männliche Exhibitionisten zu ihnen, die ihre sommerliche Nacktheit so gottverdammt selbstverständlich präsentieren, dass man denken muss, sie wollten mit ihren freigelegten Penissen nur ein paar Tassen Kaffee umrühren. Aber natürlich ist im Sommer fast alles, was der Mensch tut und denkt, Sex. Widerlicher Sex, denn er trägt die seelenlose Fratze eines Pornoshop-Besuchers, oder, um mit der Bild-Zeitung zu sprechen: »Wochenende: Superhitze – alle glücklich, viele nackt!«
Viel deprimierender als die trocken-langweilige Juni-Juli-August-Erotik ist die Mañana-Mentalität, die in diesen Monaten das tüchtige deutsche Volk erfasst, Beamte wie Kreativdirektoren, Schüler wie Lehrer, Politiker wie Journalisten. Plötzlich sitzen alle nur noch in Cafés, überziehen die Mittagspausen und gähnen in der verbliebenen Bürozeit ihren gleichfalls müden Chefs ins Gesicht. Keiner will arbeiten, keiner hat Ehrgeiz, keiner hat Ideen, die Meute träge, und jeder denkt nur noch ans Baden und Surfen und Sich-treiben-Lassen und Ficken und an das Wetter und betet Abend für Abend, morgen möge es genauso schön werden wie heute.
Diese levantinische Lässigkeits-Epidemie ist aufgesetzt. Sie passt nicht zum Deutschen, denn der Deutsche ist tiefsinnig, melancholisch und gewissenhaft, also ein Wintermensch, und als solcher sollte er – statt kiloweise Cassata zu fressen oder wie ein Strandneger in Bermuda-Shorts herumzulaufen – über den Ernst des Lebens nachdenken, putzen, malochen, Völkerball spielen oder sich vor Stalingrad die Füße abfrieren lassen.
Ihre herrlichste Ausformung aber findet die kollektive Sommergammelei im weitverbreiteten Sonnenbräunekult. Dabei wird die Haut – als spätkapitalistisches Lebensstil-Accessoire – so lange systematisch verbrannt, bis sie eine eigentümliche dunkle Färbung annimmt, die soziologische Status-quo-Signale versendet. Zum Beispiel: Seht her, ich war im Urlaub, ich konnte mir den Urlaub leisten, sich den Urlaub leisten zu können ist gesund. Weil ich Geld habe, bin ich gesund, also reich, also frei, also braun … Oder: Seht her, ich hatte Zeit herumzugammeln, ich konnte mir das Herumgammeln leisten, Herumgammeln ist gesund etc.
Es ist mir, dem Unbekannten mit dem allerbleichsten Barry-Lyndon-Astralleib, ziemlich gleichgültig, dass jene sonnenanbetenden Idioten ihre Haut ruinieren, sich in Krebs- und Allergie- und Immunsuppressionsgefahr begeben. Und es kann ebenfalls nicht meine Sorge sein, dass die Bräunungsmittelindustrie, die den Sonnenboom seit den 60er Jahren mit unerhörter marktwirtschaftlicher Perfidie systematisch propagiert und lanciert, sich an diesen Leuten eine goldene Nase verdient. Aber ich werde, selbstverständlich, meine ästhetischen und ideologischen Bedenken anmelden dürfen, denn ich finde zum einen, dass UV-gegerbte Körper längst etwas Zuhälterhaft-Primitives haben: Sie sind die Schaustücke einer neuen Formentera-Longdrink-Golf-für-die-Massen-Kultur, der Leute wie Andy WarholWarhol, Andy und Joseph BeuysBeuys, Joseph nur noch durch fingierten natürlichen Tod zu entkommen wussten. Zum andern symbolisieren die Millionen – und hier schließt sich der Kreis – die schlimmste Phase, die das Jahr hat und die ich hoffentlich ekelhaft genug beschrieben habe: den Sommer, also die Zeit, in der alle meine Freunde und Kollegen künstlich gut gelaunt Bade- und Urlaubs- und Freizeitfreuden nachgehen, während ich – ehrlich vergrämt – hinter zugezogenen Gardinen sitze und über diesen misanthropischen Kolumnen brüte.
Winter ist gut. Im Winter fühlen sich die andern genauso beschissen wie ich.
Juli 1988
Philosemitismus und kein Ende
Es gibt in Deutschland Menschen, die haben Angst, einen Juden zu beleidigen. Fürchten sie die Beleidigungsklage eines Juden, ihren gesellschaftlichen Tod oder die Attacke eines dieser so schrecklich präzise arbeitenden israelischen Vergeltungskommandos? Nein, diese Leute haben Angst vor sich selbst: vor einem unkontrollierten Moment, in dem ihnen, den »Judenfreunden«, eine antisemitische Bemerkung herausrutschen könnte.
Wir kennen viele dieser Leute. Wir nennen sie Philosemiten. Einer von ihnen sitzt im Feuilleton der Zeit und schreibt unter dem Decknamen »FinisFinis (Kolumnist Die Zeit)«. Er ist der Prototyp des Philosemiten. Diese Leute hasse ich, denn sie sind Rassisten in der Maske des liberalen, aufgeklärten Humanisten. Eine besonders widerliche Art der Spezies Bildungsbürger.
Am 8. Juli hat sich FinisFinis (Kolumnist Die Zeit) Maxim Biller zur Brust genommen. Er hatte im Juni-TEMPO meine Reportage über eine Reise junger deutscher Juden nach Polen gelesen. Dabei ist ihm der Schreck in die Glieder gefahren.
Er erlitt einen Anfall von synthetischer Jugendsprache und bezeichnete meinen Text als »vollen Schocker«. Das fand ich lustig. Wenn du »Holocaust-Scheiße« schreibst, setzen in der Zeit offenbar die Herzschrittmacher aus. Dann zitierte FinisFinis (Kolumnist Die Zeit) noch naserümpfend ein paar »Stellen« aus meinem Text und befand schließlich, ich sei ein »jüdischer Sohn«, der meine, er könne die jüdischen Eltern schon »hochkriegen, so wie die Nazikinder ihre Eltern mit Hakenkreuzen«.
Na prima. Hier schreibt einer mir, dem Nachkommen der Verfolgten, vor, wie ich diese ganze Holocaust-Scheiße zu verarbeiten habe: flennend, ehrfürchtig und stumm vor dem Altar des Großen Pogroms. Er sagt es umständlich, aber unmissverständlich: Ein guter Jude hat einzusehen, dass der deutsche Intellektuelle heute Antifaschist ist. Er hat seine verlogene Trauerarbeit zu akzeptieren. Er hat einzustimmen in den bequemen Es-war-so-schlimm-aber-passiert-nicht-wieder-Gesang. Er hat weiterhin das Opfer abzugeben – nicht mehr in der Gaskammer, sondern am Marterpfahl des deutschen schlechten Gewissens.
Weil ich aber diesen Schmus zum Erbrechen finde und nicht mitmache, ist FinisFinis (Kolumnist Die Zeit) beleidigt. Und deshalb kann er nicht anders – er muss den Lesern seines traditionsreichen Blattes zwischen den Zeilen verkünden, dass Maxim Biller kein guter Jude ist. Das Zeit-Feuilleton als deutsches Oberrabbinat, also!
Wieso aber keift FinisFinis (Kolumnist Die Zeit) nicht geradeheraus los? Wieso dreht und windet er sich bei dem Versuch, seine Wahrheit an den Mann zu bringen? Um Gottes willen, denkt er, bloß keinen Juden beleidigen! Unfreiwillig verrät FinisFinis (Kolumnist Die Zeit) damit alles über die verlogenen Mechanismen des Philosemitismus.
Diese Lehre ist rein, streng und unduldsam. Gleich nach dem Krieg wurde sie von Leuten erfunden, die alle zumindest moralisch Dreck am Stecken hatten. Plötzlich hielten sie mit derselben Gewissenhaftigkeit, mit der sie sich der Logik der Nürnberger Rassengesetze unterwarfen, die Woche der Brüderlichkeit ab, kauften beim Antiquar die Judaika-Regale leer und stiegen von Knäckebrot auf Mazzes um. Der Philosemitismus lebt – wie die Zeit-Kolumne beweist – bis heute. Er wurde im Laufe der Jahrzehnte an immer neue Generationen standesbewusster Bildungsbürger überliefert. An Leute, die keine Podiumsdiskussion hinter sich bringen können, ohne den Exhibitionismus des reuigen Sünders auszukosten. Nur die Proleten gingen schnell wieder – auf den Fußballplätzen, an den Tresen – zur offenen antisemitischen Tagesordnung über, und jeder Jude, der nur ein bisschen auf sich hält, ist ihnen dankbar: Man weiß immer gern, wo der Feind steht.
Der Philosemit ist also durch und durch ein Heuchler. Er tut so, als gebe es keinen Judenhass mehr. Er sagt: Der Jude ist gut. Für den Philosemiten hat der Jude als Opfer der Nazi-Monstrosität automatisch etwas Unschuldiges, Reines, Moralisches. Das ist natürlich Quatsch, Juden sind Engel und Arschlöcher und Spießer und Helden.
Was wir daraus lernen? Dass der Philosemit nicht nur ein Heuchler ist, sondern auch noch ein Dummkopf. Das Schlimmste an ihm aber ist, dass er – wie FinisFinis (Kolumnist Die Zeit) eindrucksvoll vorführt – im Namen der Reinheit seiner Lehre über Leichen geht. Wer nicht mit ihm ist, ist gegen ihn. Wer nicht mit ihm trauert, frohlockt. Wer anders denkt, denkt nicht. Es ist das gute alte deutsche Absolutheitsspiel: Wollt ihr die totale Vergangenheitsbewältigung?
August 1988
Bernie go home!
Kennen Sie die legendären 24 Stunden von Hollywood? Ich meine den einen Tag, an dem Bernd EichingerEichinger, Bernd nicht aß, nicht schlief, nicht ruhte. Stattdessen war er mies und böse, schleuderte seinen amerikanischen Verhandlungspartnern infernalische Beschimpfungen entgegen, rauchte Kette, taktierte, paktierte und bluffte, bis sich irgendeine schwere Tür öffnete, aus der irgendeiner dieser mächtigen Amis heraustrat, um unserem bekanntesten Filmproduzenten zähneknirschend zu erklären: »Bernie, you got it.« So erzählt es jedenfalls Bernd EichingerEichinger, Bernd.
War er Vater geworden, oder hatte er womöglich den Oscar gewonnen? Nein, er hatte es bloß geschafft, die zukünftigen Profite, die sein letzter Film, Der Name der Rose, einspielen sollte, von vornherein an zwei große amerikanische Film-Companies abzutreten. Dafür erklärten die sich bereit, sein Projekt überhaupt erst zu finanzieren. Er hatte also nicht – wie er später suggerierte – Hollywood erobert, sondern nur den US-Filmimperialisten eine neue Kolonie vor die Füße gelegt. Er hatte die Arbeit, sie den Gewinn. Er war der Sklave, sie die Herren.
Deutschland liebt Bernd EichingerEichinger, Bernd trotzdem, weil er in fast jedem von uns latente erotische Macho-Mythologie-Bedürfnisse anspricht. Es hat System, dass EichingerEichinger, Bernd in so unterschiedlichen Zeitschriften wie Quick, Zeit, Playboy oder FAZ-Magazin synchron zu den Startterminen seiner Filme so viel Platz für seine immer gleichen, immer ungefilterten Selbstdarstellungen bekommt. Jedes Mal kommt er als gnadenloser Typ in Turnschuhen, Jeans und Bomberjacke daher. Wir erfahren von ihm, dass er sich bei seinem Hollywood-Produzenten-Poker jedes Mal so einsam fühlt wie der Elfmeterschütze bei der WM und dass er Männerfreundschaften mit den schicksalhaft-idealisierenden Augen eines 15-jährigen Clint-EastwoodEastwood, Clint-Fans sieht: »Ein Blick in die Augen, ›so isses eben, du lonesome cowboy, ich auch …‹«, sagt Bernd EichingerEichinger, Bernd. Ein Held unserer Zeit? Nein. Nur ein Filmproduzent aus Neuburg an der Donau.
Warum liebt Deutschland Bernd EichingerEichinger, Bernd noch? Weil er ähnlich wie Steffi GrafGraf, Steffi, Ulf MerboldMerbold, Ulf, BMW, Helmut JohnJohn, Helmut und Hans-Dietrich GenscherGenscher, Hans-Dietrich mit seinen international erfolgreichen Megaproduktionen wie der Unendlichen Geschichte oder eben dem Namen der Rose demonstriert, dass ein Deutscher im Ausland auch ohne Panzer, Landsergesänge und einen Welteroberungsauftrag bestehen kann. Wie das geht, zeigt er bei dem am 15. September anlaufenden, von ihm konzipierten und produzierten Doris-DörrieDörrie, Doris-Film Ich und Er: Die Grundidee des gleichnamigen Romans von Alberto MoraviaMoravia, Alberto wurde zur Komödie umgestrickt und in New York, mit dem Amerikaner Griffin DunneDunne, Griffin in der Hauptrolle, auf Englisch verfilmt. Noch radikaler geht EichingerEichinger, Bernd – der mit Ich und Er erklärtermaßen Filmen wie Tootsie, Ghostbusters und E. T. nacheifern will – bei der derzeitigen Verfilmung des Hubert-SelbySelby, Hubert-Buchs Letzte Ausfahrt Brooklyn vor: Ein uramerikanischer Stoff wird von dem deutschen Auftragsregisseur Uli EdelEdel, Uli für den amerikanischen Markt erschlossen. Käme Robert AltmanAltman, Robert jemals auf die Idee, in der Lüneburger Heide die Deutschstunde von Siegfried LenzLenz, Siegfried zu verfilmen?
Bernd EichingerEichinger, Bernd hat, wie viele, einen Komplex: Es ist der Komplex eines unterdrückten Volkes, das als Folge eines verlorenen Krieges von einem anderen Volk sanft-brutal erzogen, gefördert und gegängelt wurde. Mit seinen durch und durch amerikanischen Projekten kämpft er wie ein weltfremder Don Quichotte gegen die tragikomische Geschichte seines Landes an. Er will sie neu schreiben und den alten Feind auf dessen eigenem Schlachtfeld besiegen.
Mit diesem epigonalen und würdelosen Eingeborenendenken wandelt EichingerEichinger, Bernd auf allen nur denkbaren Holzwegen. Beweis: EichingersEichinger, Bernd Filme sind allesamt ohne national-kulturellen und somit allgemein gültigen Charakter, sie erinnern schon eher an ästhetisch-inhaltliche Medienbastarde von der Überzeugungskraft eines mitternächtlichen Sky-Channel-Programms. Auf der ewigen Suche des Kinozuschauers nach Wahrheit sind sie keinem eine Hilfe. Das waren – absurd, aber wahr – eher jene Arbeiten, die EichingerEichinger, Bernd in den 70er Jahren mit den urdeutschen Regisseuren WendersWenders, Wim, SinkelSinkel, Bernhard, SyberbergSyberberg, Hans-Jürgen, GeißendörferGeißendörfer, Hans W. und ReitzReitz, Edgar produzierte. Was uns das lehrt? Dass Bernie nicht immer ein Cowboy war und dass die McDonaldisierung Deutschlands zügig voranschreitet. Ich finde das gut. Aber ihr wollt euch das tatsächlich gefallen lassen?
September 1988
Die Abschussliste
Wenn wir sie nicht töten, dann bringen sie uns um. Diese Zeit ist ein einziger Urwald. Werte, Moden, Begriffe und, vor allem, Personen sind die Schlingpflanzen, die sich um unsere Kehlen und Köpfe schnüren. Überschätzte, zu spät gekommene, ehrenrührige Personen, Fieslinge und Hunde. Dieser Kleiderständer David ByrneByrne, David zum Beispiel, dessen Gabe, lesen und schreiben zu können, wir gewiss bewundern. Trotzdem fragen wir uns, in welcher Epoche wir eigentlich leben, dass ein Musiker, der kein Analphabet ist, gleich als Kulturgigant gilt. Oder dieser Comicstrip-Philosoph StingSting, der von Abrüstung und Star Wars zweifellos genauso viel versteht wie von Pop. Oder diese zu ewiger Einzelhaft plus Onanie verurteilten RAFler, die erstens niemals das lebensbejahende Format eines Andreas BaaderBaader, Andreas erreicht haben und zweitens immer noch – siehe Konkret10/88 – in reaktionärer Kleinschreibung von der »expandierenden weltgeltung des neuen deutschen imperialismus« faseln, worauf wir zurückfaseln: selber schuld.
Es gibt noch jede Menge anderer Todeskandidaten: den Havannas rauchenden Kulturstalinisten und Profidebattierer Heiner MüllerMüller, Heiner zum Beispiel, dessen quasselig-sophistische DDR-Borniertheit ihre wahre Entsprechung einzig in der Luxus- und Westmediengeilheit seines Kollegen Stefan HeymHeym, Stefan findet. In eine ähnliche Kategorie gehört der Selbsthasser, Poesiealbumlyriker und Trotzkopf Erich FriedFried, Erich, bitte zu verwechseln mit Trotzköpfchen Amelie FriedFried, Amelie, die sich in ihrer Talkshow mit mindestens ebenso viel geistiger Brillanz für die Rechte der Frauen einsetzt wie ihr Namensvetter für die Palästinenser. In diesem Zusammenhang ist auch Harry ValerienValerien, Harry zu erwähnen. Zum einen, weil er neuerdings Fräulein FriedFried, Amelie bei ihren Robin-Hood-Robinsonaden kongenial assistiert, zum anderen, weil er bei keinem seiner Sportberichte die Olympischen Spiele 1936 in Berlin unerwähnt lässt, die für ihn, ganz ehrlich, die schönsten waren. Zuletzt so geschehen anlässlich der Eröffnungsfeier in Seoul, was insofern konsequent war, als Nazi-Deutschland und Südkorea gewiss mehr verbindet als eine läppische Olympiade.
Apropos: Nicht ganz, aber ein wenig sollten wir den Kretin Ben JohnsonJohnson, Ben umbringen, der sich beim Doping erwischen ließ, und erst recht den weibischen Waschlappen Jürgen HingsenHingsen, Jürgen, der zu bescheuert zum Starten war. Ebenso den US-Golem Mike TysonTyson, Mike, weil er der Fleisch gewordene Beweis ist, dass einer, der aus der Gosse kommt, genau dort wieder landet. Und auch unseren Teamchef Franz BeckenbauerBeckenbauer, Franz, diesen bayerischen Parvenü mit Hundesalonbesitzer-Charme, der eines Tages hoffentlich genauso enden wird wie TysonTyson, Mike: zahnlos, ohne Frau und sinnlos zugekokst, den leeren Angeberkopf gegen eine Wellblechhütte in Neu-Delhi, Brooklyn oder München-Giesing gelehnt.
Auch der Hydra »Postmoderne« gehören längst die Schädel abgeschlagen, vor allem jetzt, da sie in dekonstruktivistischem Gewand daherkommt. Genauso muss es auch dem verlogenen Hip-Hop und seinen Klassenkampf heuchelnden Middleclass-Protagonisten ergehen: der sozialdemokratischen Quotenregelung, der Valium-Zeitschrift Lettre, sämtlichen spanischen, holländischen und deutschen Modeschöpfern, dem Großen Kommunikator Otto SchilySchily, Otto sowie allen Leuten, die Jay McInerneyMcInerney, Jay, Michael ChabonChabon, Michael und Tama JanowitzJanowitz, Tama gut oder schlecht finden. Des Weiteren sollen die Köpfe folgender Zeitgenossen rollen: Thomas BernhardBernhard, Thomas (staatlich subventionierter Staatsbeschimpfer), Rainald GoetzGoetz, Rainald (alkoholisierter Halbstarker), Romeo GigliGigli, Romeo (Flohmarkt-Epigone), Friedhelm OstOst, Friedhelm (Sittenstrolch), Franz Xaver KroetzKroetz, Franz Xaver (ebenfalls Sittenstrolch), Michael JürgsJürgs, Michael (Druide), Nick CaveCave, Nick (australischer Neo-Wagnerianer) und Thomas GottschalkGottschalk, Thomas (Thomas GottschalkGottschalk, Thomas).
Zum Schluss aber – nachdem wir uns noch Jutta DitfurthDitfurth, Jutta, Heiner GeißlerGeißler, Heiner, Schlaghosen, Cocktail-Trinker, Sushi-Esser, Alden-, Church- und Reiter-Schuhe, Pilotenuhren, Tweedjacketts, BaudrillardBaudrillard, Jean, die Saatchi-Brüder sowie Michael KühnenKühnen, Michael vorgeknöpft haben –, zum Schluss kommt Michail GorbatschowGorbatschow, Michail dran, der ZK-General und Sowjetpräsident, der so unverfroren auf jeder opportunen Zeitströmung in die Weltgeschichte reitet wie vor ihm nur NapoleonNapoleon Bonaparte, HitlerHitler, Adolf und Paul McCartneyMcCartney, Paul. Die Knarre wird auf ihn – so haben wir es besprochen – der kleine Dummkopf Michael DukakisDukakis, Michael richten. Und dann stellt er sich selbst an die Wand … Oder nein, lassen wir DukakisDukakis, Michael doch in Ruhe. Für den ist Leben schlimmer als Tod.
Oktober 1988
Krieg im Kaffeehaus
Ich habe schon immer etwas gegen diese soziologische Hammelherde gehabt, die sich vornehmlich aus verweichlichten Germanistikstudenten, Privatgelehrten und halbgebildeten Millionärssöhnen zusammensetzt: ein Pack, das die Wahrhaftigkeit der eigenen Gegenwart verkennt und stattdessen von einer unpräzisen Sekundärliteratur-Vergangenheit schwärmt. Einer Vergangenheit der Wiener, Prager und Berliner Kaffeehäuser, wo jeder ein Dichter war oder zumindest einen kannte, Karl KrausKraus, Karl duzte und Witze erzählte, deren Pointen allein Franz KafkaKafka, Franz und Hans MoserMoser, Hans verstanden. Oder wie mein alter Lateinlehrer sagen würde: Quatsch muss sein.
Doch die Nostalgie hat System: Auch und gerade ein Prosa-Tartuffe wie der Exil-Tscheche Milan KunderaKundera, Milan bejubelt diese missverstandene Tante-Jolesch-Epoche. Mehr noch: Als Vordenker einer stetig anwachsenden Schriftsteller- und Kongresswanderzirkus-Truppe will KunderaKundera, Milan die Wiederkehr der guten alten Zeit erzwingen. Er und seine Kombattanten von der Schreibtischfront – der Ungar György KonrádKonrád, György etwa, der Jugoslawe Danilo KišKiš, Danilo, der Tscheche Václav HavelHavel, Václav oder die Deutschen Peter SchneiderSchneider, Peter und Hans-Christoph BuchBuch, Hans-Christoph – glauben fest, dass es das Kaffeehaus-Atlantis allein deshalb nicht mehr gibt, weil Europa bei der »Unrechtskonferenz« von Jalta in zwei unverrückbare ideologische Blöcke zerhauen wurde. Die Konsequenz: Ungarn, Deutschland, Polen und die Tschechoslowakei sollen sich aus der jeweiligen Supermacht-Umklammerung lösen und mit dem neutralen Österreich eine Union à la Habsburg bilden. Ein selbständiges Mitteleuropa, sagen die Kunderianer, brächte Entspannung, Frieden, Freiheit und vor allem eine Menge Kultur. Als ob es das alles nicht längst schon gäbe …
Wieso uns die feuchten Träume eines Häufleins weltabgewandter Revanchisten trotzdem beschäftigen? Zum einen natürlich, weil wir Nostalgie als das zeitgenössische Kommunikationsmittel und Mode-Accessoire verachten, denn Nostalgie ist Regression, und Regression ist Postmoderne. Zum andern wissen wir, dass eine neue europäische Mittelmacht unseren Kontinent keineswegs befrieden würde. Sie brächte, im Gegenteil, das so empfindliche Gleichgewicht zwischen den USA und der UDSSR derart durcheinander, dass endlich ein paar Arschlöcher einen Vorwand hätten, ihre atomaren Ejakulationen abzuschießen.
Des Weiteren ist uns aber bekannt, dass es die Vorstellung von einem zentralen europäischen Hegemonismus schon länger gibt. Immer spielte dabei Deutschland die Rolle des Dirigenten: Knallchargen wollten um Österreich und Preußen herum ein hübsches, kräftiges Reichlein bauen. HitlerHitler, Adolf hat es schließlich gebaut, und der starb später wie ein Hund in seinem Berliner Bunker.
Der Verdacht der deutschtümelnden Europatümelei verhärtet sich angesichts der Kräfte, die das Treiben der ach so humanistischen, kulturbeflissenen Kunderianer stützen: Da entdeckt man die neutralistisch-patriotische, vormals linke taz genauso wie das rechtsliberale Feuilleton der rechtsradikalen FAZ, das für Mitteleuropa aus allen Rohren schießt.
In der unheiligen Café-und-Topfenpalatschinken-Allianz finden sich außerdem charakterlose FDP-Politiker, verpickelte Mitglieder der Jungen Union und auch ein obskures »Institut für die Wissenschaften vom Menschen« aus Wien, das von einem polnischen Intimfreund des Papstes geleitet wird.
Zettelt das Institut im Auftrag des polnischen Erzreaktionärs und Gottes-Falangisten WojtyłaWojtyla, Karol ein geistespolitisches Komplott an? Dazu nur eines: Tatsächlich gibt es unter diesen Neopapisten, genauso wie unter den Kunderianern, eine Menge Leute, die im Zuge der k.u.k.-Renaissance ihr Historikerstreit-II-Hühnchen mit den Sowjets rupfen wollen: Für sie ist der Untergang der Csárdás-Bata-und-Chopin-Kultur ähnlich schrecklich wie für die Juden die Schoah und den Wichser NolteNolte, Ernst die Schlacht von El Alamein.
Und noch mal: Das scheinbar verquaste Mitteleuropa-Gerede geht uns schon deshalb etwas an, weil es gar kein Gerede ist. Weil man diese Leute ernst nehmen muss. Denn mit Büchern, Ideen und Heiße-Luft-Kongressen fing schon so manches historische Unglück an: die Napoleonischen Kriege etwa, HitlersHitler, Adolf Machtergreifung oder das Hells-Angels-Massaker von Altamont.
Und dann ist wieder Krieg. Glauben Sie, in Ihrem Kaffeehaus wird nicht geschossen?
November 1988
Zum Heucheln!
Philipp JenningerJenninger, Philipp hat nicht die Juden beleidigt, sondern die Deutschen. In seiner Gedenkrede zum 50. Jahrestag der Judenpogrome hat er der Heuchel- und Betroffenheits-Orgie, die bei uns seit über dreißig Jahren um die sechs Millionen Holocaust-Opfer veranstaltet wird, endlich ein würdiges Ende bereitet. »Auch die Kirchen schwiegen«, sagte er vor laufenden Kameras. »Der Abstieg in die Barbarei war gewollt und vorsätzlich«, erklärte er provokant. Und HitlersHitler, Adolf Popularität begründete er so: »Wer wollte bezweifeln, dass 1938 eine große Mehrheit der Deutschen hinter ihm stand?«
JenningerJenninger, Philipp wagte es auch, dem unantastbaren deutschen Soldaten den Marsch zu blasen: »Zu der entsetzlichen Wahrheit des Holocausts trat die vielleicht bis heute nicht völlig verinnerlichte Erkenntnis, dass die Planung des Krieges im Osten und die Vernichtung der Juden unlösbar miteinander verbunden gewesen waren …« Mit der Anspielung auf die Kollektivschuld entzog JenningerJenninger, Philipp den notorischen »Wir haben nichts gewusst«-Lügnern den Boden. Aber auch die Nachkriegsdeutschen setzte er matt. Er erkannte in ihnen einen Haufen ehrloser Trauerarbeitsflaschen: »Die rasche Identifizierung mit den westlichen Siegern förderte die Überzeugung, letzten Endes – ebenso wie andere Völker – von den NS-Herrschern nur missbraucht, ›besetzt‹ und schließlich befreit worden zu sein.« Warum, in der Tat, sollten nur die Österreicher das Anschlusssyndrom als Entschuldigung benutzen?
Noch nie zuvor hat ein deutscher Politiker bei einem derart prominenten Anlass den eigenen Leuten so offen erklärt, warum sie einst zu Wahnsinnigen und Mördern geworden waren. Noch nie bekamen sie in einer solchen Deutlichkeit zu hören, dass die Ausrottung der europäischen Juden vorsätzlicher Mord war, verübt zwar von einer Partei- und SS-Kaste, geduldet aber vom ganzen Volk. Endlich hatte einer den Mut, sich in einer Gedenkrede nicht wie in einem mit Watte gepolsterten Rechtfertigungslabyrinth zu verirren, sondern Selbstbezichtigung und Analyse zu betreiben.
JenningerJenninger, Philipp, ein Held unserer Zeit? Politiker, Journalisten und Historiker wollen aus ihm einen Idioten machen: Er sei intellektuell überfordert gewesen oder, schlimmer noch, er habe den Bundestag mit einer Therapiecouch verwechselt. Was an dem einen Tag zwischen seiner Rede und seinem Rücktritt geschah, war die kollektive Entmündigung eines Mannes, der der Gesellschaft die Wahrheit ins Gesicht gespuckt hatte. Alle die, die JenningerJenninger, Philipp plötzlich für unzurechnungsfähig erklärten, taten so, als hätten sie die Interessen der armen Juden im Sinn. Tatsächlich aber ging es ihnen allein um sich selbst. Um die versteckten Schuld- und Selbsthass- und Antisemitismusgefühle, die JenningerJenninger, Philipp ihnen mit seiner glanzvollen Philippika um die Ohren gehauen hatte.
Das JenningerJenninger, Philipp-Massaker hat viel in Bewegung gesetzt. Gewiss wurden ein paar neue Antisemiten produziert, aber es machte zum einen den Holocaust zu einem spannenden, vieldiskutierten Medienereignis und öffnete vielen jungen Deutschen die Augen über die Verlogenheit und Heuchelei ihrer Eltern. Zweitens verdeutlichte es, dass sich die Holocaust-Diskussion längst nicht mehr um die Verarbeitung und ethische Wertung des Massenmordes dreht, sondern um die gegensätzlichen, strittigen Positionen, die heute verbreitet werden. In diese Abteilung gehört die Historikerdebatte ebenso wie die FellnerFellner, Hermann-Äußerung, »dass die Juden sich schnell zu Wort melden, wenn irgendwo in deutschen Kassen Geld klimpert«, oder die Aufrufe linker deutscher Gruppen, israelische Waren zu boykottieren. Drittens aber, und hier überschneiden sich die Kategorien, lehrt uns das JenningerJenninger, Philipp-Massaker, dass ein kluger, ein mutiger, ein ehrlicher Politiker tatsächlich keine Chance hat. Eine beschissene Binsenweisheit.
Weder Heiner GeißlerGeißler, Heiner bekam den politischen Arschtritt, als er die Pazifisten der 20er und 30er Jahre für Auschwitz mitverantwortlich machte, noch musste Edmund StoiberStoiber, Edmund wegen seines Statements über die angebliche Gefahr einer »durchrassten« deutschen Gesellschaft gehen. Warum wurde ausgerechnet JenningerJenninger, Philipp gestürzt? Aus Heuchelei natürlich. Es war infam, wie die greise jüdische Schauspielerin Ida EhreEhre, Ida gegen JenningerJenninger, Philipp ins Feld geführt wurde. Während er seine Rede im Bundestag hielt, kauerte sie wie versteinert da, die Hand vors Gesicht geschlagen, den Kopf gebeugt. Hier saß das personifizierte jüdische Leid zweier Jahrtausende. Das Bild ging ebenso um die Welt wie das Wort von der seelischen Grausamkeit Philipp JenningersJenninger, Philipp. Die Erklärung folgte viel später: Ida EhreEhre, Ida sagte, sie habe von der Skandal-Rede kein Wort mitbekommen. Zu sehr habe sie die von ihr rezitierte Todesfuge Paul CelansCelan, Paul aufgewühlt.
Otto SchilySchily, Otto hatte einmal an dem Pult, von dem JenningerJenninger, Philipp stürzte, ein paar obligatorische Tränen über die toten Juden vergossen. SchilySchily, Otto, die Heulsuse, wurde ein Held der Vergangenheitsbewältigung. Philipp JenningerJenninger, Philipp, der Argumentator, weinte nicht, sondern erklärte. Er fiel auf dem Schlachtfeld der ewigen deutschen Schuld. Aber so ist dieses Deutschland nun mal: ein pseudo-romantischer Sumpf, dessen Helden nur weinen oder schießen. Es sind allein die Guten, die sterben.
November 1988
Enkel Tom
Früher hätten wir wohl mitgeweint. Beim Newport Jazz Festival 1958 zum Beispiel, wo Mahalia JacksonJackson, Mahalia mit einem herzzerreißenden Gospel-Song die endgültige Selbstparodie auf 450