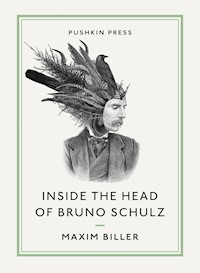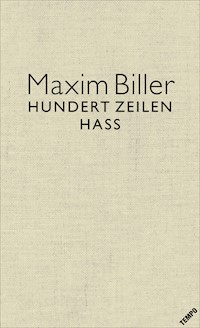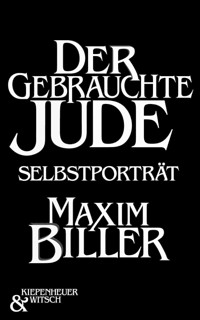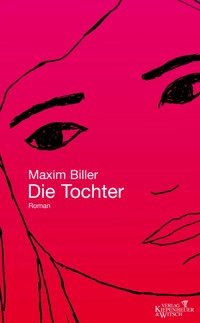9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einem, der irre wird an Deutschland. Erck Dessauer, der Held und Erzähler dieses Romans, ist jung, begabt und bereit, ein großer Schriftsteller zu werden. Leicht ist das nicht im Berlin der Nullerjahre, denn eingeschworene Cliquen teilen die Macht unter sich auf, und Missgunst ist ein anderes Wort für Glück. Und besonders einer scheint es auf Erck abgesehen zu haben. Ercks Vater wurde zweimal verlassen: einmal von seiner Ehefrau. Und einmal von der DDR. Beides hat der Professor aus Leipzig nicht verwunden. Erck ist mit diesem Schmerz groß geworden, aber Aufgeben ist seine Sache nicht. Als er beim besten Verlag der Republik einen Buchvertrag unterschreibt, ist er fast am Ziel. Wäre da nur nicht dieser Hans Ulrich Barsilay mit seinem extravaganten Auftreten, seinen schönen Ex-Freundinnen, seiner perfekten Prosa und seiner Gewissenlosigkeit. Das Problem: Er ist beim selben Verlag. Und vieles deutet darauf hin, dass er versucht, Erck sein Thema zu stehlen. Höchste Zeit, ihm mit einer Intrige zuvorzukommen. Maxim Biller erzählt die Geschichte von einem, der irre wird an Deutschland, weil er um jeden Preis hinein will: in die Gesellschaft, ins Scheinwerferlicht des Betriebs, ins Valhalla der neuen wiedervereinten Nation. »Der falsche Gruß« ist eine bitterböse Studie über Opportunismus, neuen Nationalismus und die Dinge, die man wieder sagen können muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Maxim Biller
Der falsche Gruß
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Biller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Biller
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Er schreibt Romane, Erzählungen, Essays und Satiren. Sein Roman »Esra«, den die FAS als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch« lobte, wurde gerichtlich verboten und ist deshalb zur Zeit nicht lieferbar. Sein Short-Story-Band »Liebe heute« wurde unter dem Titel »Love Today« in den USA veröffentlicht, seine Bücher wurden insgesamt in sechzehn Sprachen übersetzt. Zuletzt erschienen sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013), der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus Magnum« nannte, und »Sieben Versuche zu lieben. Familiengeschichten« (2020). Sein Bestseller »Sechs Koffer« (2018) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Erck Dessauer, jung, begabt und nachtragend, will ein großer Schriftsteller werden. Leicht ist das nicht im Berlin der Nullerjahre, wo eingeschworene Cliquen die Macht unter sich aufteilen und Missgunst ein anderes Wort für Glück ist.
Als er beim besten Verlag der Republik einen Buchvertrag unterschreibt, ist Erck fast am Ziel. Wäre da nur nicht dieser Hans Ulrich Barsilay mit seinem extravaganten Auftreten, seinen schönen Ex-Freundinnen, seiner perfekten Prosa und seiner Gewissenlosigkeit. Bevor der berühmte Schriftsteller seinen Aufstieg verhindern kann, muss Erck ihn mit einer unerhörten Intrige aufhalten.
Maxim Biller erzählt die Geschichte von einem, der irre wird an Deutschland, weil er um jeden Preis hinein will: in die Gesellschaft, ins Scheinwerferlicht des Betriebs, in die Walhalla der neuen, wiedervereinten Nation. »Der falsche Gruß« ist eine bitterböse Studie über Opportunismus, neuen Nationalismus und die Dinge, die man wieder sagen können muss. Und vor allem ist dieser Roman das überraschend liebevolle, mitreißende Porträt des jungen Schriftstellers als Monster, Feigling und ewiges Kind.
»Eine raffiniert erzählte, doppelbödige Geschichte. Ein kluges, entlarvendes, wichtiges Buch.« Benedict Wells
Inhaltsverzeichnis
Vom selben Autor
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Förderhinweis
Wenn ich einmal reich und tot bin
Die Tempojahre
Land der Väter und Verräter
Harlem Holocaust
Die Tochter
Kühltransport
Deutschbuch
Esra
Bernsteintage
Moralische Geschichten
Menschen in falschen Zusammenhängen
Liebe heute
Der gebrauchte Jude
Kanalratten
Im Kopf von Bruno Schulz
Biografie
Hundert Zeilen Hass
Sechs Koffer
Literatur und Politik
Sieben Versuche zu lieben
Wer nichts glaubt, schreibt
Er beneidete die Klavierspieler um ihre Begabung, die Soldaten um ihre Narben.
Gustave Flaubert, Die Erziehung des Herzens
1
Es war eine Mischung aus Hitlergruß und dem verrutschten Armwedeln eines Betrunkenen, aber vielleicht war es auch einfach nur mein ungeschickter Versuch, den französischen Quenelle nachzumachen, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls stand ich eines Nachts vor fünf Jahren im Trois Minutes in der Torstraße vor dem ewigen Unruhestifter und Menschenfeind Hans Ulrich Barsilay und machte das erste Mal seit meiner Kindheit wieder meine absurde Nazigymnastik. Gleichzeitig trat ich wütend gegen den Tisch, an dem er seit zwei Stunden mit Leo Meinl, dem immer nervösen Talk-Show-Anwalt, Zanussi und Zanussis linksradikaler, französischer Exfrau Lola saß, die heute vermutlich alle von Barsilay nichts mehr wissen wollen, und zischte »So viel Blödheit muss weh tun« und »Du kleines Arschloch …« in seine Richtung. Dann senkte ich den Arm schnell wieder, wenn ich mich richtig erinnere, und starrte schweigend auf den Boden. Als ich hochschaute, saßen Meinl, Zanussi und Lola nicht mehr ganz so dicht neben Barsilay an dem langen, weißgedeckten Bistro-Tisch wie vorher, und während ich in den Augenwinkeln deutlich Barsilays erschrockenes, dummes Trotzkigesicht sah, kämpfte ich mit meiner Übelkeit und meiner Angst vor dem Skandal, der mir nach meinem Hitlergruß-Blackout drohte. Wer war ich, wer war Barsilay? Und hatte ich nicht an diesem schrecklichen Abend aufgehört, Schriftsteller zu sein, noch bevor ich damit so richtig angefangen hatte?
Als ich dann eine halbe Stunde später über die schwarze, laute Torstraße nach Hause zum Teutoburger Platz lief, sah ich bereits, wie ich, ein moderner Nazi-Émigré, gleich am Morgen einen Koffer packte, mit dem Zug nach Hamburg fuhr und von dort das letzte Schiff in Richtung Amerika nahm, um für immer Deutschland zu verlassen – verjagt und ausgestoßen, bloß weil ich aus Versehen gegen eines der ungeschriebenen Gesetze der großen Umerziehung verstoßen hatte.
Ich war, glaube ich, fast schon in der Gormannstraße, als ich plötzlich wieder umdrehte und zum Rosenthaler Platz zurückging, wo gerade dieser neue riesige, helle Schnapsladen aufgemacht hatte – »Liquor store« stand darüber, als wäre ich längst auf der anderen Seite des Atlantiks angekommen –, und dort suchte ich mir den teuersten Wodka aus, den sie hatten. Er war aus Finnland, die Flasche sah aus, als hätte man sie aus einem Eisblock herausgeschlagen, und als ich beim Bezahlen zufällig die Hand der kleinen Orientalin mit dem turmartig hohen, minzgrünen Kopftuch berührte, die ein überraschend schönes, klares Deutsch sprach, dachte ich: Ihr armen, armen Leute, nach mir seid bestimmt ihr dran! Was wird man euch vorwerfen? Auschwitz wohl kaum, aber bestimmt irgendwas mit den Armeniern.
»Barsilay ist überall«, flüsterte ich der kleinen Türkin oder Araberin zum Abschied verschwörerisch zu. Sie nickte stumm und höflich, und als ich noch im Laden die finnische Flasche aufmachte und in einem Zug fast ein Drittel austrank, sagte sie auch nichts.
2
Das erste Mal hatte ich Barsilays seltsamen Namen gehört, noch bevor ich anfing, zu studieren. Mein Vater – manche sagen, dass ich von ihm meine ungewöhnlich schnelle Auffassungsgabe habe, aber leider auch seine fast aufreizende Verletzlichkeit und seine professorale Verträumtheit – kam an einem sonnigen Sommertag irgendwann Anfang der neunziger Jahre sehr viel früher als sonst aus der Universität nach Hause. Er hatte rote Flecken im Gesicht und auf dem Hals, er schwitzte so sehr, dass die Ansätze seiner gelbgrauen Haare nass waren und dunkel über der hohen Denkerstirn glänzten. Und weil sonst keiner da war außer mir, erzählte er mir, was ihn so aufgeregt hatte, dass er nicht weiterarbeiten konnte. Er hatte in der Mittagspause zufällig Barsilays bestürzenden FAZ-Essay über »die Affen von Rostock-Lichtenhagen« gelesen – so nannte Barsilay die Idioten, die fast ihre eigenen Häuser angezündet hätten, um ein paar arme Vietnamesen aus ihnen zu verjagen –, und jetzt stieß Papa immer nur Barsilays fremd klingenden Namen aus, zweimal, dreimal hintereinander, um danach plötzlich ganz laut ein unsichtbares Publikum zu fragen: »Wer dreht an der Uhr der Geschichte? Sind es die Ewiggestrigen oder sind es ihre Opfer?«
Barsilay behauptete in dem Artikel, den ich fast zehn Jahre später als Student für meine nie geschriebene Magisterarbeit das erste Mal selbst las, Ostdeutsche wie die Rostocker Randalierer würden Westdeutschen wie ihm jeden Tag die Heimat ein bisschen mehr stehlen. Aber dass die Westdeutschen uns über Nacht heimatlos gemacht hätten, verschwieg er natürlich, wie mein Vater meinte. »Leute wie dieser Barsilay, mein Kleiner«, sagte mein lieber, kluger Papa ungewöhnlich verächtlich, während er mit der brennenden Zigarette am offenen Fenster in unserem riesigen Wohnzimmer an der Ecke Gustav-Adolf- und Funkenburgstraße stand, von wo man das tiefe, wabernde Grün der riesigen Linden und Kastanien des Rosentals sehen konnte, aber auch das hohe, weißgraue Dach des alten Zentralstadions, »solche Leute suchen sich immer die falschen Genossen. Und dann gucken sie genauso dumm auf die Welt wie die Bolschewiken, die sie nie waren. Naja, es ist ja sowieso meistens dasselbe.« Damals, mit 16, sweet sixteen sozusagen und genauso verwirrt und wütend wie fast alle in meiner Klasse, wusste ich noch nicht genau, was er meinte, aber ich fühlte, dass wir beide endlich mal wieder auf einer Seite standen, wenigstens für ein paar Sekunden.
Als ich, wie gesagt, fast zehn Jahre später bei Sartorius in Berlin meine Arbeit über »Spätbolschewismus als Identität und Nachteil« schreiben wollte – wie dumm muss man sein, um seinem reaktionären Magistervater noch vor der ersten Zeile die eigene rosarote politische Einstellung zu verraten? –, war Barsilays Lichtenhagen-Artikel einer der ersten Texte, die ich mir besorgte. Ich saß in der Staatsbibliothek Unter den Linden im alten Lesesaal, an einem der altvertrauten, hellen Hellerau-Tische, die später, nach der angeblich so behutsamen Nachwende-Renovierung, spurlos verschwunden waren. Und während ich mit meinem schönen, leicht windschiefen Dessauer-Zeigefinger über das vergilbte, beinah sozialistisch braune FAZ-Papier fuhr und flüsternd Barsilays knappe, gehetzte, viel zu eingängige Sätze mit den Lippen mitlas, erinnerte ich mich daran, wie es an dem heißen, drückenden Leipziger Augustnachmittag weitergegangen war, als mein Vater wegen Barsilays Frechheiten nicht weiterarbeiten konnte und mir, nach seiner atemlosen Suada, erklärte, dass es immer nur die und uns geben würde – und dass ich das nie vergessen sollte.
Papa rauchte noch mindestens vier oder fünf Zigaretten am Fenster, während ich neugierig in der Tür stand und ihm zuhörte. Er bot mir sogar eine an, was er vorher nie gemacht hatte, und obwohl ich sie sehr gern wollte, beschloss ich, Nein zu sagen. »Dann umarm mich wenigstens, Erck, du kleiner Bandit, du großer Punker«, sagte er halb beleidigt, halb erleichtert. »Du bist jetzt groß genug, um deinem alten Vater Mut zu machen.« Das machte ich nach einem kurzen, unsicheren Hin und Her zwischen Tür und Fenster dann auch, ich dachte dabei, warum riecht er nach Apfelsinen, wir haben doch nie Apfelsinen, und wieso hält er mich so vorsichtig wie ein Baby. Hinterher gingen wir, das erste Mal seit vielen Jahren, zusammen im Rosental spazieren.
Papa ging meistens schneller als ich und warf immer wieder wie ein Dirigent seine langen, sehnigen Dessauer-Arme in die Luft, die ich natürlich auch habe, ein Erbe unserer Rostocker Werftarbeiter-Vorfahren. Er machte »Ah!« und »Oh!« und erzählte mir, wie er in jedem Park, aber besonders bei uns, im wunderschönen, luftigen Rosental, innerhalb von wenigen Sekunden vergesse, dass er eben noch todmüde oder unglücklich gewesen sei. Danach fing er an, die vielen anderen Parks aufzuzählen, in denen er schon war, Verhältnis Ost zu West, glaube ich, so ungefähr dreißig zu drei. Wir standen gerade in der Mitte der riesigen Wiese und Papa rief armwedelnd »Városliget!« und »Sokolniki!«, als plötzlich ein Kamel an uns vorbeilief. Es war sehr groß, weiß, seine Höcker wackelten beim Laufen, und es hatte ein altes, trauriges Gesicht. Es erinnerte mich ein bisschen an Großvater Julius – in der Familie immer nur »der arme, arme Julius« genannt –, der sich wegen seiner halb-arischen Herkunft freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hatte, um im Reich nicht unangenehm aufzufallen, und den ich bloß als abgemagerten, weinenden Greis gekannt hatte. Erst nachdem das Kamel hinter den Büschen des Scherbelbergs verschwunden war, fing ich an, mich zu wundern. Man hörte immer wieder, dass Tiere aus dem Zoo ausbrachen, aber ich hatte so etwas noch nie selbst erlebt und das auch nicht richtig geglaubt, und als ich zu Papa sagte: »Wahnsinn, Papa, hast du das gesehen?«, sagte er lächelnd: »Es kommt einem so vor, als würde man träumen, richtig?«
Als wir dann bei dem langen, mit Schilf und wilden Sträuchern spärlich bewachsenen Graben ankamen, der das Rosental nur dürftig vom Zoo trennte, sagte er: »Siehst du? Keiner da! Sie tun so, als würden sie in ihren Gehegen und Käfigen schlafen. Aber sie verstellen sich natürlich nur. Komm, wir warten, ob bald wieder eins von den Tieren so verrückt ist, wegzurennen.« Er packte mich am Arm und brüllte mich fast an: »Man darf nie wegrennen, Erck, verstehst du?! Egal, wie schlimm es in dem Gefängnis ist, in dem du lebst. Wanderschaft ist nichts für Leute wie uns. Hoffentlich wird der arme König der Dromedare bald von seinen Wächtern eingefangen, sonst geht es ihm dreckig in der Freiheit.« Ich schwieg, ich dachte, was will er mir damit sagen, und dann sagte ich: »Papa, jetzt hätte ich doch gern eine Zigarette.«
Das alles ging mir also durch den Kopf, während ich fast ein Jahrzehnt später in Berlin in der Bibliothek saß und beim Lesen von Barsilays Lichtenhagen-Artikel überrascht merkte, dass Papa bei seiner Zusammenfassung die Hälfte weggelassen hatte. Denn natürlich beleidigte der ewige Krawallmacher und spätere Börnepreisträger darin – nach seiner grellen und ziemlich sadistischen Ossi-Attacke – auch die Westdeutschen. Er behauptete, dass sie mit uns »bolschewisierten Menschenaffen« ähnlich rücksichtslos umgegangen seien wie die Truppen des Leutnants von Trotha mit den hilflosen, mutigen Hereros. Er verglich Deutsch-Südwest mit der Ex-DDR, die Massaker in der Omaheke-Wüste mit den Treuhand-Pogromen, und er dachte laut darüber nach, ob er in einem solchen »Bürgerkriegsland« noch weiter zu Hause sein könne. »Ich werde« – diesen Satz hatte ich mir unterstrichen und für immer gemerkt, weil er so wehleidig und unhistorisch zugleich war – »ich werde trotzdem hier bleiben, denn würde ich gehen, würden alle meine Feinde zu mir sagen, ich hätte mich doch nur selbst vertrieben.«
Ja, da war er also, der typische Barsilay-Dreh, dieses nur scheinbar vertrackte Sowohl-als-auch eines Menschen, der sich nicht festlegen wollte, intellektuell, menschlich, geografisch. Das dachte ich schon damals als kleiner, machtloser Student in der Staatsbibliothek Unter den Linden, und ich dachte es jedes Mal wieder, wenn ich später etwas von Barsilay las oder hörte und mich zitternd fragte, warum ausgerechnet er mich unter den Älteren so aufregte – nicht Goetz, Eylschmidt oder Grünbein. Und darum denke und schreibe ich es auch jetzt, im viel zu warmen Winter 2012, in meiner großen, modernen Eigentumswohnung in der Bernauer Straße, in einem der neuen Genossenschaftshäuser, die seit Jahren entlang der ehemaligen Mauer wie Pilze aus dem Boden schießen. Meine Nachbarn hier sind übrigens fast nur Architekten, junge Bundestagsreferenten und Journalisten, und die meisten von ihnen grüßen mich immer sehr höflich. Ich bin also offenbar nicht mehr der unsichtbare Nobody von früher, nein, wirklich nicht, und vielleicht empfinde ich genau deshalb inzwischen so etwas wie Mitleid mit meinem lange übermächtigen Gegner, der sich einmal zu oft seinen sprichwörtlichen Barsilay-Dreh erlaubt hatte und hinterher, als das mit meiner freundlichen Unterstützung rauskam, ganz schnell untertauchte – so ähnlich wie ein Berufsrevolutionär im Reich von Zar Nikolaus II. oder auch ein gewöhnlicher, kleiner Trickbetrüger.
3
Warum hat der vorlaute Barsilay – auf die Geschichte seines so unpassenden Vornamens Hans Ulrich komme ich noch – eigentlich nichts gesagt, als ich ihm im Trois Minutes den verbotenen deutschen Gruß zeigte? Das habe ich mich später, sehr viel später, als ich keine Angst vor den tausendfachen Konsequenzen meiner idiotischen Armschwenkerei mehr hatte, öfters gefragt, und dabei verspürte ich jedes Mal wieder kurz dieselbe Übelkeit wie in den schlimmen Wochen und Monaten nach dem Vorfall. War er genauso erschrocken wie ich über das, was passiert war, und schwieg deshalb – oder war das nur Taktik? Hat er stumm darauf gewartet, dass Meinl, Zanussi und Zanussis Exfrau sich auf seine Seite schlagen, dass sie mich schimpfend und schreiend aus dem Restaurant jagen und der Anwalt mir dann auch noch droht, mein ganzes Leben mit einer kleinen, feinen Strafanzeige wegen Volksverhetzung zu vernichten? Oder verschlug es ihm darum die Sprache, weil sie im Gegenteil alle drei so taten, als hätten sie nichts gesehen und gehört? Möglich war natürlich auch, dass er an diesem Abend ganz andere Probleme hatte, aber haben wir die nicht irgendwie alle?
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: