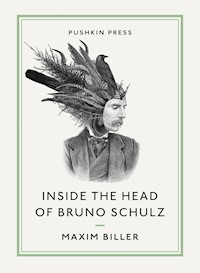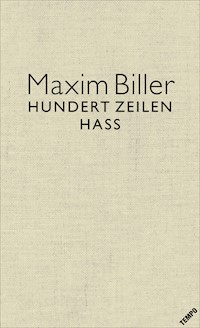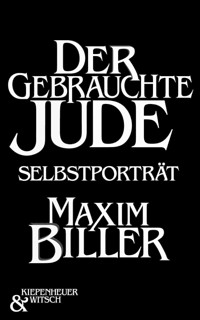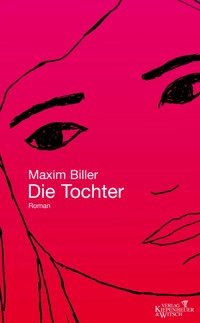9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die gesammelten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller. Was hat das Heute mit dem Gestern zu tun? Warum wollen wir oft nichts von unserer Vergangenheit wissen, ohne die wir gar nicht die wären, die wir sind? Und wer waren unsere Eltern und Großeltern wirklich? Wer Maxim Billers Bücher kennt und liebt, weiß, dass ihm diese Fragen besonders wichtig sind, sie bilden den poetischen und auch sehr menschlichen Kern seiner Literatur. Dabei begegnen uns in seinem Werk bestimmte Figuren und Orte immer wieder in neuen, überraschenden Variationen: Gebrochene Väter, traurige Mütter und stolze Söhne genauso wie Stalins düsteres Moskau, das wilde Prag von 1968, das flirrende Berlin der Nachwendezeit, das stille, melancholische Hamburg und natürlich auch Tel Aviv, die weiße Stadt am Meer, in der man als Jude wenigstens manchmal vergessen kann, wie blutig die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts war, ohne ihr ganz entkommen zu können. Sogar noch weniger als seiner fröhlichen, lauten, traumatisierten, komplizierten Verwandtschaft. Dieser Band versammelt das erste Mal die besten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller: eine Lektüre, die süchtig macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Maxim Biller
Sieben Versuche zu lieben
Familiengeschichten
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Biller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Biller
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Wenn ich einmal reich und tot bin«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Sein Roman »Esra«, den die FAS als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch« lobte, wurde gerichtlich verboten und ist deshalb zurzeit nicht lieferbar. Seine Bücher wurden insgesamt in sechzehn Sprachen übersetzt. Zuletzt erschienen bei Kiepenheuer & Witsch sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013) sowie der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus magnum« nannte. Sein Bestseller »Sechs Koffer« stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2018.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wer sich auf die Reise durch Maxim Billers erzählerisches Werk aus drei Jahrzehnten begibt, dem fällt auf: Bestimmten Orten, Ereignissen und Familienmitgliedern begegnet man immer wieder – aber immer anders. Nie gleichen sie sich ganz, alles passiert in immer wieder neuen Varianten – ein virtuoses Spiel aus Realität und Fiktion.
Moskau, Prag, Hamburg, München, Tel Aviv, Berlin – diese Orte bilden Fixpunkte in Billers Erzählkosmos. Man reist weit durch das 20. Jahrhundert mit all seinen Katastrophen, durch Kriegs-, Stalinismus-, Shoa- und Emigrationsverheerungen, aber man verbringt auch lange russisch-jüdische Abende am Küchentisch. Mit reichlich Essen, Trinken und Gesprächen, in denen es immer um alles geht: Um die große Politik, um die kleinen und noch größeren Gefühle und um die Frage, wer von denen, die da gerade miteinander sprechen, weinen und lachen, ist wirklich so ehrlich, wie er es vorgibt, zu sein. Die Biller’sche Familienmythologie macht süchtig: Es ist eine große Freude, sie in all ihren Varianten zu durchleben und immer wieder nach den Geheimnissen auf die Suche zu gehen, die vielen der so bittersüßen, witzigen und traurigen Geschichten zugrunde liegen und die die Ereignisse vorantreiben.
Inhaltsverzeichnis
Vom selben Autor
Motto
Polanski, Polanski
Rosen, Astern und Chinin
Ein trauriger Sohn für Pollok
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Warum starb Aurora?
Efim flieht in den Wald
Eine kleine Familiengeschichte
Efims Wahrheit
Meyers Wahrheit
Bernsteintage
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Erinnerung, schweig
1. Kapitel
2. Kapitel
Die schönen Stimmen der Erwachsenen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Hana wartet schon
Sieben Versuche zu lieben
Wenn der Kater kommt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Auf Wiedersehen in Hasorea
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Ehrenburgs Decke
Der Anfang der Geschichte
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Nachwort
Bibliografie
Wenn ich einmal reich und tot bin
Die Tempojahre
Land der Väter und Verräter
Harlem Holocaust
Die Tochter
Kühltransport
Deutschbuch
Esra
Bernsteintage
Moralische Geschichten
Menschen in falschen Zusammenhängen
Liebe heute
Der gebrauchte Jude
Kanalratten
Im Kopf von Bruno Schulz
Biografie
Hundert Zeilen Hass
Sechs Koffer
Literatur und Politik
Wer nichts glaubt, schreibt
»So fand ich mich nach vielen Jahren auf einmal zu Hause wieder.«
Milan Kundera, Der Scherz
Polanski, Polanski
Bevor der Gast aus Moskau meine Schwester Klawdija vergewaltigte, aß er sich bei uns erst einmal richtig satt. Zur Graupensuppe gab es Piroggen mit Kartoffeln und Kohl, danach stellte Mama eine armenische Basturma auf den Tisch. Polanski riss mit dem Besteck die blutige Lende in Stücke, er tunkte sie in die dunkle, aserbaidschanische Granatapfelsoße, das Blut und die Soße spritzten über die Tischdecke und über sein Jackett, und Polanski sagte auf Russisch zu meiner Mutter: »Gesegnete Emigration, Anna Abramowna! Die Flecken auf meiner Jacke werde ich hüten wie Andenken aus dem Paradies!«
»Aber ich bitte Sie, Grigorij Michalytsch«, sagte Mama, »das bisschen Gemüse und Fleisch.«
»Nein, Anna Abramowna, sagen Sie nichts. Wann hat es bei uns so etwas das letzte Mal gegeben? Vor den Kommunisten? Nicht einmal zur Zarenzeit … Russland hungert seit tausend Jahren«, sagte Polanski mit bebender Stimme, und sie wurde noch brüchiger, bewegter, als er dann ausrief: »Ach, ich liebe jeden einzelnen Schlachter und Metzger von Berlin!«
Wir alle vier schwiegen.
»So könnte Glück schmecken«, sagte Polanski in die Stille hinein. Er füllte den Mund mit einem neuen, wieder viel zu großen Stück. Das Blut floss an seinen Mundwinkeln hinunter, es floss über sein breites, unslawisches Kinn. »Dieses Fleisch ist wie Honig, wie Mehltau, wie Gold!« Er wischte sich mit dem Ärmel ab und musterte mit seinem Kannibalenblick mich und meine Schwester. »Und diese Kinder auch«, murmelte er. »Kinder des Westens, Kinder ohne Angst, Kinder mit Zukunft!«
Die dicke Klawdija und ich sahen uns an, wir zogen unsere eingespielte Äffchen-Grimasse, und dann lächelten wir, aber Klawkas Lächeln war anders als sonst, wenn wir uns über jemanden lustig machten.
»Ich wünschte, ich könnte wie Sie ein Kreuz hinter Russland machen, Iwan Iwanytsch«, sagte Polanski zu meinem Vater. »Aber die Verantwortung, die ich habe, überwiegt alles Persönliche.«
Mein Vater nickte. »Grigorij Michalytsch«, sagte er, »trinken wir?«
»Trinken wir.«
»Von unserem Wodka oder von Ihrem?«
»Ja, glauben Sie«, rief Polanski aus, »ich habe mich in Moskau nur zum Spaß in die Schlange gestellt?!«
»Annuschka – du auch?«, sagte Vater.
Mutter sah ihn wie einen Verrückten an. »Wann«, sagte sie, »habe ich jemals etwas getrunken?«
»Und die beiden Blondschöpfchen«, sagte Polanski und zeigte auf Klawka und mich, »trinken die?«
»Nicht in meinem Haus!«, sagte Mama laut.
»Sie haben recht, Anna Abramowna. Kinder sollen niemals vergessen, dass sie keine Erwachsenen sind. So hat man es in Russland immer gehalten.«
Noch während er sprach, sprang Klawka auf und begann, die Teller zusammenzuräumen. Die Teller krachten gegeneinander, das Besteck klirrte, Klawdija stampfte um den Tisch herum, und Polanski sagte: »Habe ich die junge Dame beleidigt?«
»Unsere Klawka«, erklärte Mama, »hasst es, siebzehn zu sein, Grigorij Michalytsch –«
»Westen hin, Osten her«, rief Klawdija dazwischen, und ich fügte, damit nur sie mich verstand, leise auf Deutsch hinzu:
»Besserwisser russischer … Provinztrottel!« Doch da hörte mir Klawka gar nicht mehr zu.
»Kinder, es ist genug!«, sagte Mama.
Und Vater sagte: »Trinken wir, Grigorij Michalytsch!«
»Natürlich, Iwan Iwanytsch, wir haben das Trinken ganz vergessen!«
Die beiden leerten ihre Gläser, und Vater füllte sie gleich wieder nach. Dann redeten sie über Politik, während wir ihnen stumm zuhörten. Klawka ging mit dem Tablett in die Küche, sie kam zurück, und im Setzen rückte sie mit dem Stuhl näher an Polanski heran. Vater und er waren noch immer beim gleichen Thema.
Mein Vater ist der einzige Goj in der Familie, und er ist auch der einzige von uns vieren, dem die alte Heimat fehlt. Wir andern drei Belovs sind froh, das Ganze für immer hinter uns gelassen zu haben. Mama und Klawdija hassen Russland einfach nur, ich aber liebe Berlin, wo wir seit sechs Jahren leben. Die Vergangenheit ist für Mama, Klawka und mich kaum der Rede wert, doch Vater nutzt jede Gelegenheit, um über Russland zu sprechen. Darum lud er Polanski am Abend vor seiner Abreise auf die Schnelle noch zu uns ein.
Jetzt sprachen die beiden über den nächsten Putsch, sie sprachen über die Irren von Kasachstan, Turkmenistan und Moldawien, über die Armee und den Geheimdienst, über die Zukunft und mehr noch über die vergangenen Tage der alten Sowjetunion, und Polanski (der an dem Kongress, den die Firma meines Vaters ausgerichtet hatte, als Mitglied einer hohen Wirtschaftskommission teilgenommen hatte) ließ allmählich seinen offiziellen Ton fahren und wurde zusehends sentimental. Zum Schluss wollte Vater nur noch in seinen Erinnerungen an Russland schwelgen – Polanski aber brachte die Rede jedes Mal wieder auf die Emigration.
Vater wurde von dem Wodka immer schweigsamer. Polanskis Gesicht dagegen füllte sich mit Blut, sein wuchtiger Kiefer schien schwerer und schwerer zu werden, seine Arme auch, sie baumelten nun kraftlos an seinem Rumpf, und dann sah ich, wie Klawka einen von ihren riesigen Schenkeln plötzlich unter Polanskis herunterhängende, halbgeöffnete Hand schob. Polanski zuckte, er griff erschrocken nach Klawkas Knie, sie riss das Knie von ihm weg, zur Seite, und schlug mit den Ellbogen laut gegen den Tisch. »Oh, oh, Grigorij Michalytsch!«, rief sie aus. »Nehmen Sie Maß?«
Die Eltern sahen erstaunt zu Klawka hinüber, und ich dachte nun daran, wie mein Großvater mich früher in Moskau mit Quark, Käse und Schokoladenbutter gemästet hatte, um jeden Sonntag mit einem Band den Umfang meines Halses auszumessen. Jeder gewonnene Zentimeter wurde wie ein Sieg gefeiert, und so war ich schon bald das, was man auf Russisch voller Bewunderung einen Jungen aus Blut und Milch nennt. Als meine Schwester alt genug war, dass Großvater auch auf sie aufpassen durfte, päppelte er Klawdija innerhalb weniger Jahre auf jenes Übergewicht hoch, das sie bis heute noch hat. Ich war ein dickes Kind gewesen, Klawka aber wurde eine dicke junge Frau.
»Verzeihen Sie, Anna Abramowna«, sagte Polanski. Er sprang vom Tisch auf, bewegte den kleinen, dürren Körper, der so ganz und gar nicht zu seinem fetten und schweren Kopf passen wollte, wie einen Kreisel viermal, fünfmal durch den Raum. Dann setzte er sich wieder hin und sagte: »Verzeihen Sie – ich habe noch immer einen ganz furchtbaren Hunger.«
Als Mama den Teller mit den eingelegten Auberginen, Salztomaten und Zwiebeln brachte, machte Polanski sich sofort über das Gemüse her. Dazu stellte sie ihm einen Teller mit kalten Lammkoteletts hin, die er bis auf die Knochen abnagte, und an den Knochen saugte und lutschte er so lange herum, bis sich kein Tropfen Mark mehr in ihnen befand.
»Es gibt noch italienischen Schinken und luftgetrocknete Wurst aus der Normandie«, sagte Mama.
Aber da lehnte sich Polanski müde und stöhnend zurück. »Später vielleicht, Verehrteste«, sagte er, und der Lammknochen, den er für einen Augenblick losgelassen hatte, hing nun wie ein Fähnchen aus seinem dicken Affenmund. Er schwieg bedeutungsvoll, aber dann legte er los: »Ach«, rief er aus, »man sollte all seinen Mut zusammennehmen, so wie Sie es getan haben! Man sollte Russland abschreiben, weggehen und ein neues, besseres Leben beginnen!«
»Nein«, murmelte Vater, »Russland kann man nicht abschreiben –«
»– sprach Iwan der Traurige«, unterbrach ihn Klawdija.
»Ihr Vater hat recht, junge Dame«, sagte Polanski. »Ob Russen, Baschkiren oder Tataren, ob Tschetschenen oder Yakuten – wir alle haben ein Gefühl und eine Pflicht.«
»Wir Juden nicht«, sagte Klawka.
Vater sah sie traurig an, Mama lächelte, und Polanski hob die Hand, er streckte sie Klawkas Sonnenblumengesicht entgegen, dann kniff er sie plötzlich zärtlich in die Backe und sagte: »Keine Stacheln, nur Haut wie Seide.«
Klawka erstarrte für eine Sekunde, aber im nächsten Moment rückte sie ihren Stuhl noch näher an den Gast aus Moskau heran, sie lehnte sich auf den Tisch und berührte mit dem Ellbogen seinen Arm.
»Die jüdische Frage ist natürlich eine sehr ernste Frage«, sagte Polanski.
»Und wie halten Sie es mit der Frauenfrage, Ilja Muromez?«, sagte meine altkluge Schwester. Sie war immer schon viel frecher gewesen als ich, aber heute übertrieb sie es.
Polanski antwortete nicht, er blickte eine Weile in die Leere, dann nahm er sich noch einmal einen von seinen ausgehöhlten Lammknochen vor, Vater goss Wodka nach, und sie sprachen jetzt wieder über Politik.
Polanski schimpfte auf die alte Bürokratie, auf die neue Mafia, auf Jelzins Trunksucht und auf Gorbatschows Weltfremdheit, er sprach ohne große Leidenschaft, es war, als erfülle er ein ihm abverlangtes Pensum. Vater, der vom Alkohol allmählich müde wurde, redete dann auch, er schwärmte und jammerte, und immer, wenn er »Russland« sagte, klang es wie der Gesang von tausend Engeln, und da aber schnitt ihm Polanski mitten im Satz das Wort ab, und er stieß aus: »Ich werde hierbleiben, ich habe es längst beschlossen!«
»Deserteur«, sagte Klawka.
Doch Polanski sah sie nicht einmal an. Er sagte streng und gefasst: »Ich habe alles genau durchdacht. Ich weiß Bescheid. Außer Ihnen, Iwan Iwanytsch und Anna Abramowna, kenne ich in der Fremde keinen – aber ich werde es trotzdem schaffen.«
»Willkommen im Flüchtlingslager Mommsenstraße«, sagte Klawka. »Hausnummer vierzehn, dritter Stock. Klingeln Sie bei Belov, und nehmen Sie sich, was Sie brauchen.«
Ich lachte, und Vater sagte: »Trinken wir erst, Grigorij Michalytsch.«
»Ja, trinken wir.«
»Trinkt nur«, sagte Mama. »Morgen ist sowieso alles anders.«
»Kriegen wir nichts?«, sagte Klawka.
»Sei still.«
»Hören Sie«, sagte Polanski, und man merkte, dass ihm das Sprechen schwerfiel, »hören Sie, Anna Abramowna, morgen wird alles so sein wie heute. Nein – es wird sogar noch schlimmer!«
»Morgen«, erwiderte Mama ohne Regung, »sind Sie schon in Brest und am Abend in Moskau, Grigorij Michalytsch. Ihr Zug geht in einer Stunde, und Iwan bringt Sie natürlich zum Bahnhof.«
»Wenn unser Gast bleiben will, dann bleibt er«, sagte Vater.
»Genau«, sagte Klawka.
Vater stützte seinen müden Wodkakopf in die Hände. »Ich verstehe Sie nicht, Grigorij Michalytsch«, sagte er. »Nein, ich verstehe Sie wirklich nicht. Sie erleben eine große Zeit mit, Sie brauchen einfach nur Mut.« Er schwieg. »Ja, jetzt weiß ich! Sie haben sich blenden lassen! Sie denken, Geld sei ein anderes Wort für Glück!«
»Sie sind, mit Verlaub, ein billiger Propagandist, Iwan Iwanytsch.«
»Dem Westen darf man niemals vertrauen.«
»Sie reden!«
»Bleiben Sie in Russland, Grigorij Michalytsch! Kämpfen Sie!«
»Warum durften denn Sie gehen?«, erwiderte Polanski leise. »Und warum aber soll ich in diesem tausendjährigen Saustall verrotten? Jeder geht oder würde es am liebsten tun. Auch Ihr geliebter Michail Sergejewitsch, wenn Sie es genau wissen wollen! Sagen Sie mir nur: Warum sind Sie gegangen?!«
»Weil …« Vater stammelte. »Weil … Nun ja, die drei da, die haben es so bestimmt.«
»Wir wollten aber nicht nach Deutschland«, sagte Mama kalt. »Wir wollten nach Haifa, nach Tel Aviv oder Jerusalem.«
»Anna, du weißt genau, Berlin war der Kompromiss. Wir hätten auch in Moskau bleiben können.«
»Du hättest in Moskau bleiben können, Vater«, sagte meine Schwester.
»Ach, Klawa, Klawatschka – du bist ein hartes Kind.«
»Ich bin kein Kind«, sagte Klawka. Sie verschränkte die Arme so, dass dadurch ihre großen Brüste hochgeschoben wurden, sie atmete tief ein und aus, die Brüste gingen hin und her, Polanski sah auf Klawkas Brüste, und dann strich er sich über das schmale Revers seiner grauweißen Nadelstreifenjacke, deren steifer Stoff an vielen Stellen bereits glänzte. Seine wasserblauen jüdisch-russischen Kinderaugen öffneten und schlossen sich ein paarmal, und plötzlich erhob sich Polanski, das Wodkaglas in der Hand, er torkelte, er hielt sich mit seitlich verrenktem Arm an der Lehne meines Stuhls fest, und er sagte: »Verehrte Anwesende, Russen und Juden –«
»Selber Russe«, rief Klawdija dazwischen.
»Verehrte Freunde! Ihr erlebt gerade den größten Moment im Leben eines sehr kleinen Mannes! Der kleine Mann bin ich. Und dies« – er richtete die angewinkelten Arme wie flehend in die Höhe –»und dies ist der große Moment!«
Polanski stieß auf, er fiel auf seinen Stuhl, aber im nächsten Augenblick stand er gleich wieder auf und fuhr fort: »Denkt an den Schlamm vor dem weißrussischen Bahnhof, denkt an die Rotarmisten in Afghanistan, denkt an die Wüstenei, die gleich hinter dem Lenin-Prospekt beginnt! Denkt an Kronstadt, an Prag und Coyoacán in Mexiko! Vergesst nie den Hunger, der uns immer so rastlos und schwach macht, den Hunger, der den Magen schmerzt, aber im Herzen erwacht …«
»Ich dachte«, unterbrach ich ihn, »ihr Russen, Baschkiren und Tataren habt alle ein Gefühl und eine Pflicht.«
»Ja«, sagte mein Vater, »wie ist es damit, Grigorij Michalytsch?«
»Scheißen wir auf die Pflicht, wenn das Gefühl nicht mehr stimmt«, sagte Polanski, er beugte sich zu Mama vor und flüsterte: »Verzeihen Sie das grobe Wort, Anna Abramowna …«
Aber Anna Abramowna waren Worte in diesem Augenblick egal. »Ihr Zug! Sie werden Ihren Zug versäumen«, sagte sie und fügte fast fröhlich hinzu: »Und denken Sie an Ihre Familie, Grigorij Michalytsch.«
»Familie? Ha! Familie!«
Polanski stieß wieder auf, er stieß sehr laut und unappetitlich auf, die Luft entwich seinem Magen, und obwohl er sich die Hand vor den Mund hielt, breitete sich der Geruch von halbverdautem Fleisch und Gemüse sofort im ganzen Raum aus. Polanski schluckte schwer, er stürzte aus dem Zimmer hinaus, und Mama rief ihm hinterher: »Zweite Tür rechts! «
Wir saßen schweigend am Tisch und hörten auf jedes seiner Geräusche. Wir hörten das Würgen und Keuchen, wir hörten das gepresste, fast leidenschaftliche Seufzen, und ich sagte: »Er kotzt so wie er redet.«
»Sei nicht gemein«, sagte Klawka.
»Iwan«, sagte Mama wütend zu Vater, »Iwan, du hast ihn hierhergebracht und du wirst ihn auch wieder hinausschaffen!«
Aber Vater antwortete nicht, er schob ihr ein Glas hin und sagte: »Trinken wir, Anna Abramowna!« Dann legte er den Kopf auf den Tisch, seine Stirn senkte sich auf die blütenblaue Tischdecke, und er schlief ein.
Als Polanski zurückkam, wirkte er wach und aufmerksam. »Wer trinkt denn jetzt mit mir?«, sagte er, nachdem er mit einem kurzen Blick Vater gemustert hatte.
»Ich«, sagte Klawka.
»Sie trinken allein, Grigorij Michalytsch«, fuhr Mama dazwischen.
Polanski setzte sich wieder zu Klawka, er machte das Glas voll und trank es in einem Zug aus. Wir schwiegen, und man hörte nur Vaters surrenden Atem.
»Verfluchtes Leben«, sagte Polanski. »Möchte wissen, wer sich das alles ausgedacht hat …«
Vater hob den Kopf und schüttelte ihn heftig. Dann schlief er weiter.
»Verfluchtes Leben, junger Mann, nicht wahr?« Polanski sah mich an.
»Ich weiß nicht«, sagte ich.
»Sind Sie glücklich?«
»Ich weiß nicht.«
»Haben Sie eine Freundin? Sie haben bestimmt eine deutsche Freundin, Sie Glückspilz«, sagte er, »so ein sauberes und schönes blondes Ding, das sich viel zu oft wäscht und überall nach Veilchen riecht.«
Ich öffnete den Mund, ich wollte ihn beleidigen, doch bevor es dazu kam, hatte er sich längst Klawka zugewandt.
»Und Sie, kleine Prinzessin«, sagte er, »haben Sie einen Freund?«
Arme dicke Klawdija! Sie hasste diese Frage. Jeder, der sie ihr stellte, bekam es von ihr immer hundert- und tausendfach zurück.
»Noch nicht«, sagte Klawdija nun aber sanft, fast freundschaftlich, und ein unangenehmer Schauer löste sich in meinem Nacken.
»Und sind Sie glücklich, Fräulein Klawdija?«
»Kann man ein Kind so was überhaupt fragen?«
»Ach, seien Sie bloß nicht nachtragend …«
»Kinder sind so!«
»Goldene Einsicht, Klawatschka«, sagte Mama.
»Sagen Sie es mir«, setzte Polanski wieder an. »Sagen Sie mir, ob eine junge Frau wie Sie schon weiß, was Glück ist –«
»– und ob sie es empfinden kann?«, fiel sie ihm ins Wort.
»Ja, genau.«
»Ist doch eine wirklich blöde Frage«, sagte Klawka, und dann aber sagte sie: »Man muss nur wollen, denke ich, und das Alter ist das Letzte, worauf es ankommt.«
»Ach, das Letzte also …« Polanski schlug sich gegen die Stirn, er biss sich auf seine Kannibalenlippen, er malmte mit seinen Kannibalenzähnen, und er sagte mit seiner Kannibalenstimme: »Ja, das ist die richtige Einstellung. Das lernt man nicht bei uns, das lernt man nur hier – bei Ihnen!«
Er verstummte, und ich dachte jetzt an seinen prallen, aus allen Nähten platzenden braunen Plastikkoffer, der im Flur neben der Eingangstür stand. Ich stellte mir vor, dass er mit Wurst und Schinken gefüllt war, mit kaltem Rinderbraten und mildem Roastbeef, mit Kilotonnen blutiger, säuerlich riechender Schweinebäuche und Innereien – und ich hoffte, Polanski würde endlich aufstehen, diesen Koffer nehmen und weggehen, ganz schnell weggehen, damit nicht am Ende sein russischer Zug ohne ihn abfuhr.
Doch der Kannibale aus Moskau füllte erneut sein Glas, dann nahm er eine Serviette und versuchte, ein Schiffchen zu falten. Aber das Papier war dünn und fadenscheinig, und schließlich zerknüllte Polanski die Serviette. Als er sie in seine Jackentasche schob, entdeckte er darin einen von den abgenagten Lammknochen. Er zog ihn überrascht heraus, und während er ihn wie eine Trophäe betrachtete, sagte er: »Gilt das Angebot mit der französischen Wurst und dem italienischen Schinken noch, Anna Abramowna? Ich könnte, glaube ich, wieder etwas vertragen. Wodka ohne etwas zum Dazubeißen, das ist doch nichts!«
»Morgen, Grigorij Michalytsch«, sagte Mama. »Gehen wir jetzt alle erst einmal schlafen.« Sie atmete tief ein. »Morgen essen wir weiter – wenn Sie wollen.« Sie lächelte, und dann sagte sie: »Geht morgen noch ein Zug nach Moskau?«
»Aber ja«, sagte Polanski traurig, »aber natürlich.«
In der Nacht, als alle schliefen, trafen sich Klawdija und Polanski im Flur. Sie trug den Teller mit der Wurst und dem Schinken, er hatte die letzte Flasche von seinem Moskauer Wodka dabei, und sie wollten sich gerade gegenseitig einen Besuch abstatten. Sie gingen in Klawkas Zimmer und legten sich aufs Bett, und dort unterhielten sie sich flüsternd, sie lachten und sahen einander im Dunkeln ins Gesicht, Polanski erzählte Klawdija von seiner Frau und seinem Sohn Fedor, sie redeten über Russen und Juden und Israel, Klawka wurde schnell betrunken, und dann fing er vom Krieg an, von jenen Jahren, in denen er als achtzehnjähriger Panzerschütze gegen die Deutschen gekämpft hatte, und am Ende sagte er noch, dass Fedor, sein Sohn, Klawka bestimmt auch mögen würde, und Klawka nickte.
Später, nachdem alles vorbei war, kam die Polizei, um Polanski abzuholen. Er hatte sich angezogen und stand nun stumm im Flur, neben der Tür zum Esszimmer. Seine dünnen Glieder schienen zu schwanken, und als sie ihn wegführten, sagte er kein Wort, er bat nicht um Verzeihung und er beschuldigte auch niemanden. Er schaute keinem von uns in die Augen, er wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß vom Gesicht und warf nur einen kurzen Blick ins erleuchtete Esszimmer. Da sah er dann die lange Tafel mit der blauen Tischdecke, es standen noch Gläser und Teller herum, unbenutztes Besteck lag dort, und an dem Platz, wo er gesessen hatte, waren lauter Flecken, Flecken von der Granatapfelsoße und der armenischen Basturma.
Klawka saß noch lange schreiend und heulend in ihrem verwüsteten Zimmer. Nachdem auch der Arzt gegangen war, ließ sie niemanden an sich heran, sie erlaubte uns nicht einmal, für sie das Bett zu richten. Irgendwann hielt Mama es nicht mehr aus, sie ging zu ihr, ich hörte die Ohrfeige, und dann wurde es still, und Vater sagte, sie würden Polanski bestimmt schnell abschieben.
Am nächsten Tag brachte ich Polanskis riesigen Koffer aufs Revier. Doch vorher machte ich ihn natürlich noch auf. Es befanden sich nur ein paar Kleidungsstücke darin, die Kongressunterlagen und eine Plastiktüte mit seinen Waschsachen. Der Rest waren Bücher, zerlesene russische Bücher, Bücher von Tschechow, Ehrenburg und Bulgakow, Bücher, die Polanski den ganzen langen Weg von Moskau nach Berlin geschleppt hatte.
Rosen, Astern und Chinin
Ich mag keine Gedichte, sie sind mir fremd, und ich verstehe auch nichts von bisexuellen russischen Poetessen à la Marina Zwetajewa. Bei meiner Mutter jedoch liegt der Fall anders, und obwohl man mit der Behauptung vorsichtig sein sollte, sie lebe ganz allein und für sich in einer kleinen, engen Welt aus Jamben, Trochäen und Daktylen, ist doch etwas dran, denn Lyrik bedeutet ihr sehr viel.
Früher, erinnere ich mich, verschwand sie manchmal für ganze Nachmittage im Schlafzimmer, um zu lesen. Wenn sie mich dann plötzlich von dort rief, wusste ich genau, dass sie mich an ihren Versabenteuern beteiligen wollte. So stand ich in der Tür, trat von einem Fuß auf den anderen und sah sie an. Die Gardinen waren zugezogen, nur die Bettlampe gab ein gedrängtes, ockergelbes Licht ab. Meine Mutter lag am äußersten Rand des Ehebettes, im Morgenrock, zugedeckt, den Rücken von dicken Kissen hochgestützt, die Beine angewinkelt. Auf ihren Knien ruhte ein Buch von Mandelstam, das sie seit Wochen studierte. Bestimmt las sie schön, und ich hatte auch nie etwas gegen ihre russischen Gedichte – aber sie interessierten mich eben nicht. Manchmal ließ ich das Ganze über mich ergehen, manchmal nicht, weshalb ich dann sofort angeödet die Schlafzimmertür von außen schloss.
Die Mandelstam-Phase ist längst vorbei. Ich lebe jetzt in München, doch meine Eltern wohnen nach wie vor in dem alten Bürgerhaus am Hamburger Rotherbaum, wo wir 1974 auf unserem Weg von Moskau über Wien, Israel und New York schließlich untergekommen waren, zufrieden über jene lebensnotwendige Portion materieller und ziviler Sicherheit, die Deutschland uns bot. Aber natürlich ist Sicherheit nicht alles, gerade wenn man sie hat, und so wurde mein Vater in seiner zweiten, westlichen Diaspora nun auch zum zweiten Mal zum Idealisten. Seit Jahren schon plant er, von meiner Mutter weder unterstützt noch gehindert, einen neuen Auszug nach Israel, der diesmal definitiv sein soll. Abmarschort: Hamburg 13, Schlüterstraße 23, Beletage. Bestimmungsziel: Jeruschalajim, jüdische Altstadt, viertes Haus rechts vom Jaffator aus gesehen, mit Blick auf Felsendom und Klagemauer. Mama hält von Israel ungefähr so viel wie ich von Poesie, und ihre gleichgültige Haltung gegenüber dem ohnehin vagen Auswanderungsvorhaben meines Vaters kommt seiner eigenen Unentschlossenheit nur entgegen. Während also die Alyah in Hamburg ein hübsches Thema-Nichtthema darstellt, überlege auch ich alle paar Monate wieder, wohin ich übersiedeln könnte. Längst sind auf meiner Liste beinahe alle westeuropäischen Hauptstädte zuzüglich New Yorks erschienen und von dort wieder verschwunden. Ich glaube, dass mein Zögern in gewisser Weise dem meines Vaters entspricht und dass also er und ich vom Kopf her noch ganz gute Juden abgeben: im Sinne unserer ständigen Sehnsucht nach einem Ortswechsel nämlich. In Wahrheit jedoch wird keiner von uns beiden jemals mehr seinen Hintern irgendwohin bewegen – eine besonders raffinierte Art von Assimilation.
Zurück zu Marina Zwetajewa. Sie ist zur Zeit Mamas große Heldin. Ich hoffe, die Verehrung bezieht sich eher auf ihre literarischen Leistungen und weniger auf die biografischen. Schließlich war Marina Zwetajewa nicht nur zeitweise lesbisch, sie hat sich 1941 im tatarischen Jelabuga auch noch erhängt. Bis Jelabuga wird meine Mutter bestimmt nie kommen. Doch natürlich hat sie Ansätze zu einer Melancholie, die zum Teil ihrem Charakter entspringt, zum Teil aber an der üblichen Russen-Wehmut geschult wurde, von der sie vierzig Jahre ihres Lebens umgeben war. Sie, die Jüdin, hat ins Ausland viel von dieser russischen Verkitschtheit mitgenommen, die sie allerdings meist gut unter Verschluss hält. Manchmal aber auch nicht. Dass dann keine blödsinnigen Jelabuga-Stimmungen über sie kommen und sie im Gegenteil diese Schwermutoffensiven halb befremdet, halb amüsiert wie aus der Ferne betrachtet, beweist, dass sie wirklich okay ist.
Vor einigen Wochen nun stieß sie auf ein Zwetajewa-Poem, das ihr sehr zu schaffen machte. Gleich beim ersten Durchlesen entpuppte sich Für Ala (von Zwetajewa für ihre Tochter geschrieben) als lyrisches Psychopharmakon: Über der zweiten Strophe heulte sich Mama derart die Augen aus, dass man sich hinterher fragte, ob es sich um einen echten Gefühlsausbruch gehandelt hatte oder um eine chemische Reaktion. Am Abend kam mein Vater vom Büro nach Hause, und nachdem er sich umgezogen hatte, setzte er sich sofort an seinen Schreibtisch, wo er, wie jeden Tag, bis zum Beginn des Heute-Journals weiterarbeiten wollte. Er spannte gerade das erste Blatt in seine kyrillische Übersetzermaschine ein, als Mama das Arbeitszimmer betrat und mitten im Raum anfing zu weinen. Das heißt, zunächst rezitierte sie nach einer kleinen Ankündigung ein Stück des Ala-Gedichts, und an ihrem Schlüssel-Vers heulte sie dann los. Ich weiß nicht, ob mein Vater sich über ihren Ausbruch wunderte oder was er sonst darüber dachte. Er nahm ihr, ohne ein Wort zu sagen, das Buch aus der Hand und las still für sich zu Ende. Und plötzlich sah sie, wie sein Gesicht zuckte, wie er seine Brille abnahm und auf den Tisch legte und wie er sich dann mit den Handballen die Augen zu reiben begann. Darüber war sie so erstaunt – erstens, weil er doch sonst nie weinte, und zweitens, weil es ihn offensichtlich an einer anderen Stelle erwischt hatte –, dass sie ihre Tränen vergaß, um wenig später von einem kleinen, befreienden Lachen durchgeschüttelt zu werden. Und dann lachte er auf einmal auch, und sie verstand, dass er sie hereingelegt hatte, und alles war wieder in Ordnung. Glücklicherweise nahm die Sache einen harmonischen Ausgang, was deshalb so bemerkenswert ist, weil meine Eltern nicht gerade das sind, was man ohne Einschränkung ein gutes Paar nennen möchte. Da, wo sie sich intellektuell ausgezeichnet verstehen, versagen oft ihre emotionalen Standleitungen. Außerdem sind Mamas Wechseljahre für keinen lustig, nicht für sie und nicht für meinen Vater, und es gibt Situationen, in denen Nichtigeres als ein paar merkwürdige Verszeilen genügt, um sie aus der Fassung zu bringen. So könnte man die Zwetajewa-Episode bereits an diesem Punkt zu den Akten legen, hätte mich meine Mutter nicht am folgenden Tag spätabends in München angerufen, um sie mir ausführlich zu schildern. Denn dabei fiel mir eine Geschichte ein, die vor ungefähr zwei Jahren, auch in Hamburg, passiert war.
Mama erzählte gerade von den ersten überraschenden Tränen, sie beschrieb die zweiten Tränen in der Gegenwart meines Vaters, sie vergaß auch nicht die dritten und vierten Tränen zu erwähnen, die in der Nacht und am nächsten Morgen kamen, immer dann, wenn sie diese verfluchte Strophe wiedersah, sie fragte mich kurz nach meiner Arbeit aus, um sogleich zu erklären, sie hätte nichts dagegen, es noch einmal zu probieren, sie wäre bereit, diese zwei Zeilen auch für mich zu rezitieren, was ich ihr aber verbot, weil ich keine Lust hatte, sie weinen zu hören, und weil ich es ohnehin nicht leiden kann, wenn man mir vorliest, und während wir also derart leidenschaftlich hin und her telefonierten, schürfte ich außerdem noch in meiner Erinnerung …
Damals hatte ich in Hamburg für ein paar Monate Ferien gemacht. Ich kam direkt von der Journalistenschule und hatte bis dahin nirgends etwas veröffentlicht – außer einer Buchbesprechung in einer kleinen Zeitschrift, die von Leuten meines Alters herausgegeben wurde und ihren Autoren viel Freiheit gab. So beschloss ich, vor allem aus persönlichem Interesse, für die Zeitschrift ein Interview mit Joseph Heller zu machen, der sich zu dieser Zeit auf einer PR-Reise durch Deutschland befand, um sein neues Buch vorzustellen – den autobiografischen Bericht über die zwölf Monate, in denen er es schaffte, sich der muskellähmenden Allmacht des Guillain-Barré-Syndroms zu entwinden. Ich rief bei Hellers deutschem Verlag an und bekam sofort einen Termin. Das Gespräch verlief sehr erfreulich, bis zu dem Zeitpunkt, an dem mich die Dame von der Presseabteilung in gespielt-scherzhaftem Ton fragte, ob ich schon wüsste, in welchem Lokal ich mit Herrn Heller, dessen Appetit nach der Krankheit viel besser geworden sei, essen wollte. Ich kannte mich inzwischen mit einer Menge guter Sachen aus, aber teure Restaurants gehörten noch nicht dazu, und bevor ich in diesem Sinne antworten konnte, fügte sie bei, ich müsse Herrn Heller und seine Begleiterin einladen – das sei so üblich. Eine Begleiterin hatte er auch?! Ich weiß genau, wie in diesem Moment etwas für mich zerfiel, wie vor meinem inneren Auge aus dem großzügigen, klugen und mannhaften Autor von Catch 22 und Gut wie Gold, mit dem ich entre nous über Literatur, Sex und Judentum philosophieren wollte, auf einmal ein ekelhafter, geiziger Mauschelzwerg geworden war, ein Unsympath mit einem weibischen Zug um die Augen. Und ich weiß auch, wie ich mich am Telefon zu winden begann und meiner Verhandlungspartnerin zu erklären versuchte, dass weder ich noch die Zeitschrift über jene finanziellen Mittel verfügten, die es uns erlauben würden, einen weltberühmten Schriftsteller standesgemäß auszuführen, und wie ich schließlich in der Not auf die rettende und kostensparende Idee kam, Herrn Heller und seine Begleiterin zu uns nach Hause einzuladen … Mama sollte Speisen kochen, die ihn an seine Kindheit, seine Jugend, ach was, die ihn an seine eigene Mutter erinnern würden …
Und somit wäre bereits der erste Kilometerstein auf dem Erkundungsmarsch durch die Innenwelt meiner Mutter erreicht, den ich ganz beiläufig unternahm, während sie mit mir zwei Jahre später am Telefon über Marina Zwetajewa und einiges mehr sprach. Was ging in Mama damals eigentlich vor, als ich ihr mitteilte, dass am nächsten Freitag ein moderner Dichterfürst, ein amerikanischer Jude mit deutsch-russischen Vorfahren, bei uns zu Abend essen würde? Um ehrlich zu sein, kann ich das mit wirklicher Bestimmtheit gar nicht sagen, ich weiß nur, wie sehr sie es hasst, wenn mein Vater am späten Nachmittag anruft, ihr Gäste zum Abendbrot ankündigt und sie bittet, doch am besten Hering, Schtschi und Pelmeni vorzubereiten, halt irgendwas, das ihr am wenigsten Mühe mache – worauf sie oft genug, noch während er spricht, wortlos aufhängt. Ich aber war jetzt zum ersten Mal mit einer solchen Bitte an sie herangetreten, was den Vorteil hatte, dass sie sie mir unmöglich abschlagen konnte.
Der große Freitag raste heran, und während ich mir in meiner freien Zeit noch einmal Joseph Hellers Romane vornahm, hielt ich Abend für Abend mit Mama Konferenzen ab, bei denen wir besprachen, was sie für den Schriftsteller kochen würde. Es sollte auf jeden Fall etwas Osteuropäisch-Jüdisches sein, und im Grunde ging es bei unseren Unterredungen nur noch um Details. Wäre ein kalter polnischer Trinkborschtsch angebrachter als der warme und dicke russische? Das Huhn gekocht oder gebraten? Zum Nachtisch Leikach oder Apfelkompott oder vielleicht beides? Immer wieder tauchte bei meiner Mutter die Überlegung auf, wie es denn jetzt um Hellers Gesundheit bestellt sei. Es wäre doch möglich, sagte sie, dass seine Hände noch zittrig seien, weshalb es ihm bestimmt weniger Mühe machte, den Borschtsch zu trinken statt zu löffeln – sie wolle einen Mann wie ihn nicht in die peinliche Situation bringen, den Tisch fremder Gastgeber wie ein Tattergreis vollzukleckern. Und so gesehen sei es bestimmt auch besser, das Huhn gekocht zu servieren, das wäre auf jeden Fall bekömmlicher, gerade für einen Kranken … Irgendwann war sie dann so weit, dass sie ihm den Nachtisch verbieten wollte, denn der liege schwer auf dem Magen, und außerdem sei Süßes schlecht für die Zähne. »Ein Tee wird reichen«, erklärte sie. Zum Schluss war ich fast ein wenig überrascht, wie schnell sich meine Mutter mit dem anstrengenden Prominentenbesuch abgefunden hatte, denn ihr Interesse ging sogar so weit, dass sie sich während unserer Besprechungen immer wieder Gedanken über Hellers Freundin machte.
»Ist sie Jüdin?«, fragte sie, Böses ahnend.
»Nein«, erwiderte ich.
»Eine Nichtjüdin?«
»Ja.«
»Groß?«
»Weiß ich nicht.«
»Aber du wirst doch wissen, welche Haarfarbe sie hat?«
»Keine Ahnung.«
»Und wie versteht sie sich mit seinen Eltern?«, sagte sie, und ich wusste nicht, ob sie sich über mich lustig machte oder ob die Frage ernst gemeint war. Ihre Neugier konnte ich kaum befriedigen, aber zumindest erzählte ich ihr, was ich inzwischen Hellers neuem Buch entnommen hatte: Danach war seine Geliebte eine ehemalige Krankenschwester, die der Schriftsteller auf der Intensivstation kennengelernt hatte. Das fand Mama aufregend, sie entdeckte darin Menschlichkeit, gleichzeitig äußerte sie sich kritisch über die gojische Herkunft des Mädchens (wie viel schöner und treffender wäre an dieser Stelle das englische Wort gentile, das auch des Öfteren bei Heller vorkommt), und sie bat mich, wenn ich selbst damit fertig sei, ihr Hellers Bücher zu leihen.
Aber dann war es plötzlich von einem Tag auf den andern vorbei mit Mamas Euphorie. Bestimmt hing es damit zusammen, dass mein Vater, der in der ganzen Einladungssache noch gar keine Rolle zugewiesen bekommen hatte, am Mittwoch geschäftlich nach Budapest fliegen musste. Doch nicht genug, dass sie von ihm für den Freitagabend allein gelassen worden war – was für eine Hilfe konnte ich schon sein? –, hinzu kam die Angelegenheit mit Oleg Borka, einem alten Freund meines Vaters aus Moskau, der inzwischen in Zürich wohnte. Borka hatte überraschend seinen Besuch angemeldet, er wollte in Hamburg ein verlängertes Wochenende verbringen, und es machte ihm gar nichts aus, dass mein Vater erst am Samstag zurückkommen würde. Meine Mutter litt aber umso mehr unter diesem Zeitplan. Dazu muss man wissen, dass Borka – ein kleiner Mann mit Glatze, schwarzen Augen und strichdünnem Schnurrbart – ein altes Junggesellenross war, vielleicht nicht mehr allzu viril, aber dafür noch sehr angriffslustig. Bestimmt wusste mein Vater von seinen Neigungen, aber nie hätte er angenommen, dass Borka auch schon mal, ganz unkameradschaftlich, versucht hat, meiner Mutter den Hof zu machen. Ich dagegen habe, während einer früheren Borka-Visite, eine für mich sehr seltsame Szene zwischen ihm und Mama miterlebt, oder besser gesagt, es waren ihre Stimmen, von ganz leise bis laut und erbost, die ich vom anderen Ende des langen Flurs unserer Hamburger Wohnung vernahm, und da ich dann auch noch Borkas darauffolgenden stillen Abgang von der Küche ins Wohnzimmer beobachtet hatte, war es für mich später kein Problem, Mamas schlechte Laune, die bis zum Ende seines Aufenthaltes anhielt, eindeutig zu entschlüsseln.
Kein Wunder also, dass Mama nun ihren Herzschmerzblick bekam, und wenn man zu den äußeren Faktoren auch noch die inneren, ihr Klimakterium und die bekannten Schwermutanlagen hinzuaddierte, kam man auf eine hübsche Melancholiesumme: Kilometer zwei.
Die Heller-Bücher lagen unberührt neben ihrem Bett, Mandelstam hatte wieder Konjunktur, sie verbrachte Stunde um Stunde im verdunkelten Schlafzimmer, und es ging ihr offensichtlich so schlecht, dass sie mich nicht einmal mehr rief, um mich an ihren Jamben und Daktylen teilhaben zu lassen. Wie sehr wünschte ich mir, sie würde mir vorlesen wollen. Und natürlich machte ich mir Sorgen um sie, aber ich dachte auch an ihr Versprechen, meine Gäste zu bewirten, und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob sie es noch einhalten konnte oder wollte. An diesem Punkt der Erinnerung aber verschlägt es mich wieder, für einen Augenblick, in die Gegenwart. Es war sehr spät geworden, ich lehnte in meinem Zimmer in München an der Fensterbank, spürte die von der Heizung aufsteigende Wärme an meinen Armen und gleichzeitig den schmalen Windzug, der irgendwo durch das Holz drang. Ich blickte durch die Nacht auf die andere Straßenseite, wo das niedrige Mietshaus stand, in dem diese Teenager-Göre mit ihren Eltern wohnte, die regelmäßig abends – offensichtlich nach dem Duschen – nackt ans Fenster trat und jedes Mal, wenn sie bemerkte, dass ich sie beobachtete, die Arme vor den kleinen Brüsten verschränkte und aus dem Zimmer rannte, um mir auf diese Weise, wie scheinbar verabredet, einen letzten kurzen Anblick ihres jungen und großen Hinterns zu bieten. Hier stand ich also, wartete auf ihren Auftritt, und da war wieder Mamas Stimme in meinem linken Ohr, klangvoll, alt, da war von Neuem dieser eine merkwürdige Haken in unserer Telefonkonversation, den sie urplötzlich schlug, und kurz darauf begriff ich, wohin sie steuerte: Listig unternahm sie einen neuen Versuch, mir hier und jetzt Für Ala aufzuzwingen. Ich sprang sofort zurück in die Vergangenheit, ich musste mich ganz genau erinnern, wie die Sache mit Heller, Borka, Mama und dem Hund ausgegangen war – Zwetajewas Gedicht konnte noch warten.
Borka reiste am Donnerstag an. Er war nicht, wie sonst, geflogen, er hatte den Wagen genommen, seinen gelben Mercedes-Kombi. Der Grund dafür war Borkas Hund, ein milchweißer japanischer Akita, fast so groß wie Borka selbst, mit wuchtigen Pfoten, langen, kräftigen Beinen, einem runden Rumpf und einer runden Schnauze, die wie ein behaartes Straußenei aussah. Dieser Hund, den Borka in einer Hommage an Stalin Jossif getauft hatte, fand bei Borkas Züricher Freunden keinen Zuspruch mehr, niemand war bereit gewesen, ihn für einige Tage bei sich aufzunehmen. Und weil Borka, der zu Tieren ein ähnlich passioniertes Verhältnis hatte wie zu Frauen, Jossif den Aufenthalt in einem Tierheim ersparen wollte, nahm er ihn mit. Als ich Jossif aus der Hecktür von Borkas Mercedes herausspringen sah, dachte ich, dass dieser Eisbär meiner Mutter den Rest geben würde. Aber zu meiner Überraschung blieb Mama, die sich inzwischen wieder etwas gefangen hatte, beim Anblick des riesenhaften Hundes gelassen. Borka küsste sie zur Begrüßung auf die Wangen, was sie mit einer Art Umarmung erwiderte; dann erklärte er uns, wieso er Jossif mitgebracht hatte, und da er sich dafür furchtbar entschuldigte, konnte sie gar nicht anders, als dem Hund schnell über die Ei-Schnauze zu fahren und Borka zu beruhigen. »Ich mag Hunde gern«, sagte sie. Als er darauf erwiderte, sie müsse sich vor Jossif nicht fürchten, erklärte sie kämpferisch, dass sie vor Hunden wenig Angst habe. Sofort ging ein Ruck durch den winzigen Körper des alten russischen Casanovas, im Nu waren die ihm sonst eigenen lockeren, fließenden Bewegungen wie weggezaubert, seine Hände strebten nicht mehr von ihm weg, hin zu fremden Körpern und Gegenständen, er war mit einem Mal ganz steif und ruhig, und man hatte den Eindruck, dieser Mann war für den Rest seiner Tage kein Tatscher und kein Grapscher mehr …
Kaum bemerkte Mama selbst, dass sie Borka auf Distanz bekommen hatte, wurde sie freundlicher und offener. Was dazu führte, dass der folgende Abend, den wir zu dritt zu Hause verbrachten, zu einer regelrechten Idylle geriet. Die beiden verstanden sich gut, sie redeten viel über die Moskauer Vergangenheit, über Freunde und Feinde, meine Mutter zeigte uns alte Fotos, später gab es etwas zu essen, und dann spielten wir bis drei Uhr früh Canasta. Jossif lag träge herum, störte nicht, bellte nicht, machte nicht auf den Teppich, und als Borka zum Schluss, nachdem die Kartenpartie beendet war, sagte, er müsse mit dem Hund noch einmal raus, und meine Mutter aufforderte, ihn zu begleiten, schien es ganz natürlich, dass sie nach kurzem Zögern seinen Vorschlag annahm.
Hier nun nähere ich mich einer kritischen Phase meines Mutter-Marsches, weil ich im Folgenden nur einen weißen Fleck umranden kann, nicht mehr. In jener Nacht nämlich war ich, kaum hatten Mama, Borka und der Hund das Haus verlassen, schlafen gegangen. Ich weiß also nicht, ob, und wenn, was in der Nacht noch geschah, weshalb mein Verdacht nur ein sehr vager Verdacht bleiben kann, denn ich habe meine Mutter nie danach gefragt. Natürlich. Und schließlich, denke ich, hatte sie doch Borka gleich zu Beginn so wirkungsvoll ausgeschaltet …
Als ich am nächsten Morgen in die Küche kam, fand ich auf dem Esstisch eine Nachricht von meiner Mutter: Sie wollte zur Massage, zum Friseur und im Anschluss daran einkaufen, weshalb sie erst am späten Nachmittag zurückkommen würde. Borka, der bereits beim Frühstück saß, hatte mir den Zettel zugeschoben, und nachdem ich ihn durchgelesen hatte, sagte er, er wolle später einen Hamburg-Rundgang unternehmen, weil er die Stadt trotz einiger Besuche noch gar nicht richtig kenne. Ich könnte ihn, wenn ich Lust hätte, dabei begleiten, und später würden wir zusammen Getränke, Nüsse und Trockenfrüchte für den Abend holen. Das mit dem Stadtbummel leuchtete mir noch irgendwie ein. Dass er jedoch, so penetrant eigenverantwortlich, einkaufen wollte, fand ich merkwürdig, zumal ich diese Art von Partyzeug sonst immer mit meinem Vater zu besorgen pflegte. Ich empfand Borkas Vorschlag als ungebührliche Einmischung, und obwohl mir selbst diese Überlegung ziemlich verklemmt und deutsch vorkam, konnte ich mich gegen sie nicht wehren. Im selben Moment fiel mir ein, dass an dem Joseph-Heller-Showdown, wenn man so wollte, statt meines Vaters doch ohnehin Borka teilnahm, und so gesehen wäre es angesichts seiner plötzlichen hausmännischen Fürsorge nur konsequent, wenn ich ihn als solchen auch dem Schriftsteller vorstellen würde …
Vorher aber zeigte ich Borka noch den Stephansplatz, den Rathausmarkt, die vielen Innenstadtpassagen mit ihren italienischen Feinkostgeschäften und Boutiquen und schönen Zeitschriftenläden. Ich führte ihn zum Hafen, wir marschierten vom Baumwall bis zu den Landungsbrücken am Wasser entlang, wir steckten Münzen in die Fernrohre, mit denen man die Tanker und Dockkräne und Barkassen beobachten kann. Wir gingen in Winterhude spazieren, und wir fuhren mit der Fähre kreuz und quer über die Alster, um dann, nach einem kurzen Abstecher nach Pöseldorf, den Heimweg anzutreten. Borka hatte Jossif zu Hause gelassen, weil er uns auf dem Ausflug nur behindert hätte. Das war mir egal, ich hätte es am liebsten gesehen, wenn auch Borka nicht mitgekommen wäre. Ein absurder Gedanke, war ich doch nur Borkas wegen zum Reiseführer geworden. Diesen und anderen Blödsinn ließ ich mir zu Beginn unserer Exkursion durch den Kopf gehen, und ich entwickelte auch einige vernünftigere Gedanken, die zum Teil in negativer Emanation Borka betrafen, ansonsten aber vorwiegend um das herannahende Treffen mit Joseph Heller kreisten, weil ich nun allmählich nervös zu werden begann. Doch schon bald gelang es Borka, mich von alldem abzulenken. »Ich habe Stalin persönlich kennengelernt«, sagte er ganz unvermittelt, nachdem wir ein Geschäft mit alten Uhren in der ABC-Straße verlassen hatten. Mir blieb nur, ihn erstaunt anzusehen, worauf er begeistert fortfuhr: »Es war kurz vor seinem Tod, 1952 glaube ich. Du weißt ja, wie Jossif Wissarionowitsch war: Eines Tages rief bei mir jemand an und fragte mich, wie es mit der Arbeit im Institut voranginge. Als ich wissen wollte, wer dran sei, sagte er, sein Name sei Stalin. Das machte er gern, Leute anrufen und erschrecken. Wir plauderten eine Weile, und zum Schluss lud er mich zu sich zum Essen ein. Zwanzig Minuten später war ein Wagen da und holte mich ab.« Borka machte eine Pause. »Schau nicht so«, sagte er schließlich, »das ist die reine Wahrheit … Während des Essens hielt sich in Stalins Nähe ein alter Schäferhund auf, dem er ab und zu ein Stückchen Fleisch hinwarf. Als der Hund ihn einmal in einem solchen Moment ansah, sagte Stalin zu mir: ›Hat der Hund nicht einen richtig menschlichen Blick?‹ Stell dir das vor! Wie konnte ein Mann wie Stalin mit all seiner Macht so etwas Dummes sagen? Ein Hund hat keinen menschlichen Blick! Ein Hund schaut wie ein Hund!«
Jetzt wusste ich also, wie Jossif zu seinem Namen gekommen war, und egal ob Borkas Geschichte stimmte oder nicht – dass und wie er sie erzählte, bedeutete mir etwas. Und so dachte ich plötzlich wieder an die Empfindsamkeiten meiner Mutter, an ihre Bücher und ihre Kindheits- und Kriegs- und Stalinismus-Anekdoten, ich dachte an meinen Vater, einen ausgewiesenen Pragmatiker, der – obwohl in der Sowjetunion von der Universität relegiert und später beruflich unter Druck gesetzt – auch im Westen nicht, anders als viele andere, zum langweiligen Kalten Krieger geworden war. Er konnte emphatisch denken und leidenschaftslos analysieren, allein das hatte er nicht nur seinen Anlagen zu verdanken, es hing ebenso mit der strengen kommunistischen Erziehung zusammen, und das erkannte er an. Auch er sprach oft von früher, erzählte Witze und mehr oder weniger reale Begebenheiten aus dem immerpolitischen russischen Alltag. Doch gleichzeitig war er trotz seiner Nüchternheit und Erinnerungskraft ein Mensch, der zuweilen in Gefühlen strandete und dann nach vorne sah, Richtung Israel. Aber das hatten wir ja bereits.