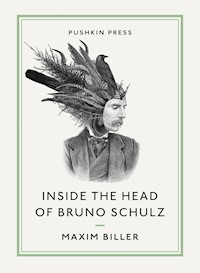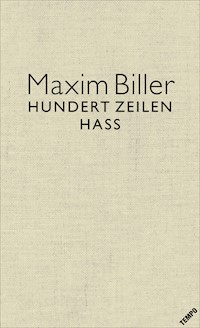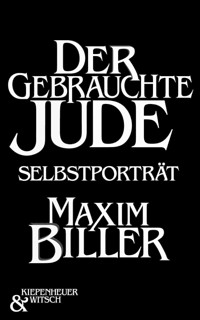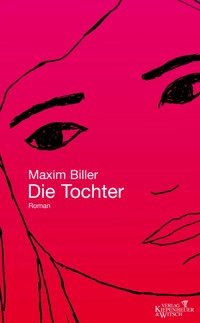9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Familiengeschichte – und ein virtuoser literarischer Kriminalroman von großer politischer Aktualität. In jeder Familie gibt es Geheimnisse und Gerüchte, die von Generation zu Generation weiterleben. Manchmal geht es dabei um Leben und Tod. In seinem neuen Roman erzählt Maxim Biller von einem solchen Gerücht, dessen böse Kraft bis in die Gegenwart reicht. »Sechs Koffer« – die Geschichte einer russisch-jüdischen Familie auf der Flucht von Ost nach West, von Moskau über Prag nach Hamburg und Zürich – ist ein virtuoses literarisches Kunststück. Aus sechs Perspektiven erzählt der Roman von einem großen Verrat, einer Denunziation. Das Opfer: der Großvater des inzwischen in Berlin lebenden Erzählers, der 1960 in der Sowjetunion hingerichtet wurde. Unter Verdacht: die eigene Verwandtschaft. Was hier auf wenig Raum gelingt, sucht seinesgleichen in der deutschen Gegenwartsliteratur: eine Erzählung über sowjetische Geheimdienstakten, über das tschechische Kino der Nachkriegszeit, vergiftete Liebesbeziehungen und die Machenschaften sexsüchtiger Kultur-Apparatschiks. Zugleich ist es aber auch eine Geschichte über das Leben hier und heute, über unsere moderne, zerrissene Welt, in der fast niemand mehr dort zu Hause ist, wo er geboren wurde und aufwuchs. »Sechs Koffer« ist ein Roman von herausragendem stilistischen Können, elegantem Witz und einer bemerkenswerten Liebe zu seinen Figuren: Literatur in Höchstform – und spannend wie ein Kriminalroman. »Wie hütet man ein Familiengeheimnis? Indem man es allen erzählt. Maxim Biller ist mit diesem Buch ein wahres Kunststück gelungen.« Durs Grünbein »Dieser Roman ist ein kunstvoll geschliffener Edelstein. Immer wieder blitzt eine andere Facette auf, bricht ein anderer Schein hervor, eine neue geschliffene Seite. Eine Epoche ist darin eingeschlossen, die Härte einer Zeit, so rätselhaft klar. Großartig, nein, nicht artig, groß: Maxim Biller.« Robert Menasse
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Maxim Biller
Sechs Koffer
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Biller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Biller
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Wenn ich einmal reich und tot bin«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Sein Roman » Esra«, den die FA S als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch« lobte, wurde gerichtlich verboten und ist deshalb zurzeit nicht lieferbar. Sein Short-Story-Band »Liebe heute« wurde unter dem Titel »Love Today« in den USA veröffentlicht, seine Bücher wurden insgesamt in sechzehn Sprachen übersetzt. Zuletzt erschienen sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013) sowie der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus Magnum« nannte und über den es im Deutschlandfunk hieß: »Unglaublich glänzend erzählt, mit knallharten Dialogen und aberwitzigen Pointen ... Eine neobarocke Wunderkammer.«
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In jeder Familie gibt es Geheimnisse und Gerüchte, die von Generation zu Generation weiterleben. Manchmal geht es dabei um Leben und Tod. In seinem neuen Roman erzählt Maxim Biller von einem solchen Gerücht, dessen böse Kraft bis in die Gegenwart reicht.
»Sechs Koffer« – die Geschichte einer russisch-jüdischen Familie auf der Flucht von Ost nach West, von Moskau über Prag nach Hamburg und Zürich – ist ein virtuoses Kunststück. Aus sechs Perspektiven erzählt der Roman von einem großen Verrat, einer Denunziation. Das Opfer: der Großvater des inzwischen in Berlin lebenden Erzählers, der 1960 in der Sowjetunion hingerichtet wurde. Unter Verdacht: die eigene Verwandtschaft.
Was hier auf wenig Raum gelingt, sucht seinesgleichen in der deutschen Gegenwartsliteratur: eine Erzählung über sowjetische Geheimdienstakten, über das tschechische Kino der Nachkriegszeit, vergiftete Liebesbeziehungen und die Machenschaften antisemitischer Kultur-Apparatschiks. Und zugleich ist es eine Geschichte über das Leben hier und heute, über unsere moderne, zerrissene Welt, in der fast niemand mehr dort zu Hause ist, wo er geboren wurde und aufwuchs.
»Maxim Biller schreibt mit einer selbstverständlichen, unaufdringlichen Eleganz, mit der sich kein anderer der deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation messen kann.« – Spiegel Online
Inhaltsverzeichnis
Vom selben Autor
Motto
1. Vor der Flucht
2. Prager Depressionen
3. Kronenhalle
4. Der späte Tod von Hanka Zweigová
5. Aktion Bruder
6. Eine reine Familiensache
Wenn ich einmal reich und tot bin
Die Tempojahre
Land der Väter und Verräter
Harlem Holocaust
Die Tochter
Kühltransport
Deutschbuch
Esra
Bernsteintage
Moralische Geschichten
Menschen in falschen Zusammenhängen
Liebe heute
Der gebrauchte Jude
Kanalratten
Im Kopf von Bruno Schulz
Biografie
Hundert Zeilen Hass
»Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen.«
Bertolt Brecht
1.Vor der Flucht
An einem heißen, viel zu heißen Tag im Mai 1965 stand mein Vater noch früher auf als sonst. Er hatte bis nachts um vier gearbeitet – Schwejk, jetzt schon der letzte Teil, der ihm nicht mehr so gut gefiel wie die ersten drei –, dann hatte er zwei Acylpyrin genommen und sich mit schrecklichen Kopfschmerzen auf die schöne neue West-Couch im Arbeitszimmer gelegt, um uns drei im anderen Zimmer nicht zu wecken. Als er zwei Stunden später aufwachte, dachte er, er hätte nur für ein paar Sekunden die Augen zugemacht. Das Licht draußen war anders als sonst, gelb, fast orange. Es hatte für ein paar Minuten kurz und heftig geregnet, aber der Himmel wurde trotzdem nicht dunkel, und hinterher leuchtete die sonderbare Morgensonne fast rot ins Zimmer hinein und überzog den Schreibtisch und die Schreibmaschine, die Manuskriptblätter und die beiden aufgeschlagenen Bände seines tschechisch-russischen Wörterbuchs mit einem zarten, blutigen Schimmer.
Während mein Vater überlegte, ob er noch schnell den Rest des Kapitels zu Ende übersetzen sollte, bevor meine Mutter, meine Schwester und ich aufstehen würden, fuhr er mit den Fingerspitzen zufrieden über den rauen und leicht kratzenden dänischen Stoff, mit dem die teure, neue Couch bezogen war. Er und meine Mutter liebten diese Couch. Sie hatten sie bei Tuzex in der Ondříčkova von dem Vorschuss bezahlt, den er vom Verlag für die Schwejk-Übersetzung bekommen hatte, und mit dem Rest des Geldes hatte er für Onkel Dima in der Kleiderabteilung zwei Anzüge, Hemden, einen Trenchcoat, ein paar hellbraune Budapester-Schuhe und einen kleinen, schwarz-weiß karierten Fedora-Hut gekauft. Meine Mutter war dagegen gewesen, aber sie hatte wie so oft auf ihre vornehme, arrogante Art geschwiegen. Darum hatte mein Vater schließlich leise zu ihr gesagt: »Fünf Jahre Pankrác, Rada, verstehst du, was das heißt? Er wird sich über die neuen Sachen freuen …« Und dann hatte er plötzlich gebrüllt: »Ja, Scheiße, natürlich soll er sich über sie freuen! Die Mode ändert sich, überall, sogar in unserem beschissenen kommunistischen Land!« Aber sie hatte immer noch nichts gesagt, und er wusste genau, was sie dachte – dass Onkel Dima selbst daran schuld war, wenn er ins Gefängnis musste, und dass fünf Jahre nicht genug waren für das, was er vielleicht wirklich getan hatte.
Erst als mein Vater – von seinem kurzen Schlaf noch völlig benommen – sich wieder an den Schreibtisch setzte, merkte er, dass die Kopfschmerzen nicht weg waren. Er tippte einen Satz, dann noch einen, dann zog er das Blatt aus der Schreibmaschine, warf es in den Papierkorb und spannte langsam ein neues ein. Er kriegte fast immer Kopfschmerzen, wenn er zu viel arbeitete, aber diesmal hatten sie bestimmt auch mit dem armenischen Cognac zu tun, den er gestern Abend mit Natalia Gelernter im Café Slavia getrunken hatte. Er trank eigentlich nie, doch sie hatte ihn überredet, und jedes Mal, wenn sie anstießen, hatte Natalia nicht »Zum Wohl!« oder »Le chajim!« ausgerufen, sondern: »Auf den dummen, lieben Dima, dem wir beide alles verzeihen!« Dabei füllten sich ihre großen schwarzen Augen mit einem kalten, grauen Gift – so kamen meinem Vater jedenfalls ihre schnellen Tränen vor, aber vielleicht täuschte er sich auch.
Als er dann um Mitternacht nach Hause gekommen war, hatten wir alle zum Glück schon geschlafen, und er konnte gleich wieder im Arbeitszimmer verschwinden. Meine Schwester und ich lagen in unserem Bett Kopf an Fuß, Fuß an Kopf wie Dame und Bube auf einer Spielkarte, und wir atmeten noch leiser als meine Mutter, die schräg auf der für die Nacht ausgeklappten Wohnzimmercouch mit offenen Augen lag, aber auch fest schlief.
Die roten Morgenstrahlen krochen jetzt immer schneller über den Schreibtisch und das kaputte, unebene Vorkriegsparkett, und nachdem mein Vater ihnen eine Weile hinterhergeschaut hatte, versuchte er wieder ein paar Sätze zu schreiben, aber er kam wieder nicht weiter. Wie sagte man auf Russisch »fauliger Geruch« – aber so, dass es komisch klang? Der »faulige Geruch«, über den sich Schwejk lustig machte, stammte von einem Massengrab, in dem ein paar Dutzend gefallene österreichische Soldaten lagen, und weil die anderen Soldaten, die überlebt hatten, keine Kraft hatten, das große Erdloch anständig mit Erde zuzuschütten, guckten sogar ein paar Arme und Beine heraus. Wie konnte man über so etwas lachen? Oder sollte man es gerade tun? So grausam konnten nur diese verdammten Tschechen sein. Sollte vielleicht Dima über seine fünf Jahre in Pankrác lachen? Sollten sie beide über den Tod ihres armen Vaters lachen, ihres geliebten, strengen und meistens viel zu großzügigen Taten?
»Papa, bringst du mich heute in die Schule? Oder Jelena? Ich will nicht, dass sie mich bringt. Ich muss immer ihre Hand nehmen. Als wäre ich noch ganz klein.«
Er drehte sich um, und hinter ihm, in der nur einen Spalt weit geöffneten Tür, stand ich in meinem neuen, noch viel zu großen, blau gestreiften Pyjama, den mir Onkel Wladimir aus Brasilien geschickt hatte. Ich sah für meine sechs Jahre oft viel zu erwachsen aus, so wie jetzt auch. Ich hatte dieses ernste, dunkle, fast orientalische Gesicht, das sie alle in der Familie hatten – sein Vater, den sie immer auf Jiddisch Tate genannt hatten, aber auch er selbst und seine drei Brüder Dima, Wladimir und Lev. Die Kinder im Riegerpark und auf der Straße sagten oft zu mir, ich sei ein Zigeunerkind, und das erzählte ich immer sehr ernst zu Hause weiter, und angeblich machte es mir nichts aus, aber keiner glaubte mir.
»Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, dich in die Vlkova zu fahren«, sagte mein Vater. »Ich muss noch ein ganzes Kapitel zu Ende übersetzen, und dann muss ich zum Verlag und alles abgeben. Und später muss ich noch Onkel Dima abholen.«
»Jelena sagt, Onkel Dima hat den Taten umgebracht«, sagte ich. »Stimmt das?«
Er schwieg. Dann sagte er: »Natürlich nicht. Hat sie das wirklich gesagt?«
»Nein«, sagte ich. »Das habe ich erfunden.«
»Warum hast du das erfunden?«
»Weil ich das glaube.«
»Und wieso glaubst du das?«
»Weil Onkel Dima im Gefängnis sitzt. Und weil ich sonst kein Kind kenne, dessen Onkel im Gefängnis sitzt. Und weil man doch immer nur ins Gefängnis kommt, wenn man jemanden tot gemacht hat. Oder nicht?«
Mein Vater schwieg und dachte darüber nach, was ich gerade gesagt hatte. Was, fragte er sich, soll aus diesem Kind werden, wenn es erwachsen ist? Warum stellt sich der Junge die Welt immer so dunkel und hässlich vor?
»Holst du Onkel Dima im Gefängnis ab?«, sagte ich. »Was macht ihr zusammen? Müsst ihr arbeiten? Oder geht ihr in der Stromovka spazieren? Papa …«
»Ja?«
»Können wir ihn dann auch sehen – oder muss er wieder ins Gefängnis zurück?«
»Weißt du was, du kleiner Chochem? Wenn du mich jetzt noch ein bisschen arbeiten lässt, schaffe ich es vielleicht, dich in die Schule zu fahren. In Ordnung?«
»Hast du schon mal jemanden umgebracht, Papa? Onkel Lev und Onkel Wladimir haben bestimmt jemanden umgebracht, sie waren doch in der Roten Armee.«
»So, genug, es reicht«, sagte mein Vater. »Geh sofort wieder ins Bett zurück. Ich will in den nächsten zwei Stunden nichts mehr von dir hören.« Er beugte sich müde über das Manuskript und begann noch einmal über die Sache mit dem »fauligen Geruch« nachzudenken, und als er sich kurz wieder umdrehte und ich immer noch hinter ihm in der Tür stand, schrie er plötzlich wie von Sinnen: »Raus! Raus!«, und ich verschwand endlich.
Dima hatte über Čedok einen Urlaub in Albanien gebucht, aber er wollte bei der Zwischenlandung in Belgrad die Reisegruppe heimlich verlassen und, statt nach Tirana, illegal nach Westberlin weiterfliegen, wo ihr gemeinsamer Bruder Lev seit Jahren lebte. Das wusste aber leider nicht nur Dima, das wusste von ihm selbst halb Prag, weil er schon Monate vorher anfing, seinen Freunden und Bekannten alles zu verkaufen, was er nicht mitnehmen konnte: seine russische Bibliothek, die ihm der Tate – genauso wie meinem Vater – jahrelang Buch für Buch mit der Post aus Moskau geschickt hatte, Möbel, Teppiche und sogar die Apparate aus seinem kleinen, privaten chemischen Labor, in dem er noch einmal die Erfindungen aus dem Metallurgischen Institut testete, die er später mit Levs Hilfe im Westen verkaufen wollte. Irgendwann wussten dann auch die Leute vom Innenministerium über Dimas Pläne Bescheid, und die Einzigen, die wahrscheinlich keine Ahnung gehabt hatten, waren mein Vater und Natalia Gelernter, seine eigene Frau. Natalia war deshalb natürlich sehr böse auf ihn. Als sie und mein Vater Dima nach seiner Verhaftung am Flughafen von Ruzyně das erste Mal im Gefängnis besuchen durften, sagte sie, ohne ihn zu begrüßen oder zu umarmen, leise: »Wolltest du wirklich ohne mich gehen, Dima? Ich dachte, wir wären eine Familie.« Und während er sich noch mit diesem traurigen, leicht beschränkten Dima-Gesichtsausdruck eine Antwort zurechtlegte, sagte sie laut: »Du Idiot hast neulich in Bratislava nicht aufgepasst, wir werden bald zu dritt sein.« Dann gab sie ihm eine Ohrfeige, und die beiden kleinen, blonden Aufseher, zwischen denen er stand, lachten gelangweilt und führten Dima gleich wieder ab.
Draußen fing es plötzlich wieder an zu regnen. Es wurde innerhalb weniger Augenblicke dunkel, das verrückte rote Licht verschwand aus dem Zimmer und aus den Winkeln der riesigen, alten Kastenfenster, und die Fassaden der gegenüberliegenden Häuser in der Laubova färbten sich jäh grau, fast schwarz. Mein Vater merkte erst jetzt, dass die Schreibtischlampe seit heute Nacht immer noch brannte, und er machte sie aus. Dann saß er da, reglos und nach vorn gebeugt wie der Jan Hus vom Altstädter Ring, in diesem erstaunlich warmen, silbrigen Morgenzwielicht, und dachte über seinen dummen, älteren Bruder nach.
War er auch böse auf ihn? Manchmal ja – aber meistens nicht. Als er noch selbst mit Natalia zusammen war, in Leningrad, wo sie gemeinsam an der Schdanow-Universität studiert hatten, da wollten sie beide auch in den Westen fliehen, aber sie hatten natürlich nie zu jemand anderem ein Wort darüber gesagt. Später in Prag wollten sie es immer noch, aber dort hatten sie sich schon bald getrennt. Und als dann Natalia Dima geheiratet hatte, standen mein Vater und sie kurz allein nebeneinander auf der Treppe vor dem großen, alten Standesamt in Smíchov, sie rauchten und schwiegen, und irgendwann sagte mein Vater zu ihr: »Vielleicht schaffst du es ja mit ihm.« Sie sagte: »Ja, vielleicht. Du darfst ihm aber nie sagen, was wir vorhatten. Das wäre traurig für ihn.« Und mein Vater sagte: »Du aber auch nicht.« Danach hatten sie nie wieder miteinander über ihren großen West-Traum geredet.
»Arbeitest du immer noch? Oder arbeitest du schon wieder?«
Jetzt war es meine Mutter, die hinter meinem Vater in der Tür seines Arbeitszimmers stand. Sie war bereits angezogen – kurzes rotes Kleid, grüner Plastikgürtel mit einer riesigen Schnalle, die schwarzen Haare nach oben toupiert wie die Schauspielerinnen aus der Viola Bar –, und er wusste sofort, dass sie auch Kopfschmerzen hatte. Immer wenn sie Kopfschmerzen hatte, sah sie besonders gut aus, ihre wie von Fremund gezeichneten, geschwungenen Gesichtszüge entspannten sich noch mehr, und der Blick ihrer sonst immer so ernsten, dunkelblauen Augen klarte auf.
»Warum machst du die Lampe nicht an? Reichen dir sieben Dioptrien nicht?«, sagte sie.
»Wie würdest du auf Russisch ›fauliger Geruch‹ sagen?«, sagte mein Vater. »Aber so, dass man lachen muss.«
»Ich weiß es nicht«, sagte sie, »ich bin noch müde. Ich habe Jelena ihre Zöpfe geflochten, aber sie schläft noch. Das Frühstück steht auf dem Tisch, und die Kleider für die beiden habe ich auch rausgelegt. Ich muss heute schon um halb acht im Institut sein. Kommt ihr mit Dima zuerst zu uns?«
Mein Vater nickte.
Sie machte die Tür von draußen leise und vorsichtig zu, dann machte sie sie aber wieder auf und sagte: »Du weißt, wie du bist. Also hör auf, darüber nachzudenken, sonst bist du noch in drei Tagen mit der Stelle beschäftigt. Vielleicht habe ich heute Abend eine Idee. Oder ist es dann zu spät?« Die Tür ging zu, ging wieder auf, und meine Mutter sagte: »Oder frag nachher deinen lächerlichen Bruder. Ihr habt doch früher zusammen übersetzt.« Mein Vater schwieg. »Du musst keine Angst haben. Ich werde nett zu ihm sein.« Er schwieg immer noch. »War es gestern Abend schön mit Natalia?«, sagte sie überraschend böse und kalt und schloss endgültig die Tür hinter sich.
Wahrscheinlich, dachte mein Vater, während er wie ein trotziges Kind ein paar Mal die Schreibtischlampe an- und wieder ausmachte, haben sie Dima in Pankrác etwas unterschreiben lassen. Nein, ganz bestimmt sogar, und bestimmt hatte er ihnen alles erzählt, was sie wissen wollten. Die Frage war nur, ob sie schon vorher von den Geschäften des Taten gewusst hatten, und wenn ja, von wem. Es konnte ihn schließlich jeder verraten haben, dem der Tate alte amerikanische Nähmaschinen oder französisches Parfum besorgt hatte, jeder, der ihm noch Geld schuldete oder der einfach nur wütend war auf diesen freundlichen, stillen Juden aus Ruthenien, weil der es schaffte, für seine Familie besser zu sorgen als die meisten Russen. Nein, als der Tate in Moskau verhaftet wurde, war Dima selbst noch frei und mit seinen unmöglichen Fluchtplänen beschäftigt, und darum konnte er es gar nicht gewesen sein! Aber dass meine Mutter das dachte – obwohl sie es natürlich nie aussprach –, machte meinen Vater trotzdem sehr wütend. Noch wütender machte ihn, dass Dima und er und wir in einer Welt leben mussten, in der jemand wegen ein paar schwarz verdienter Dollars gehängt wurde.
»Papa, ich will fünf Löffel Zucker in den Tee, aber Jelena sagt, ich darf nur drei.«
»Fünf Löffel Zucker? Da kann er ja gleich Bonbons zum Frühstück essen!«
»Warum nicht? Warum eigentlich nicht?«
»Weil dir dann schon mit zehn Jahren wie einem alten Mann die Zähne ausfallen würden.«
»So wie dir gestern die beiden Schneidezähne auf einmal?«
»Das ist etwas anderes, du kleiner Idiot!«
Wir standen nebeneinander in der Tür, meine Schwester und ich, wir hatten uns selbst angezogen und sahen so niedlich und hübsch aus wie die tschechischen Filmkinder aus den Barrandov-Studios. Meine Mutter hatte letztes Jahr sogar überlegt, ob sie uns nicht zu den Probeaufnahmen von Ferne Welten, ferne Länder schicken sollte, aber dann hatte mein Vater zu ihr gesagt, nein, auf keinen Fall, er wolle keine eingebildeten Kinder, die schlecht in der Schule sind, und das war es gewesen. Insgeheim waren sie aber beide sicher, dass wir sofort die beiden Hauptrollen bekommen hätten, wenn wir es nur gewollt hätten.
»Wisst ihr eigentlich, wie sehr ihr mir manchmal auf die Nerven geht?«, sagte mein Vater ernst, fast so, als wolle er uns nicht ausschimpfen, sondern uns nur etwas sehr Wichtiges erklären. »Wisst ihr, wie schwer es ist, in diesem Haus zu arbeiten und Geld für euch alle zu verdienen?«
Wir machten beide erschrocken einen Schritt zurück, denn wir rechneten damit, dass er gleich wieder losschreien würde. Aber er blieb ruhig und sagte: »Jelena, du bringst heute deinen Bruder in die Vlkova! Ich kann nicht, ich muss noch arbeiten. Und wenn er verdammt noch mal deine Hand nicht halten will, dann soll er es eben nicht. Lass ihn. Es ist seine Sache, ob er unter einem Auto landet oder nicht!«
»Ja, Papa«, sagte Jelena grinsend.
»Ja, Papa«, sagte ich traurig.
»Wir sehen uns heute Nachmittag«, sagte mein Vater. »Onkel Dima kommt heute von seiner großen Reise zurück.«
Jetzt grinsten wir beide, dann knallten wir die Tür des Arbeitszimmers viel zu laut zu und rannten laut lachend in die Küche.
Als Dima im Sommer 1960 am Flughafen in Ruzyně verhaftet wurde, fanden die StB-Leute sieben Hundert-Dollar-Scheine bei ihm, die er in zwei leeren Orwo-Filmdosen versteckt hatte. Das wusste mein Vater von Natalia, und die wusste es von Dima, den sie in den letzten fünf Jahren fast jede Woche besucht hatte, so oft wie niemand sonst. Jedenfalls hatte mein Vater immer gedacht, dass Dima ihr die Geschichte mit den Dollars bei einer ihrer vielen kurzen, traurigen Begegnungen in dem grell erleuchteten, immer zu kalten Besucherraum in Pankrác erzählt haben musste. Dann legte sie aber gestern Abend im Café Slavia nach dem vierten oder fünften Cognac die Hand auf seine Hand und sagte: »Die verdammten Dollars eures Vaters! Ich hab nie verstanden, warum er sie jahrelang aus Moskau nach Prag zu euch rausschmuggeln durfte, warum der StB nie etwas dagegen gemacht hat. Ohne seine Dollars hätten sie Dima vielleicht gar nicht einsperren können.« Mein Vater nahm die Flasche, schenkte ihr und sich noch mal ein und sagte: »Woher weißt du, Natalia, dass der StB jahrelang davon wusste?« Sie sah ihn erschrocken an – sehr erschrocken – und sagte unsicher: »Die wissen doch alles, oder nicht?«
Mein Vater machte wieder ein paar Mal ganz schnell und nervös die Schreibtischlampe an und aus, bis es plötzlich einen lauten, scharfen Knall gab und die Glühbirne durchbrannte. »Scheiße«, sagte er leise. »Ach, Scheiße …« Er überlegte kurz, ob er aufstehen und in der Küche eine neue Glühbirne holen sollte, aber dann hätte er uns noch mal gesehen, und das wollte er nicht, denn er wusste genau, dass er uns sofort wegen irgendeiner Kleinigkeit angebrüllt hätte, so wie er uns oder unsere Mutter immer anbrüllen musste, wenn er an den Tod seines Vaters dachte.
Warum war er nicht schon gestern darauf gekommen? Und warum hatte er nicht Natalia ihren Cognac ins Gesicht gekippt, als sie ihn so unverschämt und schlecht angelogen hatte? Wieso hatte er sie stattdessen zum Abschied auch noch wie früher geküsst? Wirklich, Natalia, wissen »die« alles? Oder wissen sie es nur, weil es ihnen einer von uns erzählt hat? Ja, natürlich, sie war es gewesen, die den StB-Leuten seit Jahren alles über die verbotenen Geschäfte des Taten erzählte, nicht Dima, und bestimmt traf sie sich regelmäßig mit einem von ihnen in der Bartolomějská oder in einer von ihren vielen Geheimwohnungen! Denn wie sonst hätte sie, obwohl sie nicht einmal in der Partei war, so schnell Dozentin an der FAMU und stellvertretende Vorsitzende des Filmverbandes werden können? Ach, Natalia, dachte mein Vater, während er sich wieder völlig erschöpft auf das schöne, neue Sofa legte und mit Wladimirs alter russischer Militärdecke zudeckte, dich hasst also Rada dafür, dass du ständig so laut auf die Kommunisten schimpfst? Ausgerechnet dich? Oder hat sie bloß schon immer gespürt, dass du eine Lügnerin bist? Und ich dachte, es ist ihre ewige Eifersucht.
Seine Augen fielen plötzlich wie von selbst zu, und als er merkte, dass er bald wieder einschlafen würde, öffnete er sie schnell und sah sich in seinem geliebten Arbeitszimmer um. Es lag wegen des Regens und der vielen Wolken draußen immer noch halb im Dunkeln, aber er konnte trotzdem alles genau erkennen. Hier, zwischen den unzähligen Wörterbüchern, Manuskriptstapeln, den beiden großen Frauenporträts von Fremund und seiner kleinen Menorasammlung auf dem alten dunkelgrünen Kachelofen, verbrachte er immer mindestens zwölf, vierzehn Stunden am Tag – also den größten und wahrscheinlich auch interessantesten Teil seines Lebens. Wer hätte gedacht, dass er jemals so ein schönes, großes Arbeitszimmer im besten Viertel der wunderbarsten Stadt Europas haben würde? Wieso war ihm das nie vorher klar geworden? Und warum machte es ihn trotzdem nicht besonders glücklich?
Als nach dem Krieg Lev und Wladimir aus Moskau nach Prag gingen – alle vier Brüder wuchsen in einem einzigen Zimmer in einer riesigen Komunalka am Puschkin-Platz auf –, waren Dima und er, ihre beiden jüngeren Brüder, sehr neidisch auf sie. Zwei Jahre später durften sie endlich nachkommen, aber kaum waren sie da, zogen Lev und Wladimir weiter in Richtung Westen, der eine nach Westberlin, der andere bis nach Brasilien. Mein Vater selbst war in dieser Zeit bereits wieder in Russland, in Leningrad, mit Natalia, und studierte Geschichte. Aber dann wurde er aus der Partei rausgeworfen und musste in die Tschechoslowakei zurück, und jetzt also lebte und arbeitete er hier, in diesem Zimmer, in dieser Stadt, seit fast zwanzig Jahren. Nein, er war nicht Historiker geworden, obwohl er das schon als altkluger, humorloser Zehnjähriger in Russland sein wollte. Er wurde Übersetzer und Dolmetscher, und das war eigentlich noch viel besser, denn so verdiente er sehr viel mehr Geld und konnte die wichtigsten Schriftsteller und Regisseure des Landes kennenlernen. Und trotzdem fragte er sich fast jeden Tag, wann Dima und er den beiden älteren Brüdern weiter nach Westen folgen würden und ob das überhaupt klug wäre. Der arme Dima hatte es allein versucht, ohne ihn, auf seine kindische, hilflose Art, und wahrscheinlich musste er ihm nächstes Mal helfen, damit es wirklich klappte.
Verflucht, wie sagte man auf Russisch »fauliger Gestank« – aber so, dass es witzig klang? Und warum fiel ihm noch immer nichts Gutes ein? Meine Mutter hatte recht: Er musste endlich aufhören, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, sonst würde er gar nicht mehr weiterkommen, und er sollte vielleicht wirklich nachher Dima fragen. Sie hatten schließlich am Anfang ihrer Prager Zeit immer sehr viel zusammen gearbeitet – Maschinenbaupläne, Chemietabellen, militärische Berichte –, und Dima war gar nicht so schlecht gewesen. Aber irgendwann ging er zum Metallurgischen Institut, und dann wurde er eingesperrt. Ja, gut, in Ordnung, er würde ihn fragen, dachte mein Vater, während er sich das harte Sofakissen so zurechtlegte, damit es ihn nicht mehr im Nacken drückte. Er machte die Augen zu und zwang sich, ruhig und langsam zu atmen, und kaum war ihm das halbwegs gelungen, merkte er wieder die Migräne. Der Schmerz lähmte jetzt seine ganze rechte Kopfhälfte – natürlich, er war ja Linkshänder –, ihm war übel, und die Beine und Arme fühlten sich so an, als würden sie langsam verbrennen.
Er versuchte, die Augen zu öffnen, aber er schaffte es nur ganz kurz, für wenige Sekunden. Er machte sie noch mal auf, doch sie klappten gleich wieder zu, und bevor er endgültig einschlief, dachte mein müder, trauriger Vater: Komisch, eben war es noch so dunkel in meinem tollen Arbeitszimmer, und jetzt versinkt hier alles in einer Fontäne aus hellem, grellrot schimmerndem Blut.
Meine Eltern sprachen schon immer Russisch miteinander – und mit meiner Schwester und mir auch. Tschechisch konnten sie natürlich auch, aber nicht so gut wie Jelena und ich, und wir schämten uns oft für ihren russischen Akzent. Wir beide durften zwar miteinander Tschechisch reden, aber nie mit ihnen, und wenn wir ein russisches Wort nicht wussten, mussten wir sie danach fragen oder das, was wir sagen wollten, auf Russisch umschreiben. Darum konnten wir immer ganz gut Russisch – Jelena spricht es bis heute perfekt –, und wahrscheinlich lernten wir darum auch nach unserer Flucht aus der Tschechoslowakei nach Deutschland im Sommer 1970 so schnell Deutsch.
Als wir an dem heißen, viel zu heißen Maitag 1965, an dem es immer wieder kurz und heftig regnete, von der Schule nach Hause kamen, sangen Jelena und ich sehr laut und sehr schön ein berühmtes tschechisches Lagerfeuer-Lied. Es ging um Apachen und Manitu und ihren Kampf gegen die Weißen, und natürlich starben sie am Ende alle, aber sie starben als Helden und stolze Indianer. Jelena hatte das Lied im Sommer davor im Zeltlager in Česká Lípa gelernt, und sie hatte es mir beigebracht. Wir können beide das Lied bis heute, und manchmal, wenn wir telefonieren – sie ist in London, ich bin in Berlin –, singen wir zusammen die ersten ein, zwei Strophen und lachen, und ich muss dann immer an diesen Nachmittag denken, an dem Dima nach Hause kam.
Kaum hatte Jelena mit ihrem Schlüssel die Wohnungstür aufgeschlossen, hörten wir auch schon die Stimmen der Erwachsenen aus dem Wohnzimmer.