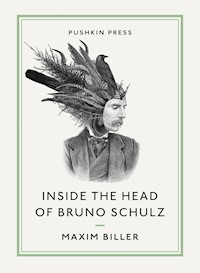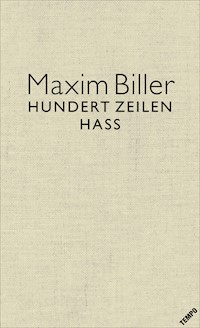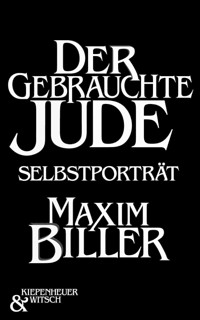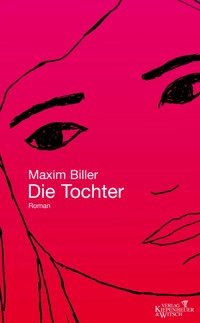9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maxim Billers gefeierte Moralische GeschichtenJeden zweiten Sonntag muss man die Kaffeetasse sicher abstellen, bevor man Billers Kürzesterzählungen in der FAS am Frühstückstisch liest, denn es wird gefährlich: entweder bleibt das Brötchen im Halse stecken, oder man bricht in prustendes Lachen aus – meistens irgendwie beides. Heftige Reaktionen sind sicher, wenn Biller sich den ganz alltäglichen, allgemein-menschlichen Abgründen im Leben von Juden, Nicht-Juden und anderen menschlichen Wesen zuwendet. Da wird ein Lippenstiftrest nach einem feuchten Traum zum Gottesbeweis, die tätowierte Nummer auf dem linken Arm zum Lottogewinn und ein Fleischermesser zum Garanten einer glücklichen Ehe. Eine irrwitzige Komik entsteht, weil mit Titeln wie Kosmos, Der Sinn des Lebens, Dichtung und Wahrheit oder Apokalypse die ganz großen Themen angeschlagen, dann aber rasant auf das Alltagsniveau heruntergebrochen werden. Träume, Phantasien und Freud'sche Fehlleistungen führen zu den überraschendsten und befreiendsten Erkenntnissen. So stößt der Literaturstudent Orlovsky in Kafkas Tagebüchern auf den Eintrag »Manchmal denke ich, ich bin einfach nur bescheuert« und erhält dadurch ein völlig neues Kafka-Bild, ohne den Satz später jemals wiederfinden zu können. Maxim Biller schreibt seit zwanzig Jahren seine Moralischen Geschichten, die seit drei Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung abgedruckt werden. Diese Auswahl größtenteils unveröffentlichter Geschichten versteht sich als wertvoller Beitrag zur Unterhaltungsliteratur und zur kulturellen Verständigung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Maxim Biller
Moralische Geschichten
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Biller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Biller
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Zuletzt erschienen von ihm der Erzählband »Bernsteintage« und die CD »Maxim Biller Tapes« mit 18 Songs.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Was ist hier eigentlich los?
Ein Lippenstiftrest wird nach einem feuchten Traum zum Gottesbeweis, die tätowierte Nummer auf dem linken Arm zum Lottogewinn und ein Fleischermesser zum Garanten einer glücklichen Ehe. Mit Titeln wie »Kosmos«, »Der Sinn des Lebens«, »Das erste Mal« oder »11. September« werden die ganz großen Themen angeschlagen, dann aber rasant auf ein scheinbar profanes Alltagsformat gebracht. Träume, Phantasien und Freudsche Fehlleistungen führen dabei zu den überraschendsten und befreiendsten Erkenntnissen. Zum Beispiel stößt der Literaturstudent Orlovsky in Kafkas Tagebüchern auf den Eintrag »Manchmal denke ich, ich bin einfach nur bescheuert« – und erhält dadurch ein völlig neues Bild vom großen Dichter, ohne den Satz später jemals wiederfinden zu können.
Seit zwanzig Jahren schreibt Maxim Biller seine »Moralischen Geschichten«, die inzwischen auch regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erscheinen. Sie sind jüdisch, komisch und manchmal auch ein bißchen wehmütig – und mit Sicherheit etwas ganz Neues in der deutschen Literatur.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Petersilie
Viagra
Bernsteintage
Die Rede
Eier
Kafka
Brod
Spielberg
Woody Allen
Shoshi
Vergeltung
Philip Roth
Der Nachruf
Das Problem
Kohn
Mahnmal
Der Idiot
Big Brother
Apokalypse
Der Zaun
Hitler
Arafat
Möllemann
Bush
Die Flut
Autobiografie
Anachronismus
Walser
Die Nummer
Der Moslem
Der Erfinder
Verschwörung
Der Test
Die Kannibalin
Geld
Moral
Der Doppelgänger
Weihnachten
Papa
Der Idealist
Der Verleger
2010
Gottesbeweis
Telepathie
Der Dibbuk
Der Studienfreund
Der Märtyrer
Der Vater
Die Tochter
Der Onkel
Das Zeichen
Der Feigling
Glücksrad
Wer wird Millionär?
Uschi
Literatur
Büchnerpreis
Nobelpreis
Die Inspiration
Baader
Das erste Mal
Die Vorhaut
Der Berater
Beatles
Der Pianist
Lotto
Die Schwiegermutter
Der Sinn des Lebens
Documenta
Der Papst
Routine
Öl
Der Knicks
Gysi
Stalin
Weininger
Dr. Mengele
Freud
Schabbatai Zwi
Kosmos
Die Prüfung
Der Kolumnist
Das Kopftuch
Der Kanzler
Schwermut
Bahncard
Freunde
Osama
Schnupfen
Der Clown
Fellatio
Schicksal
Gas
Der Übersetzer
Kongo
Staatsbesuch
Zwei Celan-Gedichte
Bitburg
Grass
Das Ende
Gene
Der Messias
Jugend
Penelope
Der Untergang
Nachbarn
Voodoo
Tyrannenmord
Den Haag
Jud Süß
Fußball
Talkshow
Goebbels
Die Krise
Die Klage
Der Versager
11. September
Abu Ghraib
Assimilation
Selbsthaß
Nachruhm
Avantgarde
Kokain etc.
Die Journalistin
Der Verschollene
Der Geliebte
Der Kuß
Luftkrieg
Der Zahnarzt
Ehebruch
Der halbe Bart
Die Glatze
Wiedergeboren
Der Heuchler
Matzeklößchen
Steuern
Pragmatismus
Dichtung und Wahrheit
Chuzpe
Geklont
Ekstase
Paradigmenwechsel
Die Erleuchtung
Therapie
Geschäfte
Entropie
PMS
Trauma
Abigail
Der Liebesbrief
»Wie spät ist es?«
Joseph Heller, Gut wie Gold
Petersilie
Shoshi und Kohn waren zwölf Jahre, zwei Monate und drei Tage zusammen. Dann hielt er ihr einmal die Tür nicht auf, und schon schmiß sie ihn raus.
Kohn ging zu seinen Eltern. Er hatte sie zwölf Jahre, zwei Monate und drei Tage nicht mehr gesehen, und vielleicht erkannte er sie deshalb nicht wieder. Nein, nicht deshalb. Er hatte sich in der Tür geirrt, und die beiden gutangezogenen Schwulen, die ihn hereinbaten, ihm Tee kochten und verständnisvolle Fragen stellten, wären Kohn als Mama und Papa natürlich viel lieber gewesen.
Bevor er ging, fragte er sie im Spaß, ob sie ihn adoptieren würden.
»Klar«, antwortete einer der beiden im Spaß. Und der zweite fügte im Spaß hinzu: »Wir wollten schon immer den großen haarigen Herrn Kohn im Kinderwagen durch Eppendorf schieben.«
Ein Stockwerk höher war die Stimmung ganz anders.
»Ich brauch’ noch Petersilie«, sagte Kohns Mutter, als er nach zwölf Jahren, zwei Monaten und drei Tagen wieder vor ihr stand. »Petersilie, verstehst du, nicht Dill. Und nimm den Müll gleich mit.«
»Sag ihm«, rief sein Vater aus dem Wohnzimmer, wo er mit dem Salz- und Pfefferstreuer den israelischen Rückzug aus Gaza nachspielte, »er soll den Müll mitnehmen. Und wenn er wieder Dill kauft statt Petersilie, reiß’ ich ihm die Eier ab.«
Als Kohn vom Einkaufen zurückkam, sah ihn seine Mutter mitleidig an. »Ich hab’ doch Dill gesagt«, sagte sie, »und du bringst mir Petersilie.«
»Er hat bestimmt Petersilie gekauft«, rief sein Vater aus dem Wohnzimmer. Er räumte gerade die Westbank, naja, einen ganz kleinen Teil davon.
»Es geht mir nicht so gut«, sagt Kohn und fing an zu weinen.
»Natürlich«, sagte seine Mutter höhnisch.
»Jetzt heult er bestimmt gleich wieder«, rief sein Vater.
»Ja«, sagte seine Mutter, »jetzt geht’s schon wieder nur um ihn.«
»Daß wir uns seinetwegen Sorgen machen, ist ihm ja egal«, rief sein Vater beleidigt. Er hatte eben begriffen, daß Ostjerusalem auch nicht zu halten war.
»Ja. Hauptsache, ihm geht es gut«, sagte seine Mutter.
»Genau«, rief sein Vater. »Wir könnten sterben vor Kummer um ihn, aber nein, er leidet trotzdem weiter.«
In dem Moment klingelte Kohns Telefon. »Weißt du, mein Dudschik«, sagte Shoshi zärtlich, »ich könnte mir doch auch manchmal die Tür selbst aufmachen. Findest du nicht?«
»Das würdest du wirklich tun?« sagte er.
»Aber natürlich. Und jetzt komm bitte schnell zurück.«
Und so verließ Kohn seine Eltern wieder, und er hat sie seitdem nicht mehr gesehen. Er hofft, das bleibt so noch eine Weile. Zwölf Jahre, zwei Monate und drei Tage wären ganz okay.
Viagra
Wer hat nicht schon mal seine Frau betrogen? Hornstein, der Zahnarzt. Dann kam aber Anfang August diese schreckliche Hitzewelle, und plötzlich gab es auf den Straßen Frankfurts mehr zu sehen als im Schlafzimmer der Familie Hornstein.
Jetzt hielt es auch Hornstein nicht mehr aus. Er rief eine Kollegin in Wiesbaden an, mit der er beim letzten Dentistenkongreß in Bad Reichenhall eine interessante Diskussion über die Vor- und Nachteile von Zahnersatz bei Oralverkehr hatte. Die Kollegin konnte sich an Hornstein zwar nicht erinnern, war aber trotzdem sofort bereit, sich mit ihm in der Mittagspause in einem Frankfurter Bahnhofshotel zu treffen. Er selbst wußte auch nicht mehr, wie sie aussah – sie hatte aber noch alle ihre Zähne, das hatte er nicht vergessen.
Auf dem Weg zum Bahnhof nahm Hornstein schnell eine halbe Viagra. Er brauchte sie nicht wirklich, aber daß er sie gar nicht gebraucht hätte, kann man auch nicht gerade sagen. Das merkte er schon am Bahnsteig. Er stand da, übte das unauffällige Winken mit der neuesten Ausgabe des »Jüdischen Dentisten«, das sie verabredet hatten, und spürte eine Erektion in der Hose, die er das letzte Mal vor vierzig Jahren zustandegebracht hatte. Damals überraschte er an einem Schabbatnachmittag seine Eltern nackt in ihrem Bett in der spektakulären Baruch-Spinoza-Stellung.
Der Zug, der Hornstein Erlösung bringen sollte, kam nicht. Wegen der Hitze hatten sich die Gleise irgendwo zwischen Frankfurt und Wiesbaden verdreht, und die Kollegin sagte per SMS ab. Jetzt hatte Hornstein also ein Problem. Zuerst versuchte er, Eis zu essen, um sich von seiner Erregung abzulenken. Dann ging er in die Bahnhofsbuchhandlung und blätterte mehrere Bände über das Dritte Reich durch. Aber die Erektion blieb. Auch eine Golda-Meir-Biografie konnte ihm keine Erleichterung verschaffen. In der Praxis schloß er sich dann im Röntgenraum ein und befriedigte sich dreimal selbst. Er hätte es noch fünfmal machen können. Kaum war er fertig, richtete sich dieses Viagra-Monster da unten schon wieder auf.
Als Hornstein nach Hause fuhr, begann es das erste Mal seit Wochen zu regnen. Es stürmte und donnerte, und die Temperatur fiel um ganze zehn Grad. War das seine Rettung?, fragte Hornstein sich verzweifelt. Nein, war es natürlich nicht. Beim Aufschließen der Haustür kam er mit seinem riesigen Schmendrik gegen die Klinke, und die Tür sprang wie von selbst auf.
Hornsteins Frau Berele – eigentlich Barbara – bemerkte sofort die ungewohnte Veränderung an ihrem Mann. Sie schob ihn ohne zu zögern ins Schlafzimmer, und ungefähr zwei Stunden später gab sie wieder auf. »Also weißt du, Liebling«, sagte sie völlig außer Atem, »wenn du mich umbringen willst, geht das mit einer echten Waffe leichter.«
Am nächsten Morgen waren es draußen wieder fast vierzig Grad im Schatten. Und Hornsteins Ding stand immer noch wie eine Eins.
Bernsteintage
Das erste Buch, das Bernstein veröffentlichte, war ein Sexualratgeber für Senioren mit übersteigerter Libido. Obwohl er selbst noch keine dreißig war, wußte er, wovon er redete. Außerdem wollte er auf diesem Weg seinen Eltern etwas sagen – er wußte nur nicht genau, was. Die beiden redeten seit Jahren nicht mehr miteinander, hatten aber noch Sex. Das merkte Bernstein daran, daß bei ihnen in der Schlafzimmertür oft einer von diesen riesigen weißen Büstenhaltern seiner Mutter klemmte. Manchmal standen sie auch beim Essen plötzlich auf, und wenn sie zehn Minuten später zurückkamen, hatte seine Mutter die dicke schwarze Brille seines Vaters auf, und er trug ihr Kleid. Bernsteins Buch hieß »Sex ist nicht alles« und wurde von der Kritik als die Wiedergeburt der jüdischen Literatur im Geist von Mendelssohn und Ephraim Moses Kuh gepriesen.
Bernsteins zweites Buch war ein Sexualratgeber für Dreißigjährige. Es war Wort für Wort dasselbe Buch, weil Bernstein aus Versehen beim Verlag das Manuskript von »Sex ist nicht alles« abgegeben hatte. Es trug den Titel »Sex ist alles«. Die Rezensenten erklärten, das zweite Buch sei für einen Schriftsteller immer das schwierigste, und so gesehen habe Bernstein wirklich nichts falsch gemacht. Sie fühlten sich beim Lesen diesmal allerdings mehr an die Sagen des Baalschem Tow und die wunderbar hintergründigen Geschichten des Rabbi Schmockowski von Potzstadt erinnert. »Chassiden sind Jidden«, lautete der letzte Satz des großen »Spiegel«-Artikels über »Sex ist alles«, und das brachte Bernstein gleich ein paar Tausend mehr Auflage in Ostdeutschland.
Als nächstes gab Bernstein ein indisch-koreanisches Kochbuch heraus. Die Kritik spielte verrückt. Man verglich ihn mit Kafka, Bruno Schulz und Celan, mit den großen jüdischen Magiern des zwanzigsten Jahrhunderts, die, wie »Die Zeit« schrieb, »in den Kochtöpfen ihrer Prosa eine Welt zusammenrührten, die es zum Glück nicht mehr gibt«. Weil Bernstein kein besserer Titel einfiel, nannte er es »Sex ist nicht alles«, und er bekam dafür den Ernst-Jünger-Gedächtnispreis, und ins Bundeskanzleramt wurde er auch eingeladen, aber eigentlich war nicht er es, sondern der Dirigent Barenboim, und es war nicht das Bundeskanzleramt, sondern die israelische Botschaft.
Mit seinem letzten Buch kam Bernstein aber nicht so gut an. Es hieß »Bernsteintage« und war ein jüdischer Familienroman in der Tradition von Isaac Bashevis Singer und Ilja Richter. »Warum muß Bernstein immer nur über Juden schreiben?« ärgerte sich der Literaturchef der »Frankfurter Rundschau« über ihn – und mit ihm praktisch jeder andere kluge Kopf im deutschen Feuilleton.
Die Rede
»Meine Damen und Herren, Juden und Deutsche, Mama und Papa«, begann Diskin seine Antrittsrede als Bundespräsident letzte Woche im Reichstag, »mir geht es heute überhaupt nicht gut. Gestern abend war ich viel zu lange im Due Forni, und ich habe diese Nudeln mit Leber gegessen, von denen mir die ganze Nacht schlecht war. Dann rief morgens um sieben meine bescheuerte Tochter Rosa aus Tel Aviv an, weil der Boiler im Badezimmer nicht ging, und wir mußten für sie von hier aus einen gottverdammten Installateur organisieren. Und als ich schon im Wagen saß, war Weinreb auf meinem Handy und meinte, wenn ich ihm nicht sofort fünftausend Dollar leihe oder noch besser zehntausend, springt er aus dem Fenster.
Verstehen Sie jetzt, meine Damen und Herren, wie es mir geht? Natürlich nicht. Sie denken ja immer nur an sich! Genauso wie meine Rosa. Sie wollen, daß ich hier jetzt eine schöne Rede halte, daß ich Ihnen sage, macht dies, macht das, und dann gehen Sie nach Hause und machen sowieso alles ganz anders. Und wissen Sie was? Ist mir doch egal! Man hätte mich genauso zum Präsidenten von Honduras oder von Liechtenstein machen können oder von Besiktas Istanbul. Hauptsache, ich kann in einer Riesenvilla wohnen, meine Flüge kosten nichts, und hundert Gojim laufen die ganze Zeit um mich rum und fragen mich, ob ich noch was brauche.
Ein paar Ratschläge kann ich Ihnen trotzdem geben, wenn ich schon hier bin. Gut, es werden nicht wirklich Ratschläge sein, mehr so Bonmots oder Sentenzen oder so was, aber die wollte ich schon immer mal loswerden. Erstens: Nichts gelingt wie geplant. Zweitens: Wer viel arbeitet, kriegt viel auf den Kopf. Drittens: Das Geld gehört immer den andern. Viertens: Deutschland den Deutschen. Fünftens: War nur ein Witz. Sechstens: Die beste Take-Away-Pizza der Stadt gibt’s bei Hebron Pizza am Ku’damm, fragt nach Izzy Frenkel, das ist mein Schwager, der bringt sie euch ohne Rechnung für den halben Preis. Und siebtens: Über die neue scharfe russische Verkäuferin bei Gucci in der Friedrichstraße müssen wir noch mal unter vier Augen reden.
Meine Damen und Herren, Juden und Deutsche, Mama und Papa! Mehr fällt mir im Moment wirklich nicht ein! Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die nächsten fünf Jahre, und weil wir uns so gut verstehen, hänge ich bestimmt noch mal fünf Jahre dran. Und jetzt muß ich ans Handy, meine kleine Rosa ruft wieder an … Ja, Rosa? Ja? Aber ja, mein Kätzchen, natürlich, geh ruhig mit ihm aus, er ist aus einer sehr guten Familie. Aber laß ihn bezahlen, hörst du? Dein Tate ist kein Rotschild!«
Eier
Als Kohn seinen Eltern sagte, er wolle eine Deutsche heiraten, brach seine Mutter in Tränen aus, und sein Vater brummte: »Ganz schön clever.« Als Andrea, Kohns Zukünftige, ihren Eltern sagte, sie wolle einen Juden heiraten, luden die ihn zum Osterfrühstück ein.
Zuerst mußten Andrea und Kohn draußen im Garten Eier suchen. Es regnete, war saukalt, und in Kohns Osternest lagen fünf gettogelbe Schoko-Eier von Nestlé sowie ein Fotoband über jüdische Friedhöfe in Niedersachsen. Dann ging es an den Frühstückstisch. Es gab hartgekochte Eier in verschiedenen Farben, und komischerweise erwische Kohn immer die gelben. Das lag vielleicht daran, daß er genau hinter dem Osterstrauß saß und wegen der vielen frühlingshaft leuchtenden Eier, die daran baumelten, nicht sehen konnte, was am Tisch vorging. Dann machten alle einen Osterspaziergang, und es regnete weiter, und auf Kohns Regenschirm stand »Deutsch-Israelische Neurodermitistage, Bonn 1980«. Hinterher wurde ein kleiner Imbiß mit Soleiern serviert, und jetzt konnte Kohn bald wirklich nicht mehr.
Aber er mußte. Im Auto, auf dem Weg nach Hause, sagte Andrea erregt, sie habe für heute von Eiern noch lange nicht genug. Kohn wußte genau, was sie meinte. Gut, dachte er, den Teil von Ostern nehm’ ich auch noch mit, und morgen ruf’ ich sofort Shoshi Marmorstein an, meine erste große Liebe, bestimmt will sie mich immer noch.
Kafka
Der Literaturstudent Orlovsky las oft in den Tagebüchern des von ihm verehrten Prager Dichters Franz Kafka. Am Abend nach seiner schriftlichen Magisterprüfung ging Orlovsky früh ins Bett. Er machte das große Licht aus und begann im Schein der Nachttischlampe in Kafkas Tagebüchern zu blättern. Zu seiner Überraschung stieß er auf eine Stelle, die ihm vorher nie aufgefallen war. Unter der Eintragung »27. August 1911, Bern« stand dort: »Manchmal denke ich, ich bin einfach nur bescheuert.«
Als Orlovsky am nächsten Tag seinem Freund Michi Herink den Satz zeigen wollte, gelang es ihm nicht, ihn wiederzufinden. Auch in späteren Jahren – Orlovsky war jetzt Feuilletonredakteur bei den »Badischen Nachrichten« – suchte er ihn vergeblich. Dennoch war Franz Kafka seit jenem denkwürdigen, magischen Abend in seiner Achtung noch mehr gestiegen.
Brod
Der Tag, an dem Max Brod die nachgelassenen Manuskripte seines verstorbenen Freundes Franz Kafka verbrennen wollte, begann nicht gut. Zuerst küßte er aus Versehen seine Frau, was er seit zwei Jahren nicht mehr getan hatte. Dann verschluckte er beim Frühstück seine einzige goldene Zahnkrone. Und als er kurz darauf Franzens Papiere in den Küchenofen schieben wollte, so wie der es von ihm in seinem Testament verlangt hatte, warf sich seine Frau vor ihn und rief: »Das kannst du nicht machen! Mach das nicht! Testament hin oder her!«
So – und nur so – kam es, daß Franz Kafka weltberühmt werden konnte, und jeder, der glaubt, Max Brod hätte sich absichtlich Franz Kafkas letztem Willen widersetzt, hat einfach nichts verstanden.
Spielberg
Der Amerikaner, neben dem der erfolglose Drehbuchautor Kamensky im Flugzeug von Tel Aviv nach Frankfurt saß, war nicht Steven Spielberg, obwohl er sich als Steven Spielberg vorgestellt hatte. Kamensky bemerkte das sehr schnell: Zuerst wollte sein bärtiger Sitznachbar nichts von Kamenskys Drehbuch wissen, das im Frankfurt des 22. Jahrhunderts spielte und eine Art futuristische Ritualmord-Burleske war, wie Kamensky selbst es nannte. Dann weigerte er sich, zumindest Kamenskys Tante Lola aus Holon für sein weltbekanntes Holocaust-Videoprojekt zu interviewen. Und spätestens, als er es ablehnte, Kamensky bis Ende nächster Woche vierhundert Dollar zu leihen, wußte Kamensky Bescheid. Trotzdem unterhielt sich Kamensky weiter mit ihm, und nachdem sie gelandet waren, fragte er, ob er die Kekse aus seiner Snacktüte haben dürfe. »Ja«, sagte der falsche Spielberg auf amerikanisch und sah Kamensky mitleidig an, »wir Juden müssen uns doch gegenseitig helfen.« Später, in der S-Bahn nach Hause, überlegte Kamensky noch lange, ob der falsche Spielberg nicht vielleicht doch der richtige war, denn schließlich war der richtige ja auch irgendwie der falsche. Jedenfalls hatte Kamensky noch nie einen solchen verlogenen, unrealistischen Scheißdreck wie »Schindlers Liste« gesehen, einen Film, in dem die Nazis groß und stark waren, die Juden aber so hilflos und grau wie Flöhe.
Woody Allen
Der Filmkritiker Süssman, der immer schon so einen Verdacht hatte, fand gleich bei seinem ersten New-York-Besuch heraus, daß Woody Allen in Wahrheit der Sohn eines berüchtigten ukrainischen KZ-Aufseherpaars war, das nach dem Krieg vom CIC falsche jüdische Dokumente bekommen hatte – und daß er es auch noch wußte. Obwohl Süssman Woody Allens Arbeit spätestens seit »The Purple Rose of Cairo« als epigonalen Manierismus verachtete, beschloß er, die sensationelle Enthüllung für sich zu behalten. Man muß, dachte er, den Feinden seines Volkes schließlich nicht an jeder Front weichen.
Shoshi
Shoshi und Kohn saßen im Café Paris, und Kohn sah so aus, als hätte er nur noch vier Minuten zu leben.
»Du siehst heute aber wirklich nicht gut aus, Dudschik«, sagte Shoshi, »willst du darüber reden?«
»Ja, furchtbar gern, Struppi.«
»Aber ich nicht!« sagte Shoshi, und sie rammte ihm zwei Finger ins Gesicht und drehte langsam an seiner Nase.
Kohn schossen vor Schmerz Tränen in die Augen.
»Sei jetzt bloß nicht beleidigt!« sagte Shoshi und drehte weiter. Irgendwann ließ sie los und sagte: »Ich hab’ bald Geburtstag. Was krieg’ ich?«
Eine Paketbombe, dachte Kohn. Er sprang auf und rannte ohne Mantel auf die Straße.
Draußen war es sehr kalt, und die Frau, die Kohn ansprach, war groß, blond und trug eine viel zu dünne Barbourjacke.
»Nein! Kohn, der Kolumnist!« schrie sie aufgeregt.
»Ja«, sagte er.
»Sie sind größer, als ich dachte!«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich sage nur Kissinger, Shamir, Gysi«, flüsterte sie.
»Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen«, sagte Kohn, »dafür habe ich einen ganz kleinen Schmendrik.«
»Köstlich!« sagte sie und lachte. »Ist das aus Ihrer letzten Kolumne?«
»Nein, aus der nächsten.«
»Bestimmt werden Sie hundertmal am Tag angesprochen, lieber Herr Kohn.«
»Nein, nie«, sagte Kohn deprimiert. »Außerdem fühl’ ich mich gerade so, als würde ich in vier Minuten sterben.«
»Was haben Sie denn? Ist der Dollarkurs gefallen?«
Kohn lachte müde.
»Es ist bestimmt wieder wegen Ihrer Shoshi«, sagte sie. »Ich sag’ Ihnen, ohne sie wäre Ihre Kolumne aber nur die Hälfte wert.«
»Mir ist kalt«, sagte Kohn, »ich geh’ wieder rein.«
»Und was hat sie diesmal gemacht?«
»Die alten Geschichten.«
»Hat sie etwa wieder an Ihrer Nase gedreht?!«
Kohn nickte traurig.
»Sie dürfen sich nicht alles gefallen lassen, Herr Kohn.«
»Ich geh’ jetzt also wieder rein, o.k.?«
»Die Zeiten sind vorbei, in denen sich Leute wie Sie wehrlos ihrem Schicksal ergeben haben!« rief sie ihm hinterher. »Verstehen Sie?«
»Mein Gott, du bist ja eiskalt«, sagte Shoshi, als Kohn sich wieder neben sie setzte, und sie rutschte sofort ein Stück von ihm weg. »Wo warst du überhaupt?«
»Ich verlasse dich«, sagte Kohn.
Shoshi grinste. »Ach, das ist also mein Geburtstagsgeschenk?« sagte sie. Dann rutschte sie wieder ganz dicht an ihn heran und küßte ihn zärtlich, und später zu Hause drehte sie seine Nase ausnahmsweise mal in die andere Richtung.
Vergeltung
Die Woche, in der Rubiner beschloß, der allererste jüdische Selbstmordattentäter in der Geschichte zu werden, war für die Juden alles andere als rosig gewesen: Am Montag stand in der »Washington Post«, Ariel Sharon sei gar kein Jude, sondern ein aus Nablus stammender Perspektivagent der Al-Fatah, der dreißig Jahre lang immer nur das machte, was Arafat ihm sagte. Am Mittwoch forderte die EU-Kommission die Israelis auf, sich am besten gleich aus ganz Israel zurückzuziehen, das würde den Nahostkonflikt auf einen Schlag lösen. Und als Rubiner am Freitagabend bei Rogacki in der Wilmersdorfer Straße noch schnell ein paar Austern essen wollte, gab es keine mehr.
Rubiner beschloß natürlich nicht wirklich, sich und einige andere Unschuldige in die Luft zu sprengen. Aber der Gedanke daran, daß er jederzeit die Möglichkeit hatte, genau das zu tun, tröstete ihn und gab ihm Kraft. Er verstand zwar noch immer nicht wirklich, wie es funktionierte, aber die Palästinenser hatten mit dieser Methode schon seit Jahren sehr viel Erfolg: Je schlechter es ihnen ging, desto mehr fremdes Blut vergossen sie. Und je mehr fremdes Blut sie vergossen, desto weniger taten ihnen ihre eigenen Wunden weh.
Philip Roth
Unglaublich, aber wahr: Eines Tages hatte sich Schlamm, der erfolglose Schriftsteller, in den Penis seines weltberühmten Kollegen Philip Roth verwandelt! Schlamm las gerade Roths letztes Buch, und an der Stelle, wo Mark Portnoyowitsch den BH seiner Mutter verspeist und gleichzeitig mit seinem gewaltigen Samenstrahl die Schabattkerzen auslöscht, bekam Schlamm zuerst einen gigantischen Ständer – und kurz darauf fand er sich selbst als Erektion in der Unterhose des großen Philip Roth wieder.