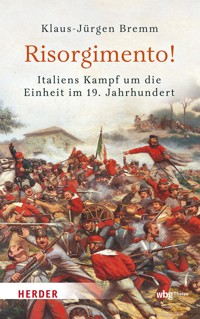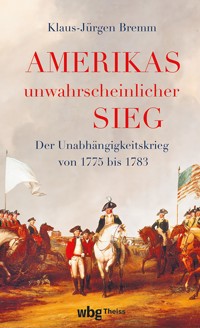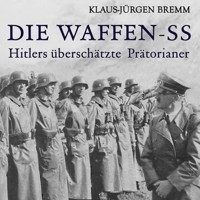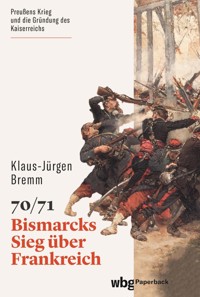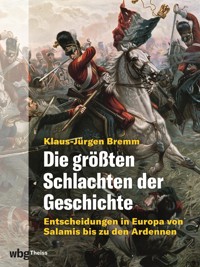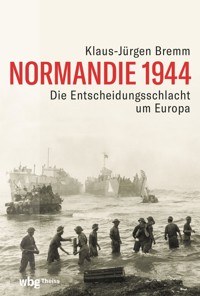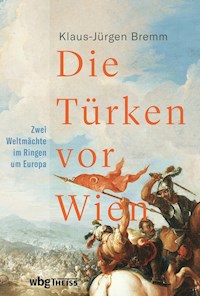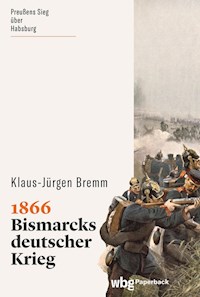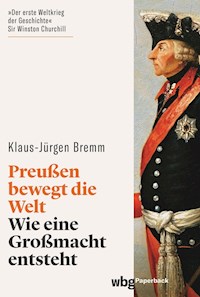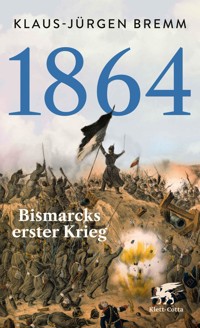
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geburtsstunde des Kaiserreichs: der deutsch-dänische Krieg neu erzählt Mit dem Einmarsch der preußischen und österreichischen Truppen in Dänemark begann am 1. Februar 1864 der deutsch-dänische Krieg, der später der erste »Einigungskrieg« genannt werden sollte. Packend schildert Bestsellerautor Klaus-Jürgen Bremm die diplomatischen Verwicklungen und militärischen Ereignisse und zeigt – vor dem Hintergrund der großen europäischen Machtpolitik – wie unter Bismarck Preußen zur deutschen Vormacht aufstieg. Auf keine Kampagne blickte Otto von Bismarck am Ende so stolz zurück, wie auf den Krieg gegen Dänemark. Mit seiner Politik voller überraschender Wendungen gelang es ihm gegen alle Widerstände, die so lange umstrittenen Elbherzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg in den preußischen Staat einzufügen. Fraglos war die Erstürmung der Düppeler Schanzen am 18. April 1864 der militärische Höhepunkt des ungleichen Kampfes, in dem das kleine dänische Heer gegen die beiden verbündeten deutschen Vormächte Österreich und Preußen keine Chance hatte. Unter Berücksichtigung des Schleswig-Holsteinischen Aufstandes von 1848/50 und der dänischen Sicht, nach der die Fortentwicklung einer modernen Verfassung in Dänemark nur unter Einbeziehung Schleswigs möglich schien, schildert Bremm die diplomatische Vorgeschichte und den Verlauf des Krieges von 1864. Er lässt uns das Kampfgeschehen hautnah nacherleben und beschreibt, wie damals erstmals viele Elemente der modernen Kriegsführung eine wesentliche Rolle spielten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Klaus-Jürgen Bremm
1864
Bismarcks erster Krieg
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg unter Verwendung einer Lithografie von © akg-images/»Storming of the entrenchments at Düppel by Prussian troops«
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Sämtliche Abbildungen im Innenteil: Historiecenter Dybbøl Banke
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98841-3
E-Book ISBN 978-3-608-12382-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
»Die
up ewig ungedeelten
müssen einmal Preußen werden«
I.
Prolog – Der große »Oprur« von 1848/51
1
Eine ehemalige Großmacht am Rande Europas
2
»Up ewig tosamende ungedeelt« –
Die Erfindung von Schleswig-Holstein
3
Schleswig-Holstein – Kriegumschlungen
4
Schleswig-Holstein ganz allein – Idstedt und Olmütz
II
.
Vom Londoner Protokoll zur Novemberverfassung
1
Politische Quadratur des Kreises – Dänemarks Kampf um eine neue Verfassung und um den Bestand des alten Gesamtstaats
2
Vom Krieg gegen das alte Heimatland – Helmuth von Moltkes Feldzugsplanungen gegen Dänemark
3
Lieber dänisch als frei – Bismarcks Opposition gegen ein unabhängiges Schleswig-Holstein
III
.
Vereint gegen Dänemark
1
Wechselvoller Kriegsauftakt – Die Preußen scheitern bei Missunde und der große Rückzug der Dänen
2
»Ein Stück Sewastopol« – Prinz Friedrich Karl vor Düppel
3
Für Preußen ein »kleiner und langsamer Anfang« – Der Seekrieg in der Ostsee
4
Triumphierende Österreicher und konsternierte Preußen – Erfolg der Kaiserlichen bei Veile und Stagnation vor Fredericia
5
Nicht ein »Malakoff«, sondern zehn! – Der 18. April 1864
6
»Nelson« in der Nordsee – Wilhelm von Tegetthoff stellt die Dänen vor Helgoland
7
Großbritannien zum »Appeasement« resigniert – Die Londoner Konferenz und die »dänische Frage«
8
Der Sturm auf Alsen und der Zusammenbruch der dänischen Moral
IV
.
Epilog – Der Wiener Vertrag und die Folgen
V.
Fazit – Bismarcks stolzeste Kampagne
Anhang
Zeittafel
Anmerkungen
»Die
up ewig ungedeelten
müssen einmal Preußen werden«
I. Prolog – Der große »Oprur« von 1848/51
II. Vom Londoner Protokoll zur Novemberverfassung
III. Vereint gegen Dänemark
IV. Epilog – Der Wiener Vertrag und die Folgen
Bibliografie
Quellensammlungen
Ältere Literatur (vor 1945)
Aktuelle Literatur
Aufsätze
Personenregister
Tafelteil
»Die up ewig ungedeelten müssen einmal Preußen werden«
»Holstein fragte: Sie wollten das gleich von Anfang an? Ja, gewiss, erwiderte der Fürst. Gleich nach dem Tode des Königs [Frederik VII.] von Dänemark. Es war aber schwer. Alles war dabei gegen mich, die Kronprinzlichen, er und sie, von wegen der Verwandtschaft, der König selbst zuerst und lange Zeit Österreich, die kleinen deutschen Staaten, die Engländer, die es uns nicht gönnten. Mit Napoleon, da ging es, der dachte uns damit zu verpflichten. Endlich waren zu Hause die Liberalen dawider, die auf einmal das Fürstenrecht für wichtig hielten – es war aber nur ihr Hass und Neid gegen mich –, und auch die Schleswig-Holsteiner wollten nicht. Die alle, und was weiß ich noch.«
Otto von Bismarck(1) am 20. Oktober 1877[1]
Jahrhundertelang galt den Dänen das Dannevirke zwischen Treene und Schlei als das eindrucksvolle Symbol ihres nationalen Selbstbehauptungswillens. In seinen wechselnden Ausprägungen sollte es seit dem Mittelalter Franken und reichsdeutsche Aufgebote aufhalten, und noch zu Beginn des Krieges von 1864 war der dänische Glaube an seine Wirksamkeit gegen die modernen Armeen der Preußen und Österreicher ungebrochen. Erhalten sind von »Königin Thyras(1)« mächtiger Burg nur noch einige Mauerreste, aber die von Pionieren der Bundeswehr und der Danske Forsvar wiedererrichtete Bastion XIV verschafft eine Vorstellung vom Ausmaß der Wehranlage zu Beginn des dänischen Katastrophenjahres. Eingehegt von der typischen westdeutschen Wohnbebauung, erscheint das Ganze inzwischen recht unspektakulär, und von seiner einstigen Wichtigkeit für das Nachbarland Dänemark erfährt der Besucher höchstens noch in dem kleinen, ebenso unscheinbaren Museum am Rande der Anlage. Der symbolische Bedeutungsverlust des Danewerks lässt sich auf den ersten Blick leicht dadurch erklären, dass es schon seit anderthalb Jahrhunderten nicht mehr Teil Dänemarks ist. Auch seit ihrer letzten Verschiebung nach dem Ersten Weltkrieg verläuft die Staatsgrenze immer noch etwa 60 Kilometer nördlich des ehemaligen Verteidigungswerkes. Allerdings hatten sich die Dänen selbst schon im Verlauf des Krieges von 1864 von ihrem einstigen Nationalmythos zu verabschieden begonnen. War doch ihre gesamte Streitmacht nur wenige Tage nach Eröffnung der Feindseligkeiten zur Bestürzung vieler dänischer Patrioten ohne Kampf heimlich und bei Nacht aus der Anlage abgezogen worden. Militärisch war es zwar ein weiser Entschluss, mit dem General Christian Julius de Meza(1) dem Land die Armee wohl gerettet hatte, erinnerungspolitisch jedoch war es eine Entzauberung.
Noch im selben Krieg sollten dagegen die auf einem Höhenzug am östlichen Rand der Halbinsel Sundewitt oberhalb von Düppel aufgeworfenen Schanzen für Dänemark zum neuen Kristallisationspunkt nationalen Stolzes werden. Zwar waren auch sämtliche dieser zehn Schanzen am 18. April 1864 innerhalb nur weniger Minuten verloren gegangen, aber die dänische Armee hatte zuvor dort wochenlang dem gewaltigen preußischen Artilleriefeuer getrotzt und bis zuletzt tapfer um die befestigten Stellungen gerungen. Gerade der verlustreiche Tag von Düppel sollte damals erheblich zu Dänemarks Bereitschaft beitragen, den Kampf gegen die Deutschen auch in scheinbar aussichtslos gewordener Lage fortzusetzen.
Freilich lagen auch die Reste der Düppeler Schanzen nach dem Wiener Friedensschluss vom 30. Oktober 1864 nicht mehr auf dänischem Staatsgebiet, und die Karriere des Schlachtortes als nationale Erinnerungsstätte begann dann auch erst nach dem Ersten Weltkrieg, als mit der Volksabstimmung von 1920 der Sundewitt und die benachbarte Insel Alsen wieder an Dänemark zurückfielen. König Christian X.(1) nahm damals das Land feierlich in Besitz und ließ auch innerhalb der von den Preußen erweiterten alten Schanzen eine Gedenktafel anbringen. Kein anderer Ort repräsentierte das nationale Trauma von 1864 und die späte Heilung der damals geschlagenen Wunden seither so wirkungsmächtig wie Dänemarks »neues Danewerk«, die Schanzen von Düppel.
Kein Name in Dänemark habe einen solchen Klang«, erklärte König Frederik IX.(1) noch anlässlich der großen Gedenkveranstaltung am 18. April 1964 in einer spontanen Rede auf den Düppeler Höhen (Dybbol Banke) und bezog in sein Gedenken auch die dänische Bevölkerung ein, die 56 Jahre lang zäh gegen eine Fremdherrschaft und eine fremde Sprache angekämpft habe.[2]
Auch ein halbes Jahrhundert später schien die Prominenz von Düppel ungebrochen zu sein. In dem 2014 mit einem Rekordbudget produzierten dänischen Historiendrama über den Krieg gegen Preußen und Österreich muss sich eine versprengte Gruppe dänischer Soldaten vom Danewerk bis nach Düppel zurückschlagen. Als sie endlich in der Nacht auf ein preußisches Feldlager stoßen, können sie bereits in der Ferne die Düppeler Mühle im Mondlicht erkennen. Keiner der Soldaten verliert darüber ein Wort, und fast jeder dänische Zuschauer weiß, ohne dass es ausgesprochen werden müsste, dass für die erschöpften Männer ihr Ziel in diesem Moment zum Greifen naheliegt.
Inzwischen steht die im Verlauf der Kämpfe zerstörte, aber schon bald wieder aufgebaute Düppeler Mühle sogar allein für den »18. April«, da die alten dänischen Schanzen schon kurz nach der Schlacht von den siegreichen Preußen zugunsten zweier größerer Befestigungen abgetragen worden waren. So wurde die Mühle für viele Dänen das prominente Symbol für den gegen eine erdrückende Übermacht verlorenen Krieg, den Dänemark nicht zuletzt auch zur Verteidigung seiner liberalen Novemberverfassung von 1863 gegen die beiden reaktionären deutschen Vormächte geführt hatte.[3] Für jeden Dänen hatte es damals auf der Hand gelegen, dass auch das staatsrechtlich nicht gebundene Schleswig trotz der entgegenstehenden Verbote des Zweiten Londoner Protokolls von 1852 in die neue Lösung einbezogen werden musste. Die ständigen Einmischungen der Deutschen unter Berufung auf den uralten Ripener Vertrag von 1460 in die Verhältnisse eines Herzogtums, das weder zum Alten Reich gehört hatte, noch Teil des Deutschen Bundes war, empfand man nördlich der Schlei als übergriffig. Es würde ehrlicher gewesen sein, wenn die Deutschen ihre Eroberungsabsichten ganz gerade heraus ausgesprochen hätten, ohne den Versuch einer Rechtsverdrehung, hatte schon 1848 der Kopenhagener Rechtsprofessor und Abgeordnete der Liberalen, Andreas Frederik Krieger(1), geklagt.[4]
Die Düppeler Höhe blieb auch in den Dekaden seit der Hundertjahrfeier mit hochrangiger Beteiligung der zentrale Ort des Gedenkens der Nation an ihren letzten Krieg mit jährlichen Kranzniederlegungen, patriotischen Reden und symbolischen Märschen von der Höhe hinab nach Sonderburg. 1992 wurde unweit der Mühle auch das gleichnamige Geschichtszentrum mit einer zunächst noch auf die dänischen Verteidiger fixierten Ausstellung eröffnet. Es war dasselbe Jahr, als der Außenseiter Dänemark mit einem Endspielsieg gegen die favorisierte bundesdeutsche Elf Fußballeuropameister wurde und viele Dänen in diesem überraschenden Erfolg dann auch eine späte symbolische Revanche für »1864« sahen.[5] Für zeitweilige Diskussionen sorgte zuletzt die vom Sonderburger Garnisonskommandanten 2002 initiierte Beteiligung einer offiziellen Delegation der Bundeswehr, in der jedoch nicht wenige Dänen nur eine neue Form deutscher Übergriffigkeit sahen.[6] Wie schwierig das erinnerungspolitische Terrain auf Seiten der Dänen nach wie vor ist, zeigt sich auch in der bereits erwähnten und von dem bekannten Filmemacher Ole Bornedal(1) produzierten Kurzserie 1864 aus dem Jahre 2014, in der frei erfundene schwarze Totenkopfhusaren mit entmenschlichten Zügen dänische Gefangene ermorden.
Einer gemeinsamen Würdigung der Ereignisse von 1864 steht vor allem aber entgegen, dass die Dänen damals einen ganz anderen Krieg als die Deutschen hatten führen müssen. Für das kleine Dänemark war er ein existenzielles Ereignis, eine zuletzt sogar die eigene Unabhängigkeit bedrohende Katastrophe, für Preußen-Deutschland dagegen nur der unspektakuläre Prolog zu zwei weiteren siegreichen »Einigungskriegen«. Großbritanniens damaliger Premierminister Henry John Temple, der dritte Viscount of Palmerston(1), nannte den Krieg sogar ein Ereignis, auf das jeder ehrenhafte und großmütige Deutsche zukünftig nur voller Scham zurückblicken könne.[7] Nur wenige Deutsche außerhalb Schleswig-Holsteins dürften heutzutage wohl von der Düppeler Mühle gehört haben, kaum größer wird der Kreis derer sein, denen der Krieg von 1864 noch ein Begriff ist, wobei auch dieses bescheidene Erinnern durch eine weitere Asymmetrie geprägt sein dürfte. Während Preußen-Deutschland nach »1864« noch in weit gewaltigeren Schlachten und schließlich sogar in zwei Weltkriegen kämpfte, war es für Dänemark bereits die letzte Schlacht und der Beginn seiner Existenz als beinahe vergessener Kleinstaat am Rande Europas. Erst 2003 sollte das Land mit seiner langen Tradition der Neutralität brechen und seine Söhne und dieses Mal auch seine Töchter wieder in einen Krieg schicken.
Bemerkenswerterweise war diese besondere dänische Sicht auf »1864« gar nicht so weit von der Haltung Otto von Bismarcks(2) entfernt. Auch für den »Reichsgründer« war der von den Dänen zwar provozierte, aber von ihm maßgeblich geprägte Krieg weit mehr als nur ein bescheidener Prolog. So musste er sich damals gegen eine stattliche Übermacht politischer Gegner selbst im eigenen Lager durchsetzen und seine tiefen Absichten einer Vergrößerung Preußens um die drei nordelbischen Herzogtümer lange geheim halten. Am Ende aber sei der Krieg gegen Dänemark die diplomatische Kampagne gewesen, auf die er am stolzesten sei, erzählte Bismarck noch sieben Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches auf seinem pommerschen Gut Varzin in vertrauter Runde. Der König habe ihm damals, als er zum Fürsten erhoben wurde, Elsass und Lothringen ins Wappen geben wollen, er hätte aber lieber Schleswig und Holstein drin gehabt.[8] Von allen denkbaren Ausgängen war zu Beginn des Konfliktes die Annexion der beiden umstrittenen Herzogtümer durch Preußen fraglos der unwahrscheinlichste, und noch in der Sitzung des preußischen Kronrates vom 4. Januar 1864 hatte der Ministerpräsident mit seinem genau darauf zielenden Bekenntnis großes Unverständnis und sogar Bestürzung ausgelöst.[9]
Um die Einigung Deutschlands war es Bismarck(3) in der nordelbischen Causa tatsächlich nie gegangen. Ganz nach seinem schon früh gefassten Entschluss hatte Preußen 1864 mit Österreich an seiner Seite einen klassischen Hegemonialkrieg gegen Dänemark geführt, und viele deutschsprachige Schleswig-Holsteiner, so etwa der aus Husum stammende Dichter und Rechtsanwalt Theodor Storm(1), fühlten sich dann auch nach ihrer staatsrechtlichen Annexion durch Preußen im Jahre 1867 nicht wie ein befreiter, sondern als »besiegter Stamm«.[10] Allenfalls im Rückblick ließe sich daher vom ersten deutschen Einigungskrieg reden. Otto von Bismarck hatte auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ausschließlich preußische Politik betrieb. Das Nationale war dem späteren »Reichsgründer« nur Mittel, nie Zweck. Schon in seiner berühmten Verteidigung der umstrittenen Olmützer Punktation mit Österreich hatte der damalige Abgeordnete im Dezember 1850 im preußischen Landtag in aller Klarheit zum Ausdruck gebracht, dass Preußen niemals das Schwert für die gefährlichen Phantasien der liberalen Nationalbewegung ziehen dürfe. Auch das Protestgeschrei der deutschen Patrioten vermochte ihn nach dem überraschenden Tod König Frederiks VII.(1) am 15. November 1863, des letzten dänischen Herrschers aus dem Hause Oldenburg, nicht davon abzubringen, die Möglichkeit eines neuen deutschen Mittelstaats unter dem im ganzen Land favorisierten Augustenburger Erben, Friedrich VIII.(1), mit allen Mitteln zu bekämpfen. Ein unabhängiges Schleswig-Holstein unter einem souveränen deutschen Fürsten hätte aus seiner Sicht nur Österreich im Deutschen Bund gestärkt, wobei allerdings Preußen die Begleichung der Zeche überlassen worden wäre. Vor die Wahl gestellt, hätte Bismarck(4) daher lieber die nordelbischen Herzogtümer weiterhin in Personalunion mit Dänemark vereint gesehen. Von seinem entrüsteten Monarchen(1) hatte er sich deswegen sogar einmal fragen lassen müssen, ob er denn nicht auch ein Deutscher sei?[11]
Die »preußische Lösung« für Schleswig und Holstein hat Bismarck(5) aber offenbar erst dann ernsthaft angestrebt, als sich die Dänen im November 1863 entnervt und der wiederholten deutschen Einmischungen überdrüssig vom Londoner Protokoll verabschiedeten und der preußische Ministerpräsident das Habsburger Kaiserhaus, das die Furcht vor dem politischen Selbstbestimmungsrecht der Völker umtrieb, sicher auf seiner Seite wusste. So lange die beiden deutschen Vormächte auf europäischer Bühne gemeinsam agierten, sollten sie für die übrigen Mächte und selbst für Großbritannien unangreifbar bleiben. »Wir haben Europa die Stirn bieten können, solange wir unser Vertrauen auf niemand weiter als aufeinander setzten«, schrieb Bismarck werbend und zugleich mahnend nach dem Wiener Vorfrieden an Österreichs Außenminister Johann Graf von Rechberg(1).[12] Dies war fraglos die wichtigste Lehre, die der preußische Ministerpräsident aus dem Krieg von 1864 gezogen hat. Die Zusammenarbeit mit dem altehrwürdigen Kaiserstaat unter einvernehmlicher Teilung der Einflusssphären in Deutschland schien ihm die sicherste Gewähr für Preußens europäische Großmachtrolle und war im August 1864 auch Gegenstand langer, jedoch ergebnisloser Verhandlungen in Schönbrunn gewesen.[13] Den Krieg von 1866 hat Bismarck(6) schließlich nur sehr ungern begonnen, und auch erst dann, als ihm klar wurde, dass der österreichische Kaiserstaat seinen längst anachronistischen Anspruch auf Vorrang unter allen deutschen Staaten nicht freiwillig zedieren wollte. Erst im Zweibund von 1879 sollte sich Bismarcks dualer Kerngedanke wenigstens im Ansatz realisieren, wobei nur ein Menschenalter nach Preußens Demütigung in Olmütz jetzt Österreich die ungeliebte Rolle eines Juniorpartners zufiel.
I.
Prolog – Der große »Oprur« von 1848/51
1
Eine ehemalige Großmacht am Rande Europas
»Trotzdem beherrschte alle eine lähmende Verbitterung. Die Dichter schrieben und die Leute lasen, aber über die schweren Erschütterungen und Verluste kamen sie trotz aller lächelnder Idylle nicht hinweg. Es war allzu deutlich, dass das Ansehen des Landes in Europa tief gesunken war. Dänemark zählte nicht mit. Fremde kamen nach Dänemark und schilderten es mit herablassender Verachtung. In den Herzen war die Erinnerung an das Reich vor der Katastrophe lebendig.«
Palle Lauring(1), Geschichte Dänemarks[1]
Dänemark sei nun ein »armes kleines Land« geworden, hörte der junge Schiffsprediger auf dem Ostasiensegler »Christianshavn«, Poul Martin Möller(1), die dänischen Kaufleute selbst im fernen Java das Schicksal ihres Heimatstaats in den Jahren nach Napoleons(1) Sturz beklagen. Seine zu lange aufrechterhaltene Bündnistreue zu dem untergehenden Stern des Korsen hatte die einstige nordische Großmacht am 14. Januar 1814 im Frieden von Kiel mit der Abtretung von ganz Norwegen an Schweden bezahlen müssen.[2] Eine Zeit lang war von den Wiener Kongressmächten sogar die Fortexistenz des gesamten Staates in Frage gestellt worden. Nach Napoleons(2) zweiter Abdankung hatten die siegreichen Großmächte jedoch auch die Vertreter Dänemarks in die habsburgische Hauptstadt eingeladen und ihnen sogar den Erwerb von Lauenburg an der Elbe in Aussicht gestellt.[3] Das kleine Herzogtum mit seinen 40 000 Einwohnern war freilich nur eine bescheidene Entschädigung für das verlorene Norwegen und konnte weder König Frederik VI.(1) noch seinen leitenden Minister Otto Joachim von Moltke(1) über den Verlust dieses den Dänen so eng verwandten Volkes trösten.
Für Dänemark war die Zeit seit 1814 nach dem rückblickenden Urteil des einflussreichen Theologen und Gründers der dänischen Volkshochschulen, Nikolai Frederik Grundtvigs(1), ein Wellental gewesen, in dem seine Bewohner in Armut, Missmut, Ohnmacht und Gleichgültigkeit verfallen waren.[4] Nicht allein sein deutlich geschmälerter Umfang machten das benachbarte Königreich in den Augen des schwedischen Historikers und Dichters Erik Gustaf Geijer(1) zu einem schwachen Staat. Der Professor aus Uppsala hatte im Sommer 1825 zwei Wochen lang die Insel Seeland und Kopenhagen besucht und in einem Brief an seine Frau darüber geklagt, dass vor allem der Absolutismus unter Frederik VI.(2) die meisten Dänen korrumpiert habe. Zwar weise wohl keine Despotie ein milderes Aussehen auf, doch lähme oder zerstöre sie auch jegliche Initiative unter ihren Bürgern. Ein öffentliches Leben, so Geijer, existiere in Dänemark nicht einmal in der Hauptstadt.[5] Der früh gealterte König, der noch als junger Herrscher die Bauern seines Landes vom Frondienst befreit hatte, war längst zum Symbol des politischen Beharrens geworden. Bei Audienzen pflegte er unbeweglich an seinem Tisch zu stehen und die Bittsteller mit einem kurzen Nicken und mit der zu einem geflügelten Wort gewordenen Bemerkung zu verabschieden: »Dann mag er ein Gesuch einreichen.« Frederik VI.(3) galt als sparsam, pflichtbewusst und bürgernah, und versuchte auch, ihm zu Ohren gekommene Missstände sogleich abzustellen, aber den früheren Mut zu großen Reformen fand er nicht mehr.[6] So schien der politische Apparat in Kopenhagen von Stillstand geprägt zu sein. Als der aus Holstein stammende Diplomat in dänischen Diensten, Johann Georg Rist(1), nur ein Jahr nach Geijer(2) die Hauptstadt besuchte, fand er die »Sprungfeder des Staates mehr und mehr erschlafft« und sprach von einem »klappernden, kreischenden Räderwerk«, aus dem jeder Geist entschwunden sei.[7]
Dänemark sah sich in den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts nicht nur auf den Rang eines Kleinstaats mit weniger als zwei Millionen Einwohnern reduziert. Auch die Wirtschaft des Landes erholte sich nur langsam. Der Verfall der Kornpreise hatte Gutsbesitzer und Bauern im gesamten Königreich ruiniert. Erst 1828 sollte für sie eine Besserung eintreten, als Großbritannien seine hohen Einfuhrzölle endlich senkte. Dagegen sollte die noch vor 100 Jahren sämtliche Meere besegelnde dänische Handelsflotte ihre einstige Bedeutung nicht mehr wiedererlangen. Bereits im September 1807 war Dänemarks stolze Kriegsflotte aus 15 Linienschiffen, zehn Fregatten und fünf Korvetten im Anschluss an die viertägige Bombardierung Kopenhagens durch ein britisches Geschwader samt allen Magazinen konfisziert worden.[8] Der kostspielige Bau einer neuen Flotte belastete nach 1815 die dänische Staatskasse so sehr, dass für die Unterhaltung des Heeres nur noch wenige Mittel übrigblieben. Die militärische Ausbildung litt seither unter der geringen Präsenzstärke der Regimenter, und leere Pensionskassen zwangen Hauptleute und Majore, weit über die Altersgrenze hinaus im Dienst zu verharren. Etliche junge Offiziere wie der aus dem mecklenburgischen Parchim stammende Absolvent der Kopenhagener Kadettenanstalt, Helmuth von Moltke(1), bevorzugten daher eine militärische Laufbahn im Ausland. 1822 trat er mit Erlaubnis des Königs(1) und unter Verzicht auf sämtliche zuvor erworbenen Vergünstigungen in die Preußische Armee ein.[9]
Auch nach der schmerzlichen Zäsur von 1814/15 klammerte sich Dänemarks absolutistische Regierung an die überkommene Idee des übernationalen Gesamtstaats, wofür die Behauptung der von Frederik VI.(4) in Personalunion regierten Herzogtümer Holstein, Schleswig und Lauenburg sowie der verbliebene Streubesitz in Übersee eine freilich recht brüchige Begründung abgab.
Als Herzog von Holstein und von Lauenburg war König Frederik VI.(5) auch deutscher Bundesfürst. Wie die anderen Souveräne des auf dem Wiener Kongress beschlossenen Deutschen Bundes, einer nur losen Nachfolgeorganisation des 1806 erloschenen mittelalterlichen Reiches, besaß der dänische Monarch und mit ihm die Könige der Niederlande (für Luxemburg) und Großbritanniens (für Hannover) das Recht, einen ständigen Vertreter in die im Frankfurter Palais Thurn und Taxis tagende Bundesversammlung zu entsenden. Die Rechte und Pflichten der zunächst 34 souveränen Staaten und der vier freien Städte waren im Juni 1815 in der Bundesakte festgelegt und schließlich fünf Jahre später in der ergänzenden Schlussakte einstimmig bekräftigt worden. Eine Regierung mit einem Staatsoberhaupt gab es nicht mehr, wohl aber ein Bundesheer, dessen Kontingente von den Mitgliedsstaaten zu stellen waren und das nach Maßgabe der Bundesversammlung auch zur Durchsetzung von Bundesbeschlüssen gegen widerstrebende Mitgliedsstaaten eingesetzt werden konnte. Gerade die Nachfolger Frederiks VI.(2) sollten später wegen ihrer Versuche, Holstein fester in den dänischen Staatsverband einzufügen, wiederholt mit der Bundesexekution bedroht werden.
Unklar blieb dagegen besonders aus Sicht der deutschen Patrioten der staatsrechtliche Status des Herzogtums Schleswig. Wegen seiner gemischten Bevölkerung bildete es zwar seit jeher eine Übergangsregion zwischen Dänen und Deutschen, gehörte aber nach Auffassung der Krone schon seit der Einführung des Königsgesetzes im Jahre 1721 dem dänischen Staatsverband an.
Der überwiegend deutschsprachige Teil der Schleswiger südlich der Linie Tondern-Flensburg fühlte sich jedoch mehr mit den Holsteinern verbunden als mit den Dänen in Jütland, Fünen oder Seeland. Vor allem in Holstein lagen die ökonomischen Zentren der dänischen Monarchie. Mit rund 30 000 Einwohnern war Altona damals die zweitgrößte Stadt des Königreiches. In Holstein entstand auch 1844/45 die erste Eisenbahn Dänemarks, die nach Kiel und Rendsburg führte, und hier verliefen über die Häfen von Hamburg und Lübeck die wichtigsten Handelsströme des Landes. Keineswegs vergessen hatten die Holsteiner und die Deutschen in Schleswig den im Januar 1813 unternommenen Versuch der dänischen Krone, durch die Gründung einer Reichsbank und die Einführung einer Papierwährung den drohenden Staatsbankrott der Monarchie abzuwenden. Mit ihrer eigenen, bis dahin durch Silber gedeckten Währung waren beide Herzogtümer damals besonders hart getroffen worden, und man fürchtete seither, dass vor allem die deutschen Untertanen des Königs den bitteren Preis für die verfehlte Bündnispolitik des Landes zu entrichten haben würden.
2
»Up ewig tosamende ungedeelt« – Die Erfindung von Schleswig-Holstein
»Ich werde nicht auf die ermüdenden Einzelheiten der sogenannten Schleswig-Holstein-Frage eingehen. Sie ist in die größte Dunkelheit früherer Zeiten gehüllt. Ich möchte nur sagen, dass sich die deutschen Advokaten auf eine Zeit bis 1460 beziehen und die damaligen Transaktionen als Grund anführen, warum sie eine engere Verbindung zwischen Schleswig und Holstein aufrechterhalten sollten. Ich kann nur sagen, dass, wenn die Staaten Deutschlands und insbesondere Preußen, das Jahr 1460 als Ausgangspunkt für die territorialen Beschränkungen wählen, sie besser bei sich selbst anfangen sollten, und Preußen sollte besser zu dem zurückkehren, was es 1460 war; und was einige der anderen deutschen Staaten betrifft, so glaube ich nicht, dass sie diese Regel für sich bequemer fänden als ihre Anwendung auf Dänemark.«
Rede des Premierministers Lord Palmerston(2) (Henry Temple) vor dem britischen Unterhaus am 23. Juli 1863.[10]
Es war wohl kaum ein Zufall, dass ausgerechnet in diesen bedrückenden Jahren des Neubeginns nach Napoleons(3) Untergang wieder ein uraltes Dokument von eher antiquarischem Wert ans Tageslicht befördert wurde, das sich jedoch für die Entwicklung der deutsch-dänischen Beziehungen in den folgenden Dekaden als geradezu verhängnisvoll erweisen sollte. Ein im Jahre 1460 im nordschleswigschen Ripen feierlich besiegeltes Abkommen der Stände beider Länder mit König Christian I.(1) hatte mit seiner ersten Klausel bestimmt, dass Schleswig und Holstein auch nach dem 1459 eingetretenen Tod des letzten der Schauenburger Herzöge up ewig tosamende ungedeelt bleiben sollten. Die Wiederauffindung des längst vergessenen Vertrages verdankte sich den Bemühungen des jungen Kieler Professors für Geschichte, Friedrich Christoph Dahlmanns(1).[11] In seiner am 7. Juli 1815 an der Universität vor den Stadthonoratioren, Mitprofessoren und Studenten gehaltenen »Waterloo-Rede« betonte der aus Wismar stammende Gelehrte und spätere Abgeordnete der Frankfurter Paulskirche unter Berufung auf den Ripener Vertrag, dass Schleswig mit Holstein in »Verfassung, Freiheiten und Gerechtsamen innigst verschmolzen« sei. Zwar hätten die Schleswiger nie zum Alten Reich gehört, seien aber durch die ihnen eng verbundenen Holsteiner gleichfalls stets Teil der Deutschen Nation gewesen. Auch wenn Dahlmann(2) antidänische Töne sorgfältig vermied, schien er jedoch mit seinen Ausführungen, die er pathetisch mit dem Ausruf: »Heil den Deutschen, welche aus tiefer Noth Errettung gefunden haben« durchaus nicht den Empfindungen aller seiner Zuhörer entsprochen zu haben. Viele standen damals noch loyal zur dänischen Krone und hielten seine Rede für zu deutsch. Auch König Frederik VI.(6) erklärte, nachdem er den Text gelesen hatte, dass sie besser nie gehalten worden wäre. Offenbar erschienen ihm aber Dahlmanns(3) Thesen eher abwegig als gefährlich. Jedenfalls beließ er den politisierenden Professor im Amt.[12]
Tatsächlich war die gut 350 Jahre zuvor in Ripen beschworene Einheit schon bald danach wieder in Vergessenheit geraten. Nach 1562 hatten sich die Stände beider Herzogtümer nie mehr gemeinsam versammelt, und schon im Laufe des 16. Jahrhunderts waren die so feierlich auf ewig verbundenen Herrschaftsgebiete unter den drei Linien des neuen regierenden Hauses Oldenburg nach und nach zu einem Flickenteppich kleiner und kleinster Territorien aufgeteilt worden. Nicht einmal mehr die alten Landesgrenzen entlang der Eider hatten dabei noch Beachtung gefunden. Erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts waren beide Herzogtümer allmählich wieder in alter Form erstanden und zugleich vollständig in den Besitz der dänischen Monarchen gelangt. Zunächst war während des Großen Nordischen Krieges der minderjährige Herzog Karl Friedrich(1) von Schleswig-Holstein-Gottorf von dänischen Truppen aus seinen schleswigschen Besitztümern vertrieben worden, nachdem sein leitender Minister unter Missachtung der Neutralitätspflicht dem schwedischen Feldherrn Magnus Graf von Stenbock(1) die Festung Tönning überlassen hatte. Nach dem Friedensschluss mit Schweden im Jahre 1721 hatte König Frederik IV.(2) sodann die Gunst der Stunde genutzt und alle Stände des Landes auf das dänische Königsgesetz von 1665 schwören lassen, das auch eine weibliche Erblinie einschloss.[13] Ein halbes Jahrhundert danach verzichtete Großfürst Paul, der spätere Zar und Enkel des vertriebenen Gottorfers Karl-Friedrich, auf sämtliche seiner mit Schleswig und Holstein verknüpften Ansprüche. Als endlich auch Herzog Friedrich Heinrich Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg(1) im Jahre 1779 verstorben war, hatte König Christian VII.(1) auch dessen Besitzungen in Holstein übernehmen können. Die staatsrechtliche Stellung dieses alten Reichsherzogtums und besonders seine männliche Erbfolge ließ die dänische Krone damals jedoch unangetastet.
Obwohl beide deutschsprachigen Herzogtümer auch danach nicht mehr als die gemeinsame Regentschaft des Königs mit dem dänischen Kernland verband, waren ihre Landeskollegien und zentralen Verwaltungsorgane seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Kopenhagen angesiedelt.
Friedrich Christoph Dahlmann(4) war bereits nach anderthalb Jahrzehnten erfüllter Lehrtätigkeit in Kiel einem Ruf der Universität Göttingen gefolgt, als im europäischen Revolutionsjahr 1830 der auf seiner Heimatinsel Sylt als königlicher Landvogt amtierende Uwe Jens Lornsen(1) unter dem Titel »Über das Verfassungswerk in Schleswigholstein« eine viel beachtete Flugschrift herausbrachte. Der für die dänische Krone provozierende Text zirkulierte in 9000 Exemplaren und forderte erstmals eine gemeinsame Repräsentativverfassung für beide Länder. Sämtliche Zentralbehörden für die Herzogtümer sollten nach Kiel verlegt und außerdem ein Oberster Gerichtshof für Schleswig-Holstein eingerichtet werden. Obwohl er während seiner Jenaer Studentenzeit auch mit deutschnationalen Studentenvereinigungen in Kontakt geraten war, schien der 37-jährige Lornsen einen Anschluss Schleswigs an den Deutschen Bund zunächst nicht angestrebt zu haben. Die gefährliche Frage nach der Integrität des dänischen Gesamtstaats war mit seiner mutigen Schrift jedoch erstmals aufgeworfen, und Lornsen, der zwei Jahre in Kiel Jura studiert und dort auch Vorlesungen von Dahlmann(5) besucht hatte, musste bald nach seiner Aktion wegen Verletzung seiner Treuepflicht gegenüber dem König eine einjährige Haft in der Festung Friedrichsort antreten. Gebrochen wanderte Lornsen(2) nach seiner Freilassung zunächst nach Brasilien aus, kehrte jedoch einige Jahre später wegen einer Krankheit nach Europa zurück und ertränkte sich 1838, von Depressionen geplagt, im Genfer See.[14]
Inzwischen aber hatte die auf eine größere Unabhängigkeit zielende Bewegung in Holstein wie auch in Schleswig an Stärke gewonnen. Mit eigenen Zeitungen und zahlreichen Sängerfesten verschafften sich ihre Protagonisten seit dem Ende der 1830er Jahre mit ihrem Wunsch nach Eigenständigkeit und Abgrenzung beider Herzogtümer von Dänemark wachsendes Gehör. Großer Beliebtheit erfreute sich auch das 1841 erstmals veröffentlichte Schleilied des Apenrader Arztes August Wilhelm Neuber(1) von den Up ewig ungedeelten. Als wichtigste politische Bühne dienten den Holsteinern und den Schleswigern jedoch die von König Frederik VI.(7) nach dem Revolutionsjahr 1830 endlich zugestandenen neuen Provinzialstände. Sie waren erstmals 1834 in Itzehoe und in der Stadt Schleswig zusammengetreten, sollten aber getrennt tagen.[15]
Gegen die drohende Vereinnahmung durch die deutsche Mehrheit in Schleswig begannen sich jedoch Fürsprecher der dänischsprachigen Bevölkerung und ihrer Kultur im nördlichen Teil des Herzogtums zu wehren. Bereits 1831 hatte der Kieler Professor Christian Paulsen(1) eine – ironischerweise noch in Deutsch verfasste – Denkschrift in Kopenhagen eingereicht, in der er dafür plädierte, überall dort in Nordschleswig die dänische Rechtssprache einzuführen, wo bereits das Dänische in den Schulen und den Kirchen vorherrschte.[16] Der damit befeuerte Sprachenstreit legte fraglos den Keim zu dem späteren nationalen Gegensatz zwischen Dänen und Deutschen. Rasch machten jetzt auf beiden Seiten abschätzige Bilder die Runde. So zeichnete etwa der einflussreiche Theologe Grundtvig(2), der später auch die patriotische Zeitschrift Danskeren (»Der Däne«) herausgab, das Bild von den herrschsüchtigen Deutschen, denen er gern seine »friedliebenden« Landsleute gegenüberstellte. Wachsenden Zulauf unter Nordschleswigern und Jütländern fand ein seit 1843 auf der Skamlinksbanken bei Kolding organisiertes Volksfest. Anlässlich der zweiten Feier im folgenden Jahr stimmten dort Studenten aus Kopenhagen im Beisein von Grundtvig zum ersten Mal unter dem Jubel der 8000 Besucher das Lied »Es gibt ein lieblich Land« (Der er et yndigt Land) an, das später zur Nationalhymne Dänemarks wurde.[17] Dänische Nationalisten wie Orla Lehmann(1) forderten inzwischen sogar vehement ein »Dänemark bis zur Eider« und damit den festen Einschluss ganz Schleswigs in den dänischen Staatsverband. Der im Jahre 1810 in Kopenhagen geborene Lehmann entstammte zwar einer holsteinischen Familie, war aber in der dänischen Hauptstadt aufgewachsen und Schüler der dortigen Borgerdydskole gewesen. Während seines Studiums an der Kopenhagener Universität hatte er gemeinsam mit dem Schriftsteller Hans Christian Andersen(1) die Werke Goethes(1) und Heines(1) studiert. Der dänische Liberalismus hatte Lehmann seither geprägt, und wegen seiner scharfen Opposition gegen den Absolutismus der Krone war er Anfang 1842 sogar zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das hatte den eifrigen Publizisten und Delegierten für den achten Hauptstadtdistrikt jedoch nicht daran hindern können, nur wenige Wochen nach seiner Entlassung anlässlich einer Feier zum Jahrestag der Ständeversammlungen in Kopenhagen betont kämpferisch die Grundzüge seines eiderdänischen Programms darzulegen. Lehmanns(2) Ziel bestand in der Errichtung eines liberalen Nationalstaats unter voller staatsrechtlicher Einbindung Schleswigs. Der vor dem königlichen Schloss versammelten Menge hatte Lehmann damals unter großem Widerhall erklärt, dass Schleswig im Gegensatz zu Holstein in vieler Hinsicht immer schon ein Teil Dänemarks gewesen sei. Holstein möge ruhig wegbleiben, aber »unser altes Dänemark«, so Lehmanns Kampfansage an die Fraktion der Up ewig ungedeelten, werde er vehement gegen das »hochverräterische Geschrei der Nordalbinger« verteidigen. »Und sollte es nötig sein, so wollen wir mit dem Schwert den blutigen Beweis auf ihren Rücken schreiben für die Wahrheit, die da lautete: Dänemark will nicht!«[18]
Dass freilich nur im nördlichen Teil des Herzogtums überwiegend Dänen lebten, war Lehmann(3) durchaus bewusst. Er setzte jedoch darauf, durch Hebung des Selbstbewusstseins der dänischsprachigen Landbevölkerung den deutschen Einfluss in Schleswig allmählich zurückzudrängen. Nur wenige Monate später hielt der aus dem nordschleswigschen Hadersleben stammende Abgeordnete Peter Hiort Lorenzen(1) ganz im Sinne des eiderdänischen Programms in der Ständeversammlung Schleswigs seine Rede erstmals in Dänisch. Dem dagegen scharf protestierenden Grafen Joseph Carl von Reventlow-Criminil(1), der als königlicher Kommissar bei den Schleswiger Ständen amtierte, entgegnete der liberale Politiker selbstbewusst, dass er nicht verstehe, weshalb seine königliche Majestät einen Vertreter zu ihnen entsandt habe, der einer Sprache nicht mächtig sei, die im halben Herzogtum gesprochen werde.[19]
In den politischen Kreisen Deutschlands musste das Programm der Eiderdänen und vor allem Lehmanns(4) Kopenhagener Rede wie eine offene Kampfansage wirken. Schon die »Rheinkrise« von 1840, in der Frankreich nach seiner diplomatischen Niederlage in der Orientalischen Frage mit der unverblümten Forderung nach der Rheingrenze hervorgetreten war, hatte alte Nationalismen in Deutschland befeuert. Auf dem Allgemeinen Deutschen Sängerfest in Würzburg standen daher 1845 die Schleswig-Holsteiner mit ihrem von dem Schleswiger Rechtsanwalt Matthias Friedrich Chemnitz(1) verfassten Lied »Schleswig-Holstein, meerumschlungen« im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die liberal geprägten Eiderdänen empfand man in Deutschland jetzt ebenso als Unterdrücker der schleswig-holsteinischen Landsleute wie die absolutistische dänische Krone. Der Bonner Rechtsprofessor Ernst Moritz Arndt(1) bestritt sogar, dass die Dänen eine Nation seien, und sprach verächtlich von einem »eitlen und gehässigen Völckchen«.[20] Obwohl König Christian VIII.(1) den dänischen Nationalisten um Lehmann(5) gleichfalls ablehnend gegenüberstand und wie sein 1839 verstorbener Vetter entschlossen war, am Konzept des dänischen Gesamtstaats festzuhalten, hatte er freilich durch sein Sprachenedikt vom Mai 1841 Professor Paulsens(2) provozierende Ansichten bestätigt und damit die nationalen Rivalitäten unter seiner Herrschaft weiter befeuert.[21]
Für helle Empörung sorgte in deutschnationalen Kreisen jedoch auch das königliche Verbot der neuen blau-weiß-roten Fahne Schleswig-Holsteins, das Christian VIII.(2) 1845 verfügt hatte, nachdem sie ihm auf dem Weg zu seinem Sommeraufenthalt auf Föhr erstmals in den Straßen von Hadersleben in vielen Exemplaren aufgefallen war. Solche Fahnen und Embleme seien jedoch, so lautete die Begründung des verärgerten Monarchen, als Kennzeichen einer politischen Partei anzusehen und stifteten nur Unordnung im Lande. Doch weder das Zeigen der Fahne noch das Abspielen des Liedes ließen sich durch strenge Dekrete verhindern.[22]
Falls Christian VIII.(3) tatsächlich daran gelegen war, die politischen Wogen im Lande zu glätten, bewirkte sein am 8. Juli 1846 den Untertanen bekanntgegebener Offener Brief eher das Gegenteil. Noch einmal hatte der Monarch darin seinen unveränderten Standpunkt bekräftigt, dass er niemals eine Trennung der unter seiner Krone vereinigten Landesteile akzeptieren werde.[23] Zwar musste er konzedieren, dass in Holstein das alte dänische Königsgesetz (Lex Regia) mit der Berücksichtigung der weiblichen Erblinie weiterhin keine Gültigkeit hatte. Allerdings wirkte Christians Ankündigung, in seinen Bestrebungen nicht nachzulassen, die noch vorhandenen Probleme zu beseitigen und die vollständige Anerkennung der Integrität des dänischen Gesamtstaats auf den Weg zu bringen, auf viele deutsche Patrioten in den Herzogtümern wie eine Drohung. Letztlich hatte sich der Monarch mit seiner Erklärung zwischen alle Fronten begeben. Den Eiderdänen um Lehmann(6) war die alte Lex Regia ohnehin ein Dorn im Auge, da sie als überzeugte Liberale dynastische Erbfolgeregelungen grundsätzlich mit Skepsis betrachteten. Der bisherige Statthalter der Krone in den beiden Herzogtümern, Prinz Friedrich von Schleswig(1)-Holstein, Sonderburg und Augustenburg, der später nur kurz der Prinz von Noer(2) genannt werden sollte, trat aus Protest von seinem Amt zurück. Durch den Offenen Brief des Königs sah er die Erbansprüche seines älteren Bruders Christian August(1) in beiden Herzogtümern, die nach dem Tod des bisher kinderlosen Kronprinzen Frederik(3) aufleben würden, massiv in Frage gestellt.[24]
Auf Seiten der deutschen Nationalisten traten die Befürworter der Einheit Schleswig-Holsteins um den Kieler Rechtsanwalt und Publizisten Theodor Olshausen(1) sowie den königlichen Beamten Wilhelm Hartwig Beseler(1), einen einstmaligen Unterstützer Jens Uwe Lornsens(3), jetzt erstmals offen dafür ein, dass auch Schleswig dem Deutschen Bund beitreten müsse. Unter Missachtung des inzwischen von der dänischen Krone erlassenen Dekrets, das zukünftig jegliche öffentliche Erörterung der staatsrechtlichen Verhältnisse beider Herzogtümer untersagte, kündigten Olshausen und seine Mitstreiter für den 14. September 1846 im holsteinischen Notorf eine Versammlung an, auf der genau dies geschehen sollte. Die düpierte Regierung in Kopenhagen griff zum letzten Mittel und ließ Olshausen(2) verhaften und für sechs Wochen in die Festung Rendsburg einliefern. Zwar hatte sie damit kurzfristig Erfolg. Die Versammlung musste ohne Beschluss auseinandergehen, doch der Gefangene avancierte jetzt endgültig zum Volkshelden und gewann mühelos im Jahr darauf bei den Wahlen zur Provinzialständeversammlung das Mandat für Kiel.
3
Schleswig-Holstein – Kriegumschlungen
»Der dänische Krieg ist der erste Revolutionskrieg, den Deutschland führt. Und darum haben wir uns, ohne den meerumschlungenen bürgerlichen Schoppenenthusiasmus die geringste Stammverwandtschaft zu bezeigen, von Anfang an für die energische Führung des dänischen Krieges erklärt …«
Friedrich Engels(1) am 10.September 1848 in der Neuen Rheinischen Zeitung
Die Lage im Königreich blieb angespannt, als fünf Wochen vor Ausbruch der Revolution in Paris am 20. Januar 1848 im Kopenhagener Schloss Amalienborg König Christian VIII.(4) überraschend an einer Sepsis verstarb. Sein Leibarzt hatte den 61-jährigen Monarchen nach der damals noch vielfach praktizierten Standartmethode zur Ader gelassen, nachdem eine Erkältung sich zur Bronchitis ausgewachsen hatte.
Die große Verfassungsreform hatte den erst neun Jahre zuvor auf den Thron gelangten Monarchen während seiner ganzen kurzen Regentschaft beschäftigt. Die Erwartungen in Dänemark waren damals hoch gewesen, nachdem er als junger Vizekönig den Norwegern bereits 1814 in Eidsvold eine liberale Konstitution zugestanden hatte, die auch die nachrückenden Schweden akzeptieren mussten.[25] Doch erst als bei den Ständewahlen im Herbst 1847 die Nationalliberalen überall eine deutliche Mehrheit gewonnen hatten, schien dem König jene schon immer gefürchtete »gebieterische Notwendigkeit« eingetreten, die ihn jetzt bewog, eine grundlegende Verfassungsreform ernsthaft in Betracht zu ziehen. Im Dezember 1847 hatte Christian VIII.(5) daher den königlichen Kommissar bei den Ständeversammlungen, Georg Peter Bang(1), mit dem Entwurf zu einer konstitutionellen Verfassung beauftragt. Ein gesamtdänisches Parlament sollte mit gesetzgebenden Kompetenzen ausgestattet sein und erstmals frei über das Staatsbudget entscheiden können. Die Sache war dringlich, und nach dem Willen des Königs sollte Bangs Konzept bereits am 6. Januar im Staatsrat erörtert werden. Die Infektion, die sich Christian VIII. am selben Tag bei klirrender Kälte anlässlich der Verabschiedung der nach Ostasien abgehenden Korvette »Valkyrie« im Hafen von Kopenhagen zugezogen hatte, und sein bald darauf eingetretener Tod verhinderten jedoch nicht, dass Dänemark noch vor dem Heranrollen der Woge des großen Revolutionsjahres 1848 den ersten Schritt in Richtung einer konstitutionellen Monarchie wagte. Christians Sohn Frederik, der noch in der Todesnacht die Mitglieder des Staatsrats auf Schloss Christiansborg einberief, mochte anfangs offenbar noch nicht so weit gehen wie sein Vater. Eine von Bang(2) formulierte Antrittsproklamation des neuen Königs sprach zunächst nur vage von einer Neuordnung der Staatsverhältnisse, durch welche »die gegenseitige Gerechtsame der Bürger« gesichert werden sollten. Den Liberalen verweigerte Frederik VII.(4) vorerst sogar die nachgesuchte Audienz.[26]
Dänemarks neue Verfassung, die schließlich eine Woche später doch noch verkündet wurde, sah dann tatsächlich die Einrichtung von gemeinsamen Reichsständen vor, die paritätisch aus je 26 Abgeordneten des Königreiches und der drei deutschen Herzogtümer bestehen und einmal jährlich im Wechsel in Kopenhagen oder in Schloss Gottorf bei Schleswig zusammentreten sollten.
Weder die dänischen Nationalliberalen um Orla Lehmann(7) und Joachim Frederik Schouw(1) noch die Vorkämpfer eines einigen Schleswig-Holsteins unter Führung Theodor Olshausens(3) und Wilhelm Beselers(2), des vormaligen Präsidenten der Schleswigschen Ständeversammlung, konnten mit dieser Lösung zufrieden sein. Die Ersteren nahmen Anstoß daran, dass den nordelbischen Herzogtümern verfassungsrechtlich der gleiche Rang wie den dänischen Kerngebieten zugebilligt worden war, während ihre Widersacher auf deutscher Seite beklagten, dass beide Herzogtümer trotz ihrer politischen Aufwertung immer noch in getrennter Form repräsentiert sein sollten. Die Tauglichkeit der neuen Verfassung Dänemarks, die sich unübersehbar an den Interessen des dänischen Gesamtstaats orientierte, sollte freilich nie auf den Prüfstand geraten. Als am 24. Februar 1848 in Paris innerhalb weniger Stunden der 18-jährigen Herrschaft des sogenannten Bürgerkönigs Louis-Philippe(1) ein abruptes Ende bereitet wurde, war auch in Dänemark das Tor zu einer Zeitenwende aufgestoßen. Schon wenige Tage später hatte der revolutionäre Funke ganz Europa erfasst. In Kiel und in Kopenhagen, wo die alarmierenden Nachrichten aus Frankreich Anfang März die Runde machten, radikalisierten sich sofort die Fronten. In der dänischen Hauptstadt sah sich König Frederik VII.(5) unter dem Druck der Menge gezwungen, ein neues liberal-konservatives Kabinett einzuberufen. Die sogenannte Märzregierung unter Graf Adam Wilhelm Moltke(1) und Laurits Nicolai Hvidt(1) stand ganz auf dem Boden des eiderdänischen Programms, Orla Lehmann(8) gehörte ihr jedoch nur als Minister ohne Portefeuille an. Dagegen sahen die Vertreter der beiden Elbherzogtümer jetzt die Zeit gekommen, ihre Unabhängigkeit von Dänemark und den ersehnten Anschluss an Deutschland zu proklamieren. Auf einer spontanen Versammlung in Rendsburg, zu der am 18. März rund 70 Abgeordnete beider Ständeversammlungen erschienen waren, setzten sich nach elfstündiger Debatte die Vertreter eines radikalen Kurses um Olshausen(4) und Beseler(3) durch. Angesichts der Ausschmückung der ganzen Stadt mit schwarz-rot-goldenen Fahnen gaben sich die Redner äußerst selbstbewusst. Unter regem Beifall der Delegierten erklärte Olshausen, dass man Dänemark nicht mehr zu fürchten brauche. Die Dänen seien ein faules, dummes und nicht zusammengehöriges Volk. Es habe alle Achtung in Europa verloren.[27] Olshausen stand auch an der Spitze einer fünfköpfigen Delegation, die sofort nach Kopenhagen aufbrach, um dem König die Forderung nach einer gemeinsamen Verfassung für beide Herzogtümer zu präsentieren. Sogar eine allgemeine Volksbewaffnung in Schleswig-Holstein stand auf der Wunschliste der Deutschen. Lediglich die alte Personalunion mit Dänemark sollte nach dem Willen der Delegierten bestehen bleiben. Die Ankömmlinge hatten allerdings den dramatischen Wandel der Lage in Kopenhagen völlig unterschätzt. Der Empfang der Deutschen in der Hauptstadt am 22. März fiel geradezu eisig aus, und vor dem Quartier der fünf Delegierten im Hotel d’Angleterre sammelte sich schnell eine aufgebrachte Menschenmenge. König Frederik VII.(6) empfing die Abordnung aus Rendsburg erst am nächsten Tag und hörte sich unbeeindruckt deren Warnungen an. Obwohl Olshausen(5) drohte, dass das ganze Land wie ein Haufen Zündstoff sei, den angeblich schon ein einziger Funke zur Flamme entfachen könne, zeigte sich der Monarch nur zur Erfüllung einer einzigen Forderung der Deutschen bereit. Der unbeliebte Präsident der Schleswig-Holsteinischen Ständeversammlung, Ludwig Nicolaus Scheele(1), wurde sofort abgelöst.[28] Die endgültige und vom König unterzeichnete Antwort der neuen dänischen Regierung überbrachte am nächsten Tag Orla Lehmann(9) persönlich der schon zur Rückfahrt an Bord ihres Schiffes gegangenen deutschen Delegation. Schleswig dürfe zwar zukünftig eine eigenständige Verwaltung besitzen, solle aber mit Dänemark durch eine gemeinsame freie Verfassung verbunden bleiben und nicht Teil des Deutschen Bundes werden.[29]