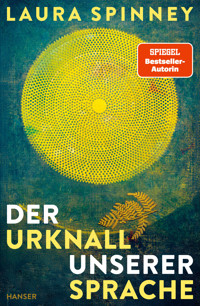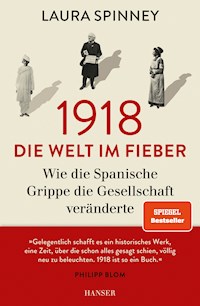
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gleichen sich die Corona-Pandemie und das Schicksalsjahr 1918? Laura Spinney in ihrem Bestseller über die Spanische Grippe als weltumspannendes gesellschaftliches Phänomen
Der Erste Weltkrieg geht zu Ende, und eine weitere Katastrophe fordert viele Millionen Tote: die Spanische Grippe. Binnen weniger Wochen erkrankt ein Drittel der Weltbevölkerung. Trotzdem sind die Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik und Kultur weitgehend unbekannt. Ob in Europa, Asien oder Afrika, an vielen Orten brachte die Grippe die Machtverhältnisse ins Wanken, womöglich beeinflusste sie die Verhandlung des Versailler Vertrags und verursachte Modernisierungsbewegungen. Anhand von Schicksalen auf der ganzen Welt öffnet Laura Spinney das Panorama dieser Epoche. Sie füllt eine klaffende Lücke in der Geschichtsschreibung und erlaubt einen völlig neuen Blick auf das Schicksalsjahr 1918.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die Spanische Grippe wird zu Unrecht als Fußnote des Ersten Weltkriegs behandelt – sie forderte wohl mehr Opfer als beide Weltkriege zusammen. Franz Kafka erkrankt Ende September 1918 in seiner Heimatstadt Prag an der Grippe und muss vom Bett aus dem Zusammenbruch des österreichisch-ungarischen Reiches zusehen. Ezra Pound beobachtet in den verregneten Straßen Londons die Auswirkungen des Waffenstillstands auf die Bevölkerung und kommt mit einem Schnupfen heim. Das dachte er zumindest. Apollinaire fiel ihr zum Opfer. Auch Woodrow Wilson erkrankte. Die Grippe traf Politiker und Schriftsteller, aber auch zu Tausenden die Männer in den Schützengräben Frankreichs, Frauen in der indischen Provinz und den Großstädten Brasiliens. Ob in Europa, Amerika, Asien oder Afrika, an vielen Orten brachte die Grippe die Machtverhältnisse ins Wanken, wahrscheinlich beeinflusste sie die Verhandlung des Versailler Vertrags und verursachte Modernisierungsbewegungen. Anhand von Schicksalen auf der ganzen Welt öffnet Laura Spinney das Panorama dieser Epoche. Sie füllt eine klaffende Lücke in der Geschichtsschreibung und erlaubt einen völlig neuen Blick auf das Schicksalsjahr 1918.
Hanser E-Book
Laura Spinney
1918 Die Welt im Fieber
Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte
Aus dem Englischen von Sabine Hübner
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Einleitung Nicht länger eine Fußnote der Geschichte
Teil 1 Als die Grippe in die Welt kam
1 Husten und Niesen
2 Leibniz’ Monaden
Teil 2 Anatomie einer Pandemie
3 Vorboten
4 Wie ein Dieb in der Nacht
Teil 3 Was macht uns so krank?
5 Krankheit mit vielen Namen
6 Das Dilemma der Ärzte
7 Der Zorn Gottes
Teil 4 Der Überlebensinstinkt
8 Kreidekreuze an den Türen
9 Der Placebo-Effekt
10 Gute Samariter
Teil 5 Post mortem
11 Die Jagd nach Patient null
12 Die Toten zählen
Teil 6 Die Wissenschaft löst ihr Versprechen ein
13 Aenigmoplasma influenzae
14 Ansteckungsquelle Bauernhof
15 Der menschliche Faktor
Teil 7 Die Welt nach der Grippepandemie
16 Erste Anzeichen der Erholung
17 Alternative Geschichten
18 Wissenschaft und Anti-Wissenschaft
19 Allgemeine Gesundheitsfürsorge
20 Krieg und Frieden
21 Melancholische Muse
Teil 8 Das Vermächtnis der Opfer
Nachwort Über das Erinnern
Danksagung
Abbildungsnachweis
Anmerkungen
Register
Für RSJF und die verlorenen Generationen
Einleitung Nicht länger eine Fußnote der Geschichte
Japanische Schulmädchen mit Atemschutzmasken während der Pandemie, 1920
»Dass die Grippepandemie 1918 nur von so kurzer Dauer war, stellte die Ärzte damals vor große Probleme (…) Seitdem sind es die Historiker, denen dieser Umstand große Probleme bereitet.«
Terence Ranger, The Spanish Influenza Pandemic of 1918–19 (2003)1
Kaiser Wilhelm II. dankte am 9. November 1918 ab, und in den Straßen von Paris jubelten die Menschen. »À mort Guillaume!«, riefen sie. »À bas Guillaume!« Tod Wilhelm! Nieder mit Wilhelm! Währenddessen lag, hoch über dem siebten Arrondissement der Stadt, der Dichter Guillaume Apollinaire auf dem Totenbett. Als herausragender Vertreter der französischen Avantgarde-Bewegung hatte sich der Mann, der den Begriff »Surrealismus« erfand und Persönlichkeiten wie Pablo Picasso und Marcel Duchamp inspirierte, 1914 als Kriegsfreiwilliger gemeldet. Nachdem er durch einen Granatsplitter eine Kopfverletzung erlitten und die anschließende Operation, bei der ihm ein Loch in den Schädel gebohrt wurde, überlebt hatte, starb er im Alter von 38 Jahren an der Spanischen Grippe und erhielt den Status »Mort pour la France«.
Das Begräbnis fand vier Tage später statt – zwei Tage nach Unterzeichnung des Waffenstillstands. Von der Kirche St. Thomas Aquinas aus zogen die Trauernden zum östlich gelegenen Friedhof Père Lachaise. »Doch als der Trauerzug die Gegend von St. Germain erreicht hatte«, erinnerte sich Apollinaires Freund und Dichterkollege Blaise Cendrars, »wurde er von einer lärmenden Menge bedrängt, die den Waffenstillstand feierte, Männer und Frauen, die singend und tanzend die Arme schwenkten, sich küssten und den berühmten Refrain schrien: »Non, il ne fallait pas y aller, Guillaume, non, il ne fallait pas y aller!«2
Der berühmte Refrain richtete sich zwar ironisch gegen den zur Abdankung gezwungenen deutschen Kaiser, war für die Freunde Apollinaires aber sehr schmerzlich.
Der Tod des Dichters steht als Metapher für das kollektive Vergessen – wir alle haben das größte Massaker des zwanzigsten Jahrhunderts aus unserem Bewusstsein gelöscht. Die Spanische Grippe infizierte jeden dritten Erdbewohner, 500 Millionen Menschen. Zwischen dem ersten Krankheitsfall, der am 4. März 1918 gemeldet wurde, und dem letzten, irgendwann im März 1920, tötete die Grippe 50 bis 100 Millionen Menschen, also 2,5 bis 5 Prozent der Weltbevölkerung – eine Spannweite, die zeigt, wie vage die Erkenntnisse über die Spanische Grippe auch heute teils immer noch sind. Im Vergleich verschiedener Ereignisse mit riesigen Opferzahlen, stellt die Spanische Grippe den Ersten Weltkrieg (17 Millionen Tote), den Zweiten Weltkrieg (60 Millionen Tote) und vielleicht sogar beide zusammen in den Schatten. Die Spanische Grippe bedeutete die größte Vernichtungswelle seit dem Schwarzen Tod im Mittelalter, ja vielleicht sogar die größte der Menschheitsgeschichte.
Doch was sehen wir, wenn das 20. Jahrhundert vor unserem inneren Auge vorbeizieht? Zwei Weltkriege, den Faschismus, den Aufstieg und Fall des Kommunismus, vielleicht einige besonders spektakuläre Episoden der Entkolonialisierung. Doch das dramatischste Ereignis von allen, obwohl es direkt vor uns steht, sehen wir nicht. Auf die Frage nach der größten Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts lautet die Antwort fast nie: die Spanische Grippe. Es überrascht die Menschen, wenn sie die Zahlen hören, die diese Epidemie umwabern. Manch einer denkt dann eine Weile nach und erinnert sich schließlich an einen Großonkel, der der Spanischen Grippe zum Opfer fiel, an verwaiste Vettern und Cousinen, die man aus den Augen verloren hat, an einen Zweig der Familie, der 1918 ausgelöscht wurde. Weltweit findet man auf fast allen über hundert Jahre alten Friedhöfen mehrere Gräber aus dem Herbst 1918 – wo die zweite und schlimmste Welle der Pandemie über die Welt hereinbrach – und die Erinnerung der Menschen spiegelt dies auch tatsächlich wider. Doch gibt es weder in London noch in Moskau oder Washington D.C. irgendein Monument, das an die Pandemie erinnert. Die Spanische Grippe schlägt sich in persönlichen Erinnerungen nieder, nicht im kollektiven Gedächtnis. Sie steht uns nicht als historische Katastrophe vor Augen, sondern bildet sich in Millionen einzelner privater Tragödien ab.
Vielleicht hat das etwas mit ihrer Gestalt zu tun. Der Erste Weltkrieg zog sich über vier lange Jahre hin, doch trotz seines Namens spielte er sich hauptsächlich an Schauplätzen Europas und des Mittleren Ostens ab. Der Rest der Welt spürte zwar den heißen Sog von dort, der sie in diesen Strudel saugen wollte, blieb aber außen vor, und tatsächlich schien der Krieg in manchen Weltgegenden sehr weit entfernt. Mit anderen Worten, der Krieg hatte einen geografischen Fokus und ein Narrativ, das sich im Lauf der Zeit entfaltete. Im Gegensatz dazu überflutete die Spanische Grippe von einem Augenblick auf den anderen den gesamten Globus. Die meisten Todesopfer gab es in den 13 Wochen zwischen Mitte September und Mitte Dezember 1918. Die Pandemie war räumlich ausgedehnt und zeitlich begrenzt, im Gegensatz zum räumlich begrenzten und zeitlich ausgedehnten Krieg.
Der afrikanische Historiker Terence Ranger hat Anfang der 2000er-Jahre aufgezeigt, dass über ein derart verdichtetes Ereignis mit einer anderen Methodik berichtet werden muss. Eine lineare Schilderung genügt nicht. Viel eher bedarf es einer Herangehensweise, wie sie die Frauen im südlichen Afrika praktizieren, wenn sie über ein wichtiges Ereignis im Leben ihrer Gemeinschaft sprechen. »Sie beschreiben es und umkreisen es dann«, schrieb Ranger, »kehren immer wieder zurück, erweitern es und fügen Erinnerungen und Vorahnungen hinzu.«3 Der Talmud, das jüdische Schriftwerk, ist ganz ähnlich aufgebaut. Auf jeder Seite wird eine Spalte antiker Texte von Kommentaren umrahmt, diese wiederum von Kommentaren zu den Kommentaren, in immer weiteren Kreisen, bis sich der Kerngedanke mit Raum und Zeit verwebt, mit der Struktur der gemeinschaftlichen Erinnerung. Vielleicht hat Rangers Empfehlung, die Geschichte der Spanischen Grippe aus weiblicher Sicht zu erzählen, noch einen zweiten Grund: Es waren meist Frauen, die die Kranken pflegten. Sie sahen und hörten, was in den Krankenzimmern passierte, sie bahrten die Toten auf und nahmen die Waisen zu sich. Sie verknüpften das Persönliche mit dem Kollektiven.
Jede Pandemie entsteht dadurch, dass ein krankheitserregender Mikroorganismus auf einen Menschen trifft. Dieses Zusammentreffen wird, neben den Ereignissen, die dazu führen, und den Ereignissen, die daraus resultieren, noch von zahlreichen anderen Ereignissen geformt, die gleichzeitig stattfinden – unter anderem sogar vom Wetter, vom Brotpreis und Einstellung zu Keimen, weißen Männern und Dschinns. Die Pandemie wirkt sich ihrerseits auf den Brotpreis, die Einstellung zu Keimen, weißen Männern und Dschinns aus – und manchmal sogar auf das Wetter. Sie ist nicht nur ein biologisches, sondern auch ein soziales Phänomen; man kann sie nicht von ihrem historischen, geografischen und kulturellen Kontext trennen. Wenn afrikanische Mütter und Großmütter ein Ereignis erzählen, erhält jener kontextuelle Reichtum Gewicht, selbst wenn das Ereignis, auf das er sich auswirkt, historisch betrachtet kaum länger als ein Herzschlag währte. Dieses Buch verfolgt den gleichen Ansatz.
Die Zeit ist reif dafür. In den Jahrzehnten unmittelbar nach der Pandemie beschäftigten sich – außer den Versicherungsmathematikern – nur Epidemiologen, Virologen und Medizinhistoriker mit ihr. Seit Ende der 1990er-Jahre jedoch ist die Zahl der historischen Darstellungen der Spanischen Grippe förmlich explodiert, was damit zusammenhängt, dass die Beschäftigung mit der Pandemie nun viele Disziplinen umfasst. Mittlerweile interessieren sich nicht nur »Mainstream«-Historiker für dieses Thema, sondern auch Ökonomen, Soziologen und Psychologen. Jedes Fach konzentriert sich auf einen anderen Aspekt, und die Summe all dieser Facetten hat unser Bild von der Spanischen Grippe verändert. Da sich solche Erkenntnisse allzu oft in Fachzeitschriften verstecken, unternimmt dieses Buch den Versuch, sie zusammenzuführen; die verschiedenen Stränge zu einem kohärenteren Bild jenes Monsters zusammenzufügen, in all seiner unglaublichen Komplexität – beziehungsweise seinem Schrecken.
Heute stehen uns nicht nur in wissenschaftlicher, sondern auch in geografischer Hinsicht komplexere Informationen zur Verfügung – denn sie erfassen die globale Ausdehnung der Katastrophe. Bisher konzentrierten sich die meisten Berichte über die Spanische Grippe auf Europa und Nordamerika. Das ging auch nicht anders, denn lange Zeit existierten systematisch gesammelte Daten nur für diese Regionen. 1998, als Experten aus aller Welt sich zum 80. Jahrestag der Spanischen Grippe in Kapstadt trafen, mussten sie zugeben, dass in weiten Teilen der Welt – Südamerika, dem Mittleren Osten, Russland, Südostasien und Festlandchina – fast nichts über die damaligen Ereignisse bekannt war. Die auf Europa und Nordamerika fokussierten Berichte verzerren das Bild aus zwei Gründen. Erstens gab es auf diesen Kontinenten durchschnittlich die niedrigsten Todesraten, sie waren also nicht repräsentativ. Und zweitens waren beide Kontinente 1918 in einen Krieg verstrickt, der Europa verheeren sollte. Das wichtigste Ereignis in Europa war zweifellos ebenjener Krieg: Frankreich verlor sechsmal so viele Menschen durch den Krieg wie durch die Grippe, Deutschland viermal so viele, Großbritannien dreimal und Italien zweimal so viele. Doch auf allen anderen Kontinenten – mit Ausnahme der Antarktis, die von beiden Katastrophen unberührt blieb – fielen mehr Menschen der Grippe als dem Krieg zum Opfer. Heute – fast 20 Jahre nach dem Gipfel von Kapstadt, während der hundertste Jahrestag der Katastrophe naht – können wir allmählich rekonstruieren, was damals in jenen Teilen der Welt geschah.
Dieses Buch wählt einen anderen Ansatz, um von der Spanischen Grippe zu berichten. Es beleuchtet das Thema aus den verschiedensten Blickwinkeln – von der Prähistorie bis zum Jahr 1918, vom Planeten bis zum Menschen, vom Virus bis zur Vorstellung davon, und umgekehrt. Im Kern geht es um die Geschichte der Spanischen Grippe – wie sie ausbrach, über unseren Planeten hinwegraste, wieder abklang und die Menschheit verändert zurückließ. Hin und wieder jedoch schwenkt der Fokus auf einzelne Gemeinschaften – auf das, was sie im Erleben der Grippe unterschied, aber auch das, was sie verband. 1918 hatten die Italoamerikaner New Yorks, die Yupik in Alaska und die Bewohner der heiligen persischen Stadt Maschhad fast nichts miteinander gemein, bis auf das Virus. Wie man jeweils mit der Pandemie umging, hing von kulturellen und anderen Faktoren ab. Deshalb geht dieses Buch in mehreren Porträts der Frage nach, wie sich die Katastrophe in verschiedenen Teilen der Welt entwickelte, und beleuchtet schlaglichtartig die tief greifenden gesellschaftlichen Implikationen einer Pandemie.
Diese Porträts erhellen auf der Weltkarte Gebiete, die zuvor im Dunkeln gelegen haben, und zeigen, wie man die Spanische Grippe in Regionen erlebte, für die 1918 das Jahr der Influenza war, nicht das Jahr des Kriegsendes. Die Porträts erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn natürlich bleiben trotzdem noch Millionen von Geschichten unerzählt. Ganz sicher war Rio de Janeiro nicht die einzige Stadt, in der ein rauschhafter Sinnentaumel nach dem Ende der Epidemie zu einem sprunghaften Anstieg der Geburtenraten führte, und ganz gewiss waren die Menschen in Odessa, Russland, nicht die einzigen, die Zuflucht bei archaischen religiösen Ritualen suchten, um sich von der Geißel der Krankheit zu befreien. Nicht nur die Inder überschritten vorübergehend strikte gesellschaftliche Grenzen, um einander zu helfen, nicht nur in Südafrika suchten Menschen der einen Hautfarbe die Schuld bei Menschen der anderen. Einerseits mag ein katholischer Bischof die Bemühungen, die Krankheit in Spanien einzudämmen, vereitelt haben, andererseits waren Missionare oft die Einzigen, die Hilfe in abgelegene Gegenden Chinas brachten. Und dann gibt es noch einen generellen Vorbehalt: Die Person, die den Text verfasst, ist – wieder einmal – Europäerin.
Die Geschichte der Spanischen Grippe wird in den Teilen zwei bis sechs des Buchs erzählt. Doch diese Geschichte ist in eine größere Geschichte eingebettet – welche davon handelt, dass Mensch und Influenzaviren 12.000 Jahre lang koexistierten und sich gemeinsam weiterentwickelten; und so erzählt Teil eins – »Als die Grippe in die Welt kam« – diese Geschichte bis zum Jahr 1918, wogegen Teil sieben, »Die Welt nach der Grippepandemie«, die Spuren der Spanischen Grippe erforscht, die bis heute unser Leben beeinflussen. Da sich Mensch und Grippe immer noch gemeinsam weiterentwickeln, richtet Teil acht »Das Vermächtnis der Opfer« den Blick in die Zukunft – auf die nächste Grippepandemie – und stellt Überlegungen an, wie wir uns für diesen neuerlichen Kampf wappnen sollten und wo aller Wahrscheinlichkeit nach unsere Achillesferse liegen wird. Zusammengenommen bilden diese Geschichten eine Biografie der Grippe – das heißt eine Geschichte des Menschen, die von der Grippe wie von einem roten Faden durchzogen wird. Ein Nachwort behandelt das Thema Erinnerung und stellt die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die Grippepandemie, die doch so tief reichende Auswirkungen hatte, heute als »vergessen« gilt.
Es heißt oft, im Ersten Weltkrieg seien Romantik und Glauben gestorben. Während die Wissenschaft das großtechnische Massensterben in Gestalt des Krieges ermöglichte, gelang es ihr nicht, dieses Sterben in Gestalt der Spanischen Grippe zu verhindern. Seit dem Schwarzen Tod im Mittelalter hat nichts mehr die menschliche Bevölkerung so stark geprägt wie die Spanische Grippe. Sie beeinflusste den Verlauf des Ersten Weltkriegs und trug möglicherweise zum Zweiten Weltkrieg bei. Sie brachte Indien der Unabhängigkeit näher, Südafrika der Apartheid, und manövrierte die Schweiz an den Rand eines Bürgerkriegs. Sie führte zu einer allgemeinen Gesundheitsfürsorge und zur Alternativmedizin, zu unserem Bedürfnis nach frischer Luft und zu unserer Leidenschaft für Sport und war vermutlich zumindest teilweise dafür verantwortlich, dass sich Künstler des 20. Jahrhunderts geradezu obsessiv mit den vielfältigen Arten befassten, auf die der menschliche Körper versagen kann. »Möglicherweise« und »vermutlich« sind unverzichtbare Einschränkungen, wenn es um die Spanische Grippe geht, weil es 1918 keine Möglichkeit gab, die Influenza zu diagnostizieren und wir deshalb nicht genau wissen, ob es sich wirklich um diese Krankheit gehandelt hat – so wie wir bis heute nicht genau wissen, ob sich im 14. Jahrhundert hinter dem Schwarzen Tod die Beulenpest (oder eine ihrer Varianten, die Lungenpest) verbarg. Unstrittig ist jedoch, dass die Pandemie von 1918 den Wandel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschleunigte und somit unsere moderne Welt mitgeformt hat.
Wenn all dies zutrifft, wie kann es dann sein, dass die Spanische Grippe für uns bis heute nur eine Fußnote des Ersten Weltkriegs darstellt? Haben wir sie wirklich vergessen? Genau dies glaubte Terence Ranger, doch wäre er heute noch am Leben, würde er vielleicht zögern, diese Behauptung zu wiederholen. Und dieses Zögern wäre einer gewaltigen gemeinschaftlichen Anstrengung geschuldet. Denn heutzutage kann man nicht von der Spanischen Grippe sprechen, ohne die Beiträge von Historikern, Naturwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern mit einzubeziehen. Die Naturwissenschaft erzählt die Geschehnisse bis an die Schwelle der Geschichte, über die Weiten der Vorzeit hinweg, die zwar auf den ersten Blick leer wirken, in Wirklichkeit aber mit unsichtbarem Gekritzel bedeckt sind – und dieses Gekritzel hat die Ereignisse 1918 ebenso stark geprägt wie alles, was später kam. Die Geschichte knüpft dort an, wo das Gekritzel lesbar wird, und die Naturwissenschaft strahlt aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. In hundert Jahren werden sich Naturwissenschaften und Geschichte ihrerseits gewandelt haben. Vielleicht wird es sogar eine Wissenschaft von der Geschichte geben, in der Theorien über die Vergangenheit mit computergestützten historischen Datenbanken abgeglichen werden.4 Höchstwahrscheinlich wird dieser Ansatz unser Verständnis so komplexer Phänomene, wie Pandemien es nun einmal sind, revolutionieren, aber er steckt noch in den Kinderschuhen. Eines jedoch steht bereits jetzt fest: Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Pandemie von 1918 zum zweihundertsten Mal jährt, werden die Historiker die heute noch bestehenden Lücken ausgefüllt und die Naturwissenschaftler die Zusammenhänge noch gründlicher ausgeleuchtet haben.
Teil 1 Als die Grippe in die Welt kam
Szene in einer belebten Straße in Bombay, ca. 1920
1 Husten und Niesen
Irgendwann um die Wintersonnenwende des Jahres 412 v.Chr. wurden die Einwohner von Perinthos, einer Hafenstadt am Marmarameer im damaligen Nordgriechenland, von Husten geschüttelt. Die Perinther klagten auch über weitere Symptome: rauer Hals, Schmerzen, Schluckbeschwerden, Lähmungen der Beine, Nachtblindheit. Ein Arzt namens Hippokrates schrieb all dies nieder, und der »Husten von Perinth« wurde die erste schriftliche Schilderung einer Krankheit, bei der es sich vermutlich um die Influenza handelte. »Vermutlich« deshalb, weil bestimmte Symptome nicht zu passen scheinen: Nachtblindheit, Lähmung der Gliedmaßen. Dass diese Symptome einbezogen wurden, bereitete den Medizinhistorikern anfangs Kopfzerbrechen, bis sie erkannten, dass Hippokrates den Begriff Epidemie anders definierte als heutzutage üblich. Tatsächlich hat Hippokrates das Wort Epidemie (wörtlich »im ganzen Volk«) als Erster im medizinischen Sinne verwendet. Davor hatte man den Begriff Epidemie auf sämtliche Phänomene angewandt, die sich in einem Land ausbreiten können, vom Nebel über Gerüchte bis hin zu Bürgerkriegen. Hippokrates jedoch beschränkte ihn auf eine Krankheit und definierte dann den Begriff Krankheit neu.
Die alten Griechen waren der Auffassung, Krankheiten seien spirituellen Ursprungs, eine Strafe der Götter für irgendein Fehlverhalten. Den Ärzten, die teils Priester, teils Magier waren, fiel die Aufgabe zu, die Götter mit Gebeten, Zaubersprüchen und Opfern zu besänftigen. Hippokrates argumentierte, Krankheitsursachen seien physischer Natur, man könne Krankheiten an den Symptomen des Patienten erkennen. Hippokrates und seine Schüler führten ein System zur Klassifizierung von Krankheiten ein, weshalb man ihn oft den Vater der westlichen Medizin nennt: Auf ihn geht unser heutiges Verständnis von Diagnose und Behandlung zurück. Er hinterließ uns auch einen grundlegenden Kodex für ärztliche Ethik, den Eid des Hippokrates, mit dem Ärzte am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn versprechen, von ihren Patienten »Schaden abzuwenden«.
Hippokrates glaubte, jede Krankheit sei das Resultat eines Ungleichgewichts der vier »Säfte« oder Flüssigkeiten, die im menschlichen Körper kreisten – schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim und Blut. Gemäß dieser Lehre produzierte der Phlegmatiker zu viel Schleim, weshalb die Behandlung im Verzehr von Zitrusfrüchten bestand. Galen, ein anderer griechischer Arzt, der ungefähr 500 Jahre nach Hippokrates lebte, verfeinerte dieses Modell und schlug vor, die menschlichen Temperamente in Kategorien einzuteilen, je nachdem, welcher Körpersaft dominierte. Schwarze Galle wurde mit Melancholie assoziiert, gelbe Galle mit cholerischem Jähzorn. Ein Phlegmatiker war gelassen, ein Sanguiniker hoffnungsfroh. Wir haben zwar bis heute die betreffenden Adjektive bewahrt, nicht jedoch das Verständnis von Anatomie und Körperfunktionen, dem diese Begriffe entsprangen. Und doch hat das galenische Prinzip die Medizin Europas gut 1500 Jahre lang beherrscht, und Galens Vorstellung, dass »Miasmen« oder giftige Luft ein Ungleichgewicht der Säfte hervorrufen könnten, war in einigen Weltregionen sogar noch im 20. Jahrhundert verbreitet.
Auch Hippokrates’ Definition einer Epidemie hat nicht überlebt. Für ihn bedeutete eine Epidemie all jene Symptome, die Menschen an einem bestimmten Ort über einen bestimmten Zeitraum hinweg entwickelten, während die Krankheit grassierte. Unter den damaligen Umständen unterschied Hippokrates nicht zwischen einzelnen Krankheiten. Später wurde der Begriff Epidemie nur noch mit einer bestimmten Krankheit assoziiert, dann mit einer bestimmten Mikrobe, schließlich mit einem bestimmten Mikrobenstamm, doch dieser Prozess der Differenzierung vollzog sich erst im Mittelalter, als die großen Seuchen die Menschen zum Umdenken zwangen. Darum litten die Menschen von Perinth, nach modernen Begriffen, wahrscheinlich an einer Kombination aus Influenza, Diphtherie und Keuchhusten – und vielleicht noch an Vitamin-A-Mangel.
Warum sollten wir uns über einen Influenzaausbruch Gedanken machen, der sich vor 2400 Jahren in Griechenland ereignete? Weil wir gerne wissen möchten, seit wann die Menschheit von Influenza-Epidemien heimgesucht wird und wie es überhaupt dazu kam. Wenn wir die ursprünglichen Zusammenhänge verstehen lernen, finden wir eher heraus, welche Faktoren für Zeitpunkt, Ausmaß und Schwere einer Epidemie verantwortlich sind. Vielleicht erhalten wir dann eine klarere Vorstellung davon, was 1918 geschah, und können künftige Epidemien vorhersagen. Vermutlich handelte es sich beim Husten von Perinth nicht um die weltweit erste Grippeepidemie. Und obwohl es bis 412 v.Chr. keine historischen Aufzeichnungen über die Grippe gibt, heißt dies nicht, dass man über die Influenza früherer Zeiten keinerlei Erkenntnisse hat. Genau wie der Mensch trägt auch die Influenza Informationen über ihre Ursprünge in sich. Wir sind wandelnde Zeugnisse unserer evolutionären Vergangenheit. Ein Beispiel dafür ist das menschliche Steißbein, ein verkümmertes Glied unserer baumbewohnenden Vorfahren. Als der Schwanz immer nutzloser wurde, bevorzugte die natürliche Selektion Individuen, bei denen ein chemisches Signal im Lauf der embryonalen Entwicklung die Verlängerung des Rückgrats abschaltete, bevor der Schwanz zu wachsen begann. Ganz selten passiert es, dass jenes Signal aufgrund eines Gendefekts nicht abgeschaltet wird. In der medizinischen Literatur existieren etwa 50 Berichte über Babys, die mit Schwänzen geboren wurden – hier erhaschen wir einen Blick auf den baumbewohnenden Primaten, von dem wir abstammen.
Das Grippevirus hat zwar keinen Schwanz, birgt jedoch andere Hinweise auf seinen Ursprung in sich. Es ist ein Parasit, das heißt, dass es nur innerhalb eines anderen lebenden Organismus oder »Wirts« überleben kann. Unfähig, sich selbst zu reproduzieren, muss es in eine Wirtszelle eindringen und den Reproduktionsapparat der Zelle übernehmen. Der Virus-Nachwuchs muss dann den betreffenden Wirt verlassen und einen neuen Wirt infizieren. Tut er das nicht, geht das Virus gemeinsam mit dem ursprünglichen Wirt zugrunde, was das Ende der Grippe bedeutet. So wie das Überleben unserer Vorfahren von ihrer Fähigkeit abhing, sich von Baum zu Baum zu schwingen, hängt das Überleben der Influenza von ihrer Fähigkeit ab, von einem Wirt zum nächsten zu springen. Und hier wird die Geschichte der Influenzaviren interessant, weil ihr Überleben als Parasiten sowohl von ihrem eigenen Verhalten als auch vom Verhalten ihres Wirts abhängt. Obwohl die Wissenschaft, was die Ursprünge der Grippe betraf, lange Zeit im Dunkeln tappte, wusste man zumindest ungefähr, wie die Menschen vor 412 v.Chr. gelebt hatten.
Die Grippe wird durch winzige infizierte Schleimtröpfchen, die beim Husten und Niesen durch die Luft geschleudert werden, von einem Menschen auf den anderen übertragen. Rotztröpfchen sind ziemlich effektive Geschosse – schließlich wurden sie quasi im Windkanal entwickelt –, aber sie können nur ein paar Meter weit fliegen. Damit sich die Grippe ausbreiten konnte, mussten die Menschen folglich nah beieinander leben. Dies war eine entscheidende Erkenntnis, denn Menschen haben nicht immer eng beisammen gelebt. Vielmehr waren sie über lange Phasen der Menschheitsgeschichte hinweg Jäger und existierten weit voneinander entfernt. All dies änderte sich vor 12.000 Jahren, als irgendwo in der Weite Eurasiens ein Jäger einen Zaun um eine Herde wilder Schafe errichtete und zum Viehzüchter wurde. Auch Pflanzen wurden domestiziert, als Saatgut, und aufgrund dieser beiden Entwicklungen konnte das Land nun mehr Menschen ernähren. So fanden die Menschen zusammen, und es entwickelten sich die für menschliche Gemeinschaften charakteristischen Phänomene wie Konkurrenz, Zusammenarbeit und Erfindergeist. Die Innovation jenes Jägers, bekannt als Agrarrevolution, markierte den Aufbruch in eine neue Ära der Menschheit.
Die durch die Landwirtschaft entstandenen neuen Kollektive bahnten neuen Krankheiten den Weg, den sogenannten »Masseninfektionskrankheiten« wie Masern, Pocken, Tuberkulose und Influenza. Schon immer war der Mensch anfällig für Infektionskrankheiten gewesen – Lepra und Malaria suchten die Menschen schon lange vor der Agrarrevolution heim –, doch hatten sich die Erreger an das Überleben in kleinen, zerstreuten menschlichen Populationen angepasst. Zu ihren Überlebenstricks gehörte, dass ein genesener Wirt nicht völlig immun wurde, sondern erneut infiziert werden konnte. Außerdem konnten sie sich, falls ein Mangel an Menschen bestand, auf einen anderen Wirt zurückziehen, ein sogenanntes »tierisches Reservoir«. Diese beiden Strategien stellten sicher, dass es stets einen ausreichend großen Pool an suszeptiblen Wirten gab.
Die Masseninfektionskrankheiten waren da anders. Sie grassierten in der bäuerlichen Bevölkerung, indem sie ihre Opfer entweder töteten oder immunisierten. Zwar infizierten sie mitunter auch andere Säugetiere, das funktionierte aber nicht so gut wie beim Menschen. Manche Erreger waren so gut an den Menschen adaptiert, dass sie ausschließlich zu Parasiten unserer Spezies wurden. Sie benötigten einen Pool aus Tausenden oder gar Zehntausenden potenziellen Opfern – daher der Name »Masseninfektionskrankheit«. Vor der Agrarrevolution hätten sie nicht überlebt, dann jedoch war ihr evolutionärer Erfolg eng mit dem Wachstum menschlicher Populationen verknüpft.
Wenn sie vor der Agrarrevolution nicht überlebt hätten, wo kamen sie dann überhaupt her? Eine entscheidende Rolle spielten die vorhin erwähnten tierischen Reservoire. Wir wissen, dass manche Krankheitserreger nur Tiere infizieren. Es gibt zum Beispiel Malariaformen, die zwar Vögel und Reptilien infizieren, aber nicht auf Menschen übertragbar sind. Wir wissen, dass manche Mikroorganismen sowohl Tiere als auch Menschen infizieren (in diese Kategorie fällt auch die Influenza), und wir wissen, dass es Mikroben gibt, die ausschließlich Menschen infizieren. Dies trifft zum Beispiel auf Masern, Mumps und Röteln zu. Nach dem heutigen Wissensstand repräsentieren die verschiedenen Kategorien der Infektionskrankheiten die evolutionären Entwicklungsphasen, durch die eine ursprünglich auf Tiere beschränkte Krankheit zu einer ausschließlich auf Menschen beschränkten Krankheit wird. Genauer gesagt kennt die Wissenschaft fünf Schritte, die ein Krankheitserreger für diese Wandlung durchlaufen muss.1 Manche Krankheiten, wie etwa Masern, haben diese Entwicklung bereits hinter sich; andere sind irgendwo unterwegs stecken geblieben. Doch sollten wir uns diesen Prozess nicht als unveränderlich vorstellen. Er ist äußerst dynamisch, wie zum Beispiel das Ebolafieber zeigt.
Das hämorrhagische Ebolafieber, das von einem Virus verursacht wird, ist in erster Linie eine Tierkrankheit. Als natürliches Reservoir des Virus gelten Flughunde, die in den Wäldern Afrikas leben und womöglich andere Tiere infizieren, die von Menschen als Buschfleisch geschätzt werden (auch Flughunde werden von Menschen verzehrt). Bis vor Kurzem betrachtete man Ebola als eine Krankheit, deren Ansteckungspotenzial für Menschen gering war: Man glaubte, dass sie zum Beispiel über den Kontakt mit Buschfleisch übertragen werde, aber ein auf diesem Weg infizierter Mensch hätte nur wenige andere Menschen anstecken können, womit der »Ausbruch« alsbald im Sande verlaufen wäre. Dies änderte sich 2014, als eine Epidemie in Westafrika zeigte, dass das Ebola-Virus die Fähigkeit entwickelt hatte, von einem Menschen auf den anderen überzuspringen.
Es ist für ein Virus nicht leicht, die Artengrenze zu überspringen. Wobei »überspringen« eigentlich ein völlig falscher Begriff ist – hilfreicher wäre, obgleich immer noch eine Metapher, die Vorstellung, dass das Virus »durchsickert«. Die Zellen verschiedener Wirte sind verschieden gebaut, und deshalb bedarf es verschiedener Mechanismen, um in sie einzudringen. Die Entwicklung von einer Tier- zu einer Menschenkrankheit wird deshalb von bestimmten molekularen Veränderungen begleitet, die vom Zufall bestimmt sind. Meist durchläuft das Virus unzählige Replikationszyklen, bevor eine Mutation eintritt, die zu einer zweckmäßigen Veränderung führt. Dann jedoch, wenn sich als Resultat die evolutionäre Fitness verbessert – wenn das Virus also Menschen effektiver infiziert und sich selbst damit erfolgreicher repliziert – wird die natürliche Selektion diese Veränderung begünstigen (andernfalls nicht). In der Folge können noch weitere Veränderungen stattfinden, und dank ihres kumulativen Effekts bewegt sich das Virus weiter in diese Richtung.
Im Allgemeinen betrachtet man Vögel, insbesondere Wasservögel, als das natürliche Reservoir des Influenza-Erregers. Wenn eine bestimmte Spezies für einen bestimmten Erreger die Rolle des Wirtsreservoirs übernimmt, hat sie den großen Vorteil, selbst nicht zu erkranken. Wirt und Erreger haben sich über so lange Zeit gemeinsam entwickelt, dass das Virus seinen Lebenszyklus vollenden kann, ohne seinem Wirt allzu viel Schaden zuzufügen und ohne eine Immunreaktion hervorzurufen. Enten zum Beispiel zeigen selbst bei schweren Grippeinfektionen keinerlei Symptome. Nach der landwirtschaftlichen Revolution gehörten Enten zu jenen Tieren, die vom Menschen domestiziert und in die Dörfer geholt wurden. Dasselbe galt für Schweine, die bei der Entwicklung einer Vogelkrankheit zu einer Menschenkrankheit gleichfalls als potenzielle Zwischenwirte gelten, da Schweinezellen sowohl mit Menschenzellen als auch mit Vogelzellen Ähnlichkeiten aufweisen. Jahrtausendelang haben diese drei Spezies Seite an Seite existiert, und so hatte das Influenza-Virus ideale Laborbedingungen, um den Transfer von einer Spezies zur anderen experimentell zu erproben. Irgendwann infizierte die Grippe dann auch Menschen, aber anfangs vermutlich nicht besonders effektiv. Im Lauf der Zeit jedoch akkumulierten sich die molekularen Mechanismen, die nötig waren, um die Krankheit hochinfektiös werden zu lassen, und irgendwann gab es dann zum ersten Mal einen Ausbruch, der den Namen »Epidemie« verdiente.
Epidemie wird hier im modernen Sinne verwendet – das heißt als meist abrupter Anstieg der durch einen bestimmten Erreger verursachten Krankheitsfälle innerhalb einer bestimmten Population. Eine »endemische« Krankheit hingegen findet sich in jener begrenzten Population andauernd gehäuft. Eine Masseninfektionserkrankung kann sowohl endemisch als auch epidemisch sein, wenn sie in einer bestimmten Region stets präsent ist, dort aber auch gelegentliche Ausbrüche bewirkt. Hier sind die Grenzen zwischen beiden Begriffen fließend und variieren je nach Krankheit. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass es sich bei den relativ milden Ausbrüchen der saisonalen Grippe, die wir jeden Winter erleben, um die endemische Form der Krankheit handelt, und könnten uns den Begriff Epidemie für den Fall aufheben, dass ein ganz neuer Erregerstamm zu einer Influenza mit schwerer Verlaufsform führt – obwohl mit dieser Differenzierung nicht jeder einverstanden wäre.
Über die ersten epidemischen Masseninfektionskrankheiten liegen uns zwar keine schriftlichen Berichte vor, aber gewiss forderten sie viele Todesopfer (siehe die Ebolaepidemie 2014, die irgendwann vielleicht einmal das Prädikat »Massenkrankheit« beanspruchen wird). Wir wissen zum Beispiel, dass eine der tödlichsten Massenerkrankungen überhaupt, die Pocken, schon vor mindestens 3000 Jahren in Ägypten auftrat, denn man hat Mumien mit pockennarbigen Gesichtern gefunden. Der erste schriftliche Bericht über eine (mutmaßliche) Pockenepidemie stammt jedoch aus dem Jahr 430 v.Chr., als ein Zeitgenosse von Hippokrates, Thukydides, die in den Tempeln Athens aufgehäuften Leichenberge schilderte.
Wann trat die erste Grippeepidemie auf? Ziemlich sicher in den letzten 12.000 Jahren und sehr wahrscheinlich in den letzten 5000 Jahren – als die ersten Städte entstanden und der Ausbreitung der Krankheit ideale Bedingungen boten. Jene allererste Grippeepidemie muss entsetzlich gewütet haben. Für uns ist dies schwer zu begreifen, weil die Influenza heute meist nicht tödlich verläuft. Und doch gibt es selbst heute noch bei jeder Grippeepidemie einen kleinen Teil von Patienten, für die die Krankheit böse Folgen hat. Diese Unglücklichen entwickeln ein akutes respiratorisches Distresssyndrom (ARDS): Sie leiden an Atemnot, ihr Blutdruck sinkt, ihr Gesicht verfärbt sich bläulich, und ohne rasche ärztliche Hilfe haben sie kaum Überlebenschancen. In einigen Fällen erleiden sie sogar Lungenblutungen und bluten aus Nase und Mund. ARDS gibt uns einen kleinen Eindruck davon, welch fürchterliches Massensterben die erste Influenzaepidemie angerichtet haben muss.
Da es keine Aufzeichnungen gibt (das erste vollständige Schriftsystem wurde ja erst vor 4500 Jahren entwickelt), wissen wir nicht, wann oder wo sich dies abspielte, doch wäre Uruk im Gebiet des heutigen Irak ein wahrscheinlicher Kandidat. Vor 5000 Jahren die größte Stadt der Welt, hatte Uruk 80.000 Einwohner, die ein ummauertes Areal von sechs Quadratkilometern bewohnten – zweimal so groß wie die City of London, das internationale Finanzzentrum. Keiner war gegen die Krankheit immun. Keiner konnte dem anderen helfen. Damals müssen sehr viele Menschen gestorben sein. Es folgten weitere Grippeepidemien, die vermutlich milder verliefen: Obwohl die Erregerstämme von den ursprünglichen Erregern und voneinander abwichen, dürfte immer noch so viel Ähnlichkeit bestanden haben, dass Menschen, die überlebten, allmählich eine gewisse Immunität erwarben. Und so entwickelte sich die Influenza, auf Kosten unzähliger Menschenleben, immer mehr zu der Krankheit, die wir heute kennen.
»Gegen alles Mögliche kann man sich Sicherheit verschaffen«, schrieb der griechische Philosoph Epikur im dritten Jahrhundert v.Chr., »angesichts des Todes aber bewohnen wir Menschen alle eine Stadt ohne schützende Mauern.«2 Ab dem Moment, wo die Influenza zu einer Menschenkrankheit wurde, begann ihr Einfluss auf die Menschheitsgeschichte – auch wenn (wahrscheinlich) erst Hippokrates die schriftliche Schilderung lieferte. Doch selbst nach Hippokrates können wir nicht sicher sein, dass es sich bei der geschilderten Krankheit wirklich um die Influenza handelt, so wie wir sie kennen. Zum einen hat sich unsere Vorstellung von Epidemien und Krankheiten gewandelt, zum anderen erhielt die Influenza immer wieder neue Namen, in denen sich widerspiegelt, dass es im Lauf der Zeit die unterschiedlichsten Theorien über ihre Ursache gab. Darüber hinaus kann man die Grippe leicht mit anderen respiratorischen Krankheiten verwechseln – am häufigsten mit der normalen Erkältung, aber auch mit schwereren Erkrankungen wie Typhus und Denguefieber, die gleichfalls mit grippeähnlichen Symptomen beginnen.
Historiker haben – wenn auch vorsichtig und stets mit einem Bewusstsein für die Fallen, die die Zeit zwischen den Worten aufstellt – darüber spekuliert, dass es die Grippe war, die die Armeen von Rom und Syrakus in Sizilien im Jahr 212 v.Chr. vernichtete. »Deshalb hatte man täglich Begräbnisse und Tod vor Augen«, schreibt Livius in seiner Geschichte Roms, »und überall hörte man Tag und Nacht Weinen und Klagen.«3
Vielleicht war es die im neunten Jahrhundert n.Chr. in den Truppen Karls des Großen grassierende respiratorische Erkrankung, die er unter der Bezeichnung febris Italica kannte (italienisches Fieber). Mutmaßliche Grippeepidemien sind in Europa im zwölften Jahrhundert dokumentiert, doch die erste wirklich verlässliche Beschreibung einer solchen Epidemie erschien im 16. Jahrhundert. 1557, in dem kurzen Intervall, als Maria I. den englischen Thron innehatte, eliminierte eine Epidemie sechs Prozent ihrer Untertanen – das waren mehr Protestanten, als »Bloody Mary«, wie man sie nannte, sich jemals hätte träumen lassen, auf den Scheiterhaufen zu bringen.
Im 16. Jahrhundert war das Zeitalter der Entdeckungen in vollem Gange. Die Europäer trafen mit Schiffen in der Neuen Welt ein und brachten moderne Krankheiten mit, gegen die die Einheimischen keinerlei Immunität entwickelt hatten – denn sie hatten nicht den gleichen grauenhaften, aber abhärtenden Zyklus von Epidemien tierischen Ursprungs durchlaufen, der letztlich zu milderen Verlaufsformen der Krankheit führte. Die Fauna der Neuen Welt ließ sich nicht so gut domestizieren wie die der Alten Welt, und so waren die Einheimischen teils immer noch Jäger und Sammler. Vielleicht handelte es sich bei der Krankheit, die Christoph Kolumbus 1493 auf seiner zweiten Reise in die Neue Welt begleitete und die, nachdem er auf den Antillen Station gemacht hatte, einen Großteil der indianischen Ureinwohner auslöschte, um die Influenza. In jenem Jahr geschah in der Karibik etwas ganz Ähnliches wie einige Jahrtausende früher in einer eurasischen Stadt wie Uruk – nur gab es diesmal eine Personengruppe, die die Epidemie überlebte: die conquistadores.
Lange Zeit ignorierten Historiker die Rolle der Infektionskrankheiten und übersahen, wie unterschiedlich sie sich auf verschiedene Populationen auswirkte. Noch bis ins 20. Jahrhundert versäumten es europäische Historiker, die von der erstaunlichen David-gegen-Goliath-Eroberung des Aztekenreichs in Mexiko durch den Spanier Hernán Cortés berichteten, zu erwähnen, dass ihm eine Pockenepidemie den größten Teil der Arbeit abnahm.4 Sie betrachteten die Grippe als kleine Unpässlichkeit, als Plage, die die dunkle Jahreszeit nun einmal mit sich brachte. Sie begriffen nicht, welche Furcht diese Krankheit im Herzen der Ureinwohner Amerikas, Australiens oder der Pazifikinseln säte und wie eng sich für jene Menschen die Influenza mit dem Erscheinen des weißen Mannes verband. »Sie waren der festen Überzeugung, dass Influenzaepidemien in den letzten Jahren seit den Besuchen der Weißen weit häufiger auftraten und verheerendere Auswirkungen hatten als früher«, schrieb ein Mann, der im 19. Jahrhundert die Insel Tanna im Vanuatu-Archipel besuchte. »Und dieser Eindruck beschränkt sich nicht auf Tanna, sondern ist, wenn ich mich nicht irre, im gesamten Pazifikraum verbreitet.« Als die Historiker ihren Irrtum erkannt hatten, gingen sie teils dazu über, Masseninfektionskrankheiten anders zu benennen: imperiale Krankheiten.5
Es waren die Erkenntnisse der Paläoklimatologen, die den Historikern klarmachten, dass sie sich geirrt hatten. Paläoklimatologen erforschen das Erdklima in der Vergangenheit, etwa anhand sedimentärer Lagerstätten oder mithilfe von Fossilien und Baumringen. Aufgrund der Erkenntnis, dass in der spätrömischen Epoche die Erdtemperatur sank, weisen sie zum Beispiel darauf hin, dass die Justinianische Pest – eine Beulenpest-Pandemie, der in Europa und Asien im sechsten Jahrhundert n.Chr. ungefähr 25 Millionen Menschen zum Opfer fielen – dazu führte, dass riesige Agrargebiete verlassen wurden und sich dort wieder Wälder ausbreiteten. Da Bäume der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen, wurde durch die Wiederbewaldung so viel von dem Gas im Holz gebunden, dass die Erde abkühlte (das Gegenteil des Treibhauseffekts, den wir heute erleben).
Vergleichbares haben die massiven Vernichtungswellen angerichtet, die im 16. Jahrhundert in Nord- und Südamerika entfesselt wurden – durch Cortés, Francisco Pizarro (der das Inka-Reich in Peru eroberte) und Hernando de Soto (der die erste europäische Expedition in das Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten leitete) – und die einen Bevölkerungsrückgang bewirkt hatten, der möglicherweise zur Kleinen Eiszeit geführt hat.6
Dieser Effekt kehrte sich erst im 19. Jahrhundert um, als Europäer eintrafen und das Land wieder zu roden begannen. Die Kleine Eiszeit war aber vermutlich das letzte Beispiel dafür, dass eine menschliche Krankheit das Weltklima beeinflussen konnte. Auch wenn es weitere Pandemien gab, sorgten die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft und das exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung doch dafür, dass sich selbst der Tod von zig Millionen Bauern nicht mehr negativ auf die Erdatmosphäre auswirken konnte – zumindest nicht so, dass es den Paläoklimatologen aufgefallen wäre.
Die erste Grippewelle, die von Experten einhellig als Pandemie klassifiziert wurde – das heißt als Epidemie, die mehrere Länder oder Kontinente umfasste – begann wohl im Jahr 1580 in Asien und breitete sich nach Afrika, Europa und möglicherweise Amerika aus. Hier müssen wir allerdings eine Einschränkung machen. Wie wir noch sehen werden, lässt sich nicht ohne Weiteres feststellen, wo der Ursprung einer Grippepandemie liegt und in welche Richtung sie sich ausbreitet, und das heißt, dass jede kategorische Aussage über den Ursprung historischer Grippepandemien mit Vorsicht zu genießen ist. Dies gilt vor allem deshalb, weil die Europäer, deren Landsleute einst tödliche Krankheiten in die Neue Welt einschleppten, spätestens ab dem 19. Jahrhundert rasch bei der Hand waren, den Ursprung jeder neuen Seuche in China oder den stillen Weiten der eurasischen Steppen zu verorten.
Zeitgenössische Berichte legen nahe, dass sich jene allererste Grippepandemie innerhalb von sechs Monaten von Nord- nach Südeuropa ausgebreitet hat. Rom registrierte 8000 Tote, wurde also buchstäblich »dezimiert« – ungefähr jeder zehnte Römer starb –, und einigen spanischen Städten widerfuhr ein ähnliches Schicksal.7 Zwischen 1700 und 1800 ereigneten sich zwei Grippepandemien. Auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemie, 1781, gab es in Sankt Petersburg täglich 30.000 neue Krankheitsfälle. Mittlerweile wurde die Krankheit meist »Influenza« genannt. Der Name wurde zwar bereits im 14. Jahrhundert von einigen Italienern geprägt, die die Krankheit dem Einfluss, der »Influenz«, der Sterne zuschrieben, setzte sich aber erst nach mehreren Jahrhunderten durch. Er hat sich im Grunde bis heute erhalten, auch wenn – ebenso wie bei den Begriffen »melancholisch« und »phlegmatisch« – die begrifflichen Verankerungen hinweggefegt wurden.
Im 19. Jahrhundert waren die Masseninfektionskrankheiten auf dem Höhepunkt ihres evolutionären Erfolgs angelangt und beherrschten den gesamten Globus. Es war das Jahrhundert der industriellen Revolution und damit in vielen Weltregionen der rasanten Ausdehnung der Städte. Diese Städte wurden nun zu Brutstätten der Massenkrankheiten, und das in einem Maße, dass die Stadtbevölkerung sich nicht mehr selbst versorgen konnte – nötig war ein ständiger Zustrom gesunder Bauern vom Land, um die Verluste durch die vielen Todesopfer auszugleichen. Auch in Folge von Kriegen brachen Epidemien aus. Kriegerische Konflikte bedeuten Hunger und Angst; die Menschen werden entwurzelt, unter mangelhaften Hygienebedingungen in Lagern untergebracht und Ärzte werden zum Kriegsdienst eingezogen. In Kriegszeiten steigt die Infektionsanfälligkeit, und Menschen, die sich in Bewegung befinden, tragen die Infektion dann überall hin. In den Konflikten des 18. und 19. Jahrhunderts starben insgesamt mehr Menschen durch Krankheiten als auf dem Schlachtfeld.
Im 19. Jahrhundert gab es zwei Influenza-Pandemien. Die erste dieser Pandemien, die 1830 ausbrach, soll vom Schweregrad – wenn auch nicht von der Ausdehnung her – mit der Spanischen Grippe vergleichbar gewesen sein. Die zweite Pandemie, die sogenannte »Russische« Grippe, begann 1889 wohl in Bokhara, Usbekistan. Sie war die erste Pandemie, die – zumindest bis zu einem gewissen Grad – statistisch erfasst wurde, denn inzwischen hatten die Wissenschaftler entdeckt, welch mächtige Waffe die Statistik im Kampf gegen Krankheiten sein konnte. Dank der Leistung jener ersten Epidemiologen wissen wir, dass die russische Grippe ungefähr eine Million Todesopfer forderte und in drei Wellen die ganze Welt überrollte. Eine erste mildere ging einer zweiten schweren Welle voraus, wogegen die dritte Welle wiederum milder verlief als die erste. Viele Kranke entwickelten eine Lungenentzündung, die dann zum Tod führte, und diese Grippe traf nicht nur ältere und ganz junge Menschen – wie in der normalen Grippesaison üblich –, sondern auch Menschen in den Dreißiger- und Vierzigerjahren. Mit Sorge beobachteten die Ärzte, dass es bei vielen Patienten, die die erste Attacke überlebt hatten, irgendwann zu neurologischen Komplikationen kam, einschließlich Depressionen. Der norwegische Künstler Edvard Munch mag zu ihnen gehört haben, und manche meinen, sein berühmtes Gemälde, Der Schrei, sei aus einer Depression heraus entstanden, die auf die Grippe zurückging. »Eines Abends ging ich einen Pfad entlang, auf der einen Seite die Stadt, auf der anderen der Fjord«, schrieb er später. »Ich fühlte mich müde und krank. Ich blieb stehen und blickte über den Fjord. Die Sonne ging gerade unter, und die Wolken färbten sich blutrot. Ich spürte, wie ein Schrei durch die Natur ging; mir kam es vor, als hörte ich den Schrei.«8 Als Munch dies niederschrieb, war die Pandemie vorüber, ebenso der jahrtausendelange Kampf zwischen Mensch und Influenza. Ganz sicher würde es der Wissenschaft im nächsten Jahrhundert, dem 20. Jahrhundert, gelingen, die Masseninfektionskrankheiten ein für alle Mal zu besiegen.
2 Leibniz’ Monaden
Für uns, die wir hundert Jahre später leben, in dieser Welt, die von der Aids-Pandemie beherrscht wird, scheint die Vorstellung, dass die Wissenschaft Masseninfektionskrankheiten für immer besiegen könnte, absurd. An der Wende des 20. Jahrhunderts waren zumindest im Westen viele Menschen genau davon überzeugt. Der Hauptgrund für ihren Optimismus war die Keimtheorie – die Erkenntnis, dass Keime Krankheiten verursachen. Man hatte zwar schon seit Jahrhunderten gewusst, dass es Bakterien gab – seit ein holländischer Linsenschleifer namens Antoni van Leeuwenhoek ein Vergrößerungsglas über einen Teichwassertropfen bewegte und sah, dass dieser Tropfen von Leben wimmelte –, hatte die Bakterien allerdings als eine Art harmloses Ektoplasma betrachtet; niemand hätte vermutet, dass sie Menschen krank machen konnten. Robert Koch in Deutschland und Louis Pasteur in Frankreich zogen dann Anfang der 1850er-Jahre die richtigen Schlüsse. Die Entdeckungen dieser beiden Männer sind so zahlreich, dass man sie gar nicht alle auflisten kann, aber zum Beispiel zeigte Robert Koch, dass die Tuberkulose, die »romantische« Krankheit der Poeten und Künstler, nicht etwa, wie man damals glaubte, vererbt, sondern durch ein Bakterium verursacht wurde, während Pasteur die Hypothese widerlegte, dass lebende Organismen spontan aus unbelebter Materie entstehen könnten.
In Kombination mit älteren Vorstellungen über Hygiene und sanitäre Einrichtungen führte die Keimtheorie nun allmählich zu einer neuen Sicht auf die Masseninfektionskrankheiten. Es gab Kampagnen zur Reinigung des Trinkwassers und zur Förderung der Sauberkeit. Impfaktionen wurden verordnet, allerdings nicht ohne Widerstand – was nicht weiter überraschte, denn den Menschen wollte nicht einleuchten, dass man sie gegen eine Krankheit schützen wollte, indem man ihnen Krankheitserreger injizierte –, und im Lauf der Zeit führten all diese Anstrengungen zu konkreten Resultaten. Hatten in den vorangegangenen Jahrhunderten Krankheiten mehr Todesopfer als Kriege gefordert, kehrte sich dieser Trend nun um. Zwar gab es nun tödlichere Kriegswaffen, andererseits lernten Militärärzte immer besser, Infektionen zu beherrschen. Der Krieg mag nach einem merkwürdigen Ort für medizinische Erfolge klingen, aber tatsächlich gehörten die Armeeärzte zu den ersten, die die Keimtheorie in die Praxis umsetzten, und ihr Wissen sickerte dann allmählich zu den zivilen Kollegen durch. Am Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Städte endlich autark.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war der Glaube an Wissenschaft und Rationalismus deshalb sehr ausgeprägt. Noch war die Aufregung über die Entdeckung, dass es eine Verbindung zwischen Bakterien und Krankheiten gab, nicht abgeklungen, und es bestand die Versuchung, für jede beliebige Malaise nun Bakterien verantwortlich zu machen. Ilya Mechnikov, der wilde russische »Dämon der Wissenschaft«, den Pasteur in sein Pariser Institut geholt hatte, machte Bakterien sogar für das Altern verantwortlich. Mechnikov hatte für seine Entdeckung der Phagocytosis – des Mechanismus, durch den sich Immunzellen im menschlichen Blut schädliche Bakterien einverleiben und sie vernichten – im Jahr 1908 den Nobelpreis bekommen. Er vermutete jedoch auch im menschlichen Darm Bakterien, die Toxine freisetzen, die Arterien verhärten und so zum Alterungsprozess des Körpers beitragen – eine Theorie, mit der er sich ziemlich lächerlich machte. Er entwickelte ein geradezu obsessives Interesse an bulgarischen Dörfern, in denen Menschen angeblich über hundert Jahre alt wurden, und schrieb diese Langlebigkeit der Sauermilch zu, vor allem den »guten« Milchsäurebakterien. In seinen letzten Lebensjahren trank er riesige Mengen Sauermilch, bevor er 1916 im Alter von 71 Jahren starb.1 (Heutzutage betrachtet man die menschlichen Darmbakterien meist als harmlos oder schreibt ihnen sogar eine positive Wirkung zu.)
Das Geheimnis der Viren war allerdings immer noch nicht gelüftet. Im Lateinischen bedeutet das Wort Virus Gift oder einen wirksamen Saft, und genau so sahen das die Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts auch. Als der brasilianische Autor Aluísio Azevedo im Jahr 1890 in seinem Roman O Cortiço (Der Slum) schrieb: »Brasilien, dieses Inferno, wo jede knospende Blüte und jede summende Schmeißfliege ein laszives Virus in sich trägt«, dachte er vermutlich an ein giftiges Sekret. Die Wissenschaft jedoch begann diese Definition zu hinterfragen. Handelte es sich bei Viren um Toxine oder Organismen? Um eine Flüssigkeit oder Teilchen? Um etwas Totes oder Lebendiges? Das erste Virus wurde 1892 entdeckt, als der russische Botaniker Dmitri Ivanovsky als Ursache einer Krankheit, die in Tabakfabriken auftrat, ein Virus ausmachte. Er hatte dieses Virus nicht gesehen. Er hatte einfach nur entdeckt, dass die Krankheit durch einen Infektionserreger verursacht wurde, der kleiner war als alle bekannten Bakterien – so klein, dass man ihn nicht sah.
1892 grassierte in Europa die Russische Grippe, und in dem Jahr, als Ivanovsky seine Entdeckung machte, identifizierte ein Student Robert Kochs, Richard Pfeiffer, das Bakterium, das für die Influenza verantwortlich war. Ja, das für die Influenza verantwortliche Bakterium, Pfeiffers Bazillus, auch als Haemophilus influenzae bekannt, existiert tatsächlich und verursacht eine Krankheit, aber nicht die Grippe (Pfeiffers Irrtum lebt im Namen »Pfeiffersches Drüsenfieber« fort, als Warnung an seine Kollegen oder als Treppenwitz der Medizingeschichte). Niemand kam auf die Idee, die Grippe könne das Werk eines Virus sein, jenes nicht klassifizierbaren Etwas, das irgendwo jenseits der Grenzen des Sichtbaren existierte, und auch 1918 hatte man kein Virus im Verdacht. Im psychischen Kosmos von 1918 spielten Viren kaum eine Rolle. Niemand hatte sie bis dahin gesehen, sie waren nicht nachzuweisen. Diese beiden Fakten sind entscheidend, wenn man verstehen will, wie die Spanische Grippe damals auf die Menschen wirkte. Infolge der Pandemie änderte sich dies zwar, wie wir noch sehen werden, aber es brauchte Zeit. Als James Joyce in seinem hochmodernen Roman Ulysses (1922) schrieb: »Maul- und Klauenseuche. Bekannt als Kochsches Präparat. Serum und Virus«2, entsprach seine Vorstellung vom Virus vermutlich derjenigen Aluísio Azevedos.
Die Schüler Pasteurs und Kochs machten die Keimtheorie so bekannt, dass sie allmählich den galenischen Krankheitsbegriff ablöste. Die dadurch nötige psychologische Umstellung verunsicherte die Menschen ähnlich wie 2000 Jahre früher das von Hippokrates geforderte Umdenken, und so nahmen sie die neue Sichtweise nur zögernd an. Als Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Cholera-Wellen über London hinwegfegten, machten die Einwohner Miasmen dafür verantwortlich, üble Ausdünstungen, die von der verschmutzten Themse aufstiegen. Schließlich gelang es einem Arzt namens John Snow durch brillante Detektivarbeit (unter anderem trug er krankheitsbedingte Todesfälle auf einer Karte ein) einen der Ausbrüche auf eine bestimmte Wasserpumpe in der Stadt zurückzuführen und davon leitete er – völlig zu Recht – ab, dass die Cholera durch das Wasser verbreitet wurde, nicht durch die Luft. Er veröffentlichte sein Forschungsergebnis im Jahr 1854, doch erst nach dem »Großen Gestank« von 1858 – als außergewöhnlich heißes Wetter zum penetranten Gestank ungeklärter Abwässer an den Ufern der Themse führte – beauftragten die Behörden endlich den Ingenieur Joseph Bazalgette mit dem Entwurf eines effizienten städtischen Kanalisationssystems. Ihre Theorie? Dass durch die Beseitigung des üblen Geruchs auch die Cholera beseitigt würde.
Die Keimtheorie stellte zudem ganz neu die Frage nach der persönlichen Verantwortung für bestimmte Krankheiten. Hippokrates hatte dazu einige überraschend moderne Ideen parat. Er glaubte, Menschen seien zwar für Krankheiten selbst verantwortlich, wenn sie sich gegen einen gesunden Lebensstil entschieden, doch sofern es sich um eine Erbkrankheit handelte, könne man ihnen keinen Vorwurf machen. Und selbst in diesem Fall hätten sie noch die Wahl. Hippokrates erklärte am Beispiel von Käse, dass der Mensch sich je nach ererbter Konstitution für oder gegen den Verzehr von Käse entscheiden solle. »Käse«, schrieb er, »ist nicht allen Menschen in gleicher Weise unzuträglich; manche können sich daran satt essen, ohne im Mindesten Schaden zu nehmen, ja, jene, denen er bekömmlich ist, erfahren dadurch sogar eine erstaunliche Stärkung. Anderen ergeht es schlecht.«3
Im Mittelalter hatten die Menschen Krankheiten meist auf die Götter beziehungsweise Gott zurückgeführt, und ungeachtet der Entstehung der modernen Naturwissenschaften herrschte jahrhundertelang Fatalismus. Im Jahr 1838 reiste die französische Schriftstellerin George Sand mit ihrem tuberkulosekranken Geliebten Frédéric Chopin auf die spanische Insel Mallorca, in der Hoffnung, dass das mediterrane Klima die Symptome ihres »armen melancholischen Engels« lindern werde. Sie erwartete keineswegs, dass das Klima ihn heilen würde, da TBC ihrer Meinung nach unheilbar war. Und ihr kam auch nicht der Gedanke, dass sie sich bei ihm anstecken könnte. Aber die Theorien über die Ursachen der Tuberkulose waren damals bereits im Wandel begriffen, und als die beiden in Palma de Mallorca eintrafen, merkten sie, dass die Einwohner nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Wie sich George Sand in einem Brief empörte, forderte man sie sogar auf zu gehen, da die Tuberkulose »in jenen Breiten höchst selten vorkommt und darüber hinaus als ansteckend betrachtet wird!«4.
Im 19. Jahrhundert wurden Epidemien immer noch, wie Erdbeben, als Naturereignisse empfunden. Die Keimtheorie zwang die Menschen zu der Einsicht, dass sie Epidemien möglicherweise beherrschen könnten, und diese überraschende Entdeckung brachte ein weiteres neues Denkmodell ins Spiel: Die Evolutionstheorie, die Charles Darwin in seinem Werk Über die Entstehung der Arten (1859) vorgestellt hatte. Als Darwin über natürliche Selektion gesprochen hatte, hatte er nicht damit gerechnet, dass seine Ideen auf menschliche Gesellschaften übertragen werden würden, doch genau dies taten seine Zeitgenossen, und so entstand die »Wissenschaft« der Eugenik. Eugeniker glaubten, die Menschheit bestehe aus verschiedenen »Rassen«, die ums Überleben konkurrierten. Die am besten an ihre Umwelt angepassten Individuen hatten definitionsgemäß Erfolg, während die »degenerierten« Rassen irgendwann in tiefem Elend landeten, weil es ihnen an Tatendrang und Selbstdisziplin mangelte. Diese Denkweise passte auf perfide Weise zur Keimtheorie: Auch wenn arme Arbeiter unverhältnismäßig oft an Typhus, Cholera und anderen tödlichen Seuchen litten, trugen sie doch selbst Schuld daran, da Pasteur ja gelehrt hatte, dass solche Krankheiten verhindert werden könnten.
Ende des 19. Jahrhunderts prägte die Eugenik weltweit die Immigrations- und Gesundheitspolitik. Eifrig klassifizierten deutsche Anthropologen in ihren afrikanischen Kolonien »Menschentypen«, während man in einigen amerikanischen Staaten Personen, die man für geisteskrank hielt, zwangssterilisierte. Obwohl amerikanische Eugeniker die Japaner als minderwertige Rasse betrachteten und sie aus dem Land heraushalten wollten, war die Eugenik ironischerweise auch in Japan populär, wo wiederum die japanische Rasse als die überlegene galt.5 Heutzutage ist Eugenik verpönt, doch 1918 war sie an der Tagesordnung und prägte die Reaktionen auf die Spanische Grippe ganz entscheidend.
»Die Vorstellungswelten verschiedener Generationen sind füreinander so undurchdringlich wie die Monaden*1 von Leibniz«, schrieb der Franzose André Maurois, doch wir können zumindest einige augenfällige Unterschiede zwischen 1918 und heute aufzeigen. Die Welt befand sich bereits seit 1914 im Krieg. Die Gründe für diesen Krieg lagen hauptsächlich in Europa – in Spannungen zwischen den starken imperialen Mächten dieses Kontinents. Das Zeitalter der Entdeckungen hatte Früchte getragen, denn zu keinem anderen Zeitpunkt der Geschichte besaßen die Europäer weltweit mehr Kolonien als 1914. Diesem Gipfel folgte ein langer Prozess der Dekolonisierung, der schließlich dazu führte, dass jene Imperien geschwächt und ihre Kolonien befreit wurden. 1918 fand jedoch auch eine der letzten Schlachten in einem der letzten Kolonialkriege statt – den Indianerkriegen, in denen die europäischen Siedler Nordamerikas indigene Völker bekämpften und schließlich besiegten.
Die späteren Staatsführer Nicolae Ceaușescu und Nelson Mandela wurden 1918 geboren, ebenso der spätere Dissident und Autor Alexander Solschenizyn, der Regisseur Ingmar Bergman und die Schauspielerin Rita Hayworth. Max Planck erhielt den Physik-Nobelpreis für seine Entdeckung des Planckschen Wirkungsquantums, während Fritz Haber für seine Erfindung der Herstellung von Ammoniak, das eine wichtige Rolle bei der Düngemittel- und Sprengstoffproduktion spielt, mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet wurde (das Nobelpreiskomitee entschied sich in jenem Jahr gegen die Vergabe des Medizin-, Literatur- und Friedensnobelpreises). Gustav Holsts Komposition Die Planeten wurde bei der Premiere in London mit großem Applaus bedacht, während Joan Mirós Werk bei der ersten Einzelausstellung in Barcelona Hohn und Spott erntete.
Die Filme waren stumm und Telefone selten. Fernkommunikation erfolgte hauptsächlich durch Telegramme oder, in manchen Gegenden Chinas, durch Brieftauben. Es gab keine Verkehrsflugzeuge, aber U-Boote, und die Dampfschiffe befuhren die Ozeane mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp zwölf Knoten (etwa 20 Kilometer pro Stunde).6 Viele Länder verfügten über gut entwickelte Eisenbahnnetze, viele aber auch nicht. Persien, ein Land dreimal so groß wie Frankreich, hatte ein Schienennetz von gerade mal zwölf Kilometern. Auch verfügte es über ein Straßennetz von nur 300 Kilometern und über ein einziges Automobil – das des Schahs. Ford produzierte zwar sein günstiges Modell T, doch waren Autos damals selbst in Amerika noch Luxusgüter. Als häufigstes Transportmittel benutzte man den Maulesel.
Es war eine uns vertraute und doch auch schrecklich fremde Welt. Obwohl die Keimtheorie allmählich Wirkung zeigte, war zum Beispiel die Bevölkerung weit weniger gesund als heutzutage, und selbst in der industrialisierten Welt stellen Infektionskrankheiten immer noch die größte Bedrohung der Gesundheit dar – nicht die chronischen degenerativen Krankheiten, die heutzutage die meisten Todesopfer fordern. Nachdem Amerika 1917 in den Krieg eingetreten war, fand eine Massenuntersuchung der Wehrpflichtigen statt – die erste nationale Gesundheitsprüfung der amerikanischen Geschichte. Die Resultate wurden als »das abschreckende Beispiel« bekannt: von 3,7 Millionen untersuchten Männern wurden 550.000 als untauglich abgelehnt, und der Rest wies zur Hälfte physische Fehlbildungen auf, von denen viele vermeidbar oder heilbar waren.
Für uns ist der Begriff »Pest« ganz präzis umrissen: Die Beulenpest ebenso wie ihre Varianten, die Lungen- und die septikämische Pest, werden allesamt vom BakteriumYersinia pestis verursacht. Doch noch 1918 wurde »Pest« auf jede gefährliche Seuche angewandt, die sich rasant ausbreitete. Währenddessen war die »echte« Pest – die Seuche, die unter dem Alias »Der Schwarze Tod« das mittelalterliche Europa verheerte – auf diesem Kontinent immer noch präsent. Es kommt einem erstaunlich vor, aber in England fiel das letzte Auftreten der Pest mit der Spanischen Grippe zusammen.7 Auch »Durchschnittsalter« bedeutete damals etwas anderes als heute: Die durchschnittliche Lebenserwartung eines in Europa oder Amerika geborenen Menschen betrug höchstens 50 Jahre, und in weiten Teilen des Globus lag sie viel niedriger. Inder und Perser etwa konnten von Glück sagen, wenn sie ihren 30. Geburtstag erleben durften.
Selbst in reichen Ländern fand die Mehrzahl der Geburten zu Hause statt, Badewannen blieben den Wohlhabenden vorbehalten, und eine signifikante Minderheit der Bevölkerung war ungebildet und des Schreibens und Lesens nicht mächtig. Einfache Leute konnten sich Ansteckung zwar vorstellen, begriffen aber nicht den Mechanismus, der dahintersteckte, und wer dies – angesichts dessen, dass die Keimtheorie damals ja schon seit einem halben Jahrhundert existierte – überraschend findet, denke an eine moderne Parallele. Die Entdeckung der DNA-Struktur 1953 bereitete der Molekulargenetik den Weg, was unseren Gesundheits- und Krankheitsbegriff erneut radikal veränderte. Eine Umfrage in den USA 2004, also ein halbes Jahrhundert später, ergab, dass der Durchschnittsamerikaner nur recht wirre Vorstellungen davon hatte, was ein Gen eigentlich ist.8
Ärztefortbildungen gab es 1918 nur vereinzelt, obwohl Abraham Flexner im Jahr 1910 in den USA eine Kampagne für strikt standardisierte medizinische Weiterbildungsmaßnahmen initiiert hatte. Das Thema Krankenversicherung war nahezu unbekannt, und Gesundheitsfürsorge wurde meist privat finanziert oder durch karitative Organisationen geleistet. Antibiotika waren noch nicht erfunden, und wenn man erst einmal erkrankt war, konnte man immer noch relativ wenig tun. Darum war das Thema Krankheit selbst in Paris und Berlin insgeheim im Alltag gegenwärtig. Es lauerte hinter Zeitungsartikeln, die sich mit dem Krieg befassten. Es ähnelte der dunklen Materie des Universums, so intim und persönlich, dass man nicht davon sprechen durfte. Es löste Panik aus, gefolgt von Resignation. Die Religion war die wichtigste Quelle des Trostes, und meist überlebten Eltern zumindest einige ihrer Kinder. Die Menschen hatten zum Tod eine völlig andere Einstellung als heute. Er war ein häufiger Gast; man empfand weniger Angst vor ihm.
So sah die Welt aus, über die die Spanische Grippe hereinbrach: eine Welt, die das Automobil zwar kannte, sich auf dem Maultierrücken aber wohler fühlte; eine Welt, die zwar schon an die Quantentheorie, aber auch noch an Hexen glaubte; eine Welt im Spagat zwischen Vormoderne und Moderne, sodass manche Menschen bereits in Wolkenkratzern wohnten und Telefone benutzten, andere hingegen noch wie ihre Vorfahren im Mittelalter lebten. Die Seuche jedoch, die über sie hereinbrach, hatte nichts Modernes; sie war uralt. Vom ersten Todesopfer an schien es, als sei die gesamte Weltbevölkerung, etwa 1,8 Milliarden Menschen, um mehrere Jahrtausende zurückgeworfen worden, in eine Stadt wie das mesopotamische Uruk.
Teil 2 Anatomie einer Pandemie
Notlazarett im US Army Camp Funston Kansas, 1918 errichtet, um an der Spanischen Grippe erkrankte Patienten aufzunehmen
3 Vorboten
Am Morgen des 4. März 1918 meldete sich in Camp Funston, Kansas, ein Mann namens Albert Gitchell auf der Krankenstation, mit rauem Hals, Fieber und Kopfschmerzen. Schon um die Mittagszeit gab es über hundert weitere Fälle, und in den Wochen danach meldeten sich so viele Männer krank, dass der Chief Medical Officer des Camps einen Hangar als Notlazarett beschlagnahmte, um alle Patienten unterzubringen.
Möglicherweise war Gitchell gar nicht der erste Mensch, der die »Spanische« Grippe bekam. Seit damals wird spekuliert, wo genau die Pandemie eigentlich begann. Wir wissen jetzt aber, dass Gitchell zu den ersten registrierten Erkrankungsfällen zählte, und so kam man – einfachheitshalber – überein, dass sein Fall den Beginn der Pandemie markierte. In den anschließenden Monaten folgten 500 Millionen Menschen Albert Gitchell, bildlich gesprochen, auf die Krankenstation.
Amerika war im April 1917 in den Ersten Weltkrieg eingetreten, und ab jenem Herbst sammelten sich junge Männer, meist aus ländlichen Gegenden der USA, in Militärcamps, um für die American Expeditionary Forces (AEF), die Streitkräfte, die General John ›Black Jack‹ Pershing nach Europa führen würde, rekrutiert und ausgebildet zu werden. Camp Funston war eines dieser Camps. Von dort wurden Soldaten in andere amerikanische Camps oder direkt nach Frankreich verlegt. Im April 1918 grassierte die Grippe im Mittleren Westen, in den Städten der Ostküste, von denen aus sich die Soldaten einschifften, und in den französischen Häfen, wo sie von Bord gingen. Mitte April hatte die Epidemie die Schützengräben der Westfront erreicht. Das Wetter war damals in Westeuropa für die Jahreszeit ungewöhnlich warm, dennoch klagten die deutschen Truppen schon bald über »Blitzkatarrh«, etwas, das dem deutschen Sanitätsoffizier Richard Pfeiffer – der Mann, dessen Namen das Pfeiffer-Influenzabakterium trägt – zweifellos Sorgen bereitete. Von der Front aus verbreitete sie sich dann rasch über ganz Frankreich und gelangte nach Großbritannien, Italien und Spanien. Ende Mai 1918 erkrankte in Madrid der spanische König Alfons XIII. gemeinsam mit seinem Premierminister und Mitgliedern des Kabinetts.1
Ebenfalls im Mai gab es Berichte von Grippefällen in Breslau, das damals zu Deutschland gehörte, jetzt Wrocław in Polen (wo Pfeiffer in Friedenszeiten den Lehrstuhl für Hygiene innehatte), und im russischen Hafen Odessa, 1300 Kilometer östlich. Nachdem im März die neue russische Regierung der Bolschewiki mit den Mittelmächten den Friedensvertrag von Brest-Litowsk geschlossen hatte und Sowjetrussland damit als Kriegsteilnehmer ausschied, begannen die Deutschen ihre russischen Kriegsgefangenen zu entlassen. Da es in Deutschland an Arbeitskräften mangelte, hielt man die körperlich gesunden Gefangenen anfangs zurück; unter Aufsicht mehrerer Rotkreuz-Gesellschaften wurden jedoch täglich mehrere Tausend Invaliden entlassen, und es waren vermutlich diese »wandelnden Leichname«, die die Grippe nach Russland brachten.2