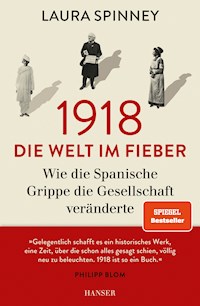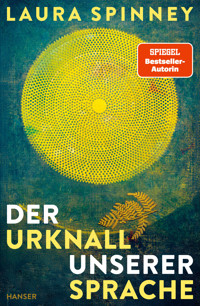
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Laura Spinney erzählt die Frühgeschichte unserer Sprache. Eine spektakuläre Reise in die Lebenswelt und Kultur unserer Vorfahren
Griechische Tragödien, indische Veden, römische Mythologie, „Beowulf“ und „Der Herr der Ringe“ – all diese Erzählungen sind durch eine gemeinsame Sprache und deren Sprecher verbunden, den Indoeuropäern. Wer waren diese Menschen, wie lebten unsere Vorfahren? Dank bahnbrechender Erkenntnisse aus Linguistik, Archäologie und Genetik erzählt Bestsellerautorin Laura Spinney die unvergleichliche Entstehung unserer Ursprache. Vor 5.000 Jahren trafen am Schwarzen Meer Nomaden aus der Steppe auf Bauern aus der gemäßigten Zone. Laura Spinney erweckt den Alltag und die Sprache dieser Menschen zum Leben und zeigt, wie eng Ost und West miteinander verbunden sind. Eine faszinierende Reise zu den Ursprüngen unserer Kultur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Bestsellerautorin Laura Spinney erzählt die Frühgeschichte unserer Sprache. Eine spektakuläre Reise in die Lebenswelt und Kultur unserer VorfahrenGriechische Tragödien, indische Veden, römische Mythologie, »Beowulf« und »Der Herr der Ringe« — all diese Erzählungen sind durch eine gemeinsame Sprache und deren Sprecher verbunden, den Indoeuropäern. Wer waren diese Menschen, wie lebten unsere Vorfahren? Dank bahnbrechender Erkenntnisse aus Linguistik, Archäologie und Genetik erzählt Bestsellerautorin Laura Spinney die unvergleichliche Entstehung unserer Ursprache. Vor 5.000 Jahren trafen am Schwarzen Meer Nomaden aus der Steppe auf Bauern aus der gemäßigten Zone. Laura Spinney erweckt den Alltag und die Sprache dieser Menschen zum Leben und zeigt, wie eng Ost und West miteinander verbunden sind. Eine faszinierende Reise zu den Ursprüngen unserer Kultur.
Laura Spinney
Der Urknall unserer Sprache
Aus dem Englischen von Stephanie Singh
Hanser
Für Ryszard
Da gehen die Menschen hin und bestaunen die Gipfel der Berge, die Wogen des Meeres, das gewaltige Strömen der Flüsse, die Größe des Ozeans und die Kreisbahnen der Sterne, aber sich selbst vergessen sie. Sie erstaunen nicht darüber, dass …
Augustinus, Bekenntnisse, ca. 400 n. Chr.
Vorwort
Im Jahr 2021 erinnerte sich der Archäologe David Anthony an ein Projekt, an dem er etwa zehn Jahre zuvor gearbeitet hatte. Im Sommer 2010 hatten er und seine Frau, die Archäologin Dorcas Brown, gemeinsam mit einem ukrainisch-amerikanischen Team Ausgrabungen in der Steppe südlich von Donezk vorgenommen. Damals herrschte in der Ukraine noch Frieden. Der Gruppe gelang es, aus prähistorischen Grabstätten 66 menschliche Knochenfragmente zu bergen. Modernste Untersuchungen dieser Fragmente ermöglichten deren Datierung sowie Erkenntnisse über die Ernährung der Verstorbenen. Nach dem Ende der Ausgrabungen kehrten Brown und Anthony an ihre Arbeitsplätze am Hartwick College im Bundesstaat New York zurück. Sie glaubten, den Knochenfragmenten alle Geheimnisse entlockt zu haben, und räumten sie in eine Schublade. »Diese Schublade wurde zehn Jahre lang nicht geöffnet«, so Anthony.
Eines Tages erhielt er aus heiterem Himmel einen Anruf von David Reich, einem Genetiker der Universität Harvard. Reichs Arbeitsgruppe hatte eine Methode entwickelt, mit der man DNA aus alten menschlichen Knochen gewinnen und analysieren konnte. Er bat Anthony um Knochen, an denen er die Methode testen könnte. So wurde die Schublade wieder geöffnet — und gab den Blick auf die Frühgeschichte frei. Die Unterhaltung, die sein Leben veränderte, beschrieb Anthony später als »eine erstaunliche Revolution« und »einfach unglaublich«. Sichtlich bewegt fuhr er fort: Archäologen könnten nun Knochen aus antiken Grabstätten nutzen, um Haar-, Augen- und Hautfarbe der dort Beigesetzten zu bestimmen. Sie könnten das Verwandtschaftsverhältnis von Menschen innerhalb derselben oder verschiedener Grabstätten sowie deren Krankheiten bestimmen. Zum ersten Mal könne man Migranten mit Sicherheit archäologisch identifizieren. »Das verändert das gesamte Forschungsfeld«, so Anthony.
Mit dem Forschungsfeld meinte er die Untersuchung prähistorischer Sprachen und besonders einer Sprache, deren spätere Formen heute von fast der Hälfte der Menschheit gesprochen werden. Es handelt sich um eine Sprache, der Anthony seine gesamte berufliche Laufbahn gewidmet hatte und die von Migranten vergangener Zeiten in die Welt getragen wurde.
Einleitung: Ariomanie
Der mächtigste Gott im alten indischen Pantheon war der Himmelsvater, Dyaus Pita (Sanskrit). Der oberste Gott der Griechen war Zeus patēr, der später nur noch Zeus genannt wurde. Die Römer veränderten den Anfangslaut dy und nannten ihren Gott Jupiter. Im Altnordischen wurde das d zu einem t, sodass er den Wikingern als Tyr bekannt war, während er im mit dem Altnordischen eng verwandten EnglischTiu genannt wurde. Den Dienstag (Tuesday) widmeten englischsprachige Menschen dem Himmelsvater.
Sanskrit, Griechisch, Latein, Altnordisch und Englisch stammen alle von dem viel älteren Proto-Indoeuropäischen ab. »Proto« bedeutet »das Erste«, und »indoeuropäisch« zeigt die Sprachfamilie an. Die Sprecher des Proto-Indoeuropäischen, deren Zahl sich anfangs vielleicht auf wenige Dutzend beschränkte, lebten in der Schwarzmeerregion zwischen Europa und Asien. Auch sie beteten den Himmelsvater an. Vor 5000 Jahren breitete sich ihre Sprache über das Schwarzmeerbecken hinaus nach Osten und Westen aus und veränderte sich dabei. Binnen 1000 Jahren wurden spätere Formen dieser Sprache von Irland bis Indien gesprochen. Dieser Urknall der indoeuropäischen Sprachen ist innerhalb der Alten Welt das mit Abstand bedeutendste Ereignis der letzten 5000 Jahre. Ab 1492 fanden einige dieser Sprachen auch den Weg in die Neue Welt und verbreiteten sich von dort weiter.
Im Vergleich zur Lebensdauer eines Menschen sind 5000 Jahre eine Ewigkeit, verglichen mit der Zeit, seit der es Menschen gibt, nur ein Herzschlag. In dieser zugleich kurzen und langen Spanne von 5000 Jahren sind viele indoeuropäische Sprachen entstanden und ausgestorben, doch bis heute werden noch mehr als 400 davon gesprochen. Dazu gehören etliche Sprachen Indiens, Pakistans, Afghanistans und Irans, slawische und baltische Sprachen, Welsch, Irisch und andere keltische Sprachen, das Englische und seine germanischen Verwandten, Griechisch, Armenisch und Albanisch und die zahllosen vom Lateinischen abstammenden Sprachen.
In Europa und einigen ehemaligen europäischen Kolonien sehen die Menschen sich in der kulturellen Tradition des jüdisch-christlichen Mittelalters sowie der Römer und Griechen. Weiter im Osten berufen sich viele auf die iranischen Sprachen und den Propheten Zarathustra oder auf Sanskrit und die Religionen des alten Indien. Doch hinter Ovid, den griechischen Sagen und der Göttervielfalt Südasiens verbirgt sich eine Verbindung zwischen Osten und Westen. Wie eine gespannte Saite schwingt sie — vielleicht unbemerkt — in all jenen von uns, die indoeuropäische Sprachen sprechen. Diese Verbindung entstand im Herzen Eurasiens vor der Erfindung der Schrift — in der Vorgeschichte, in der Zeit der Mythologie. Sie setzt sich zusammen aus Drachen und Bären, Hexern und Kriegern, mächtigen Himmelsgöttern und weisen, sinnlichen Königinnen. Sie entstammt dem Reich der Träume und Albträume, der Fantasien und Ängste. Die hinduistischen Texte, Homers Sagen, Beowulf und Herr der Ringe berufen sich darauf. All diese Werke sprechen uralte Wurzeln in der Psyche ihres Publikums an. Und alle stehen in linguistischer Hinsicht in der Schuld der ersten Indoeuropäer. Jahrhundertelang haben wir diese Menschen mit Faszination betrachtet oder gar verklärt. Nun rücken sie in den Fokus. In den letzten zehn Jahren hat die Wissenschaft unser Verständnis dieser Menschen verändert. Ihre Sprache, ihre Vorfahren und ihre Nachkommen, die die Welt bereisten, sind Gegenstand dieses Buchs.
*
Das Sanskrit und seine Schwestersprachen entstanden erst zu einem späten Zeitpunkt in der Geschichte des ältesten Werkzeugs der Menschheit — der Sprache. Als in Afrika vor 300.000 Jahren der Homo sapiens auftauchte, verfügte er bereits über die Sprache; er war in der Lage, alle Laute zu produzieren, derer auch wir mächtig sind, und Bedeutungseinheiten — Wörter — zu Sätzen zu kombinieren.
So lautet die eine Sichtweise. Die andere besagt, dass sich die Sprache überhaupt nicht entwickelt hat, sondern vor 80.000 Jahren in der südostafrikanischen Wüste erfunden wurde — vielleicht von Kindern, die sich selbst überlassen waren, ähnlich wie in Herr der Fliegen. Möglicherweise wurde sie sogar in unterschiedlichen Teilen Afrikas mehrfach erfunden.
Die ersten menschlichen Sprachen waren eine gesprochene oder mit Gesten übermittelte Kombination beider Szenarien. Sie wären uns vielleicht äußerst rudimentär erschienen, weil sie beispielsweise nicht über Adjektive oder eine feste Anordnung der Wörter verfügten. Doch selbst mit einfacher Syntax konnten die Sprecher (oder Gestenanwender) ihren Gesprächspartnern etwas über die unmittelbare sinnliche Wahrnehmung, über die Gegenwart hinaus vermitteln. Die Annahme, dass die ersten Sprecher bereits Geschichten erzählen konnten, ist vor diesem Hintergrund nicht unvernünftig.
Unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler, die in Kleingruppen umherzogen und sich ihre Geschlechtspartner außerhalb der eigenen Gruppe suchten. Dabei müssen sie auf neue Sprachen gestoßen sein, und Kinder wuchsen mit mehr als nur einer Sprache auf. Unterbewusst wählten sie die nützlichsten Eigenschaften jeder dieser Sprachen und verfeinerten sie so. Als die Menschen vor 60.000 Jahren Afrika verließen, kommunizierten sie wahrscheinlich hauptsächlich durch Sprache und waren zu komplexer Ausdrucksweise fähig.1
Vor 60.000 Jahren war die Erde kalt und wurde noch kälter. Irgendwann bedeckten Gletscher einen Großteil Westeurasiens, und jenseits des Eises begann die baumlose Tundra. Die Menschen folgten ihrer Beute in wärmere Gebiete. So könnte das Erzählen von Geschichten zu einer überlebenswichtigen Fähigkeit geworden sein. Vor etwa 14.000 Jahren begannen die Gletscher zu schmelzen, und die Überlebenden zogen wieder in die freigelegten Regionen. Binnen weniger Jahrtausende begannen ihre Nachfahren im fruchtbaren Halbmond um Euphrat, Tigris und Unterem Nil, Pflanzen und Tiere eher zu züchten, als zu jagen. So erschlossen sie ganz neue Nahrungsmittel.
Am Vorabend der Revolution durch den Ackerbau lebten auf der Erde etwa zehn Millionen Menschen. Sie sprachen vielleicht 10.000 Sprachen, von denen jede höchstens 1000 bis 2000 Sprecher hatte. Dank neuer, durch den Ackerbau hervorgebrachter Energiequellen wuchsen die Gemeinschaften und mit ihnen ihre jeweiligen Sprachen. Wie Supernovas entstanden ganze Sprachfamilien. In diesem Zeitalter, dem Neolithikum oder der Neusteinzeit, ereignete sich eine linguistische Explosion: Nun wurden mehr Sprachen gesprochen als zu jeder anderen Zeit der Menschheitsgeschichte. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung könnten es bis zu 15.000 gewesen sein.
Sie waren natürlich nicht gleichmäßig verteilt. Wie wir Menschen selbst sammeln sich die Sprachen oder spalten sich auf. Eine Inselgruppe umfasste vielleicht so viele Sprachen wie Inseln. Für den Kaukasus, der von einem arabischen Geografen im 10. Jahrhundert auch als »Berg der Sprachen« bezeichnet wurde, beschreibt die Linguistik das Phänomen der vertikalen Mehrsprachigkeit: Menschen in höher gelegenen Orten kennen die Sprachen der weiter unten Lebenden, doch umgekehrt trifft dies nicht zu. Orte hoher linguistischer Diversität sind zugleich Orte hoher Biodiversität, weil diese Regionen mehr verschiedensprachige Gruppen aufnehmen können, die nicht auf andere Gebiete ausweichen müssen. Melanesien und Westafrika bieten Einblicke in die einstige weltweite Sprachenvielfalt und sind noch heute davon gekennzeichnet.
Sprachen passen sich also der bewohnbaren Landschaft an. Doch »bewohnbar« ist kein festes Merkmal, sondern es wird jeweils von der natürlichen Umgebung, dem Klima und der menschlichen Anpassungsfähigkeit definiert. Als das Klima sich änderte, zogen die Menschen weiter oder passten sich an. Ihre jeweilige Reaktion spiegelte sich in ihrer wandlungsfähigen Sprache. Als Bantu-Bauern vor circa 5000 Jahren aus Zentralafrika nach Süden zogen, nahmen sie unterwegs die Klicklaute der Buschvölker auf, denen sie begegneten. Als man in Alaska zunehmend mehr Landwirtschaft betreiben konnte, wandelte sich die Bedeutung einiger aleutischer Wörter: Was einst »die Angelschnur auswerfen« oder »den Fang verteilen« hieß, bedeutete später jeweils »pflanzen« und »säen«. Die menschliche Anpassungsfähigkeit ist jedoch nicht unbegrenzt. Im 15. Jahrhundert verschwanden die nordischen Siedler Grönlands zusammen mit ihrer Sprache. Möglicherweise hatte sie ein kühler werdendes Klima an diese Grenze gebracht.
Nach dem Höhepunkt im Neolithikum nahm die Sprachenvielfalt langsam und stetig ab. Der Niedergang begann mit der Entstehung der ersten Staaten, beginnend vor 5000 Jahren mit Sumer in Mesopotamien (dem heutigen Irak). Diese Staaten suchten sich bestimmte Sprachen aus, und diese wuchsen. Binnen 1000 Jahren gab es die ersten Sprachen mit einer Million Sprechern. Manche von ihnen breiteten sich auf Kosten kleinerer Sprachen weiter aus. Viele Sprachen starben aus, hinterließen jedoch meist Spuren, weil die Überlebenden sich an ihren nützlichsten Neuentwicklungen bedient hatten.
Heute sprechen acht Milliarden Menschen etwa 7000 Sprachen. Diese teilen sich in etwa 140 Sprachfamilien ein. Die meisten von uns sprechen jedoch Sprachen aus einer von nur fünf Sprachfamilien: Indoeuropäisch, Sinotibetisch, Niger-Kongo, Afroasiatisch und Austronesisch. Unter diesen fünf gibt es zwei Giganten: Die indoeuropäische Sprachfamilie mit ihrer Hauptvertreterin, dem Englischen, und die sinotibetische, zu der auch das Mandarin gehört. Mandarin hat zwar mehr Muttersprachler als Englisch, aber Indoeuropäisch hat mehr Muttersprachler als Sinotibetisch. Rechnet man Zwei- oder Mehrsprachige hinzu, ist das Indoeuropäische die bei Weitem größte Sprachfamilie, die es weltweit jemals gab. Das stimmt auch hinsichtlich der geografischen Ausbreitung: Fast jeder zweite Mensch auf der Erde spricht eine indoeuropäische Sprache.
*
Unsere modernen Sprachen weisen zwar Spuren ausgestorbener Sprachen auf, doch wir werden nie erfahren, wie die Mehrheit von ihnen klang, weil sie nie aufgezeichnet wurden. Stellte man die 300.000 Jahre der Existenz des Homo sapiens in einer Zeitspanne von 24 Stunden dar, wäre die Schrift um ungefähr 23:30 Uhr entstanden. In diesem Augenblick begann die Geschichte (englisch history, von griech. historia: »Wissen« oder »Wissenssuche«, später auch »Chronik« oder »Bericht«). Alles, was diesem Moment vorausgeht, bezeichnen wir als Vorgeschichte.
Wie die Sprache wurde auch die Schrift mehrfach und unabhängig voneinander entwickelt. Das älteste bekannte Schriftsystem wurde von den Sumerern erfunden. Es nutzte Ideogramme, also Symbole, die Ideen bildlich darstellen. Mit der Zeit entstanden abstraktere Systeme, in denen die Symbole für Laute standen. Diese teilten sich in zwei Kategorien: Silbenschriften (in denen jedes Zeichen für eine Silbe steht) und alphabetbasierte Schriften (in denen jedes Zeichen einen individuellen Sprachlaut repräsentiert). Doch es gab auch hybride Systeme, manche sogar mit einigen Ideogrammen.
Soweit wir wissen, wurde das Alphabet nur einmal erfunden — in oder in der Nähe von Ägypten. Es wurde weithin kopiert und dabei jedes Mal verändert. Eine Schrift kann in mehrere Sprachen codieren, während eine bestimmte Sprache in mehr als einer Schrift wiedergegeben werden kann. Bislang nicht entzifferte antike Schriften, etwa die kretominoische oder die der Indus-Kultur, könnten deshalb bekannte oder bislang unentdeckte Sprachen codieren. Das wissen wir erst, wenn sie entziffert werden.
Verließen wir uns bei der Suche nach ausgestorbenen Sprachen nur auf die Schrift, wäre dieses Buch sehr kurz, denn die indoeuropäischen Sprachen wurden jahrtausendelang von Menschen gesprochen, die Schrift nicht kannten. Zum Glück gibt es andere Mittel, die Vergangenheit zu befragen. Weil Sprache so wandlungsfähig ist und sich pausenlos aus sich selbst heraus fortentwickelt hat, bildet sie das Archiv ihrer eigenen Entstehungsgeschichte. Wenn wir sagen, Sprachen würden »geboren« oder »stürben aus«, definieren wir sie als Pakete von Kommunikationswerkzeugen, die für Benutzer anderer Pakete nicht verständlich sind. (In ähnlicher Weise werden biologische Spezies gemäß der Standarddefinition danach differenziert, ob sie — genauer: ihre Nachkommen — sich untereinander fortpflanzen können.) Diese Definition ist nützlich, aber nicht die einzig mögliche. Die Behauptung, alle Sprachen könnten auf die ersten zurückgeführt werden, ist nicht weniger zutreffend als die Aussage, alle Arten könnten von den ersten lebenden Organismen abgeleitet werden. In diesem Sinne sind alle Sprachen gleich alt. Die heute gesprochenen sind lebende Fossile. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug, sie ist auch ein Denkmal.
Die Menschen wissen schon seit Langem, dass die Struktur einer Sprache und ihre Beziehung zu anderen Sprachen einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen. Herodot, der oft als Vater der Geschichtsschreibung und manchmal auch als Vater der Lügengeschichten gilt, begriff das intuitiv im 5. Jahrhundert v. u. Z.2 Er schrieb, die Bewohner der Steppen nördlich des Schwarzen Meeres wollten mit den Stämmen im (für Herodot am Rand der Weltenscheibe gelegenen) zentralasiatischen Altaigebirge Handel treiben, wozu sie für sieben verschiedene Sprachen sieben Übersetzer benötigt hätten. Er wusste, dass Sprachen sich unterscheiden und gleichzeitig verwandt sein können.
Herodot selbst sprach wahrscheinlich nur Griechisch. Um den Gedanken der Differenziertheit und Verwandtschaft der Sprachen klarer zu formulieren, bedurfte es eines vielsprachigen Menschen. Ein solcher war der polyglotte Dante Alighieri, der im Alleingang das Aussterben des Lateinischen beschleunigte, indem er eines der wichtigsten Werke der mittelalterlichen europäischen Literatur auf Italienisch — der Alltagssprache seiner Landsleute — niederschrieb. Die Göttliche Komödie war so einflussreich, dass Dantes toskanischer Dialekt immerhin über einige Jahrhunderte lang zur Literatursprache Westeuropas aufstieg.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts, als das Lateinische bereits in den akademischen Bereich zurückgedrängt war, betrachtete Dante die europäische Sprachlandschaft. Er benannte die Sprachen nach dem jeweiligen Wort für »Ja« und unterschied die germanischen oder jo-Sprachen von den im Süden und Westen gesprochenen romanischen Sprachen, die er ihrerseits in die (durch die Loire getrennten) langue d’oc und langue d’oïl differenzierte. Weiterhin identifizierte er die im italienischen und iberischen Raum gesprochenen sì-Sprachen. Dante vertrat die These, die oc-, oïl- und sì-Sprachen stammten alle vom Lateinischen ab.
Er argumentierte, sie hätten viele Wörter gemeinsam, etwa für Gott, Liebe, Himmel, Meer und Erde. Das zeigt sich selbst in den modernen romanischen Sprachen, die noch mehr Zeit hatten, sich auseinanderzuentwickeln. Aus dem lateinischendeus, Gott, wird im Französischendieu, auf Italienischdio und auf Spanischdios. Amare (lat. für lieben) wird zu amour — amore — amar; caelum (Himmel) zu ciel — cielo — cielo; mare (Meer) zu mer — mare — mar; und terra (Erde) zu terre — terra — tierra. Im Okzitanischen, der noch heute in Teilen Frankreichs, Spaniens und Italiens gesprochenen langue d’oc, lauten diese Wörter dieu — amor — cèl — mar — tèrra.3
Laut Dante waren die Unterschiede zwischen diesen Sprachen das Ergebnis eines graduellen Wandels. Seine Analogie lautete: »[N]icht wundersamer möchte das erscheinen, was wir sagen, als einen erwachsenen Jüngling zu sehen, den wir nicht aufwachsen sahen. Denn was sich allmälig bewegt, wird von uns sehr wenig bemerkt, und je längere Zeit die Veränderung einer Sache um bemerkt zu werden erfordert, um so beständiger halten wir sie.«4
Das ketzerische Potenzial dieses Gedankens ist schwer zu vermitteln. Im mittelalterlichen Europa galt eine andere Erklärung für die Sprachenvielfalt: Nachdem Noahs Arche am Berg Ararat auf Grund gelaufen war, bauten dessen Nachfahren laut biblischer Überlieferung einen Turm bis in den Himmel. Darüber erzürnt habe Gott »daselbst verwirrt […] aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut […] über die ganze Erde«. Alle Sprachen wurden als Produkte dieser babylonischen Sprachverwirrung betrachtet — mit einer Ausnahme: dem Hebräischen, das als die von Noah mitgebrachte, erste Sprache galt. Da diese Ereignisse erst wenige Jahrtausende zurücklagen, war für den von Dante angenommenen graduellen Sprachwandel keine Zeit. Aus dieser Perspektive war der Dichter auf einem Irrweg, genau wie jene seiner Zeitgenossen, die behaupteten, auch die germanischen Sprachen hätten eine gemeinsame Vorfahrin.
[…] gelehrte Philologen, die
Durch Zeit und Raum einer Silbe nachjagen,
Von Zuhause aufbrechen und sie in der Nacht
Bis nach Gallien, Griechenland und auf Noahs Arche verfolgen […]5
Langsam setzte sich die Theorie der Sprachentwicklung gegen die biblische Darstellung durch, und man akzeptierte die Existenz der romanischen, germanischen und keltischen Sprachfamilien. Im frühen 18. Jahrhundert gelangte der polyglotte Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz zu der Ansicht, dass diese Sprachfamilien ihrerseits eine gemeinsame Vorfahrin hatten. Inzwischen waren die Europäer bis in weit entfernte Weltregionen vorgedrungen und so einer Vielfalt von Völkern und Sprachen begegnet. Manche lernten diese Sprachen sogar, um die kolonialisierten Völker besser regieren zu können. Eine in zahllosen Linguistik-Handbüchern zitierte Rede, die der britische Richter Sir William »Oriental« Jones 1786 in Kalkutta hielt, besagte, Sanskrit, Latein und Griechisch hätten einen gemeinsamen Ursprung, der vielleicht nicht mehr existiere. Auch das Germanische, Keltische und Iranische stammten womöglich von dieser früheren Sprache ab.
Jones war nicht der Erste, der diese Theorie vertrat, aber erst jetzt war die Zeit dafür reif. Die Vorstellung einer archaischen Verbindung zwischen Europa und dem Orient elektrisierte die Menschen. In einer Welt ohne Flugzeuge und Internet, die so viel größer und geheimnisvoller erschien als heute, staunte man über Wortpaare aus dem Lateinischen und dem Sanskrit wie domus — dam (Haus, Heim), deus — deva (Gott), mater — mata (Mutter), pater — pita (Vater), septem — sapta (sieben) und rex — raja (König) oder über den Vergleich der ersten drei Zahlen im Deutschen (eins — zwei — drei), Griechischen (heis — duo — treis) und Sanskrit (ekas — dvau — trayas). Von welchen vergangenen, fantastischen Begegnungen zeugten diese leisen Echos? »Gehörtes Lied ist süß, doch süßer ist / Ein ungehörtes«.6 In der westlichen Welt wurde Sanskrit nun intensiv erforscht.
Die historische Linguistik untersucht den Wandel von Sprachen im Lauf der Zeit und identifizierte zwölf Hauptzweige der indoeuropäischen Sprachfamilie: Anatolisch, Tocharisch, Griechisch, Armenisch, Albanisch, Romanisch, Keltisch, Germanisch, Slawisch, Baltisch, Indisch und Iranisch.7 Diese Zusammenfassung in einer Liste kommt jedoch einer Gewalttat gleich, denn jeder Zweig steht für die Odysseen und Gedanken der Menschen durch die Zeiten.
Das Anatolische umfasst eine Reihe lange ausgestorbener Sprachen, die einst auf der türkischen Halbinsel gesprochen wurden. Dazu gehört die Sprache des großen Reichs der Hethiter. Anatolisch gilt als ältester Abkömmling des Indoeuropäischen, obwohl es als letzter anerkannt wurde. Das Tocharische ist ein weiteres dieser ungebetenen Kinder, doch die Beweise seiner Zugehörigkeit sind überwältigend. Auch das Tocharische ist eine ausgestorbene Sprache, oder besser zwei, und wurde an den Handelsposten der Seidenstraße im heutigen Nordwestchina gesprochen. Damit bildet es den östlichsten Zweig des Indoeuropäischen.
Die indischen und iranischen Zweige gelten als so eng verwandt, dass die Linguistik sie meist als Indoiranische Sprachfamilie zusammenfasst. Sowohl in geografischer Hinsicht als auch mit Blick auf die Sprecherzahl sind sie die größten Zweige. Zu ihnen gehören auch die weniger bekannten Nuristani-Sprachen, die in abgelegenen Tälern des Hindukusch gesprochen werden. Der iranische Zweig umfasst das ausgestorbene Avestisch, die Muttersprache Zarathustras, und das Sogdische, das im Frühmittelalter von Händlern entlang der Seidenstraße gesprochen wurde, aber auch Farsi (modernes Persisch), Paschtu und Kurdisch. Deren ausgestorbene Cousine Sanskrit, die Sprache der Veden (der frühesten hinduistischen Schriften), ist vielleicht die fruchtbarste aller indoeuropäischen Sprachen. Zu ihren vielen noch heute lebendigen Nachkommen gehören Hindi, Urdu, Romani und das in Sri Lanka gesprochene Singhalesisch.
Griechisch, Albanisch und Armenisch sind so verschiedene Sprachen, dass jede ihren eigenen Zweig hat. Ihr Waisenstatus zeugt von all den lange ausgestorbenen Verwandten, die sie einst auf ihrer Reise durch die Zeit begleitet haben, der Reihe nach ausstarben und nur diese drei zurückließen. Die überlebenden baltischen Sprachen, Lettisch und Litauisch, haben eine gemeinsame Geschichte mit den slawischen Sprachen. Doch diese erzählen ihre eigene Geschichte und bilden westliche (darunter Polnisch und Tschechisch), südliche (wie Bulgarisch und Slowenisch) und östliche (vor allem Ukrainisch und Russisch) Verzweigungen.
Am anderen Ende Europas teilen sich die keltischen Sprachen entlang einer Nord-Süd-Achse. Irisch, das schottische Gälisch sowie Manx entwickelten sich anders als Walisisch und Kornisch, die eher Gemeinsamkeiten mit dem Bretonischen und dem ausgestorbenen Gallischen zeigen. Die romanischen Sprachen umfassen das Lateinische und dessen Nachkommen, von Portugiesisch bis Rumänisch, aber auch die toten Schwestern des Lateinischen, Umbrisch und Oskisch. Das Oskische war die Sprache der Sabiner, deren Frauen der Sage nach vom Gründer Roms und dessen Gefolgsleuten vergewaltigt wurden. Der germanische Zweig schließlich differenziert sich in die skandinavischen Sprachen, Englisch, Niederländisch und Deutsch sowie das ausgestorbene Gotisch, das einst bis in die Krimregion und ins heutige Südrussland hinein verbreitet war.
Die meisten Sprachen sind ihrerseits variantenreich. Ein Beispiel ist das moderne Englisch, das sich über Mittelenglisch aus dem Altenglischen entwickelt hat. Die Linguistik schätzt, dass es durchschnittlich 500 bis 1000 Jahre dauert, bis eine Sprache für deren ursprüngliche Sprechergemeinschaft unverständlich wird (wobei diese natürlich nicht mehr anwesend sind, um verständnislos dreinzublicken). Die Sprecher des modernen Englisch verstehen Shakespeares Mittelenglisch, das im 16. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, aber nicht das alte Englisch des Beowulf, der 900 Jahre früher entstand. Die ersten Zeilen des Beowulf lauten: »Hwæt. We Gardena in geardagum, þeodcyninga, þrym gefrunon, hu ða æþelingas ellen fremedon«. Der US-amerikanische Dichter Stephen Mitchell übersetzt sie so:
Of the strength of the Spear-Danes in days gone by
we have heard, and of their hero-kings:
the prodigious deeds those princes performed!8
(Anders als man glauben könnte, wurde Europa nie gänzlich von den indoeuropäischen Sprachen beherrscht. Finnisch, Estnisch und Ungarisch gehören zur uralischen Sprachfamilie, während das Baskische als Anachronismus überlebt — eine alte Insel im Meer des Indoeuropäischen. Im ersten Jahrtausend u. Z. eroberten die Westgoten die baskischen Gebiete. Jeder westgotische König verkündete: Domuit vascones! Die eigentlich germanischsprachigen Westgoten übernahmen im Rahmen ihrer Bewegung nach Westen das Lateinische. Der Ausdruck bedeutet: »Er zähmte die Basken!« Die Behauptung wurde nie eingelöst.)
Es ist also logisch, dass die Mutter aller indoeuropäischen Sprachen auch selbst von einem Vorfahren abstammte, den sie mit anderen Sprachfamilien gemeinsam hatte. So ließe sich immer weiter zurückgehen, bis zu den ersten Sprachen der Menschen. Doch je weiter wir in die Vergangenheit blicken, umso schwieriger ist zu erkennen, ob Sprachen einander ähneln, weil sie eine gemeinsame Abstammung haben, oder ob es dafür einen anderen Grund gibt — weil sie beispielsweise untereinander Anleihen vorgenommen haben. Jenseits der 10.000 Jahre in der Vergangenheit ist es unmöglich, diese Effekte klar voneinander zu unterscheiden. Während also niemand abstreitet, dass es »Super-Sprachfamilien« gibt — und sogar eine vermutet wurde, die indoeuropäische und uralische Sprachen umfasst —, ist die Erforschung dieser Sprachen eine eher abseitige Unternehmung. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen widmen sich heute Fragen, auf deren Antworten wenigstens Aussicht besteht.
Kaum war die Verbindung zwischen den indoarischen und europäischen Sprachen bewiesen, fragten sich die Menschen, wo diese gemeinsame Sprache einst gesprochen wurde. Die Verortung des indoeuropäischen Ursprungslands galt vielen Intellektuellen — und vielen weniger Intellektuellen — 250 Jahre lang als Heiliger Gral. Die Denker der Aufklärung erklärten Indien zum Geburtsort der indoeuropäischen Sprachen und hielten Sanskrit für deren archaischste Ausprägung. Manchen Vorreitern der Rationalität war jeder Ort recht, solange er nicht biblisch war. Kandidaten waren unter anderem der Nordpol oder die im Schwarzmeer versunkene Stadt Atlantis. Beinahe jedes Land am Schwarzmeer wurde als Entstehungsort vermutet,9 für manches gilt das noch heute.
Anfangs führte das Spannungsverhältnis zwischen den Vorstellungen, die indoeuropäische Protosprache sei an einem Ort oder von einem Volk gesprochen worden, zu gefährlichen Lücken. Tendenziell nationalistische europäische Archäologen konzentrierten sich im 19. Jahrhundert auf das Wort »arisch«, mit dem die alten Inder und Iraner sich selbst bezeichneten (»Ich gab das Land dem Arier«, erklärt der Gott Indra im ältesten indischen Text).10 Dieses angebliche Urvolk verorteten die Archäologen weit näher der eigenen Heimat. Die Nazis strapazierten diese Fantasie bis zum absurden und düsteren Extrem, behaupteten sie doch, die ersten Sprecher des Indoeuropäischen seien blond und blauäugig gewesen, hätten einheitliche Töpferkunst produziert und im heutigen Norddeutschland gelebt. Schon bei kurzem Nachdenken erweist sich eine solch simple Gleichsetzung von Völkern, Kulturen und Sprache als Illusion. Indigene Australier, die sich als einander ethnisch ähnlich begreifen, sprechen Hunderte verschiedene Sprachen, während Englisch von über einer Milliarde Menschen gesprochen wird, die sich einer Vielzahl von Ethnien und Kulturen zurechnen. Die heutige Fachwelt ist zwar mehrheitlich der Ansicht, es habe eine indoeuropäische Protosprache gegeben, die von echten Menschen an einem echten Ort gesprochen wurde, nimmt aber nicht an, dass diese Menschen ethnisch oder kulturell homogen waren.
Eine Minderheit unter den Fachleuten hinterfragt die Vorstellung eines Ursprungslands. Sie verweisen darauf, dass Sprachen sich in der Realität nicht klar umgrenzen lassen. Stattdessen gehen verschiedene Dialekte ineinander über. (Das war vor dem 18. Jahrhundert für jeden offensichtlich. Mit der Einführung von Nationalgrenzen und Nationalsprachen, die gegenüber Dialektkontinua Vorrang erhielten, wurde es weniger klar erkennbar.) Die Definition einer Sprache ist hoffnungslos politisch. Dem Linguisten Max Weinreich wird die Aussage zugeschrieben, eine Sprache sei ein Dialekt mit Armee und Flotte. Sprachen verändern sich nicht nur durch vertikale Entwicklung, sondern auch durch horizontale Anleihen. Das bekannte Baummodell der Sprachentwicklung ist eine Vereinfachung, die uns schrecklich getäuscht hat. Den Skeptikern zufolge wurde im Zeitalter der Aufklärung der biblische Ursprungsmythos nur durch einen nationalistischen ersetzt. Je schneller wir auf die mythische Wiege der Sprache zulaufen, umso schneller weicht sie zurück, weil es sie nie gegeben hat. Sie ist eine Fata Morgana.
Die meisten Linguisten halten diese Sichtweise für unnötig pessimistisch. Sie gestehen zu, dass das Baummodell stark vereinfachend ist und die Sprache sich durch horizontale und vertikale Prozesse wandelt. Zugleich aber sind sie überzeugt, diese Prozesse unterscheiden und zurückverfolgen zu können. Und sie glauben durchaus, dass man von der »Geburt« der indoeuropäischen Sprachen sprechen dürfe und somit auch von deren »Geburtsort«. Ihnen ist klar, dass ihre Disziplin dadurch in der Vergangenheit in einige düstere ideologische Sackgassen geraten ist. Diese Vergangenheit wollen sie jedoch nicht verstecken, sondern aufzeigen und davor warnen, je wieder dorthin zurückzukehren.
Die indoeuropäische Sprachfamilie genießt die zweifelhafte Ehre, Übungsobjekt der historischen Linguistik gewesen zu sein. Die so gewonnenen Fähigkeiten setzte die Forschung später bei anderen Sprachfamilien ein. Die indoeuropäische ist deshalb die am besten dokumentierte und in vielerlei Hinsicht am besten verstandene Sprachfamilie der Welt, doch sie ist auch mit dem meisten veralteten intellektuellen Ballast behaftet. Sie ist wie der Vorzeigepatient eines Quacksalbers aus dem 19. Jahrhundert, der Öffentlichkeit halb entblößt vorgeführt, gleichermaßen gefeiert und missbraucht.
*
Wie erforscht man eine Sprache, die seit Tausenden von Jahren ausgestorben ist und niemals niedergeschrieben wurde? Die kurze Antwort lautet: mit Demut. Die längere Antwort lautet: mit Linguistik, Archäologie und Genetik. Die historische Linguistik untersucht die Sprachgeschichte; die Archäologie erforscht kulturelle Entwicklungen und die Genetik das Erbgut.
Sprache, Kultur und Gene lassen sich zwar nicht eins zu eins miteinander ins Verhältnis setzen, aber zwischen allen drei Bereichen existieren Beziehungen, sodass jeder uns etwas über die beiden anderen erzählen kann. Sprachen reflektieren im weitesten Sinne die Kulturen, mit denen sie verbunden sind, weil Menschen mehr Wörter für Dinge haben, die ihnen wichtig sind — seien es Meißel, Elfen oder gesalzene, fermentierte Heringe (schwedisch: Surströmming). Wenn Menschen an andere Orte ziehen, bringen sie ihre Kulturen und Sprachen mit und behalten sie — wenigstens eine Zeit lang — bei. Migration gilt als wichtige, wenn nicht hauptsächliche Ursache des Sprachwandels, weil sie Dialekte voneinander trennt und sie mit anderen Sprachen in Kontakt bringt. Auf vielen Kontinenten besteht eine Korrelation zwischen prähistorischen Migrationsrouten und der Verzweigung der Sprachfamilien. Von diesen Regeln gibt es viele Ausnahmen, weil Gene und Sprachen auf verschiedene Weise weitergegeben werden. (Menschen erhalten ihre Gene von den Eltern, können aber Sprachen auch von Dritten erhalten oder aus Büchern und Apps, und sie können sie auch verlernen.) Dennoch gilt: Gleicht man Migrationsbewegungen, kulturelle Entwicklungen und Sprachen miteinander ab, kann man die Geschichte der Menschen hinter diesen von Herodot einst nur erahnten, von Dante, Leibniz und Jones aber schon deutlich wahrgenommenen Beziehungen erforschen. Man kann die sprachliche Vergangenheit der Menschen und sogar die längst ausgestorbenen Sprachen selbst rekonstruieren.
Im 19. Jahrhundert schließlich stand die historische Linguistik auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Unter Zuhilfenahme aller Quellen — von alten, in toten Sprachen verfassten Texten bis zu deren lebenden, aktiv gesprochenen Verwandten — verglich sie systematisch Wort- und Satzbildung dieser Sprachen und entwickelte Gesetzmäßigkeiten, die voraussagten, wie ein Laut auf einem bestimmten Zweig der indoeuropäischen Sprachfamilie sich auf einem anderen Zweig veränderte: Ein lateinischesp wurde im Englischen verlässlich zu f, qu wurde zu wh (pater — father, quod — what). Diese sogenannte Erste Lautverschiebung wurde erstmals von Jacob Grimm beschrieben. Als er sich mit seinem Bruder Wilhelm auf die Suche nach deutschen Märchen begab, sammelten die beiden Materialien in verschiedensten Dialekten, aus denen sie unter anderem den urgermanischen Vorläufer rekonstruieren wollten.
Sprachlaute verschieben sich im Lauf der Zeit, aber die menschlichen Sprechorgane können nicht unendlich viele unterschiedliche Lautkombinationen erzeugen. Einzelne Laute können sich nur in begrenzter Weise verschieben. Ändert sich ein Laut, wirkt sich das meist auch auf benachbarte Laute aus. Die Gesetze der Lautverschiebung begrenzen also die Möglichkeiten der Sprachen, von einem gemeinsamen Vorfahren abzuweichen. Nun konnte die Linguistik ererbte Merkmale identifizieren, die verwandte Sprachen gemeinsam haben — auch wenn sie dort jeweils unterschiedlich klingen. Sie konnten auch zwischen ererbten Merkmalen und Anleihen differenzieren. Sogenannte Lehnwörter bergen viele Informationen und verweisen auf Kontakte zwischen Sprachen. Unter anderem dank der Lehnwörter war die historische Linguistik in der Lage, die Herkunft der Roma aus Indien zu belegen. Die Sprache Romani stammt vom Sanskrit ab, was sich deutlich an den Lautverschiebungen zeigt, die beide Sprachen unterscheiden, aber auf der langen Reise des Volkes Richtung Westen nahm sie auch viele Lehnwörter aus anderen Sprachen auf. Zu den in Persien aufgenommenen Wörtern gehörten jene für »Honig«, »Birne« und »Esel«. Die Roma mussten zur Zeit der Eroberung Persiens durch die Muslime im 7. Jahrhundert weitergezogen sein, weil Romani keine Lehnwörter aus dem Arabischen enthält.
Weil Sprachen Informationen bewahren, ohne dass sich deren Sprecher normalerweise dessen bewusst sind, bieten sie einen unzensierten Blick auf die Vergangenheit. Er mag nicht vollständig sein, wie jede historische Darstellung, aber Sprachen und Geschichtsbücher ergänzen einander auf interessante Weise. Die Herausforderung der Linguistik besteht darin, ihre Version intakt zu bergen, ohne dabei in eine der vielen Fallen zu tappen, die in Sprachen lauern. Beispielsweise musste sie lernen, sich nicht von Wörtern täuschen zu lassen, die einander zufällig ähneln, weil sie etwa die ersten von Babys gesprochenen Wörter (»Mama« ist universell) oder onomatopoetisch sind.
Ein Beispiel des Onomatopoetischen ist das Wort »Barbar«, dessen Wurzeln im Sanskrit (barbaras) und im Altgriechischen (barbaros) zu finden sind. Sowohl das griechische als auch das Sanskrit-Wort bezeichnen jemanden, der stottert oder in fremden Zungen spricht (die Barbaren allerorten mögen dies entschuldigen). Vielleicht sind die Wörter inspiriert von den Lauten, die Menschen wahrnahmen, wenn sie eine Äußerung nicht verstanden: bar-bar, bla-bla, Rhabarber. Doch wenn Fremde sprachen, hörten alle nur Blabla. Im Hebräischen gibt es das alte Wort balal (Geplapper). Hebräisch gehört zur afroasiatischen Sprachfamilie (semitischer Zweig). Es wäre falsch, aufgrund dieser Ähnlichkeit anzunehmen, Hebräisch und Deutsch hätten einen gemeinsamen Vorfahren.
Die Linguistik entwickelte Schritt für Schritt eine Vorstellung vom relativen Alter sprachlicher Merkmale, etwa gewisser Lautkombinationen oder grammatischer Elemente — je nachdem, ob sie in älteren oder jüngeren Zweigen der Sprachfamilie auftraten. So konnten sie lange ausgestorbene Ursprachen rekonstruieren — die gemeinsamen Vorfahren der zwölf Hauptzweige und letztlich die Mutter aller, das Urindoeuropäische. Angesichts der Tatsache, dass es letztlich kein sicheres Wissen über diese Protosprachen geben kann, entstand die Konvention, einem rekonstruierten Wort einen Asterisk voranzustellen, um dessen hypothetischen, undokumentierten Status zu markieren. So glaubt man etwa, dass *klewos im Urindoeuropäischen »Ruhm« bedeutet hat, oder vielleicht eher »das, was gehört wird« (das, wovon die Dichter singen). Das Wort wurde gemäß den Gesetzen der Lautverschiebung auf Basis seiner Nachfahren rekonstruiert, unter anderem griechisch kleos, altkirchenslawischslawa und Sanskritshravas.
Diese Rekonstruktion war keine exakte Wissenschaft. Je mehr Zweige einer Sprachfamilie Merkmale aufwiesen, die als ererbt eingeschätzt wurden, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, dass diese Merkmale alt waren. Doch die Linguistik war über die für solche Urteile notwendige Zahl der Sprachzweige uneins. Äußerst erbittert wurde zudem über die Bedeutung rekonstruierter Wörter gestritten, denn diese kann sich im Lauf der Zeit verengen, ausweiten oder wandeln. Das Wort »Fokus«, welches die Ausrichtung der Aufmerksamkeit bezeichnet, stammt von einem lateinischen Wort für »Feuerstelle«. »Maus«, von lat. mus, kann ein kleines Nagetier oder das Gerät zur Bewegung des Cursors auf dem Computerbildschirm meinen, doch im Romani hatte es nur eine dieser Bedeutungen. Die Etymologie macht unter anderem deshalb Freude, weil sie den spannenden Weg nachzeichnet, den die Bedeutung eines jeden Wortes seit dessen Ursprung zurückgelegt hat.
Nur äußerst selten wurden die Linguisten bestätigt — wenn etwa eine Inschrift oder ein Dokument zum Vorschein kam, das den Beweis für die Existenz eines Wortes oder Lautes lieferte. Doch hin und wieder geschah genau das. Der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure vermutete die Existenz eines verschwundenen Konsonanten, des Laryngals, um die Entwicklung von Wörtern zu erklären, die diesen einst enthalten hatten. Später wurde eine Tafel aus der Zeit der Hethiter entdeckt, die einen solchen Laut als Symbol darstellt. Leider erlebte de Saussure dies nicht mehr.
Die historische Linguistik vergleicht auch heute noch Sprachen miteinander. Inzwischen werden die Sprachstammbäume allerdings von Computern mit sprachlichen Merkmalen abgeglichen, um Übereinstimmungen zu finden. Doch die Vergleichsmethode kann nur das relative Alter von Sprachen angeben. Sie kann uns nicht sagen, zu welchem historischen Zeitpunkt diese Sprachen entstanden sind, sich aufgespalten haben oder ausgestorben sind. Hier können Lehnwörter Aufschluss geben, sofern sie zeitlich belegbar sind — etwa im Fall der persischen Wörter im Romani. Andernfalls gibt es für die Datierung von Schlüsselereignissen innerhalb der Sprachenentwicklung nur externe, nicht-linguistische Quellen.
Geschichten sind hier sehr hilfreich. Römische Geschichtsschreiber berichten zum Beispiel, dass die Senatoren sich um 100 u. Z. anlässlich einer Rede des künftigen Kaisers Hadrian vor dem Senat über dessen spanischen Akzent lustig gemacht hätten. (Hadrian wurde in der Provinz Sevilla im heutigen Spanien geboren.) Die Fragmentierung des Lateinischen war zu dieser Zeit also bereits im Gange, doch Hadrian sprach noch immer ein als solches erkennbares Latein, nicht etwa eine frühe Version des Spanischen. Als zwei Enkel Karls des Großen im 9. Jahrhundert einen Pakt schlossen, hatten sich die romanischen Sprachen bereits vom Lateinischen getrennt. Das wissen wir, weil einer der Brüder eine Form des Altfranzösischen, der andere jedoch eine Form von Althochdeutsch sprach und beide ihren Eid in der Sprache des jeweils anderen ablegten. Der deutschsprachige Ludwig beherrschte zwar Latein, aber Französisch war für ihn schwieriger. Dieses Dokument, heute bekannt als die Eide von Straßburg, ist der älteste erhaltene französische Text (und auch der älteste in einer romanischen Sprache).
Der Rigveda, der älteste indische Text nennenswerter Länge, wird auf 1400 v. u. Z. datiert. Die ältesten griechischen Texte stammen etwa aus derselben Zeit. Es gibt noch ältere indoeuropäische Inschriften wie Graffiti, Epitaphe oder andere kurze Wortreihungen. Die ältesten sind hethitischen Ursprungs und datieren auf etwa 2000 v. u. Z. Vor diesem Zeitpunkt verlieren sich die Spuren der Sprachen, und eine neue Methode zur Erforschung der Sprachstammbäume und der Lebensweisen früherer Kulturen wird benötigt. Hier kommen Archäologie und Genetik ins Spiel.
Die Archäologie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts förderte Inschriften und Texte zutage, die es der Linguistik ermöglichten, zunächst verschiedene Schriftsysteme zu entziffern und dann die damit codierten Sprachen methodisch zu untersuchen. Doch die Archäologie lieferte weitere Erkenntnisse. Als Wissenschaft hat sie sich in den letzten 70 Jahren zu einer äußerst fesselnden Angelegenheit entwickelt. Ein Archäologe, dem ich kürzlich zuhörte, lachte glücklich, als er schilderte, dass der Zahnbelag von Schäfern, die vor Tausenden Jahren gelebt hatten, Aschepartikel jenes Rauchs enthält, den diese Personen einst eingeatmet hatten. Die Analyse der Ascheteilchen offenbarte sogar, welche Baumart verbrannt worden war.
Das Verhältnis der Isotope in Knochen und Zähnen verrät nicht nur, was jemand gegessen hat, sondern auch, ob die Person am selben Ort aufgewachsen ist wie ihre Eltern, ob sie das Kind von Immigranten war und ob sie Hungerphasen durchlebt hat. (Isotope sind verschiedene Formen des gleichen chemischen Elements. Sie sind in verschiedenen Anteilen in der Natur und folglich auch in unserer Nahrung enthalten.) Eine weitere archäologische Untersuchungsmethode sind Knochenscans: Sie zeigen, ob unsere Vorfahren viel liefen, schwere Lasten trugen oder zu Pferd unterwegs waren. Noch ehe die Genetik die Migrationsbewegungen nachvollziehen konnte, lieferten diese Methoden Hinweise darauf, dass unsere Vorfahren migriert sind.
Eine Muschel, die einst als Schmuckstück an einem Armband getragen wurde, kann heute als Teil eines Geschenkeaustauschs an ihren Ursprungsstrand zurückverfolgt werden. Ein Kupferbarren aus einem Schiffswrack kann bis zu der weit entfernten Mine zurückverfolgt werden, in der das Kupfer abgebaut wurde. Das Verhütten des Barrens könnte tief im Torf Bleistaub hinterlassen haben. Archäologen können in den Torf bohren, den Bleistaub finden und Aufschlüsse über die Dimensionen der Verhüttung geben.
Weil Torf sich sehr langsam bildet, ist er eine Art Kohlenstoffkopie der Vergangenheit. Das gilt auch für die organischen Überreste am Boden von Seen. Dort wie auch im Torf lagern sich Pollen ab. Analysiert man Konzentration und Arten der Pollen in den verschiedenen Sedimentschichten, lässt sich die Abfolge des prähistorischen Klimawandels rekonstruieren — eine Art Zeitlupe steigender und sinkender Meeresspiegel, wachsender und schrumpfender Wälder. Dann kann man fragen, wie sich die Menschen jeweils in diese Konstellationen einfügten. Die präziseste Form der Radiokarbondatierung ermöglicht die Datierung organischer Materialien — auch Knochen — auf etwa eine Generation Genauigkeit. In seinem Gedicht Moorkönigin beschreibt der irische Dichter Seamus Heaney die Aushebung einer alten Moorgrabstätte.11
Die Archäologie kann also aus winzigen, nur unter dem Mikroskop sichtbaren Fragmenten eine Vielzahl an Informationen gewinnen. Dennoch bleibt ihr Wissen begrenzt. Sie kann belegen, dass die Menschen von Ort zu Ort gezogen sind, aber nicht, wie viele es waren, wie schnell sie migrierten oder zu welcher Zeit die Bewegungen stattfanden. Sie hat Einblick in die intimsten Rituale im Leben — und Tod — eines Individuums, kann aber nur raten, welche Überzeugungen ihnen zugrunde lagen. Es gab Nomadenvölker, von denen nie eine Siedlung entdeckt wurde, und ganze Städte, deren Tote nie gefunden wurden (beiden Formen der Abwesenheit werden wir in diesem Buch begegnen). Die Archäologie erfasst normalerweise eher Ereignisse als Prozesse, aber die Menschen und ihre Sprachen wurden eher langsam und durch kumulative Faktoren geformt. Diese Entwicklungen vollzogen sich manchmal so langsam, dass selbst die unmittelbar davon betroffenen Menschen sie nicht wahrnahmen. Die Untersuchung dieser Prozesse bedarf einer anderen Disziplin.
Vor ungefähr 20 Jahren lernte die Genforschung, DNA aus sehr alten menschlichen Überresten zu extrahieren. Man setzte die Gentechnik nicht zum ersten Mal für die Erforschung der Vorgeschichte ein, doch bislang hatte man in heutigen Populationen nach Spuren von Migrationsbewegungen gesucht. Das Erbgut eines lebenden Menschen ist ein Schnappschuss von dessen Vorfahren, die ihre DNA beigetragen haben. Die Strategie war also klug. Firmen wie 23andMe machen es genauso. Doch die Methode ist nur für einen Zeitraum von ungefähr zehn Generationen in die Vergangenheit verlässlich, weil Erbgut, das später hinzukommt, das frühere verwässert. Sie kann uns sagen, ob ein Vorfahr im 18. Jahrhundert auf einem Sklavenschiff nach Algier gebracht wurde, aber nicht, ob 1000 Jahre zuvor ein Ahn in den Alpen Salz abgebaut hat.
Viele glaubten, es werde nie möglich sein, die DNA lange verstorbener Menschen auszulesen, und zwar aufgrund des Kontaminationsrisikos. Selbst das Berühren eines alten Knochens mit den Fingerspitzen kann die eigene DNA auf diesen übertragen. In den Museen gab es nur wenige Knochen, die ausschließlich mit Handschuhen angefasst worden waren. (Im 19. Jahrhundert leckten Archäologen sogar an Knochen, um deren Alter zu schätzen. Angeblich war der Knochen umso älter, je mehr er an der Zunge klebte.) Der Durchbruch kam Anfang der 2000er-Jahre, als es Genforschern gelang, das individuelle Profil alter DNA zu identifizieren, deren Veränderungen über die Zeit sichtbar zu machen und sie von der modernen DNA zu trennen. Auch das Sequenzieren des Genoms (des vollständigen Erbguts) eines Menschen wurde immer günstiger und konnte im großen Stil sowie deutlich schneller durchgeführt werden. Die verbesserten Möglichkeiten der Extraktion, Sortierung und Decodierung alter DNA brachten eine Zeitenwende in der Erforschung der noch ungeschriebenen Vergangenheit.
Seitdem sind viele Studien über alte DNA erschienen. 2023 hatte man bereits 10.000 alte Genome analysiert und damit das Ergebnis des vorhergehenden Jahrzehnts um das 100-Fache überschritten. Die Genetiker selbst gestehen ein, dass dies noch lange nicht ausreicht und sie noch weit mehr Daten benötigen, um die Lücken in unserem Wissen über ausgestorbene Völker zu füllen und die historischen Prozesse zu rekonstruieren. Doch bereits jetzt haben sie viele Details zusammengetragen, die ein erstaunliches Bild des prähistorischen Europa ergeben. Durch die Nachverfolgung spezifischer Arten von DNA, die nur über die männliche Linie (das Y-Chromosom) vererbt werden, können sie zwischen Ortswechseln von Männern und Frauen unterscheiden und Fortpflanzungsnetzwerke darstellen. So wurden etwa Tabus offengelegt, die es Angehörigen von Eliten verboten, unterhalb ihrer sozialen Schicht zu heiraten. Auch die Segregation zwischen bestimmten ethnischen Gruppen wurde sichtbar gemacht. Genetische Signale weisen auf die Existenz von Pflegefamilien, Mitgefühl für Behinderte, Menschenopfer, Völkermorde und Seuchen hin. Die Genetik konnte Ausmaß — und manchmal Geschwindigkeit — von Migrationsbewegungen bestimmen, die Archäologen nur als Momentaufnahmen erfassen konnten. Aber vor allem bestätigt sie zweifelsfrei, welch große Rolle die Migration in der Geschichte der Menschheit und ihrer Sprachen gespielt hat.
Dank dieser Fortschritte ist die Erforschung der indoeuropäischen Sprachen in eine aufregende neue Phase eingetreten. In der 200-jährigen Geschichte dieses Forschungsfelds kann nun auf zuvor nicht gekannte Weise trianguliert werden, sodass sich die Ereignisse beschreiben lassen, durch die sich unsere modernen Sprachen aus inzwischen ausgestorbenen entwickelt haben. Auch andere Disziplinen haben ihre Erkenntnisse beigesteuert. Die Sagenforschung rekonstruierte die Sagen längst verschwundener Völker durch die vergleichende Betrachtung häufig wiederkehrender Elemente von Mythen. So eröffnete sie den Blick auf das Weltverständnis dieser Menschen. Die Ethnografie zeigt mögliche Parallelen zwischen modernen und historischen Gesellschaften auf. Dabei ergibt sich beispielsweise, dass Gesellschaften von Viehzüchtern gewalttätiger sind als Gemeinschaften von Ackerbauern, weil ihre Güter mobil sind und deshalb leichter gestohlen werden können. Die computergestützte Biologie untersucht die Mikroben, die sich parallel zum Menschen entwickelt haben, darunter auch das Mikrobiom sowie Krankheitserreger. Sie verleihen der »lautesten Stille« (so der Anthropologe James C. Scott) in der Archäologie eine Stimme: den Infektionskrankheiten. Auch Keime spielten eine Rolle in der Entwicklung unserer Sprachen.
Der Ursprung der indoeuropäischen Sprachfamilie ist eine der großen Fragen der Geistesgeschichte. Die Rekonstruktion der Vergangenheit dieser Sprachfamilie ist hoch kompliziert, weil ihr Gegenstand flüchtig ist: die Äußerungen längst nicht mehr existierender Gehirne, die längst nicht mehr existierende Trommelfelle zum Vibrieren brachten. Die historische Linguistik ist sich vollends bewusst, dass sie sich von Regeln leiten lässt, die — mit Ausnahme der Lautverschiebungen — höchstens als Daumenregeln durchgehen. Die Migration hat den Sprachwandel befördert, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die Skythen wanderten in die Ukraine und nach Indien ein, hinterließen ihre Sprache aber an keinem der beiden Orte. Die Römer gelangten bis nach England, aber das Lateinische blieb (hauptsächlich) in Frankreich. Und wer immer die keltische Sprache nach Irland brachte, hinterließ fast keine Spuren im irischen Genpool.
Die Ironie der interdisziplinären Forschung besteht darin, dass die Archäologie und die Genetik nicht dieselbe Sprache sprechen. Archäologen untersuchen Kulturen, genauer wiederkehrende Muster von Gegenständen, die die Identität einer Gruppe definieren. Kulturen entstehen und vergehen, aber Gene bestehen fort — wenn auch in unterschiedlichen Konzentrationen. Die Genetik hat also einen anderen Identitätsbegriff. Sprachen wiederum haben ihre eigene Dynamik, verändern sich sowohl durch Vererbung als auch durch Kontakt und sind doch nicht weniger eng mit unserer Identität verknüpft.
Dieses wissenschaftliche Babel ist an sich nichts Schlechtes, weil Identität, wie wir alle wissen, eben multifaktoriell ist. 2016 unterbrach ein Mann während einer Busfahrt in Großbritannien die Unterhaltung einer Niquab tragenden Frau mit ihrem kleinen Sohn, um ihr zu sagen, sie solle in Großbritannien Englisch sprechen. Ein anderer Passagier kritisierte den Mann: Man sei hier in Wales und die beiden hätten Walisisch gesprochen. 1600 Jahre zuvor wurde ein römischer Diplomat im Lager des Hunnen Attila an der Unteren Donau auf Griechisch angesprochen. Er drehte sich um und erblickte einen langhaarigen, in Felle gekleideten Mann. »Ein Barbar, der Griechisch spricht!«, staunte er. Der Mann erklärte, er sei kein Barbar, sondern ein von den Hunnen versklavter ehemaliger römischer Händler. Er hatte sich freigekauft, wieder geheiratet und zog dieses Leben nun seinem alten vor. »Jetzt kämpfe ich gegen die Römer.« Linguisten, Archäologen und Genetiker sind zwar regelmäßig uneins über die Interpretation der Daten und Artefakte, doch diese Uneinigkeit könnte auch eine Stärke sein. Sie haben jeweils Zugang zu zwei anderen Datensätzen, an denen sie ihre Theorien überprüfen können. Bei gut funktionierender Triangulation können sie gegenseitige Voreingenommenheiten hinterfragen und einander zu intellektueller Redlichkeit verpflichten. Jede der drei Disziplinen tappt, für sich genommen, bei der Erforschung der indoeuropäischen Sprachen im Dunklen. Gemeinsam könnten sie der Wahrheit näher kommen.
Brechen wir also auf in diese neu geschriebene Vorgeschichte. Auf unserem Weg werden uns Linguisten, Archäologen und Genetiker begleiten — manche von ihnen haben die Route erst vor Kurzem selbst entdeckt. In Kapitel 1 machen wir in dem Gebiet um das Schwarze Meer nach dem Abschmelzen des Eises halt. Hier wurde die Vorfahrin aller indoeuropäischen Sprachen erstmals artikuliert. Wir wissen nicht viel über diese Urahnin, aber einiges über die Welt, in der sie entstand. Wir wissen auch, dass sie innerhalb einer reichen Sprachlandschaft zu den unbedeutenden gehörte. Kapitel 2 beschreibt, wie diese Sprache nicht nur bedeutend, sondern zu etwas Außergewöhnlichem wurde und in einer späteren Entwicklungsstufe von den Nomaden des Bronzezeitalters gesprochen wurde. Aus dieser Sprachstufe, dem Proto-Indoeuropäischen, sollten sich später alle heute gesprochenen indoeuropäischen Sprachen entwickeln.12
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der schwierigen Frage nach dem Anatolischen, der —vielleicht — ältesten Tochter des Proto-Indoeuropäischen. Danach folgen wir dem Weg der indoeuropäischen Sprachen durch die Alte Welt von der Vorgeschichte bis in die Gegenwart und zeichnen dabei deren Hauptverzweigungen nach. Kapitel 4 erzählt die Geschichte des Tocharischen, Kapitel 5 die der westlichen und mitteleuropäischen (romanischen, keltischen und germanischen) Sprachen. Kapitel 6 untersucht die Expansion gen Osten, aus der der indoiranische Zweig hervorging, und Kapitel 7 beschäftigt sich mit den baltischen und slawischen Sprachen, die möglicherweise an dieser Expansion beteiligt waren. Kapitel 8 widmet sich den idiosynkratischen, aber miteinander verbundenen Geschichten des Armenischen, Albanischen und Griechischen. Das Fazit bietet eine Zusammenschau. Es steht fest verankert in der Gegenwart, blickt zurück in die Vergangenheit, dreht sich dann um und blinzelt nach vorne, in den Nebel.
I Genesis
Lingua obscura
An der bulgarischen Schwarzmeerküste liegt nördlich von Varna das Golden Sands Resort. Es trägt seinen Namen zu Recht. Im warmen, flachen Wasser paddeln Kinder, während ihre Eltern entspannt am Strand liegen und ihnen zusehen. Der Kontinentalsockel ist hier etwa 50 Kilometer breit. Heute liegt er unter Wasser, aber früher, als der Meeresspiegel niedriger war, lag er oberhalb. In den vergangenen zwei Millionen Jahren war das Schwarze Meer eben die meiste Zeit kein Meer, sondern ein See — ein großer, klarer oder brackiger Teich, der vom Marmarameer, dem Mittelmeer und den dahinterliegenden Ozeanen getrennt war. Wärmeperioden ließen den Wasserspiegel des Mittelmeers steigen. Es trat über die Ufer und ergoss sich über den felsigen Bosporus. Riesige Salzwassermengen liefen in den See und verbanden ihn mit den Weltmeeren.
Zuletzt wurde der See währen der letzten Eiszeit vom Meer getrennt, als ein Großteil der weltweiten Wassermenge in Gestalt von Gletschern vorlag. Die Gletscher schmolzen, die Pegel der Ozeane stiegen und führten, so eine These aus der Forschung, vor neun- bis zehntausend Jahren zu dem Moment, in dem der Bosporus das Mittelmeer nicht länger zurückhalten konnte. Das Wasser überflutete den gigantischen Staudamm mit der Kraft von 200 Niagarafällen und löste einen Tsunami aus, der sich in Flussmündungen und Lagunen ergoss und eine Fläche von der Größe Irlands überflutete.
Nicht diese erneute Verbindung ist umstritten, aber ihr genauer Ablauf durchaus. Manche meinen, sie sei graduell entstanden. Das Schwarze Meer sei zunächst ins Kaspische Meer übergelaufen, dieses sei gleichfalls über die Ufer getreten und die Oszillation zwischen beiden Gewässern habe sich schließlich beruhigt. Einer anderen Theorie zufolge stieg der Wasserspiegel des Schwarzen Meers nur um zehn (statt um 60) Meter. Wäre er tatsächlich um »nur« zehn Meter gestiegen, wäre eine geringe Fläche überflutet worden — eher in der Größe Luxemburgs als Irlands. Wieder andere vertreten die Meinung, der Ausgleich der Meerespegel habe viel Zeit benötigt, denn die Wassermassen hätten den Flaschenhals des Bosporus durchqueren müssen. Nicht monate-, sondern jahrzehntelang sei Wasser durch das Bosporustal gerauscht — ein beeindruckendes Naturschauspiel.
Die beiden US-amerikanischen Geologen William Ryan und Walter Pitman präsentierten 1997 ihre Theorie der Sturzflut. Sie vermuteten, Berichte traumatisierter Augenzeugen seien mündlich über viele Generationen hinweg tradiert worden und hätten die Überflutungsmythen der Bibel und des Gilgamesch-Epos inspiriert. »Der die Tiefe auslotete«, lauten die ersten Worte des Gilgamesch-Epos, das vor 4000 Jahren in Mesopotamien verfasst wurde. Laut der Bibel »brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf«. Die Theorie von Ryan und Pitman lässt sich nicht überprüfen, so überzeugend sie auch sein mag (zumal es viele Flutmythen gibt). Größeren Einfluss auf die Menschheit hatte vielleicht die Tatsache, dass das Schwarze Meer, seit jeher eine per se wertvolle Ressource, nun auch zum Übertragungsweg anderer Ressourcen wurde — darunter Gene, Technologien und Sprache.
Als die Verbindung zwischen beiden Gewässern wiederhergestellt war, hatte das Schwarze Meer ungefähr die heutige Form und Größe. Der griechische Geograf Hekataios von Milet verglich es mit einem skythischen Bogen, wobei die Südküste die Sehne und die Nordküste der Bogen selbst war. Die Griechen nannten es »ungastliches Meer« (pontos axeinos), bis sie sich im 1. Jahrhundert v. u. Z. an dessen fruchtbaren Ufern niederließen und es in »gastliches Meer« (pontos euxeinos) umbenannten. Dort gab es unzählige Fische, die von Delfinen, Robben und Zwergwalen durch das Bosporustal (nun Bosporusstraße) getrieben worden waren. Wahrscheinlich machten türkische Seeleute auf der Jagd nach diesen Fischen Erfahrungen mit den gefährlichen Windböen und gaben der See den Namen »Schwarzes Meer«.
Nördlich des Meeres befand sich die in Anlehnung an den griechischen Namen für das Schwarze Meer benannte pontische Steppe.1 Im Osten ragte das Kaukaususgebirge auf, im Süden die Berge und Hochebenen Anatoliens. Westlich befanden sich die bewaldeten Hügel des Balkans und die Donau-Auen. All diese Gebiete waren individuelle Welten, die einander am Schwarzen Meer berührten. Alles, was dort ausgetauscht wurde, konnte auf den großen Zuflüssen Don, Dnjepr, Dnister und Donau tief ins Landesinnere transportiert werden. (Auf dieses wiederkehrende D werden wir später zurückkommen.)
Vor 10.000 Jahren wurde der Balkan von Jägern und Sammlern bewohnt, die seit dem Ende der Eiszeit in Europa lebten. Eine andere Gruppe Jäger und Sammler war, als die Erde wärmer wurde, vom Kaspischen Meer nach Westen gezogen. Diese Menschen siedelten in den Sümpfen und Lagunen der nördlichen Schwarzmeerküste und entlang der Zuflüsse. Ein Flussabschnitt südlich des heutigen Kiew bestand damals aus Felsen, Wasserfällen und Seen, die als Stromschnellen des Djnepr bekannt sind.2 Laut der Archäozoologie, die Tierknochen untersucht, lebten in den Stromschnellen Welse, die so groß wie Walbabys waren. Die damaligen Jäger mussten nur am Ufer hocken und ihre Speere bereithalten, um die Megafische zu fangen.
(Die Welse im Dnjepr waren bis zu zweieinhalb Meter lang und wogen bis zu 300 Kilogramm. Noch heute schwimmen Welse dieser Größe in den europäischen Flüssen. Sie erschrecken Archäologen, die in der schlammigen Rhone nach römischen Relikten tauchen: Sie packen die Taucher an den Flossen und lassen erst los, wenn sie merken, dass sie die Beute aufgrund ihrer Größe nicht herunterschlucken können. Die Bezeichnungen Wels und Wal haben einen gemeinsamen Wortursprung.)
Südlich des Schwarzen Meers, im sogenannten Fruchtbaren Halbmond, ereignete sich zeitgleich die Revolution des Ackerbaus. »Revolution« ist hier ein irreführender Begriff, weil die Bestandteile, die den uns bekannten Ackerbau ausmachen, sich über einen langen Zeitraum und an verschiedenen Orten durch Versuch und Irrtum herausgebildet haben. Die Jäger und Sammler im Zagros-Gebirge am westlichen Rand der Iranischen Platte domestizierten wohl als Erste Ziegen — nach dem Hund, dessen wölfische Vorfahren bis in die Eiszeit zurückgehen, ist die Ziege erst die zweite domestizierte Tierart. Wahrscheinlich bauten sie auch Weizen und Gerste an. Westlich davon, in Anatolien und der Levante (dem Gebiet des heutigen Libanon, Israel und Jordaniens), begann man, Schafe zu halten sowie Kichererbsen, Erbsen und Linsen anzubauen. Später wurde auch der Auerochse domestiziert, ein wilder Ochse mit langen, gebogenen Hörnern. Die ersten Bauern benötigten wohl neue Wörter, um diese Pflanzen und Tiere und die im Umgang mit ihnen eingesetzten Werkzeuge zu bezeichnen. So eigneten sie sich das Vokabular des Ackerbaus an.
Zur echten Revolution wurde der Ackerbau, als die Bauern sich auch außerhalb des Fruchtbaren Halbmonds ansiedelten. Das gesamte 20. Jahrhundert hindurch stritten Archäologen darüber, ob die Bauern selbst migriert waren oder andere nur deren Erfindungen übernommen hatten. Genetische Untersuchungen zeigen, dass tatsächlich die Bauern weitergezogen waren — und zwar in sehr großer Zahl. Dabei handelte es sich nicht um eine bewusste Strategie der Gebietserweiterung. Die Bauern benötigten schlicht mehr Land, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Die Kolonialisierung erfolgte in kleinen Schritten: Ein Kundschafter suchte zu Fuß teils Hunderte Kilometer entfernt nach geeigneten Orten. Andere siedelten sukzessive in den dazwischenliegenden Gebieten. Ihre Sprachen nahmen sie mit.
Bauern aus Anatolien gelangten über zwei Routen nach Europa. Ein Migrationsstrom führte über den Bosporus, erreichte den östlichen Balkan um 6500 v. u. Z. und folgte dem Donaulauf Richtung Inland. 1000 Jahre später bauten diese Menschen Dörfer in der Pannonischen Tiefebene. Ein zweiter Strom kam mit Flößen oder Ruderbooten (nicht segelnd) über die ägäischen Inseln und entlang der Mittelmeerküste und zog dann von der französischen Côte d’Azur gen Norden. Die beiden Ströme trafen sich im Pariser Becken, der kontinentalen Sackgasse direkt vor dem Atlantik, und vermischten sich dort, ehe sie weiterreisten. Um 4500 v. u. Z. hatten sie ganz Europa besiedelt und im Westen Irland, im Osten die Ukraine erreicht. Diese Migrationsbewegungen dauerten über viele Generationen an. Dennoch sind die dabei zurückgelegten Entfernungen beeindruckend angesichts der Tatsache, dass sie — mit Ausnahme der Meeresüberquerungen — zu Fuß zurückgelegt wurden. Damals gab es noch keine domestizierten Esel oder andere Packtiere, keine domestizierten Pferde, kein Rad und folglich keine Wagen.
Während die Bauern sich ausbreiteten, zogen sich die eingeborenen Jäger und Sammler zurück. Im Vergleich waren es so wenige und sie hatten so geringe Spuren in der Landschaft hinterlassen, dass die Migranten vielleicht den Eindruck hatten, Neuland zu entdecken. Einige der vertriebenen Jäger und Sammler zogen ans Baltische Meer, andere schlossen sich vielleicht den Wels-Fängern am Dnjepr an (deren Sprache ihnen gewiss fremd war). Wieder andere blieben in der Heimat, suchten aber Zuflucht in den Bergen oder den dichtesten Wäldern — an Orten, die sich nicht für den Ackerbau eignen.
Hin und wieder muss es — etwa auf einer Lichtung — zu Begegnungen der Jäger und Sammler mit den Bauern gekommen sein. Wahrscheinlich war dies für beide Seiten ein Schock. Etwa 40.000