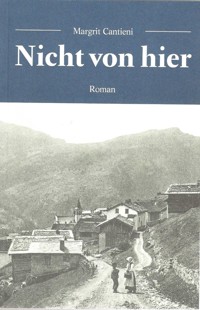11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Gegen jeden Widerstand Sommer 1941. Tausende polnische Soldaten wurden auf der Flucht vor der deutschen Wehrmacht in der Schweiz interniert und von den Einheimischen als Helden gefeiert. Doch bald schon kippt die Stimmung, und die zuvor willkommenen Männer werden zur vermeintlichen Bedrohung. So auch Marek, der im Arbeitslager auf die junge Bündnerin Sofia trifft. Es ist Liebe auf den ersten Blick, aber je länger der Krieg dauert, desto unerwünschter wird ihre Beziehung. Schaffen sie es, sich den Regeln der Gesellschaft zu widersetzen und ihr gemeinsames Glück zu finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Nach einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung arbeitete Margrit Cantieni im kulturellen, sozialen und gewerblichen Bereich. 2009 gründete sie den Cancas Verlag, der sich auf Bücher mit Bezug zu Mittelbünden spezialisiert und in dem sie auch eigene Werke veröffentlicht. Ihr Debütroman «Nicht von hier» erschien 2020. Margrit Cantieni ist verheiratet und lebt in Chur.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Personen sind frei erfunden. Nur General Bronisław Prugar, Abschnittskommandant Paul Engi und der Kommandant der Strafanstalt Wauwilermoos existierten wirklich. Die Handlung basiert auf einem historischen Hintergrund.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung der Bildmotive stock.abobe.com/nicolaskostja, arcangel.com/Collaboration JS
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-011-2
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Ist es denn irgendwie schlimm,Wenn zwei Menschen, die sich leidenKönnen, ohne Wort, ohne NimmUnd ohne GibBald wieder voneinander scheiden?«Den oder die habe ich lieb.»
Joachim Ringelnatz (1883–1934)
Prolog
Langsam glitten die Finger über das Geländer. Als der Zeigefinger einen Holzsplitter erspürte, der nadelspitz hervorstand, hielt die Hand kurz inne. Der Finger tastete über die Spitze, drückte sie, widerstand dem Schmerz, verstärkte den Druck, liess den Einstich zu. Der Daumen verrieb den winzigen Blutstropfen auf der Fingerbeere. Dann wanderte die Hand weiter bis zur Mitte des Geländers. Dort blieb sie stehen.
Der Fluss trug Baumstämme mit sich. Wenn einer davon den Kopf träfe, würde man sicher ohnmächtig und still in den Fluten versinken. Man hätte Ruhe vor dieser Zerrissenheit in der Seele, vor der Angst, dieser übergrossen Verantwortung nicht gerecht zu werden und die Liebsten unglücklich zu machen.
Was blieb dem Menschen ohne Heimat? Was blieb, wenn man entwurzelt wurde?
Es war leicht, das Geländer zu übersteigen, die Augen zu schliessen und loszulassen.
Wie viel durfte der geliebte Mensch von einem verlangen?
Teil 1
1
Sofia riss ungehalten die Haustüre auf. Seit über einer Stunde hockte sie trotz wunderschönen Augustwetters in ihrem Zimmer und suchte sich einen Weg durch verwirrende algebraische Gleichungen. Das Ergebnis war greifbar nahe. Sie musste es nur noch einfangen wie einen vor der Nase tanzenden Schmetterling. Doch dann hatte es geklingelt, schrill und scharf. Der Schmetterling flog davon und mit ihm die Inspiration.
«Was ist?», raunzte sie, noch bevor sie die Türe ganz geöffnet hatte, in einem Ton, der ihr selbst fremd vorkam.
Heitere Augen, deren Braun die gleiche Farbe hatte wie die Kaffeebohnen, die sie jeden Morgen mahlte, blickten sie an. Der junge Mann trug eine hellbraune Uniform und streckte ihr wie eine Opfergabe drei Spazierstöcke auf den offenen Handflächen und den Unterarmen entgegen. Sein Lächeln entblösste ebenmässige Zähne.
«Guten Tag, gnädiges Fräulein», sagte er und verneigte sich leicht. «Ich hoffe, ich störe nicht.» Sein Deutsch hatte einen seltsamen Akzent.
«Nein, nein», log sie hastig. Die Algebra war plötzlich weit weg, ihr Unmut wie durch Zauberhand verschwunden. Sie schämte sich wegen ihres barschen Auftretens. «Guten Tag», beeilte sie sich hinzuzufügen.
Der junge Mann war nur wenig grösser als sie. Der oberste Knopf seiner Uniformjacke war offen und liess die schwarze Krawatte sehen. Die Hosen plusterten sich durch die Wadenbinden unterhalb des Knies wie bei Knickerbockern auf, was Sofia etwas albern fand. Auf dem rechten Oberarm war ein rotes, zweifingerbreites Stoffteil mit der weissen Aufschrift «Poland» angebracht.
«Gefallen Ihnen meine Spazierstöcke? Ich habe sie selbst geschnitzt.» Die hoch liegenden Brauen verliehen seinem runden Gesicht einen erstaunten Ausdruck. Das schwarze Béret sass schief auf dem Kopf, was ihm etwas Verwegenes gab.
Sofia musterte die Stöcke unsicher. Sie waren mit Tieren und Blumenornamenten, Schlangenlinien und efeuähnlichem Blattwerk verziert. Einer hatte einen Handgriff in Form eines schmalen Fisches mit Schuppen, ein anderer sah aus wie ein Pickel zum Bergsteigen, nur viel feiner.
«Sie sind ganz billig, nur zwanzig Rappen. Und sie halten ein ganzes Leben lang.»
«Ach, wie langweilig», entfuhr es ihr.
Die Augenbrauen des jungen Mannes schoben sich noch weiter nach oben. «Langweilig?», fragte er.
«Ja, langweilig. Wer will schon ein Leben lang den gleichen Spazierstock benutzen. Das ist doch langweilig. Dann kann man sich nie einen neuen gönnen. Zwei Stöcke wären einer zu viel.»
Er lachte hell auf. «Das habe ich mir noch nie überlegt. Aber vielleicht lässt man mal einen im Zug liegen oder schenkt ihn weiter an den Grossvater oder die Tante. Als Erinnerung.»
«Oder man verfeuert ihn im Winter, wenn man zu wenig Holz hat.»
«Das wäre ein schlimmes Schicksal für meine Spazierstöcke. Das hätten sie nicht verdient.»
Grinsend blickten sie einander an. Sofias Herz pochte stärker als sonst.
«Oder er wird gestohlen, weil er so schön ist. Schöne Dinge werden oft gestohlen», sagte er.
Sofia erwiderte rasch und bestimmt: «Bei uns im Dorf wird nichts gestohlen. Da kann man alles stehen und liegen lassen, wo man will. Am nächsten Morgen ist alles noch da.»
Sein Lächeln wurde schwächer.
«Ja, bei uns im Dorf in Polen konnten wir die Türen auch unverschlossen lassen. Bis die fremden Soldaten kamen.» Er stellte die Stöcke auf den Boden. Die Spitzen verursachten beim Auftreffen auf den Kies feine helle Töne.
«Jetzt sind Sie selbst ein fremder Soldat. – Muss ich nun meine Haustüre abschliessen?» Sie hatte es als Scherz gemeint, um ihn wieder aufzumuntern. Doch tatsächlich hatte sie im Dorf schon Bemerkungen gehört, dass man derzeit vorsichtiger sein müsse wegen der vielen Internierten im Lager.
«Nein, das müssen Sie nicht. Wir Polen wollen niemandes Land stehlen. Wir sind den Schweizern dankbar, dass sie uns aufgenommen haben. Wissen Sie, schönes Fräulein, was meine Grossmutter immer sagt?» Seine Augen funkelten. «Sie sagt, dass selbst der heiligste Mensch einmal in seinem Leben gestohlen hat. Und sei es nur jemandes Zeit.»
Seine Fröhlichkeit war wieder da.
«Ich heisse Marek. Und jetzt, da Sie meinen Namen kennen, bin ich Ihnen auch nicht mehr fremd, nicht wahr? Ich bin dort unten im Lager untergebracht, auf der anderen Seite des Flusses.»
Er zeigte mit dem Arm die Strasse hinunter zum Hinterrhein, obwohl das nicht nötig war. Alle im Dorf wussten, wo das Lager war. Es lag unübersehbar auf halbem Weg zwischen Rodels nach Cazis, gegenüber dem kleinen Bahnhof. Fast hundert Polen waren dort untergebracht. Es kämen noch mehr, hiess es im Dorf. Für bis dreihundert Männer gäbe es Platz.
Einen Moment schwiegen beide.
Unter halb gesenkten Lidern musterte Sofia den jungen Mann, der unschlüssig seine Spazierstöcke betrachtete. «Ich kann Ihnen leider nichts abkaufen. Ich habe kein Geld, und mein Vater ist nicht da.»
Josef Caderas war ins Wirtshaus gegangen. Heute brauchte er ein Bier mit Freunden, um seinen Ärger über die Geländegewinne der deutschen Wehrmacht in Russland hinunterzuspülen, hatte er gesagt.
«Und Ihre Mutter?»
«Meine Mutter ist tot.»
Mareks Lächeln verschwand schlagartig, als hätte ihn ein Blitz getroffen. «Wie schrecklich», stammelte er. «Das tut mir so leid, gnädiges Fräulein. Die Mutter ist das Herz der Familie. Ihre Seele. Ihr Mittelpunkt.»
Über seine Augen hatte sich ein Schleier gelegt. Sofia fand seine Reaktion übertrieben. Schliesslich kannten sie sich gerade mal seit fünf Minuten. Da war so viel Mitgefühl fehl am Platz.
«Sie ist schon vor über elf Jahren gestorben. Als ich sieben war.»
Ihre Erklärung änderte wenig an seinem Gesichtsausdruck.
«Die Mutter zu verlieren, das ist so schlimm. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Mama sterben würde. Mein Herz würde aufhören zu schlagen.»
«Dann könnten Sie keine Spazierstöcke mehr schnitzen.» Sofia lächelte leicht. Die Bemerkung war etwas grob, doch sie wollte kein Mitleid. Den Tod ihrer Mutter hatte sie schon lange überwunden. Sie war zufrieden mit ihrem Leben, hatte es gut mit ihrem Vater. Manchmal hätte sie gerne eine Schwester gehabt, mit der sie abends im Bett über hübsche Unterwäsche, über die monatlichen Beschwerden oder über Nagellack und Lippenstift reden könnte.
Marek schien etwas irritiert, bevor sich seine Züge entspannten. «Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen?»
Sie zögerte. Weshalb sollte sie einem polnischen Soldaten ihren Namen verraten? Nur weil er den seinen genannt hatte, musste sie das noch lange nicht. Dann flutschte er ihr heraus wie ein Stück Seife, das man festhalten will und einem doch aus den Händen gleitet. «Sofia.»
«Sofia. Was für ein wunderbarer Name für ein wunderschönes Fräulein.»
Er strahlte, als hätte er einen Diamanten gefunden. Sie hatte das Gefühl, dass das Gespräch langsam zu persönlich wurde.
«Ich muss wieder an meine Schulaufgaben», sagte sie. Es gab nichts mehr zu bereden. Sie würde keinen Spazierstock kaufen.
Er hatte den Wink verstanden. Trotzdem fragte er, während er die Stöcke mit einer Schnur zu einem Bündel zusammenschnürte: «Sie gehen ins Gymnasium?»
«Nein, ins Lehrerseminar.» Wiederum waren die Worte entschlüpft, bevor Sofia sie daran hindern konnte. Doch jetzt würde sie nichts mehr sagen, sich nur noch verabschieden. «Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.»
Marek klemmte die Spazierstöcke unter den linken Arm, und bevor sie wusste, wie ihr geschah, ergriff er ihre Hand und führte sie an seine Lippen. Sekundenbruchteile berührte sein Mund den Handrücken, kaum spürbar.
«Auch Ihnen einen schönen Abend, Sofia. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.»
In ihrem Inneren flatterte etwas. Hastig entzog sie Marek die Hand und trat zurück auf die Türschwelle.
«Darf ich wiederkommen, wenn Ihr Vater da ist? Vielleicht möchte er einen Spazierstock kaufen.»
Sie zuckte mit den Schultern. Auf keinen Fall sollte er denken, dass sie ihn zu einem neuerlichen Besuch auffordern wolle.
«Wenn Sie wollen», sagte sie und ergriff die Türklinke.
Franz, ein junger Bauer aus dem Dorf, kam die Strasse herunter. Neugierig schaute er herüber. Sofia nickte ihm leicht zu. Ausgerechnet der, dachte sie. Franz war ein Klatschmaul.
«Also dann», sagte sie nachdrücklich zu Marek. «Nochmals einen schönen Abend.»
Auch Marek musterte Franz kurz, dann wandte er sich wieder an Sofia. «Danke. Ihnen auch.» Er tippte sich mit zwei Fingern an die Mütze und folgte Franz hinunter zum Fluss. Ein fröhliches Pfeifen ertönte.
Sofia sah ihm nach, bis er hinter der Wegbiegung verschwunden war. Ihr Blick blieb an der Kapuzinerkresse hängen, die sie in einem Topf an der Hauswand angepflanzt hatte. Sie kniete nieder, brach ein Blümchen ab und steckte es sich ins Haar. Doch dann zog sie es wieder heraus und warf es kopfschüttelnd auf die Strasse. Es war höchste Zeit, sich wieder der Mathematik zu widmen.
2
Den ganzen Tag war leiser Regen gefallen, der die Erde zwischen den Baracken aufgeweicht hatte. Sie klebte an den klobigen Schuhsohlen. Mit energischem Stampfen klopfte Marek sie ab, bevor er in die Soldatenstube trat. Leonora lächelte ihm zu, während sie mit zwei Topflappen ein viereckiges Blech mit Apfelkuchen aus dem Ofen des Holzkochherds zog. Ein verlockender Duft erfüllte den Raum.
Nur ein Dutzend Kameraden sass an den beiden langen Tischen, vier von ihnen waren in ein Kartenspiel vertieft. Die anderen waren draussen, spielten trotz des schweren Bodens Fussball oder schauten zu.
Marek setzte sich. Kleine Vasen mit gelben, blauen und violetten Blumen, zarten Gräsern und Weizenstängeln standen auf den Tischen. Er machte Leonora ein Zeichen, und sie brachte ihm ein Bier.
«Viva», sagte sie.
Er dankte flüchtig. Seine Gedanken waren bei der jungen Frau, die er tags zuvor kennengelernt hatte. Sie hatte ihm auf Anhieb gefallen. Als er ihr die Hand geküsst hatte, war sie rot geworden. Das fand er süss. Auch ihre Stupsnase und die Sommersprossen.
Leonora kam mit einem Teller voller Guetzli und legte ihm eines hin.
«Danke, Leonora.»
Sie verstand es, auch ohne den rationierten Zucker gut zu backen. Saccharin verflüchtigte sich zwar rasch, wodurch die Guetzli schnell hart wurden. Doch ihr Gebäck fand Abnehmer, kaum dass es ausgekühlt war. Sie war eine kleine Frau, kaum ein Meter sechzig gross, mit Ansätzen zur Rundlichkeit, die durchschlagen würde, wenn man wieder so viel Zucker und Rahm und Butter essen konnte, wie man wollte. Einzelne feine graue Haare durchzogen ihre dunklen, halblangen Locken. Sie war dreiundvierzig Jahre alt, Witwe und kinderlos.
«Ihr seid jetzt meine Kinder», sagte sie, wenn die Polen ihr zu Ehren ein schwermütiges Lied sangen, wischte sich eine Träne aus den Augenwinkeln und verschenkte die letzten Kuchenstücke.
Leonora blieb neben Marek stehen. Sie hatte ein knielanges rotes Kleid an. Rot war ihre Lieblingsfarbe. Etwas Rotes trug sie meistens, zumindest einen Schal oder einen Gurt. Es betonte ihre dunkelbraunen Augen und ihre rosigen Wangen.
«Alles in Ordnung, Marek? Du bist so abwesend.»
«Alles gut. Danke. Ich bin nur etwas müde. Bäumefällen ist anstrengend.»
«Ja, das verstehe ich. Vor allem, wenn man weiss, dass ein Wald von siebzig Hektaren gerodet werden muss. Da sieht man kein Ende.»
Sie ging zurück zum Herd, und er dachte wieder an Sofia. Das war auch ein polnischer Name. Als der junge Bauer vorbeigegangen war, hatte sie verlegen zur Seite geschaut, als wäre es ihr nicht recht, dass dieser sie im angeregten Gespräch mit ihm gesehen hatte. Als wäre sie bei etwas Unziemlichem ertappt worden.
Am Nebentisch wurde es laut. Krystian, einer der Kartenspieler, warf mit einem triumphierenden «Ha» die letzte Karte auf den Tisch.
«Gewonnen», rief er mit lallender Zunge. «Leonora, bring mir einen Schnaps.»
«Du weisst, dass du hier bei mir keinen Schnaps bekommst.»
Krystian drehte sich hölzern um. Seine Lider drückten schwer auf die Augen.
«Warum nicht? In den Restaurants bekommen wir ihn auch. Und in den Läden.» Er rülpste. «Ausserdem kann ich selbst entscheiden, was und wie viel ich trinken will.» Seine Stimme war lauter geworden. «Ich bin schliesslich kein Gefangener.»
Einer seiner Mitspieler legte ihm die Hand auf den Arm. «Lass gut sein, Krystian. Komm, spielen wir noch eine Runde. Du hast heute Glück beim Spiel. Vielleicht gewinnst du noch einmal. Und Leonora bringt dir einen Kaffee.» Er blickte fragend zu Leonora.
Diese nickte, nahm eine Tasse hervor, schenkte aus Zichorienwurzeln aufgebrühten Kaffee ein und brachte die Tasse an den Tisch. Krystian brummelte Unverständliches vor sich hin, war jedoch bereits wieder am Mischen der Karten.
Leonora setzte sich zu Marek.
«Wenn er nüchtern ist, ist er ganz nett», sagte er leise mit einer Kopfbewegung zu Krystian.
«Ich weiss.»
«Wir haben eigenen Wodka, weisst du? Den besten der Welt. Viel besseren als euren.»
Sie drohte ihm scherzhaft mit dem Finger. «Sag das nicht. Unser Schnaps ist aus süssen Früchten gemacht, nicht nur aus gewöhnlichen Kartoffeln wie euer Wodka. Bei uns gedeiht das beste Obst. Früher hat man es bis nach St. Petersburg geliefert. Es gibt bei uns über hundert Apfelsorten.»
Die vielen Obstgärten rings um die Dörfer waren Marek bei seiner Ankunft vor vier Wochen als Erstes aufgefallen. Schön sahen die Apfel-, Zwetschgen-, Mirabellen-, Kirsch- und Birnbäume aus. Auf den ersten Blick kam man sich wie im Paradies vor. Doch es gab kein Paradies. Auch in der Schweiz nicht.
«Ich habe gestern ein Mädchen kennengelernt.» Er verzog verlegen den Mund. «Sofia heisst sie.»
Leonora blickte neugierig auf. «Ach ja?» Sie drehte an ihrem Ehering, den sie immer noch trug, obwohl ihr Gatte vor fast sieben Jahren gestorben war. «Ist es jemand von hier?»
«Ja. Aus Rodels.»
«Das freut mich für dich.»
Doch Marek war nicht sicher, ob sie es wirklich so meinte. Ihrer Miene war keine Freude anzusehen. Er bereute, dass er von Sofia erzählt hatte. Schliesslich hatte er sie nur einmal gesehen.
«Ich gehe noch ein wenig zu den anderen zum Fussballspiel», sagte er abrupt, stürzte den letzten Rest des Bieres hinunter und stand auf.
Leonora hob die Augenbrauen. «Ist was?»
Marek schüttelte den Kopf. «Nein, nein. Gar nicht.»
Er ging nicht zum Fussballspiel. Er ging in seine Baracke, warf sich auf sein Strohbett, schloss die Augen und rief sich Sofias Gesicht in Erinnerung, den trotzigen herzförmigen Mund, das schüchterne Lächeln. Morgen würde er im Wald ein geeignetes Stück Holz suchen und daraus für sie etwas Hübsches schnitzen.
3
«Ein polnischer Soldat war vorgestern hier», sagte Sofia wie beiläufig. Sie hatte versucht, Mareks Gesicht aus ihrem Kopf zu verdrängen. Ohne Erfolg. Die Mathematikaufgabe war noch immer ungelöst. Mathematik war ihr schwächstes Fach. Sie hatte sich vorgenommen, den letztjährigen Stoff bis zum Schulbeginn im September nochmals durchzuarbeiten. Es blieben ihr noch knapp vier Wochen.
«Ein Internierter?», fragte ihr Vater. «Davon hast du noch gar nichts erzählt. Was wollte er denn?»
«Einen Spazierstock verkaufen.» Sie wusste selbst nicht, warum sie ihrem Vater noch nichts gesagt hatte.
«Er hat hausiert?», fragte Leonora.
Josef Caderas lud seine Schwägerin Leonora hin und wieder zum Mittagessen ein. Er verdankte ihr einiges. Nach dem Tod seiner Frau war sie für Sofia da gewesen, auf zurückhaltende, stille Art. Sie hatte sie getröstet, wenn der Kummer über den Verlust ihrer Mutter sie übermannt hatte, ihre aufgeschürften Knie verarztet, sich mit ihr über gute Schulnoten gefreut und Sofia einige Jahre später in die Geheimnisse des Frauwerdens eingeweiht. Ihrem Schwager hatte sie das Kochen beigebracht.
Sofia stocherte im Reis mit den gedörrten Sellerie- und Karottenstäbchen. Gedörrtes Gemüse war ihr zuwider. Doch das behielt sie für sich. Als sie sich kürzlich beklagt hatte, dass es nur noch Haferrösti, Erbsenmus mit Kartoffelstängeln und zur Vorspeise dünne Suppen gäbe, die nach nichts schmeckten, hatte ihr Vater sie zurechtgewiesen. Andere Menschen hätten in diesen Zeiten gar nichts zu essen, hatte er gesagt und ihr ein schlechtes Gewissen verursacht.
Etwas an Leonoras Tonfall liess Sofia aufhorchen. «Kennst du ihn, Tante? Er ist im Lager untergebracht, wo du die Soldatenstube führst. Er heisst Marek.»
Bevor Leonora antworten konnte, sagte ihr Vater: «Ich glaube, die Internierten dürfen gar nicht hausieren. Sie bekommen im Lager alles, was sie brauchen. Auch einen Lohn für ihre Arbeit.»
«Das stimmt», pflichtete Leonora bei. «Ich hoffe nur, dass Marek mit dem Hausieren aufhört. Sonst bekommt er Ärger mit den Behörden. Und was deine Frage betrifft: Ja, ich kenne ihn.»
Vergebens wartete Sofia darauf, dass Leonora etwas mehr zu Marek sagen würde.
«Aber es schadet doch niemandem, wenn die Internierten ihre selbst gemachten Sachen verkaufen, finde ich», sagte sie. Ein trotziger Ton drängte in ihre Stimme.
«Schaden? Nein, das tut es nicht. Doch die Behörden wollen nicht, dass die Internierten Kontakt mit der Bevölkerung haben. Deshalb brauchen sie für alles eine Bewilligung. Zum Beispiel, wenn sie in ein Wirtshaus gehen wollen oder wenn sie jemanden privat besuchen möchten», erklärte Leonora.
«Warum nur? Sie sind doch nicht gefährlich, oder?», fragte Sofia.
Internierte. Ein seltsames Wort mit einem Beigeschmack von Trauer, Niederlage, Warten und Hoffen – und Einsamkeit.
«Es geht nicht darum, ob sie gefährlich sind», antwortete Leonora. «Es geht darum zu verhindern, dass sie fliehen und wieder in den Krieg eingreifen.»
«Aber von diesen Internierten will doch sicher keiner wieder in den Krieg ziehen?», fragte Sofia ungläubig.
«Vielleicht doch? Vergiss nicht: Sie sind freiwillig in ihre Schützendivision eingetreten, um gegen die Nazis zu kämpfen. Ich habe gehört …», setzte Leonora nach kurzem Überlegen hinzu, «… dass schon viele von ihnen geflohen sind. Die Deutschen seien ziemlich ungehalten darüber und drohten der Schweiz mit Schwierigkeiten, wenn dies kein Ende nehme. Wer weiss, was sie damit meinen.»
Sofia pickte nachdenklich die Gemüsestängel auf. Wollte dieser Marek auch wieder gegen die Deutschen kämpfen? Warum machte sie sich überhaupt solche Gedanken um ihn? Sicher hatte er ihre Begegnung schon vergessen.
Schweigend assen sie weiter. Aus dem Radio ertönte eine Symphonie von Johannes Brahms. Zur Freude von Sofias Vater, der klassische Musik liebte. Vor allem Werke von Johann Sebastian Bach. Hin und wieder besuchte er ein Konzert im Stadttheater in Chur. Sofia fand diese Musik langweilig. Sie tönte oft schwermütig oder dann wieder übertrieben pompös. Warum konnten die im Radio nicht auch mal fröhlichen Jazz bringen?
Nach dem Essen verabschiedete sich Leonora.
«Vielleicht kommt er noch einmal vorbei», sagte Sofia, als sie ihre Tante zur Tür begleitete.
Diese wusste sofort, von wem Sofia redete. «Dann sag ihm, dass es verboten ist, zu hausieren, und dass er nicht mehr kommen soll. Und kauf ihm nichts ab.» Nach kurzem Zögern ergänzte sie: «Und vergiss ihn. Du hast genug zu tun mit deiner Ausbildung.»
Sofia ärgerte sich über diese Bemerkung. Aber sie entgegnete nichts. Sie ging zurück in die Stube und räumte den Tisch ab. Würde Marek wiederkommen? Wahrscheinlich nicht. Sie hatte sich ja unmöglich benommen, hatte versucht, humorvoll zu sein und doch vornehm zurückhaltend. Beides war ihr nicht gelungen. Sicher hielt er sie für eine dumme Gans. Die Teller klapperten, und die Pfannen schepperten, als Sofia sie energisch in den Schrank versorgte. Mit einer festen Drehbewegung wrang sie den Abwaschlappen aus. Dann holte sie ihre Schulsachen und setzte sich an den Stubentisch. Ihr Vater zog sich in sein Zimmer zurück, um sein Nickerchen zu machen.
Nach dem Abendessen hatte sich Josef Caderas in der Stube eine Zigarette angezündet und das Radio lauter gestellt. Wie jeden Freitag ertönte um sieben Uhr auf Radio Beromünster die Weltchronik von Jean Rudolf von Salis.
«Ich bin gespannt, wie lange von Salis noch so offen informieren und kommentieren darf», sagte er. «Sonst ist jede Zeitungsmeldung, jede Tagesschau, jede Wochenschau im Kino bis auf den kleinsten Buchstaben zensuriert. Es ist beschämend, was für Informationen und Meldungen uns da aufgetischt werden. Man weiss kaum mehr, was wahr ist und was nur Propaganda von den Deutschen. Die behandeln uns wie Kinder, denen man die Wahrheit nicht zumuten kann.»
Mit «die» meinte er die Bundesbehörde, die seit Kriegsbeginn rigoros darauf achtete, dass kein Zeitungsbericht die Neutralität verletzte und weder den Deutschen noch den Alliierten Angriffsflächen bot für politische oder militärische Reaktionen. Auf den Historiker Jean Rudolf von Salis war Sofias Vater stolz. Weil dieser Bündner war und nach Josef Caderas’ Meinung der einzig zuverlässige Kommentator im Land.
Sofia nahm sich einen Apfel aus der Obstschale, biss ein Stück ab und setzte sich auf das Sofa. Sie liess sich Zeit mit dem Apfel, knabberte ihn gründlich ab. Dann ass sie auch die Fliege und das Kerngehäuse auf. Vielleicht hörte so das eigenartige Bauchgrimmen auf, von dem sie nicht wusste, ob es vom nicht restlos getilgten Hunger oder von etwas anderem kam.
Josef Caderas verfolgte von Salis’ Ausführungen mit starr auf den Boden gerichtetem Blick. Dieser berichtete von der Konferenz zwischen Amerikas Präsident Roosevelt und dem englischen Premierminister Churchill. Roosevelt hatte angetönt, dass sich der Krieg bis zum übernächsten Jahr, 1943, hinziehen könne, da nicht im Geringsten Hoffnung auf einen Verständigungsfrieden bestünde. Die beiden Staatsführer hatten Stalin zugesichert, dass sie Russland alles, was ihnen möglich war, zukommen lassen würden, um die Angriffe der deutschen Wehrmacht zurückzuschlagen. Den Deutschen waren grosse Geländegewinne gelungen, vor allem in der südlichen Ukraine, auch im Norden Russlands. Sie standen nur noch wenige Kilometer vor Leningrad. Doch Stalin liess verlauten, dass die Rote Armee im russischen Winter einen zusätzlichen mächtigen Verbündeten haben werde.
Sofias Vater seufzte, als von Salis seine Ausführungen beendet hatte, und stellte das Radio leiser.
«Wie ist es im Krieg, Papa?», fragte Sofia unvermittelt. Diese Frage war ihr den ganzen Nachmittag im Kopf herumgegangen. Mit der Mathematik war sie nicht weitergekommen.
Ihr Vater nahm einen tiefen Zug und schaute dem Rauch nach, der zur Decke stieg.
«Ich weiss nicht, wie es ist. Während der Mobilmachung zu Kriegsbeginn waren wir zu unserem Glück nicht in Kampfhandlungen verwickelt. Ich musste mit meiner Kompanie Bunker bauen und Manöver üben. Und Wache stehen bei Brücken oder Bahngleisen oder vor wichtigen Gebäuden. Stundenlang. Es war furchtbar kalt im Winter 1939/40, tagelang weit unter null Grad. Ich kann mich an keinen eisigeren Winter erinnern. Wir haben gefroren wie die Hunde, vor allem nachts. In den Hütten und Baracken war es fast ebenso kalt wie draussen. Aber das Schlimmste war die Ungewissheit, ob uns die Deutschen angreifen, so wie sie es mit anderen Ländern gemacht hatten. Dann hätte jeder Tag mein letzter sein können. Ich durfte nicht daran denken, was dann aus dir geworden wäre.»
«Diese Polen waren im richtigen Krieg, nicht wahr?», fragte Sofia.
«Ja, sie waren im richtigen Krieg, wie du es nennst. Sie gehören der 2. polnischen Infanterie-Schützendivision an und diese dem 45. französischen Armeekorps. Die Division wurde gegründet, damit die Polen, die bei Kriegsbeginn aus ihrer Heimat geflohen sind, gegen die Nazis kämpfen konnten. Zudem leben in Frankreich seit vielen Jahren polnische Emigranten. Auch von ihnen sind viele der Division beigetreten. Soviel ich weiss, waren sie ziemlich schlecht ausgerüstet. Im Juni 1940 ist das ganze Armeekorps von der deutschen Wehrmacht an der Grenze zur Schweiz eingekesselt worden. Die einzige Möglichkeit, am Leben und frei zu bleiben, war die Flucht in die Schweiz. Der Bundesrat hat den Übertritt auf schweizerisches Staatsgebiet erlaubt. Und so sind über vierzigtausend Männer zu uns gekommen. Franzosen, Marokkaner, Polen, Briten und Belgier. Kannst du dir vorstellen, wie schwierig es war, alle unterzubringen und zu verpflegen?»
Darüber hatte Sofia nicht nachgedacht.
«Die Franzosen, Belgier, Marokkaner und Briten konnten nach einigen Monaten wieder zurück nach Frankreich, weil Deutschland einen Waffenstillstand mit Frankreich abgeschlossen hatte. Die Polen mussten hierbleiben.»
«Warum?»
«Sie konnten nicht zurück in ihre Heimat. Das wäre für sie viel zu gefährlich gewesen. Von dort sind sie ja geflohen. Ausserdem hat Polen denjenigen Landsleuten, die ausserhalb Polens lebten, die Staatsbürgerschaft abgesprochen. Sie sind also staatenlos.»
«Sie können froh sein, dass sie jetzt hier bei uns sind, oder?»
Ihr Vater überlegte. «Das müsste man sie selbst fragen.»
Sofia musterte das schmale Gesicht ihres Vaters. Die Falten um seinen Mund waren in den letzten Monaten tiefer geworden, neue hatten sich auf der Stirn gebildet. Vorläufig musste ihr Vater nicht mehr einrücken. Doch das konnte sich schnell ändern. Das kam ganz auf diesen verrückten Hitler an.
Ihr Vater suchte den BBC-Sender. Aber nur ein wirres Rauschen ertönte, mal leiser, mal aufgeregter. Da stellte er murrend das Radio ab und legte eine Schallplatte von Mozart auf. Sofia wusste nicht, was für ein Werk es war. Auf jeden Fall eines der schwermütigen Sorte. Sie nahm die Stickerei hervor, die sie in Arbeit hatte. Es sollte ein Bezug für ein Sofakissen werden, reich verziert mit Blumen im Kreuzstichmuster. Den wollte sie ihrer Tante zum Geburtstag schenken, wenn er bis dann fertig wurde. Sonst gäbe es halt ein Weihnachtsgeschenk für sie. Oder für sonst jemanden, der Freude daran hätte. Sofia lächelte, ohne es zu merken.
4
Rodels hatte um ein Vielfaches mehr Obstbäume als Häuser. Das Dorf lag rechts des Hinterrheins, auf halbem Weg durchs Domleschg. Knapp drei Dutzend Gebäude drängten sich an der Landstrasse aneinander. Die meisten waren dreistöckig, mit ziegelbedeckten Satteldächern und weiss getünchten Steinmauern. Schmucklos waren sie, und doch erschienen sie Marek standhaft und selbstbewusst. Er fragte sich, ob deren Bewohner auch so waren. Oberhalb des Dorfes schaute wie ein behäbiger Krösus das Schloss Rietberg auf das Dorf hinunter, mit seinem mächtigen viereckigen Turm, dessen steinerne Wände mehr als zwei Meter dick waren. Die Fassade des Turmes kam Marek vor wie ein Gesicht. Die beiden runden Öffnungen unterhalb des flachen Turmdachs bildeten kalt starrende Augen, die ihm folgten, wenn er vom Lager hinauf ins Dorf ging. Die zwei schmalen Schiessscharten erinnerten an geblähte Nasenflügel und die darunterliegenden Sprossenfenster an einen zähnezeigenden Mund.
Da war ihm die schlichte, aber trotzdem Furchtlosigkeit und Unbeugsamkeit ausstrahlende katholische Kirche mit dem Zwiebelturm lieber. Sie lag in der Mitte des Dorfes. Ein Mäuerchen umfasste sie und das kleine Gräberfeld. Die Kirche war dem Apostel Jakobus dem Älteren und dem heiligen Christophorus geweiht. Marek hatte sich schon lange vorgenommen, das Gotteshaus zu besuchen und eine Kerze anzuzünden. Schliesslich war Christophorus der Schutzheilige der Reisenden, den man um eine gesunde Heimkehr bat. Vielleicht würde er auch Marek dazu verhelfen.
Gleich neben der Kirche befand sich der kleine Laden. Als Marek eintrat, klingelte hell ein Glöckchen. Die Verkäuferin empfing ihn mit einem freundlichen, aber beiläufigen Blick. Ihre Aufmerksamkeit war auf den jungen Bauern gerichtet, der auf sie einredete und sich von Mareks Eintreten nicht stören liess.
«Während der Generalmobilmachung vor zwei Jahren hatte ich einen Vorgesetzten im Militär, wie ich noch nie einen erlebt habe. Ein richtiger Drecksack war das, ein arroganter, aufgeblasener Idiot. Er behandelte uns wie dumme Buben. Wir würden dann schon noch Disziplin lernen, wenn wir dem grossdeutschen Reich angehörten. Ich sage dir, Carolina: Wenn es bei uns zum Krieg kommen würde und dieses Schwein mein Vorgesetzter wäre, würde ich ihn erschiessen wie einen deutschen Nazi. Auch wenn er ein Schweizer Offizier ist.»
Erst jetzt drehte er sich um, und Marek erkannte in ihm den jungen Bauern, der an Sofias Haus vorbeigegangen war, als er ihr einen Spazierstock verkaufen wollte. Ungeniert musterte er Marek, als wollte er prüfen, welche Wirkung seine Worte auf ihn hatten.
Carolina tippte dem Bauern mit dem Zeigefinger auf den Arm, und als er sich ihr wieder zuwandte, sprudelte es aus ihr heraus: «Letzthin kam ein Mann in den Laden. Er redete Unterländer Dialekt. Dick war er und hatte einen goldenen Ring mit einem gelben Stein am Finger, der sicher ein Vermögen gekostet hatte. Seine Jacke war aus ganz feinem Stoff. Ich habe mich gefragt, wie man so dick sein kann in diesen Zeiten. Der bekommt sicher mehr Lebensmittelmarken, als ihm zustehen. Und hat auch noch das Geld dazu, um diese einzulösen. Weisst du, was er wollte, Franz?», fragte Carolina mit grossen Augen, als ob sie es immer noch nicht fassen könnte.
«Was denn?»
«Er wollte, dass ich Nazihefte verkaufe. Das ‹Signal› und die ‹Front›. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass wir hier keine Nazifreunde seien, und er solle sich zum Teufel scheren. Da hat er blöde gelacht und gesagt, dass ich mich da noch täuschen könne. Ich habe gezittert vor Wut.»
«Gut gemacht. Solches Gesindel und solche Schundhefte haben bei uns keinen Platz», antwortete Franz, den Blick wieder auf Marek geheftet.
«Hast du wieder hausiert?», fragte er.
«Nnnein», stotterte Marek, überrascht von der Frage. Er berichtete nicht, dass er am Abend zuvor bei Sofias Haus gewesen war, doch ohne einen selbst geschnitzten Spazierstock, denn seine Kameraden hatten gesagt, dass er das Verkaufen lieber bleiben lassen solle. Das sei verboten. Er hatte Sofia ein Blumensträusschen bringen wollen, das er in den Wiesen zusammengesucht hatte. Doch niemand war zu Hause gewesen. So hatte er das Sträusschen auf dem Rückweg in den Fluss geworfen. Ins Lager konnte er es ja nicht mitnehmen.
«Das ist auch besser so», sagte Franz.
Marek schwieg. Der raue Tonfall irritierte ihn. Auch, dass er ihn einfach duzte.
Carolina plapperte weiter: «Ich habe wirklich Angst vor diesen Nazis. Wenn ich mir vorstelle, dass sie bei uns einmarschieren, wird mir übel, und ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Was meinst du: Wird Amerika in den Krieg eingreifen? Dann wäre er sicher schnell vorüber. Die Amerikaner sind stark.»
«Ja, das hoffe ich auch», pflichtete Marek ihr bei. «Dann würde Churchill endlich Unterstützung bekommen. Er ist ein grosser Mann. Er kämpft für ganz Europa.»
Carolina nickte eifrig und zog ihren Rossschwanz zurecht. «Was darf ich Ihnen denn geben?», fragte sie.
«Ich hätte gerne Zigaretten, bitte.»
«Ich habe nur Marocaine. Ist das in Ordnung?»
«Aber sicher.» Marek trat an die Verkaufstheke. Sie holte aus einer Schublade eine Packung hervor und schob sie ihm zu.
«Herr Capadrutt kann sich keine Zigaretten mehr leisten, sagt seine Frau.»
«Herr Capadrutt?» Marek wusste nicht, wer Herr Capadrutt war. Carolina hüpfte von einem Thema zum anderen. Es war schwierig, ihren Gedankensprüngen zu folgen.
«Das ist ein Familienvater aus dem Dorf. Er hat sieben Kinder und verdient keine zweihundert Franken im Monat», erklärte Franz.
«Ich weiss nicht, ob Sie das im Lager mitbekommen», führte Carolina weiter aus. «Die Lebensmittel werden immer teurer. Es gibt Familien mit vielen Kindern, die kaum mehr genug kaufen können, um alle satt zu bekommen. Natürlich kann Herr Capadrutt einen Teil bei uns anschreiben lassen. Aber wir müssen auch unsere Rechnungen bezahlen. Zum Glück hat sein Ältester, Anastasius, die Schule abgeschlossen und kann nun in der Fabrik in Ems arbeiten. Er ist ja schon sechzehn Jahre alt. Und Frau Capadrutt macht Näharbeiten und so, um etwas dazuzuverdienen.»
Marek wehrte sich dagegen, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil er sich Zigaretten leisten konnte. Schliesslich arbeitete er hart für den einen Franken Tageslohn. Wortlos legte er einige Münzen auf den Tisch.