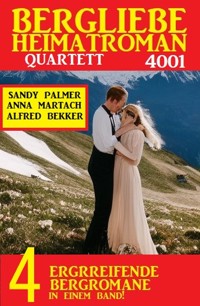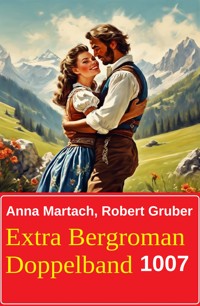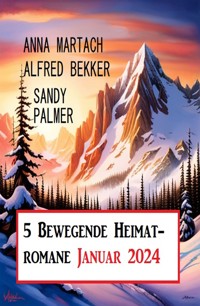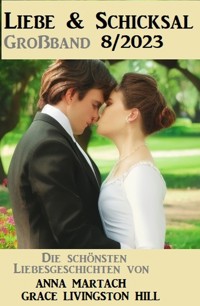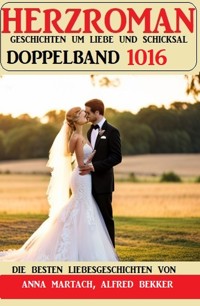Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane von Thomas West, Anna Martach, Max Brand Drei Schicksale und eine Ärztin mit Herz (Thomas West) Geisel seines Herzens (Thomas West) Kongress außer Kontrolle (Anna Martach) Dr. Kildare geht nach Hause (Max Brand) Madln und Berge – geliebt und gefährlich (Anna Martach) Eigentlich wollen Dr. Alexandra Heinze und ihr Mann beim Kollegen Molani einen fröhlichen Abend verbringen, doch weil der Hund mit dabei sein muss, geht alles schief. Das große Problem taucht jedoch einige Tage später auf, als Dr. Molanis Frau, die mit dem Nachbarn eine heftige Affäre hat, bei einem missglückten Banküberfall als Geisel genommen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West, Anna Martach, Max Brand
5 Arztromane unterm Tannenbaum 2023
Inhaltsverzeichnis
5 Arztromane unterm Tannenbaum 2023
Copyright
Drei Schicksale und eine Ärztin mit Herz: Arztroman
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Geisel seines Herzens
Kongress außer Kontrolle
Dr. Kildare geht nach Hause: Arztroman Exklusiv Edition
Madln und Berge – geliebt und gefährlich
5 Arztromane unterm Tannenbaum 2023
Thomas West, Anna Martach, Max Brand
Dieser Band enthält folgende Romane
von Thomas West, Anna Martach, Max Brand
Drei Schicksale und eine Ärztin mit Herz (Thomas West)
Geisel seines Herzens (Thomas West)
Kongress außer Kontrolle (Anna Martach)
Dr. Kildare geht nach Hause (Max Brand)
Madln und Berge – geliebt und gefährlich (Anna Martach)
Eigentlich wollen Dr. Alexandra Heinze und ihr Mann beim Kollegen Molani einen fröhlichen Abend verbringen, doch weil der Hund mit dabei sein muss, geht alles schief. Das große Problem taucht jedoch einige Tage später auf, als Dr. Molanis Frau, die mit dem Nachbarn eine heftige Affäre hat, bei einem missglückten Banküberfall als Geisel genommen wird.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Drei Schicksale und eine Ärztin mit Herz: Arztroman
Ärztin Alexandra Heinze
Arztroman von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 140 Taschenbuchseiten.
Tabea Werdersen wird von ihrem Mann betrogen. Doch das erfährt sie erst nach einem Zufallsfund durch ihre Tochter. Sigrid DaCosta macht sich große Sorgen um die Gesundheit ihres geliebten Mannes – und die sind berechtigt. Sonia Schwanner ist verzweifelt. Ihr Mann tyrannisiert sie und die beiden gemeinsamen Kinder. Aber sie weiß nicht, wie sie das ändern kann.
Dr. Alexandra Heinze begegnet diesen drei so unterschiedlichen Frauen im Marien-Krankenhaus …
1
Das Kreischen des Weckers bohrte sich in Tabeas Träume. Warum stellt Dirk das verdammte Ding nicht aus? Sie hechtete über das leere Bett ihres Mannes und schlug mit der flachen Hand auf die plärrende Nervensäge. Sie rieb sich die müden Augen aus und blinzelte in einen Lichtstrahl, den die Morgensonne trotz des zugezogenen Vorhangs durch das Schlafzimmerfenster schickte.
"Ach so", murmelte sie, "Dirk ist ja gar nicht da." Jetzt erst fiel ihr ein, dass ihr Mann gestern nach Madrid geflogen war. Obwohl er schon seit Jahren beruflich ständig unterwegs war, hatte sich Tabea immer noch nicht daran gewöhnt, das Bett neben sich morgens so häufig leer vorzufinden.
Seufzend stand sie auf und streckte sich. Sie war klein und ihrer straffen, kerzengeraden Gestalt sah man an, dass Tabea viele Jahre ihres Lebens intensiven Leistungssport getrieben hatte. Sie zog den Vorhang vom Schlafzimmerfenster zurück und blinzelte in die Sonne, die schon hell und warm über den Baumwipfeln des Waldes stand. Im Garten unten zwitscherten die Amseln in den Haselnusssträuchern und im Geäst der Blautanne. Eine Katze schlich um den Gartenteich herum.
Tabea riss sich von dem idyllischen Anblick ihres Gartens los und schaute auf den Wecker neben Dirks Bett: Schon Viertel nach sieben. Höchste Zeit - um halb neun hatte sie den ersten Termin in der Frauenberatungsstelle. Dreimal in der Woche arbeitete sie dort für einen halben Tag.
Sie öffnete das Fenster und sog die kühle Morgenluft in ihre Lungen. Ein warmes Prickeln perlte durch ihren Körper. Die letzte Spur des Traumes, aus dem der verdammte Wecker sie gerissen hatte. Der Traum war weg - schade. Sie legte sich beide Hände auf den Bauch - eine sanfte Erregung zitterte darin. Es muss ein schöner Traum gewesen sein, dachte sie. Doch so sehr sie in ihrem Gedächtnis nach den Bildern suchte, die vor wenigen Minuten noch so gegenwärtig gewesen waren - sie konnte sich nicht an den Traum erinnern.
Tabea zog einen Morgenmantel über und ging die Treppe hinunter in die Küche. Am Herd stand ein junger Mann. Er trug eine dunkle Stoffhose mit Bügelfalten und eine rote Samtweste über einem weißen Leinenhemd. Er bewachte einen dampfenden Wassertopf, in dem drei Eier klapperten. Tabea strich sich über ihr nagelbürstenkurzes, dunkelrot gefärbtes Haar und sah ihn verdutzt an.
Er bemerkte sie nicht gleich, und als er sie dann wie zufällig hinter sich entdeckte, fuhr er erschrocken herum.
"O! Ich habe Sie gar nicht kommen hören!" Er streckte ihr die Hand entgegen. "Ich bin Georg - guten Morgen, Frau Werdersen!" Er stutzte. "Sie sind doch Kathrins Mutter?" Sein stoppelbärtiges Gesicht verzog sich zu einem verlegenen Grinsen. Die weichen Gesichtszüge erinnerten Tabea sofort an diesen Bergsteiger - wie hieß er gleich? - Reinhold Meßner, richtig. Jedenfalls hatte er in seinen besten Jahren so ähnlich ausgesehen, wie dieser Sunnyboy hier.
Tabea nickte.
"Morgen", brummte sie. Mehr brachte sie nicht über die Lippen. Sie war ein ausgesprochener Morgenmuffel. Außerdem empfand sie keine allzu leidenschaftliche Gastfreundschaft dem Mann gegenüber, der offensichtlich das Frühstück zubereitete hatte. Jedenfalls schienen die Eier gleich fertig zu sein, auf der Anrichte neben der Spüle brodelte bereits die Kaffeemaschine, und der Tisch war auch schon gedeckt, wie Tabea mit einem flüchtigen Blick feststellte. Und das, obwohl von Kathrin noch keine Spur zu sehen war.
Georg sah auf die Uhr und ging schnell zum Herd.
"Die drei Minuten sind um", erklärte er und nahm den Topf mit den Eiern vom Herd.
Tabea wandte sich seufzend ab. Die letzten drei Monate hatte sie häufig einen gewissen Paul morgens in der Küche angetroffen. Der hatte allerdings nie Eier gekocht, nicht mal Kaffee. Meistens hatte er nur Zeitung gelesen. Und vor Paul einen gewissen Charly. Glücklicherweise nur drei Wochen lang. Der junge Kerl - ein Klassenkamerad von Kathrin - hatte die Gewohnheit, mit lauter Technomusik zu frühstücken. Gleich am ersten Morgen hatte Tabea Streit mit ihm bekommen. Und vor Charly ...
Lassen wir das, dachte Tabea, jetzt eben Georg.
Sie schloss die Badezimmertür hinter sich zu und stieg in die Dusche. Wohlig räkelte sie sich unter dem warmen Wasserschauer. Wie so oft an solchen Morgen fragte sie sich, ob sie wohl irgendetwas falsch gemacht hatte bei der Erziehung ihrer Tochter. Die Antwort war jedes Mal dieselbe: Nein! Es sei denn, man betrachtete es als Fehler, ein Kind so wenig wie möglich zu erziehen.
Als Tabea später in die Küche kam, saßen ihre Tochter und ihr neuer Georg bereits am Kaffeetisch.
"Morgen, Ma", flötete Kathrin, "darf ich dir Georg vorstellen?"
"Wir hatten schon das Vergnügen", sagte Tabea und setzte sich. Während sie ihren Kaffee schlürfte und sich dann schweigend ihrem Frühstücksei widmete, sprachen die beiden über mögliche Prüfungsthemen in Deutsch. Kathrin steckte mitten im Abitur. Ihr zweiter Anlauf. Dieser Georg tat sehr fachkundig, und Tabea hörte bald heraus, dass er Lehrer war. Allerdings nicht an Kathrins Schule. Tabea beobachtete ihn verstohlen. Sie schätzte ihn mindestens zehn Jahre älter als ihre Tochter. So korrekt seine Garderobe war - es fehlte eigentlich nur noch der Schlips - so wirr standen seine dichten, strohblonden Haare nach allen Seiten ab. Seine Augen leuchteten in einem seltenen hellen Blau. Sie lachten sogar noch, als Kathrin ihn mit dem Ellenbogen anstieß und Kaffee auf seine weißes Hemd tropfte.
Tabea reichte ihm eine Serviette. Für den Bruchteil einer Sekunde berührten sich ihre Hände, und sie spürte die Wärme seiner Haut. In dem Augenblick fiel ihr der Traum wieder ein. Sie hatte in den Armen eines Mannes gelegen. Nicht in Dirks Armen ...
Um Viertel vor acht verließ Georg das Haus. Er musste zum Unterricht. Tabea wartete, bis er die Treppe hinuntergegangen war und sie die Haustür ins Schloss fallen hörte. Dann musterte sie kritisch ihre Tochter. Kathrin war nicht viel größer als ihre Mutter und genauso schlank.
"Du wechselst die Männer wie deine Unterwäsche", sagte Tabea.
Kathrin konnte diesen typischen Mutterblick nicht ausstehen. Er erinnerte sie immer an diese allwissende Kommissarin aus dem ,Tatort‘.
"Die wechsle ich täglich, Ma", entgegnete sie schnippisch, "und Georg ist erst der vierte in diesem Jahr."
"Wir haben gerade mal Mai."
"Ach komm, Ma", Kathrin knallte die Kaffeetasse auf den Unterteller, "spiel' nicht schon wieder den Moralapostel! Ich will mich eben nicht fest binden!" Mit einer energischen Kopfbewegung warf sie ihre langen schwarzen Locken hinter sich. "Schon gar nicht jetzt, wo ich mitten in den Prüfungsvorbereitungen stecke - ich kann es mir nicht leisten, ein zweites Mal durchs Abi zu rasseln!"
"Schon gut", beschwichtigte Tabea, "ich mach' mir ja nur Sorgen um dich."
Kathrin stand auf und griff nach ihrer abgewetzten Schultasche. "Mach' dir lieber Sorgen um dich und Pa!"
"Wieso?"
",Wieso‘", äffte Kathrin ihre Mutter nach, "fast jede zweite Woche ist Pa in Madrid oder Mailand oder sonst wo. Glaubst du vielleicht, die vielen südländischen Ingenieurskolleginnen, mit denen er zusammenarbeitet, wären alle alt, fett und hässlich?"
Tabea zuckte nur mit den Schultern.
"Dein Vater ist treu, mein Kind. Außerdem weiß ich gar nicht, was das ist - Eifersucht."
2
"Ein Weizenbier, Sonia!" Der Mann an der Theke grinste fröhlich. Sonia sah ihn überrascht an. Sie brauchte ein paar Sekunden, bis sie ihn erkannte.
"Walter, du ...? Was für eine Überraschung!" Sie drückte ihm gerührt die Hand. Aus den Augenwinkeln fing sie einen grimmigen Blick ihres Mannes auf. Er saß in der Mitte des Lokals am Stammtisch. Sie zuckte zusammen. Walter hatte es bemerkt.
"Dein Mann?"
Sonia wich dem Blick ihres ehemaligen Chefs aus und nickte stumm. Sie bückte sich zum Kühlschrank und holte eine Flasche Weizenbier heraus. "Wie geht es dir denn so als Wirtin?" Walter sah sich in der kleinen, überfüllten Kneipe um. "Sicher mehr Arbeit als in meinem Blumengeschäft, oder?"
"O ja", Sonia füllte das große Glas, "das kann man wohl sagen!" Sie stellte ihrem Gast das Bier hin und betrachtete ihn genauer. Seine Haare waren lichter geworden. Und grauer, aber sonst war er noch ganz der alte, fröhliche Walter, bei dem sie jahrelang als Floristin gearbeitet hatte. Bis vor sieben Jahren, als sie geheiratet hatte.
"Ich hab' gehört, du hast Kinder?"
"Ja, einen Jungen und ein Mädchen", sagte Sonia. "Lukas kam, kurz nachdem wir geheiratet haben."
"Und was machen die Kleinen, während du hier unten die Gäste bewirtest?"
"Was die machen?" Sonia schluckte und versuchte ihrer Stimme einen festen Klang zu geben. "Ach, die sind oben und schlafen." Sie sah, wie ihr Mann sich von seinem Platz erhob und seine zwei Zentner behäbig durch die Menge der stehenden Gäste schob. Misstrauisch musterte er den Mann, mit dem seine Frau sprach. Er hatte ihn noch nie in seiner Kneipe gesehen. Er beugte sich zu Sonia und brummte: "Quatsch nicht 'rum hier! Da hinten am Tisch sitzen Gäste, die haben nichts mehr zu trinken."
"Hab' schon gesehen, Olaf", sagte Sonia hastig. Sie zwang sich, ihren ehemaligen Chef anzulächeln und steuerte dann einen Tisch am anderen Ende der Kneippe an. Ihr Mann schaukelte zurück zu seinen Stammtischgästen.
Walter sah Sonia nachdenklich hinterher.
"Hallo, Walter", klopfte ihm jemand auf die Schulter, "ich komme schon seit Jahren ins ,Fässchen‘, aber dich habe ich noch nie hier gesehen."
Walter drehte sich zu dem anderen um.
"He, Ewald, na sowas? Sag' bloß, du bist hier öfter!" Walter kannte Ewald Zühlke aus früheren Jahren. Sie hatten zusammen beim Roten Kreuz gearbeitet; Zühlke hauptberuflich, er ehrenamtlich.
"Klar, das ist sozusagen meine Stammkneipe", lachte Ewald Zühlke. "Kennst du Sonia? Ich habe gesehen, dass ihr miteinander gesprochen habt."
"Ja, sie hat früher in unserem Blumenladen gearbeitet. Ich kam zufällig vorbei, da dachte ich: Schauste mal nach deiner kleinen Floristin."
Zühlke beobachtete die zierliche, rothaarige Wirtin, wie sie von Tisch zu Tisch ging, Bestellungen aufnahm und mit den Leuten scherzte.
"Und? Hast du sie noch wiedererkannt?" Aufmerksam beobachtete er die Reaktion des anderen.
Über Walters Gesicht flog ein Schatten.
"Wiedererkannt schon", sagte er gedehnt, "so ein kleines, niedliches Persönchen mit solchen langen, roten Haaren erkennt man wohl noch nach hundert Jahren wieder, aber ...", er starrte in sein Glas, trank einen Schluck und schien nach Worten zu suchen, "aber besonders glücklich scheint sie nicht zu sein."
Ewald Zühlke lachte bitter auf.
"Du bist zehn Minuten hier und kapierst, was manche hier nach sieben Jahren noch nicht wahr haben wollen." Vielsagend sah er den anderen an. "Sie ist hier Köchin, Wirtin, Mutter, Putzfrau und seine Dienerin." Mit einer abfälligen Kopfbewegung deutete er zum Stammtisch. "Wundere mich, dass sie noch nicht zusammengeklappt ist."
Walter spähte zum Stammtisch hinüber. Olaf Schwanner lachte dröhnend mit seinen Saufkumpanen. "Der Bursche hat mir schon bei der Hochzeit nicht gefallen", murmelte Walter. "Was ist das für einer?"
"Ein übler Saufkopf", knurrte Zühlke, "war Z-zwölf bei der Marine. Hat sich mit der Abfindung die Kneipe hier finanziert. Zwölf Jahre älter als Sonia, fünfundvierzig. Er spielt den Chef, und sie macht die Arbeit. Weiß jeder hier ..." Er unterbrach sich, weil die Wirtin zurückkam.
"N'Abend Ewald, wie geht's?"
"Gut und selber?"
"Ganz gut", sagte sie und stellte ihm ungefragt ein Bier hin. Sie erledigte die Bestellungen, brachte die Getränke an die Tische, gab Aufträge an die Küche weiter und ließ ihre Augen über die Gäste wandern. Im Augenblick schienen alle versorgt zu sein. Zeit, mal eben nach den Kindern zu schauen. Sonia verließ den Gastraum durch die Hintertür und spurtete die Treppe hinauf. Schon von unten hörte sie die Kleine schreien. Hastig schloss sie die Wohnungstür auf und ging ins Kinderzimmer. Aus dem Wohnzimmer dröhnte der Fernsehapparat. Ihre fünfjährige Tochter saß im Bett und heulte.
"Was ist denn, Anna, mein Mäuschen?" Zärtlich drückte sie die Kleine an sich.
"Ich kann nicht schlafen!", krähte das Kind. "Lukas hat den Fernseher so laut gestellt!"
Sonia nahm sie auf den Arm und lief ins Wohnzimmer. Dort saß ihr Siebenjähriger auf dem Teppichboden zwei Meter vor dem Fernseher und knabberte Salzstangen. Ein Krimi flimmerte über die Mattscheibe.
"Lukas!", schimpfte Sonia. "Ich habe dir nicht erlaubt, die Glotze anzuschalten, wenn das der Papa mitkriegt!" Sie schaltete den Apparat aus.
"Nur noch zehn Minuten", bettelte der Junge, "nur noch zehn Minuten. Der Papa merkt's doch eh nicht!"
"Nein!" Sonia wurde energisch. "Es ist gleich halb zehn. In's Bett mit dir!" Sie scheuchte ihren Sohn ins Bett, drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange und legte auch die Kleine wieder hin.
"Immer müssen wir allein sein!", protestierte Lukas.
Das sagte er oft. Und jedes Mal gab es Sonia einen Stich.
"Wir kommen bald", log sie und verließ die Wohnung. Vor ein Uhr würde sie sie wohl kaum wieder betreten.
Hastig sprang sie die Treppe hinunter und ging zurück in den Gastraum. Ihr Mann bediente an der Theke. Missmutig suchten seine Blicke die Tische ab.
O Gott, er sucht mich schon, dachte Sonia erschrocken. Ängstlich ging sie zur Theke. Olaf packte sie am Arm.
"Spinnst du eigentlich, mitten im größten Betrieb zu verschwinden?" Fest drückte er zu. Sonia biss sich auf die Unterlippe. "Wegen dir muss ich meine Gäste alleinlassen", knurrte er. "Los, an die Arbeit!" Endlich ließ er sie los.
"Ist gut, Olaf." Sie drehte sich um - ihr ehemaliger Chef und Ewald Zühlke hatten die Szene beobachtet. Erschrocken wandte Sonia sich ab. Sie schluckte die aufkommende Bitterkeit wieder hinunter, unterdrückte die Tränen und setze ein Lächeln auf. Theaterspielen - das hatte sie gründlich gelernt in den sieben Jahren mit Olaf.
3
Der Notarztwagen jagte mit Blaulicht und Martinshorn durch die Innenstadt.
"NAW an Rettungsleitstelle", funkte Ewald Zühlke, "bitte Adresse noch mal zum Mitschreiben. Kommen."
"Leitstelle an NAW", quäkte die Stimme aus dem Funksprechgerät, "die Adresse lautet: Untere Gasse zwölf. Feinkostgeschäft DaCosta. Kommen, ob verstanden."
"NAW an Leitstelle, verstanden, Ende." Zühlke hängte das Mikro ein.
"Du lieber Himmel!", rief Alexandra Heinze aus. "Feinkost DaCosta - die Leute kenne ich!" Seit Jahren kauften Werner und sie bei den DaCostas ein. Das Feinkostgeschäft führte italienische Spezialitäten - Parmaschinken, eingelegte Artischockenherzen, getrocknete Tomaten und dergleichen. Und die besten Tortellini in der ganzen Stadt. Diesen netten Leuten wird doch nichts zugestoßen sein?
"Da vorne ist es", sagte Jupp Friederichs und ging vom Gas. Auf dem Bürgersteig vor einem Schaufenster stand ein junger Mann und winkte. Alexandra erkannte ihn: Es war Giovanni DaCosta, der jüngste Sohn der Familie. Der Notarztwagen hielt, und sie sprangen aus dem Fahrzeug.
"Papa geht es schlecht", rief Giovanni und lief dem Notarztteam voran in den Laden. Er führte sie ins Hinterzimmer. Auf einem Stuhl saß ein hagerer, dunkelhaariger Mann, der etwa Mitte fünfzig war. Eine Frau gleichen Alters - ein wenig untersetzt und mit auffallend kurzen grauen Haaren - kniete vor ihm auf dem Boden und wischte ihm mit einem feuchten Tuch die Stirn ab. Als sie Alexandra sah, sprang sie auf.
"Frau Dr. Heinze, Sie sind es! Wie gut, dass Sie kommen! Silvio geht es nicht gut!"
Alexandra trat zu dem Mann und tastete seinen Puls, während Ewald Zühlke ihm die Blutdruckmanschette umlegte.
"Ist gar nicht wahr, Frau Doktor", der Mann winkte müde ab, "fühle mich nur ein wenig schwach." Alexandra registrierte erleichtert, dass die Situation zumindest nicht lebensbedrohlich war. Sie betrachtete den mittelgroßen Mann mit den dunklen Augen und dem südländischen Profil. Er war ziemlich blass. Kleine Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Auch sein sorgfältig gepflegter Schnurrbart schimmerte feucht.
"Von wegen ,ein bisschen schwach‘", schimpfte seine Frau, "die ganze Woche schleppt er sich schon herum. Immer sag' ich: Geh' zum Arzt, Silvio, bitte geh' zum Arzt! Aber er weiß ja alles besser, der Herr, nie hört er auf mich!" Ihre blauen Augen funkelten zornig. In ihren Gesichtszügen las Alexandra die Sorge um ihren Mann. Sie mochte die Frau schon immer gut leiden. Ihre warmherzige, direkte Art war wohltuend. Sigrid hieß sie, sie war Deutsche. Gemeinsam mit ihrem Mann Silvio führte sie seit Jahrzehnten den Feinkostladen.
Alexandra untersuchte DaCosta. Sein Puls war schnell, sein Blutdruck niedriger, als einem Mann seines Alters guttun konnte, und er wirkte insgesamt etwas erschöpft.
"Haben Sie Schmerzen, Herr DaCosta?", fragte sie ihn.
"Ah was!", wieder winkte er ab. "Nix Schmerzen, nur ein bisschen schwach. Kleine Schluck Rotwein, und DaCosta steht wieder hinter Ladentheke." Trotzdem er schon über dreißig Jahren in Deutschland lebte, sprach er mit einem kleinen Akzent, über den seine Familie sich gerne lustig machte.
Seine Frau zeigte ihm einen Vogel.
"Einen Schluck Rotwein - du spinnst wohl! Zum Arzt gehörst du!" Sie wandte sich an Alexandra. "Bitte nehmen Sie ihn mit, Frau Dr. Heinze. Freiwillig geht er zu keinem Arzt. Aber er muss endlich einmal gründlich untersucht werden. Er gefällt mir schon lange nicht mehr."
"Aha!", rief er aus. "Hören Sie, Frau Doktor, ich gefalle ihr nicht mehr." Er gestikulierte mit beiden Händen. "Sie will mich loswerden!"
Sein Sohn Giovanni stand im Türrahmen und grinste über das ganze Gesicht. Ein kleiner Junge sah ängstlich an ihm vorbei in das Zimmer.
"Hörst du, Tonio", sprach DaCosta ihn an, "deine Großmutter will mich loswerden!" Ein verschmitztes Lächeln kräuselte sich um seine dunklen Augen.
"Du Quatschkopf!", schimpfte Sigrid DaCosta.
Alexandra schmunzelte. So schlecht schien es dem Mann nicht zu gehen. Andererseits musste man bei Männern seiner Generation immer damit rechnen, dass sie ihre Beschwerden herunterspielten. Was ihr auffiel, war sein harter, aufgeblähter Bauch.
"Haben Sie Bauchschmerzen, Herr DaCosta", fragte sie ihn.
"Nur ein bisschen", winkte er ab, "klappt nicht mehr auf dem Topf." Er grinste verlegen. Alexandra hörte den Bauch mit dem Stethoskop ab. Die Darmgeräusche waren äußerst spärlich, und was sie hörte, gefiel ihr nicht.
"Ihre Frau hat recht, wir nehmen Sie mit in die Klinik. Sie müssen gründlich untersucht werden." Sie gab ihren Sanitätern ein Zeichen. Friederichs und Zühlke verließen den Raum, um die Trage zu holen.
"Mamamia!" DaCosta schlug die Hände über dem Kopf zusammen und verdrehte die Augen. "In die Klinik wegen ein bisschen Schwäche. Und wer kümmert sich um den Laden, he?" Vorwurfsvoll sah er seine Frau an.
"Wir werden selbstverständlich bankrott gehen, wenn du nicht da bist!", erwiderte Sigrid trocken. "Du bist ja sooo wichtig!"
Der Sohn an der Tür grinste immer noch.
"Ich bin doch auch noch da, Papa. Mein Studium fängt erst in drei Monaten an."
DaCosta gab auf und winkte ein letztes Mal ab.
"Also gut, dann geht DaCosta eben in die Klinik. Bring' mir mein Jackett und meinen Schlips, Sigrid."
Halb fasziniert und halb amüsiert beobachtete Alexandra, wie der Mann sich einen Schlips umband, in sein Jackett schlüpfte und aus dessen Innentasche dann einen Kamm zog, um sich damit durch seine dichten, schwarzen Haare zu fahren. Es war ihr schon immer aufgefallen, dass der Feinkosthändler eleganter gekleidet war als der Durchschnitt seiner Altersgenossen. Aber dass er es so genau nahm, überraschte sie doch.
Die beiden Sanitäter kehrten mit der Trage zurück und stellten sie vor seinem Stuhl ab. DaCosta bedachte das Gestell mit einem verächtlichen Blick, während er sich erhob. Er küsste seine Frau auf die Stirn und ging an der Trage vorbei auf die Tür zu. Dort umarmte er Sohn und Enkel.
Alle Proteste von Alexandra fruchteten nichts. Der Mann wollte partout auf seinen eigenen Beinen zum Notarztwagen gehen. Brummend trugen Zühlke und Friederichs die Trage hinter ihm her.
"In der Mittagspause bringe ich dir deine Sachen vorbei", rief Sigrid ihm nach.
4
Auf den Feldern neben der schnurgeraden Straße saßen Scharen von Möwen und Kiebitzen. Wolkenfetzen jagten über den grauen Himmel, der das flache Land überspannte. Autos mit Nummernschildern aus dem ganzen Bundesgebiet überholten ihn. Die ersten Vorboten der nahenden Hauptsaison. Rüdiger Borchert trat kräftig in die Pedale. In wenigen hundert Metern Entfernung sah er den Dachfirst des elterlichen Hofes auftauchen. Obwohl ihr Ponyhof fast zwanzig Kilometer außerhalb von Jever lag, benutzte Borchert grundsätzlich das Fahrrad, wenn er seine Eltern besuchte. Er saß so viel hinter dem Steuer, dass er froh war, in seiner Freizeit ohne Auto auszukommen.
Er erreichte die Pferdekoppeln des Ponyhofs. Einige der Ponys hoben die Köpfe, als er die Fahrradklingel betätigte. Er fuhr auf den asphaltierten Hof und stellte sein Fahrrad neben die Bank vor der Eingangstür. Ein paar PKWs mit süddeutschen Kennzeichen parkten im Hof. Von den Stallungen her hörte er Hammerschläge. Er schirmte die Augen mit der flachen Hand ab und erkannte seinen Vater auf dem Dach des Pferdestalls.
"He, Rüdi, lässt du dich auch mal wieder blicken?" Der alte Herr auf dem Dach winkte ihn zu sich. "Da steht die Leiter - komm' hoch und hilf mir! Ich muss ein paar Ziegel auswechseln. Danach trinken wir Kaffee."
Borchert stieg die Leiter hoch und packte mit an.
Eine Stunde später saßen sie am Kaffeetisch in der guten Stube. Mutter Borchert hatte Mohnkuchen mit Streusel gebacken, und Rüdiger ließ es sich schmecken. Die üblichen Neuigkeiten wurden ausgetauscht: wie viele Gäste schon im Haus waren, und wie viele für die Hauptsaison gebucht hatten, Ärger mit den Nachbarn, Neuzugänge bei den Ponys und so weiter. Borchert erzählte von seiner letzten Fahrt nach Spanien und von der bevorstehenden Tour nach Rom.
"Heute Abend geht's los", sagte er mit vollem Mund, "durchs Ruhrgebiet nach Stuttgart, und dann über München nach Italien. Maschinenteile."
Beim Bund hatte Borchert den Führerschein für LKWs gemacht. Zwanzig war er damals. Seitdem war er auf den Autobahnen Deutschlands Zuhause. Seit fünfzehn Jahren also. Oft schon hatten seine Eltern versucht, ihn zu überreden, wieder in seinen alten Beruf als KFZ-Mechaniker zurückzukehren. Vergeblich.
"Ich muss unterwegs sein", pflegte er zu sagen, "immer unterwegs sein, mehr brauch' ich nicht zum Leben, aber das brauch' ich."
"Das hast du von deinem Großvater", seufzte seine Mutter oft, "der war auch so ein Vagabund. Mit zwanzig nach Südamerika und dann in der ganzen Welt herumgestromert. Nicht mal wo sein Grab ist, wissen wir."
Borchert lachte dann immer.
"Na siehst du - ich hab's geerbt, kann gar nichts dafür."
Vater Borchert trank seine Tasse leer und stand auf.
"Ich muss wieder auf's Dach. Gute Fahrt, Junge."
Borchert sah ihm nach. Er schien ein Stück gebeugter zu gehen als noch das letze Mal.
Seine Mutter schenkte ihm Kaffee ein und legte ihm noch ein Stück Mohnkuchen mit Streusel auf den Teller.
"Iss, mein Junge, soviel Mann braucht viel Kraftstoff." Das war einer ihrer Standardsprüche. Borchert vermutete, dass sie ihn damit schon als kleinen Jungen aufgepäppelt hatte. Wahrscheinlich war er deswegen ,soviel Mann‘ - nämlich knapp einsneunzig groß und über hundertachtzig Pfund schwer. Er ließ es sich schmecken.
"Hör' mal, Rüdi, ich muss dir was sagen." Das war in aller Regel die Einleitung zu einer Predigt, die Borchert schon auswendig konnte. Er hörte sie sich wie immer geduldig an. "Dein Vater wird alt. In drei Monaten feiert er seinen Siebzigsten. Neulich hat er schon wieder davon gesprochen, den Ponyhof zu verkaufen."
"Keine schlechte Idee", mampfte Borchert.
"Aber Rüdi", seine Mutter rutschte mit ihrem Stuhl näher an ihn heran und legte ihre Hand auf seinen Arm, "schau, das wär' doch schade, der schöne Hof. Du bist doch hier aufgewachsen. Kannst du dir vorstellen, dass plötzlich fremde Leute hier leben?"
"Nein", er spülte den Kuchen mit Kaffee herunter.
"Ja siehst du, überleg's dir noch mal! Du könntest ihn doch weiterführen."
Er lachte: "Ich und sesshaft werden, das kann ich mir noch weniger vorstellen." Und damit endete das Gespräch. Wie immer.
Sechs Stunden später saß er in seinem Brummi und fuhr Richtung Dortmund. Fred, sein Beifahrer, schnarchte hinter dem Vorhang der Koje. Es wurde langsam dunkel, und das graue Band der Autobahn durchzog das Münsterland. Er dachte an seine Eltern und an den Ponyhof. Natürlich beschäftigte er sich hin und wieder mit dem Gedanken, etwas ganz anderes zu machen. Meistens, wenn er frei hatte. Und er zweifelte nicht daran, dass er so einen Ferienhof gut führen würde. O nein - im Gegenteil: Er würde richtig etwas daraus machen. Was er sich da im Lauf der Jahre zusammengefahren hatte, war ein hübsches Sümmchen. Damit ließe sich so ein Hof schon auf Vordermann bringen.
Aber sobald Borchert wieder hinter seinem Steuer saß, rückten diese Gedanken in weite Ferne. So weit weg, wie das Grab seines Großvaters. Dann konnte er sich nicht vorstellen, je etwas anderes zu tun, als mit irgendwelchen Sattelschleppern irgendwelche Industrieprodukte durch halb Europa zu kutschieren. Seit fast fünfzehn Jahren tat er das. Und er tat es im Grunde genommen verdammt gern. Wenn es nach ihm ginge, könnte es immer so bleiben. Zufrieden lehnte er sich zurück. Wenn ihm jemand gesagt hätte, dass er gerade zum letzen Mal in Richtung Süden fährt, hätte er ihn ausgelacht.
5
Es war Freitag. Tabea saß schon am Frühstückstisch. In der Dusche hörte sie das Wasser rauschen. Dirks Stimme drang dumpf aus der Badezimmertür. Er sang einen alten Dylon-Song. Er sang eigentlich immer beim Duschen. Solange sie ihn kannte.
Die Badezimmertür öffnete sich, eine Wolke Wasserdampf strömte heraus. Dirk trug seinen blauen Bademantel. Pfeifend schlurfte er in die Küche.
"Nanu?", stutzte er und betrachtete mit gerunzelter Stirn den Frühstückstisch. "Vier Gedecke?"
"Ja", Tabea konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, "Kathrin und Georg schlafen noch." Sie gönnte ihrem Mann diese Überraschung. Für sie war das ja schon fast Routine.
"Georg?" Seine gute Laune schien sich zu verflüchtigen. "Was für'n Georg?"
"Kathrins neuer Freund, ein Lehrer. Schöner Mann, wird so um die dreißig sein."
Er strich eine nasse Haarsträhne aus der Stirn und verdrehte die Augen.
"Kann man nicht mal mehr in Ruhe frühstücken in seinen eigenen vier Wänden."
"Doch, doch", sagte Tabea genüsslich, "deine Tochter schläft auch von Zeit zu Zeit allein, dann frühstücken wir ohne Gast. Wenn du öfter zu Hause wärst, würdest du auch das erleben."
"Aha", brummend schenkte er sich Kaffee ein, "apropos: Ich muss heute Abend schon wieder weiter, nach Florenz diesmal."
"Wie bitte?", empört funkelte Tabea ihn an. "Am Wochenende?"
"Natürlich am Wochenende", sagte Dirk gelassen, "wann sonst soll eine Bank ihre EDV-Anlage abschalten, um sie zu reparieren? Etwa unter der Woche, wenn die Geschäfte laufen?"
"Schon gut", beschwichtigte Tabea, "ich hatte mich nur auf ein gemeinsames Wochenende eingestellt."
"Hab's erst gestern Abend erfahren", brummte Dirk und widmete sich seinem Frühstücksei. Schweigend aßen sie. Irgendwann ging unten die Tür von Kathrins Zimmer, und ihre Schritte näherten sich auf der Treppe.
"Guten Morgen!" Überrascht sah sie ihren Vater an. "Hi, Pa, bist du auch mal wieder hier?"
"Komm, komm - ich war doch nur drei Tage weg." Er hielt ihr die Wange hin und bekam einen Begrüßungskuss. "Ich dachte, wir hätten einen Gast heute Morgen?", er deutete auf das vierte Gedeck.
"Kommt gleich", Kathrin nahm Platz, "unter der Garderobe steht ein neuer Aktenkoffer, kann ich deinen alten haben?"
"Steht im Arbeitszimmer, nimm ihn dir."
"Danke, Pa."
Tabea sah auf die Uhr. Gleich acht. Sie stand auf.
"Ich muss geh'n. Sehen wir uns heute Nachmittag noch?"
"Kann schon sein", brummte Dirk mit vollem Mund. Er hatte sich mittlerweile in die Tageszeitung vertieft. Seufzend verließ Tabea die Küche.
"Tschüss, Ma", rief ihre Tochter ihr nach. Tabea nahm ihre Tasche und lief die Treppe ins Erdgeschoss hinunter. Gegenüber dem Gästezimmer öffnete sich die Tür zu Kathrins Zimmer. Georg erschien im Türrahmen.
"Guten Morgen, Frau Werdersen." Sein verschlafenes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln.
"Morgen und auf Wiedersehen", Tabea öffnete die Haustür.
Als sie in ihrem Wagen saß und in die Stadt zur Beratungsstelle fuhr, kroch ein bitterer Geschmack auf ihre Zunge. Sie hatte sich an Dirk gewöhnt - an seine häufige Abwesenheit, an seine brummige Art, an seinen Geiz, was Zärtlichkeiten betraf. Sie hatte sich daran gewöhnt, allein zu sein und weitgehend ohne ihn auszukommen. Und trotzdem brannte an Morgen wie diesem die Enttäuschung in ihr.
Der Vormittag in der Beratungsstelle ging wie im Flug vorbei. Tabea vergaß jedes Mal die Zeit, wenn sie ins Gespräch mit Ratsuchenden vertieft war. Frauen aller Altersgruppen saßen an diesem Morgen nacheinander in ihrem Sprechzimmer: Eine Frau Anfang dreißig, die ungewollt schwanger geworden war, eine türkische Jungendliche, deren Familie sie an einen zwanzig Jahre älteren Mann in Anatatolien verheiraten wollte, eine Frau in den Vierzigern, deren Mann trank und schließlich eine Frau, die etwa zehn Jahre älter als Tabea war.
Sie war die letzte Klientin dieses Vormittags. Und sie beschäftigte Tabea am meisten. Nach fünfundzwanzig Jahren Ehe hatte sie entdeckt, dass ihr Mann sie betrog. Beide Kinder waren seit kurzem aus dem Haus, und die Frau hatte plötzlich gemerkt, dass sie bisher nur für andere gelebt hatte und selbst zu kurz gekommen war. Ihre Bitterkeit war für Tabea fast körperlich spürbar.
"Es wird langsam Zeit für sie, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen", sagte sie zu der Frau. Einer ihrer Lieblingssätze. Die Frau zeigte sich wenig zugänglich für Appelle. Sie bewegte sich am Rande einer Depression. Tabea vermittelte ihr einen Therapeuten.
Noch auf der Heimfahrt musste sie an diese Frau denken. Eine Geschichte, wie sie viele Frauen erzählten, die zu ihr kamen. Immer nur für andere dagewesen, immer die eigenen Wünsche beiseite geschoben - und irgendwann, meistens wenn die Kinder aus dem Haus gingen, brach die große Bitterkeit über sie herein. In zehn Jahren würde sie selbst so alt sein wie diese Frau. Ihr erstes Kind war schon aus dem Haus. Tabeas Sohn Friedemann studierte seit einem Jahr in Süddeutschland. Kathrin würde auch nicht mehr lange zu Hause wohnen bleiben. Sie ging ja jetzt schon eigene Wege. Und Dirk? Tabea dachte an das Frühstück. Seine brummige, gleichgültige Art verletzte sie mehr, als sie sich eingestand. Kathrins Worte fielen ihr ein: ,Mach' dir lieber Sorgen um dich und um Pa!‘
Werde ich in zehn Jahren auch als frustriertes Nervenbündel in irgendeiner Beratung sitzen?, fragte sie sich.
6
Der Vormittag war wie verhext. Ein Einsatz jagte den nächsten. Alexandra und ihr Team hatten kaum eine Verschnaufpause. Diesmal waren sie zu einer noblen Vorortvilla gerufen worden. Einige Leute standen vor der offenen Garteneinfahrt. Friederichs bremste scharf, und Alexandra sprang aus dem Notarztwagen.
"Schnell, kommen Sie!", rief eine ältere Dame mit verweinten Augen und lief ihr voran durch den Garten. Zühlke folgte mit dem Notfallkoffer.
Durch die offene Terrassentür rannten sie in ein großes Wohnzimmer. Auf einer Couch lag der leblose Körper einer blonden Frau. Alexandra schätzte sie um ein paar Jahre jünger als sie selbst. "Ich bin die Haushälterin, ich hab' sie eben gefunden", sagte die ältere Dame atemlos. Der Schock stand in ihren Gesichtszügen.
Alexandra brauchte nur Sekunden, um zu erfassen, dass die junge Frau schon im Sterben lag. Ihre Bewusstlosigkeit war tief, ihre Atmung mehr als flach, der Puls kaum noch zu tasten.
"Fünfzig zu dreißig", bellte Zühlke den bedrohlich niedrigen Blutdruckwert heraus.
Auf dem Tisch stand eine halbvolle Weinflasche, mehrere leere Tablettenröhrchen lagen daneben und ein Abschiedsbrief.
In kürzester Zeit legte Alexandra Infusionen an und intubierte die Frau. Jupp Friederichs schloss einen schwarzen, ovalen Plastikball an den Schlauch an, der nun aus dem Hals der Frau ragte und begann ihn mit rhythmischen Bewegungen zusammenzupressen. Der Brustkorb der Bewusstlosen hob und senkte sich.
"Wie lange, glauben Sie, hat sie hier schon gelegen?", wandte Alexandra sich an die Haushälterin.
Die zuckte traurig mit den Schultern.
"Wenn ich das wüsste", schluchzte sie, "ich hab' sie gestern am Spätnachmittag zuletzt gesehen. Ihr Mann ist auf einem Kongress. Er ist Gynäkologe."
Alexandra presste die Lippen zusammen. Im schlimmsten Fall war es also schon fünfzehn Stunden her, dass die Frau die Tabletten genommen hatte. Alexandra nahm eines der leeren Röhrchen - ein besonders giftiges Zeug.
Weniger als zehn Minuten später schoben sie die Bewusstlose auf die Intensivstation. Dr. Lars Remmers und sein Team pumpten ihr den Magen aus. Es fanden sich so gut wie keine Tablettenreste mehr im Mageninhalt.
"Sieht nicht gut aus", erklärte der Internist, als Alexandra später mit ihm telefonierte, "neunzig zu zehn, dass sie es geschafft hat."
"Geschafft hat?" Alexandra verstand nicht gleich.
"Sich umzubringen."
Alexandra legte auf und erzählte ihren Sanitätern von der niederschmetternden Prognose. Bedrücktes Schweigen breitete sich im Bereitschaftszimmer aus. Zühlke brütete düster vor sich hin. Friederichs verschwand irgendwann in Richtung Notarztwagen. Er wollte angeblich Material auffüllen. Alexandra erinnerte sich, dass er das vorgestern erst getan hatte. Sie selbst fuhr mit dem Aufzug in den dritten Stock.
Vor der internistischen Station begegnete ihr ein eleganter Herr in Schlips und Kragen. Alexandra hielt ihn im ersten Moment für einen Besucher. Erst auf den zweiten Blick erkannte sie Silvio DaCosta. Sie begrüßten sich.
"Gehen Sie wieder nach Hause, Herr DaCosta?", erkundigte sie sich. Sie war es gewohnt, dass Patienten, die nicht im Morgenmantel oder Jogginganzug herumliefen, entweder gerade gekommen waren, oder kurz vor der Entlassung standen.
"Oh - das wäre schön!", rief DaCosta aus. "Bin schon viel zu lange hier, vier Tage! Nein, Frau Doktor, ich komme von Darmspiegelung. Sie wissen: Lange Schlauch und dann ...", er machte eine eindeutige Handbewegung in Richtung seines Gesäßes, "schlimm, sag' ich Ihnen, mach' ich nie mehr."
Alexandra hörte sich seine wortreichen Klagen über zahllose Untersuchen an, die er in den letzten Tagen über sich ergehen lassen musste. Alexandra wurde nicht recht schlau daraus.
Kurz darauf klopfte sie bei Lore Keller, der internistischen Oberärztin. Sie saß mit ihrem Diktiergerät am Schreibtisch. Alexandra ließ sich in einen freien Sessel fallen und seufzte: "Ich hatte gerade eine scheußlich Fahrt." Dann machte sie ihrem Herzen Luft. "So eine junge Frau, einunddreißig Jahre alt, und wirft einfach ihr Leben weg."
"Nun - du kennst nicht die Hintergründe", gab Lore Keller zu bedenken, "vielleicht hatte sie Depressionen, oder irgendetwas anderes hat ihr das Leben zur Hölle gemacht."
"Aber es gibt doch andere Möglichkeiten, vor einer Hölle davonzulaufen, als den Tod."
"Wenn man jemanden in der Nähe hat, der einem diese anderen Möglichkeiten zeigt, dann schon."
Sie schwiegen eine Zeitlang.
"Was ist denn mit dem charmanten italienischen Feinkosthändler, den ich Anfang der Woche gebracht habe?" Alexandra wechselte das Thema.
"Herr DaCosta?" Ein Schatten huschte über Lores Gesicht. "Sieht nicht gut aus. Wir haben ihn gründlich untersucht, und das Ergebnis macht mir großen Kummer."
"Krebs?", fragte Alexandra erschrocken.
Die Oberärztin nickte.
"Ein großer Tumor im Rektum. Unter Umständen muss der Enddarm amputiert werden. Ich will die Befunde heute noch den Chirurgen vorstellen."
"Er machte vorhin, als ich ihn traf, nicht den Eindruck, als wüsste er das bereits."
"Tut er auch nicht." Lore Keller stand seufzend auf. "Heute Nachmittag, wenn seine Frau kommt, werde ich den beiden die Diagnose mitteilen."
"Ich möchte nicht in deiner Haut stecken", bedauerte Alexandra ihre Freundin.
"Schade", sagte Lore und lächelte müde, "ich wollte dich schon fragen, ob du das nicht übernehmen willst."
7
Sie fuhren durch die ganze Bundesrepublik in Richtung Süden. Über München und Österreich bis nach Italien. In Genua wurde ein Teil der Ladung gelöscht und auf eine Fähre nach Griechenland verladen. Jedes Mal, wenn Rüdiger Borchert im Fährhafen von Genua war, nahm er sich vor, in irgendeinem Urlaub hier zuzusteigen und nach Griechenland zu fahren. Und von dort weiter in den Nahen Osten. Eine unbestimmte Sehnsucht zog ihn. Nach vier Tagen - es war ein Freitag - erreichten sie ihren Zielort: Rom. Während ihr Sattelschlepper in der Partnerspedition neu beladen wurde, hatten Fred und Rüdiger ein paar Stunden frei. Mit dem Taxi fuhren sie in die Innenstadt. An einer Kreuzung zwinkerten sie sich zu - sie trennten sich. Beide gingen zielstrebig in verschiedene Richtungen.
Rüdiger schlenderte erst einmal eine halbe Stunde durch enge Gassen. Er bildete sich etwas ein auf seinen Orientierungssinn, aber jedes Mal, wenn er in diesem Teil Roms unterwegs war - das kam etwas drei bis vier Mal im Jahr vor - hatte er Mühe, die kleine Reinigung wiederzufinden. Und umso größer war jedes Mal die Erregung, die ihn befiel, wenn er dann endlich vor der Tür stand, von deren Holz die grüne Farbe herunter blätterte. Rüdiger kannte diese Tür gar nicht anders.
Er spähte durch das Schaufenster. Angelina stand hinter dem Tresen. Sie war allein. Er klopfte und winkte ihr zu. Sekunden später riss eine kleine Frau mit einer widerspenstigen, schwarzen Mähne die Ladentür auf und zog ihn an dem Tresen vorbei ins Hinterzimmer. Eine Flut von Worten ergoss sich über Rüdiger. Sie klangen erstaunt, gerührt, fröhlich, aber er verstand nicht mal zehn Prozent davon. Nur, dass Angelina sich freute, ihn wiederzusehen, das verstand er. Aber das hätte er auch ohne Worte verstanden. Er zog sie an sich und küsste sie.
Angelina hängte ein Schild ins Schaufenster und schloss die Tür ab. Sie gingen nach oben in ihre kleine Wohnung. Für zwei Stunden vergaß Rüdiger seinen Brummi, seine Arbeit, vergaß er die ganze Welt.
Später, unterwegs durch die engen Gassen und auf der Suche nach einem Taxi, befiehl ihn, wie immer nach solchen Stunden, eine tiefe Schwermut. Nein - er liebte Angelina nicht. Und er wusste, dass auch sie ihn nicht liebte. Es war nicht mehr, als eine lose Freundschaft zwischen ihnen. Eine Freundschaft, die sich bei ihren seltenen Treffen für Augenblicke zu rauschhafter Leidenschaft steigerte. Angelinas Reinigung in Rom war nicht die einzige Adresse, die Rüdiger bei seinen Fahrten durch Europa aufsuchte, um für eine paar Augenblicke sich selbst in den Armen einer Frau zu vergessen. Aber jedes Mal danach, wenn eine dieser Türen sich hinter ihm schloss, sprang ihn seine Einsamkeit umso schmerzlicher an.
Gegen Abend brachen sie auf und fuhren wieder Richtung Norden. Stundenlang saß Rüdiger am Steuer und brütete schweigend vor sich hin. Er dachte an Angelina, er dachte an die anderen Frauen, die er flüchtig kannte, und das Gefühl, nirgendwo hinzugehören, zog seine Stimmung tief in den Keller. Der Ponyhof seiner Eltern fiel ihm ein, und etwas wie Heimweh schmerzte in seiner Brust.
"He Kumpel, was ist los?" Fred hatte den Vorhang vor der Koje, in der er lag, aufgezogen, und schlug Rüdiger auf die Schulter. "Irgendjemand gestorben, oder was?"
"Alles bestens, alles bestens", murmelte Rüdiger.
"Na also, dann mach' nicht so ein Gesicht." Fred stieg aus der Koje und beugte sich zum Radio. "Komm, wir machen ein bisschen Musik, das hebt die Stimmung."
In solchen Augenblicken tat ihm der fast zehn Jahre jüngere Fred gut. Er setzte sich neben ihn und plauderte munter drauf los. Als sie viele Stunden später in einen Rasthof zwischen Klagenfurt und Villach einbogen, hatte Rüdiger seine trübsinnigen Gedanken längst wieder vergessen.
Im Restaurant des Rasthofs trafen sie ein paar Kollegen - Fernfahrer aus Wien, Hamburg und Dresden. Einer von ihnen legte ein Skatblatt auf den Tisch, und Rüdiger fand sein Leben rundherum in Ordnung.
8
Nach Dienstschluss legte sich Ewald Zühlke erst einmal zwei Stunden aufs Ohr. Der Tag hatte ihn ziemlich geschlaucht, viel mehr als sonst. Danach erledigte er seine Hausarbeit: Blumen gießen, Geschirr spülen, Saugen - heute war das Schlafzimmer dran. Seine Frau hatte ihm einen genauen Wochenplan aufgeschrieben, bevor sie in die Kur fuhr. Jeden Tag nach Dienstschluss sah er auf den Zettel und arbeitete genau das ab, was sie ihm für den jeweiligen Wochentag aufgeschrieben hatte. Am Abend, wenn sie miteinander telefonierten, würde sie ihn danach fragen. Darauf konnte er verlassen. Ein Glück nur, dass er in dieser Woche nicht auch noch kochen musste. Seine Tochter Irmgard war für zehn Tage mit ihrer Klasse in einem Landschulheim.
Am frühen Abend - die Glotze zog ihn heute nicht besonders an - machte er sich auf den Weg in seine Stammkneipe. So oft, wie in den letzten beiden Wochen, war er das ganze Jahr noch nicht im ,Fässchen‘ gewesen. Aber schließlich fuhr seine Frau auch nicht jeden Tag in die Kur. Zühlke hatte sich vorgenommen, das Beste aus dieser Abwechslung zu machen.
Es war erst kurz vor sechs, und nur eine Handvoll Gäste saßen an den Tischen. Zühlke nahm an der Theke Platz.
"Ein Bier, Sonia."
Die Wirtin nickte ihm zu und griff nach einem leeren Glas. Zühlke beobachtete sie, während sie sich am Zapfhahn zu schaffen machte. Ihre Augen waren leicht gerötet, als hätte sie vor kurzem erst geweint. Zühlke fiel auf, dass Sonia heute dick Schminke aufgetragen hatte. Nur dürftig kaschierte das Make-up den bläulichen Fleck um ihr rechtes Auge. Zühlke guckte sich nach ihrem Mann um. Es war nicht das erste Mal, dass man die junge Frau mit einem blauen Fleck hinter der Theke stehen sah. Olaf Schwanner war nirgends zu sehen.
Sonia stellte das Bier vor ihren Gast. "Zum Wohl."
"Danke", er nahm einen Schluck, ohne sie aus den Augen zu lassen. Dann überwand er seine Hemmung und sprach sie an: "Hast du dir wehgetan, Sonia?"
Sie nickte und verzog ihr Gesicht zu einem krampfhaften Lächeln.
"Ich habe mich gestoßen."
"An der Faust deines Mannes?"
Sonia wurde blass, wich Zühlkes Blick aus und verfiel in hektische Betriebsamkeit. Die Antwort blieb sie ihm schuldig.
Grübelnd saß Zühlke vor seinem Glas. Die Gerüchte, die man sich über die Schwanners erzählte, gingen ihm durch den Kopf. Der Fässchen-Wirt galt als notorischer Säufer. Natürlich nannte das niemand so. ,Er trinkt gern ein Gläschen zu viel‘ - so hieß das bei den meisten Gästen. Was das im Klartext bedeutete, hatte Zühlke schon oft studieren können. Je später der Abend wurde, desto seltener hob Schwanner seinen gedrungenen Zweizentnerleib von der Sitzbank am Stammtisch. Und wenn er es doch tat, weil Gäste an der Theke warteten und seine Frau kaum noch wusste, wo ihr der Kopf stand vor lauter Arbeit, dann schwankte er wie ein alter Tanzbär.
Im Grunde wusste jeder, wie er mit seiner Frau umsprang. Nicht nur durch die blauen Flecken, die man hin und wieder in ihrem Gesicht entdecken konnte. Oft genug zischte er sie unfreundlich an, und Zühlke hatte auch schon beobachtet, wie er sie hinter der Theke grob anpackte. Wahrscheinlich ging er mit den Kindern genauso um. Zühlke kannte ehemalige Gäste, die wegen dieses widerlichen Kerls die Kneipe nicht mehr betraten.
Er dachte an die junge Frau, die sie heute Morgen halb tot ins Marien-Krankenhaus gebracht hatten. Wer weiß, was sie alles mitgemacht hatte, bevor sie im Selbstmord Zuflucht gesucht hatte. Plötzlich tat ihm Sonia leid. Er überlegte, wie man ihr helfen konnte. Und dann hatte er eine Idee.
Er wartete bis Sonia von einem Gästetisch zurück hinter die Theke kam. Sie begann Gläser zu spülen.
"Olaf heute nicht da?", begann er.
"Hat sich hingelegt." Mit ihrer kurzangebundenen Art signalisierte sie, dass sie über nichts Persönliches sprechen wollte. Ewald Zühlke ließ sich davon nicht abschrecken.
"Auf Deutsch: Er schläft schon seinen ersten Rausch aus", sagte er. Sonia antwortete nicht. "Ich habe Nachbarn, da hat der Mann die Frau jahrelang geprügelt", erzählte er wie beiläufig, "er war Alkoholiker, verstehste?" Sie reagierte nicht, sondern blickte starr auf die Gläser, die sie spülte. "Irgendwann ist die Frau zu einer Beratungsstelle gegangen", fuhr Zühlke fort, "so eine kirchliche Einrichtung - extra für Frauen. Die Adresse hatte sie von meiner Chefin, die kennt sich mit sowas aus." Er trank einen Schluck und beobachtete sie. Es kam ihm vor, als würde sie die Gläser nicht mehr ganz so hektisch spülen wie noch vor wenigen Sekunden. Zwar schaute sie ihn nicht an, aber sie schien zumindest zuzuhören.
"Später hat sie ihm gedroht, wegzulaufen, wenn er nicht aufhört zu saufen", erzählte Zühlke weiter. "Er hat zwar eine Entziehungskur gemacht, hat aber nichts genützt, die ganze Scheiße ging von vorne los. Schließlich hat sie sich scheiden lassen." Sonia ließ die Gläser sinken und sah Zühlke aus ihren dickgeschminkten, grünen Augen an. "Tja, Sonia, so war das. Ohne fremde Hilfe hätte sie das nicht geschafft. Und du schaffst es auch nicht mehr ohne Hilfe, hängst schon zu tief drin." Abrupt wandte sie sich ab. Schneller als sonst kam sie hinter der Theke vor und verschwand zwischen den Tischen.
Mit hochgezogenen Augenbrauen sah Zühlke ihr nach.
Schöne Frau eigentlich, dachte er, schade um sie, wirklich schade. Er trank sein Glas aus und holte einen Stift heraus. Auf seinen Bierdeckel schrieb er eine Adresse.
"Zahlen, Sonia", rief er ihr zu.
Sie kam zur Theke zurück und nahm seinen Bierdeckel um die Striche zu zählen. Misstrauisch sah sie ihn an, als sie die Adresse entdeckte.
"Das ist die Adresse von dieser Beratungsstelle", sagte er und kramte seine Brieftasche heraus, "Telefonnummer findste im Telefonbuch." Er zahlte. "Vielleicht biste dir ja doch zu schade für diese Scheiße." An der Tür drehte Zühlke sich noch einmal um. Sie stand immer noch an der Theke, den Bierdeckel mit der Adresse in der Hand. Plötzlich huschte ein scheues Lächeln über ihr mädchenhaftes Gesicht. Sie nickte ihm zu und ließ den Bierdeckel in die Tasche ihrer Servierschürze fallen.
9
Sigrid DaCosta öffnete die Tür zum Zimmer 312 der internistischen Station. Ihr Mann stand auf dem Balkon und sah in den Krankenhausgarten hinab. Der Patient im zweiten Bett des Zimmers schnarchte laut.
"Silvio", flüsterte Sigrid. Er drehte sich um. Seine trübsinnige Miene erhellte sich, mit offenen Armen kam er auf sie zu und küsste sie.
"Sigrid, endlich! Ich sterbe vor Langeweile!" Sie setzten sich auf den Balkon, und Silvio überschüttete sie mit tausend Fragen. "Wie geht es im Laden, kommt ihr zurecht? Was macht mein kleiner Tonio? Wie geht es Lisa und Antonia?" Nach sämtlichen Familienmitgliedern erkundigte er sich: nach den zwei ältesten Söhnen Dieter und Lothar, die Sigrid mit in die Ehe gebracht hatte genauso wie nach den drei Kindern, die sie gemeinsam hatten - nach Giovanni, Lisa und Antonia. Und natürlich nach seinen sieben Enkelkindern, in die er rettungslos vernarrt war.
Sigrid musste ihm alles haarklein erzählen.
"Sie kommen dich alle am Wochenende besuchen und bringen die Kinder mit. Und um den Laden brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Dein Giovanni und ich, wir kommen schon zurecht. Du musst jetzt erst mal gesund werden."
"Gesund werden!" Silvio hob unwillig beide Arme über den Kopf. "Ich bin gesund! Oder fast gesund. Nach Hause will ich, weiter nichts!"
"Was sagen denn die Ärzte?", erkundigte sich Sigrid vorsichtig. Auch wenn sie es vor ihrem Mann und ihrer Familie nicht zugab - insgeheim nagte doch die Sorge um Silvio an ihr.
"Was die sagen? Gar nichts sagen die!", schimpfte er. "Weil es nichts zu sagen gibt, weil sie nichts finden. Und trotzdem lassen sie mich nicht nach Hause gehen."
Hinter sich hörten sie die schwere Zimmertür scharren. Sie drehten sich fast gleichzeitig um und sahen die Oberärztin im Türrahmen stehen.
"Kann ich Sie mal sprechen?", flüsterte sie. Sie warf einen Blick auf Silvios schlafenden Zimmernachbarn. "Am besten gehen wir in mein Büro."
Sigrid und Silvio folgten ihr über den Stationsgang in ihr Arztzimmer. Sigrids Herz schlug plötzlich aufgeregt, und sie merkte, dass sie weiche Knie hatte.
"Wann kann ich endlich nach Hause, Frau Dr. Keller?", rief Silvio noch bevor er Platz genommen hatte.
"Darüber wollte ich mit Ihnen reden, Herr DaCosta", begann Lore Keller, und irgendetwas in ihrer Stimme alarmierte Sigrid. Sie wurde blass und saß kerzengerade neben Silvio auf ihrem Sessel.
"Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden", sagte die Oberärztin, "ich habe schlechte Nachrichten für Sie beide." Sigrid beobachtete aus den Augenwinkeln wie Silvio in sich zusammensank. Sie nahm seine Hand. "Wir haben einen Tumor in ihrem Dickdarm gefunden, Herr DaCosta. Die Untersuchungsergebnisse lassen keinen Zweifel zu."
Für einige Sekunden herrschte bleiernes Schweigen im Arztzimmer. Sigrid spürte, wie sich Silvios Hand verkrampfte.
"Krebs?", flüsterte sie.
Lore Keller nickte.
"Ja. Aber jetzt verlieren sie bitte nicht den Mut. Ich nenne ihnen die Diagnose so unumwunden, nicht damit sie die Hoffnung sinken lassen, sondern weil wir Hoffnung haben, Sie zu heilen. Sie müssen so schnell wie möglich operiert werden."
"Wann?" Silvios Stimme war nur noch ein heiseres Krächzen. Seine Ungeduld in den letzten Tagen, seine launigen Bemerkungen, das ständige Drängen nach Entlassung - damit hatte er nur seine Angst überspielt. Sigrid kannte ihren Mann in und auswendig. Sie hatte sich nichts vorgemacht.
"Ende nächster Woche", erklärte die Oberärztin, "gleich am Montag werden wir sie auf die chirurgische Station verlegen und sie auf die Operation vorbereiten."
Später saßen sie schweigend auf dem Balkon. Am Horizont schoben sich dunkle Wolken zusammen. Die Luft war schwül. Das erste Gewitter des Jahres kündigte sich an. Sigrid hielt Silvios Hand umklammert. Er war blass, und Tränen liefen ihm über seine Wangen. Auch Sigrid weinte.
"Ich hab' Angst, Sigrid", flüsterte Silvio, "solche Angst hab' ich."
"Was glaubst du, wie es mir geht?"
"Ich muss sterben", seine Stimme zitterte, "ganz sicher muss ich sterben ..."
"Den Teufel musst du!", fuhr Sigrid ihn an. Sie riss ihre Hand von ihm los und funkelte ihn an. "Ich will das nicht mehr von dir hören. Wir stehen das durch, hast du das verstanden?!"
10
Müde ging Tabea am Samstagmorgen die Treppe zur Haustür hinunter. Sie bückte sich nach der Zeitung und klopfte dann an Kathrins Tür.
"Aufwachen, du wolltest um neun Uhr aufstehen!"
Hinter der Tür hörte sie das Bett knarren. Dann ein herzhaftes Gähnen.
"Ist es denn schon so spät?"
"Kurz vor neun." In der Zeitung blätternd bewegte sich Tabea langsam die Treppe hoch. "Soll ich für drei decken?"
"Nein", hörte sie Kathrin rufen, "ich bin allein."
Tabea bereitete das Frühstück vor und wartete auf ihre Tochter. Sie liebte diese gemeinsamen Morgen mit ihr. Seit Dirk so viel unterwegs war und seit dem Auszug von Friedemann hatten Kathrin und Tabea sich wieder angenähert. Es hatte auch lang genug gedauert. Die Jahre während Kathrins Pubertät hatten sie sich ständig aneinander gerieben.
Kathrin kam die Treppe hoch, stellte ihre Tasche - den ausrangierten Aktenkoffer ihres Vaters - neben den Tisch und schmierte sich ein Brot.
"Und - ist Pa gut gelandet in Florenz?"
Tabea zuckte gleichgültig mit den Schultern.
"Das nehme ich stark an, wenn irgendwas passiert wäre, hätte er sicher schon angerufen."
Kathrin beobachtete sie neugierig.
"Entschuldige, Ma, ich will mich nicht in eure Angelegenheiten mischen - aber eure Ehe scheint ja der reinste Honeymoon zu sein."
Überrascht sah Tabea ihre Tochter an. Es war das erste Mal, dass sie sich zu ihrer und Dirks Beziehung äußerte. Tabea hatte es immer vermieden, mit ihren Kindern darüber zu sprechen.
"Wie meinst du das?"
"Na ja - Pa kommt und geht und benimmt sich eher wie ein Gast, wenn er da ist. Früher rief er immer gleich an, wenn er verreist war. Jetzt scheint es dir völlig gleichgültig zu sein, wo er steckt. Du vermisst nicht mal ein Lebenszeichen von ihm."
Tabea rührte nachdenklich in ihrem Kaffee herum.
"Hast schon recht - unsere Beziehung ist ein wenig abgekühlt in letzter Zeit. Aber das gibt sich wieder ..."
",Ein wenig abgekühlt‘ - das ich nicht lache! Ihr seid euch gleichgültig, das ist die Wahrheit!" Herausfordernd sah Kathrin ihre Mutter an. Tabea antwortete nicht, immer noch rührte sie in ihrem Kaffee herum. "Ist gut, Ma, entschuldige, wenn ich mich in deine Angelegenheiten einmische. Ich glaub', es ist besser, wir wechseln das Thema."
"Ja, vielleicht hast du recht", sagte Tabea, "wann ist deine Matheprüfung?"
"Am kommenden Freitag. Deswegen muss ich auch das ganze Wochenende über lernen."
"Bei wem?"
"Bei Michael." Tabea runzelte fragend die Stirn. "Michael ist eine Mathestudent. Ich habe ihn durch Georg kennengelernt. Er trainiert mich in Mathe. Das ist eine wahre Pracht, da kann überhaupt nichts mehr schiefgehen."
"Na, hoffen wir das Beste", sagte Tabea nachdenklich. Die Art, wie ihre Tochter diesen allerneusten Männernamen aussprach, erregte ihren Verdacht. "Ist es schon wieder aus mit Georg?"
"Nö, wie kommst du denn darauf?"
"Ich dachte nur. Wann kommst du nach Hause?"
Kathrin sah auf ihre Armbanduhr und stand auf.
"Gar nicht, ich übernachte auswärts."
"Bei Georg?"
"Nein, bei Michael."
Empört stellte Tabea ihre Tasse ab.
"Also Kathrin - wirklich! Sag mal, schämst du dich überhaupt nicht?"
"Wofür denn? Es ist doch noch gar nichts passiert!" Sie gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Stirn. "Und vielleicht passiert auch nichts. Mach' dir keine Gedanken, Ma!"
",Vielleicht passiert auch nichts!‘" Tabea wurde laut. "Du hast es doch darauf angelegt! Sag mal - hast du schon mal was von Treue gehört?!"
"Jetzt fang nicht schon wieder mit diesem moralischen Mist an!", zeterte Kathrin. "Ich kann's bald nicht mehr hören!"
"Und ich kann's bald nicht mehr ertragen, dass meine Tochter sich wie ein Flittchen benimmt!"
Nun gab es kein Halten mehr. Beide ließen ihrem Zorn freien Lauf. Ein Wort gab das andere. Wie zwei angriffsbereite Katzen standen sie sich gegenüber und gifteten sich an.
"Ich bin fast zwanzig Jahre alt und entscheide ganz allein, wie ich mein Leben gestalte!", schrie Kathrin. "Das musst du ein für alle Mal kapieren!"
"Du bist immer noch meine Tochter! Und solange wir unter einem Dach wohnen, wirst du dir meine Meinung über deinen Lebensstil gefälligst anhören!"
"Spar dir deine Worte für Wichtigeres auf! Ich mach' was ich will! Glaubst du, ich habe Lust in zwanzig Jahren so zu leben wie du?"
Tabea erschrak.
"Wie meinst du das?"
"Glaubst du, ich seh' nicht, was mit dir los ist? Sitzt hier in dem großen Haus und langweilst dich und hast dich an den Frust mit Pa gewöhnt. Mach' dir lieber mal darüber Gedanken!"
"Wieso?" Der überraschende Angriff machte Tabea wehrlos.
"Wieso!", äffte Kathrin sie nach. "Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Pa an so einem Wochenende in Florenz, Madrid oder weiß Gott wo, weiter nichts tut, als von morgens bis abends in irgendwelchen Banken irgendwelche Computerprogramme zu installieren und zu warten?!"
"Sondern?" Tabea erschrak vor ihrer eigenen Stimme. Sie klang plötzlich belegt.
Kathrin wich ihrem Blick aus. Ihre zornigen Gesichtszüge entspannten sich plötzlich. Sie nahm ihre Tasche und ging auf die Treppe zu. "Ich muss jetzt zu Michael."
"Sondern?!", wiederholte Tabea. Diesmal nachdrücklicher.
Kathrin blieb auf der obersten Stufe stehen. Langsam drehte sie sich um.
"Ma, bitte, lass jetzt gut sein - ich bin zu weit gegangen ..."
"Ich will eine Antwort!", beharrte Tabea. "Jetzt!"
Kathrin ließ seufzend ihre Schultern sinken. Dann öffnete sie ihren Aktenkoffer und holte ein kleines, rotes Päckchen heraus, nicht viel größer als eine Schachtel Streichhölzer. Sie ging an Tabea vorbei und warf es auf den Küchentisch.
"Das habe ich in Pa‘s altem Aktenkoffer gefunden."
Stumm starrte Tabea das Päckchen an. Es war eine Packung Präservative. Kathrin strich ihr zärtlich über das Haar.
"Oder nimmst du seit neuestem die Pille?"
11
Die Kullmanns waren es gewohnt, dass sich ihre Nachbarn zu fast jeder Tages- und Nachtzeit geräuschvoll bemerkbar machten. Sie hätten sich wohl eher Sorgen gemacht, wenn man von drüben, also von der Wohnung, die an ihre Küchenwand angrenzte, mal einige Stunden lang gar nichts gehört hätte: kein Kindergeschrei, kein Türenschlagen, kein Gebrüll einer tiefen Männerstimme.
Heute aber, ab Samstagnachmittag, wollte all dieser Lärm gar nicht mehr aufhören. Und diesmal mischte sich das Durcheinander von Kindergeschrei, Männergebrüll und Türenschlagen ein eher ungewohntes Geräusch: das laute Weinen einer Frauenstimme.
"Dieser verdammte Mistkerl!", zischte der alte Erich Kullmann. "Die arme Frau so zu prügeln!"
Gerda Kullmann warf einen Blick auf die Wanduhr. Es war schon nach vier, und sie war gerade damit beschäftigt, den Kaffeetisch abzuräumen. "Die sollen endlich mal in ihre Kneipe verschwinden, dass es wieder Ruhe gibt da drüben."
"Ja, komisch", wunderte sich ihr Mann, "samstags machen sie doch gewöhnlich schon um drei auf."
"Wahrscheinlich ist dieser Scheißkerl mal wieder stinkbesoffen." Gerda Kullmann blieb mit dem Tablett in der Hand stehen und lauschte. Wieder das Gebrüll des Mannes. Deutlich waren ein paar üble Schimpfworte zu verstehen. Dann donnerte etwas hart gegen die Wand und eine Frauenstimme schrie auf.
"Jetzt reicht's", brummte der alte Kullmann und stand auf, "da darf man nicht untätig zugucken!" Er ging zur Tür.
"Misch' dich nicht ein, Erich!", rief ihm seine Frau erschrocken zu. "Der Schwanner wird dir an die Gurgel gehen!"
"Dann haben wir wenigstens einen Grund, die Polizei zu holen!" Schon war er im Treppenhaus. Er klingelte Sturm bei den Schwanners. Der Lärm hinter der Tür ebbte ab. Bald näherten sich Schritte. Die Tür wurde aufgerissen.
"Was is' los?!" Olaf Schwanners Gesicht war stark gerötet. Er stank nach Schnaps. Im Hintergrund sah Kullmann die verstörten Gesichter der beiden Kinder hinter einem Türrahmen hervorschauen. Die Frau sah er nicht.
"Sie veranstalten einen Höllenlärm und fragen was los ist!?" Kullmann musterte den Fässchen-Wirt wütend. "Sie führen sich auf wie ein Schwein, Mann! Wenn so etwas noch einmal vorkommt, werden wir die Polizei rufen, verlassen Sie sich darauf!"
"Ist schon gut!", versuchte Schwanner abzuwiegeln. "War nur ein kleiner Streit, weiter nichts. Kommt doch mal vor." Er schloss die Tür.
Unschlüssig zog sich Kullmann zu seiner offenen Wohnungstür zurück. Seine Frau stand neugierig im Türrahmen. "Und? Hast du seine Frau gesehen?"
Erich Kullmann zuckte mit den Schultern.
"Eben nicht. Hoffentlich hat er ihr nicht ..." Er unterbrach sich.
"Hoffentlich hat er ihr nicht was?", drängte seine Frau.
"Den Schädel eingeschlagen."
In dem Moment ging die gegenüberliegende Wohnungstür wieder auf. Sonia Schwanner kam heraus. Sie trug ihr Servierschürzchen. Unter ihren geröteten Augen lagen dunkle Ringe. Ihre Unterlippe war geschwollen. Sie zwang sich zu einem scheuen Lächeln und nickte grüßend. Hastig wollte sie an den Kullmanns vorbei die Treppe hinuntergehen. Erich Kullmann hielt sie am Arm fest.
"Hat er sie wieder geschlagen?"
Augenblicklich brach Sonias lächelnde Fassade zusammen, und Tränen liefen ihr über das Gesicht.
"Kindchen", Gerda Kullmann kam heraus und legte den Arm um die junge Frau, "so kann es doch nicht weiter gehen!"
Sonia schüttelte stumm den Kopf und setzte ihren Weg nach unten in die Gaststube fort. Die Kullmanns sahen ihr nach. Sorgenfalten standen auf ihren Stirnen, und betreten schauten sie sich an, als sie unten die Tür zum Gastraum zuschlagen hörten. Erich Kullmann hob die Arme und ließ sie resignierend sinken.
Unten im Gastraum der Schankkneipe setzte sich Sonia Schwanner erst einmal auf einen Stuhl und weinte sich aus. Sie tastete in ihrer Schürzentasche nach einem Taschentuch - und zog den Bierdeckel heraus, auf den Ewald Zühlke ihr die Adresse jener Beratungsstelle aufgeschrieben hatte. Sie hatte ihn aufgehoben und jedes Mal, wenn sie die Schürze gewechselt hatte, auch diesen Bierdeckel in die frische Schürze gesteckt.
Sie stand auf, ging zum Telefon und suchte die Nummer aus dem Telefonbuch heraus. Enttäuscht hörte sie wenig später die Stimme eines Anrufbeantworters. Natürlich - heute war ja Samstag. Sie wählte die Nummer ein zweites Mal und schrieb die Bürozeiten der Beratungsstelle auf die Rückseite des Bierdeckels: montags, mittwochs und freitags von acht bis zwölf Uhr. Am Montag, wenn sie die Kinder im Kindergarten abgeliefert hatte, würde sie einfach vorbeigehen.
Als die diesen Entschluss gefaßt hatte, war ihr ein wenig leichter. Sie ging in die Toilette und machte sich vor dem Spiegel zurecht. Eine Stunde später als sonst samstags öffnete sie das ,Fässchen‘.
12
Tabea wunderte sich selbst, wie kühl sie blieb. Da lag diese kleine rote Schachtel vor ihr auf dem Tisch, und in ihr regte sich weiter nichts als ein fast kindliches Staunen. Das also war die Wahrheit. Die ganzen letzten Jahre ihrer Ehe mit Dirk hatte sie im Raum gehangen wie eine graue, schwere Wolke, hatte ihre Gespräche nichtssagend und oberflächlich werden lassen, hatte ihren Sex zu einer langweiligen und mechanischen Gewohnheit und ihr gemeinsames Leben zu einer bloßen Zweckgemeinschaft verkommen lassen. Tabea hatte es nie wahrhaben wollen. Krampfhaft hatte sie an ihrem Eheideal festgehalten und weggesehen von der Wirklichkeit. Jetzt hatte ihre eigene Tochter es ausgesprochen: ,Ihr seid euch gleichgültig‘ ... Jetzt lag sie vor ihr auf dem Tisch, die Wahrheit: eine Fünferpackung ,London gefühlsaktiv‘ ...
Tabea fühlte sich fast erleichtert. Sie öffnete die kleine Schachtel - zwei Kondome waren noch darin. In Romanen hatte sie von Frauen gelesen, die von jetzt auf nun mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass ihre Männer sie betrogen. In Filmen hatte sie solche Frauen gesehen. In der Beratungsstelle hatte sie solchen Frauen gegenübergesessen. Nach allem, was sie wusste, pflegten Frauen in dieser Situation hysterisch zu reagieren, Gläser und Teller gegen die Wand zu werfen, zu weinen und zu schreien. Manche - und sie kannte solche Frauen - griffen sogar zu Schlaftabletten oder Rasierklingen.
Tabea verspürte lediglich eine bleierne Müdigkeit. Und das merkwürdige Bedürfnis nach oben ins Schlafzimmer zu gehen und sich im Spiegel anzuschauen. Das tat sie auch. Sie stellte sich vor ihren Garderobenspiegel und betrachtete ihr zweiundvierzigjähriges Gesicht. Und begann zu lachen. "Du bist so dumm gewesen, Tabea", lachte sie sich aus, "so dumm."
Fast eine halbe Stunde stand sie vor dem Spiegel. Dann erinnerte sie sich daran, dass sie heute mit einer Freundin zum Einkaufsbummel verabredet war. Sie telefonierte mit ihr und sagte ab.
"Mir ist etwas Wichtiges dazwischengekommen", redete sie sich heraus. Als sie auflegte, sah sie die kleine, rote Schachtel auf dem Tisch liegen und musste wieder lachen. "Mir ist eine Kleinigkeit dazwischen gekommen ..."
Sie nahm eine Jacke und verließ das Haus. Durch den Garten ging sie über das angrenzende Feld in den Wald. Stundenlang lief sie über die Waldwege, bis in den Nachmittag hinein. Lief und dachte nach. Über Dirk, über ihre Ehe, und vor allem über sich selbst.
Hatte sie sich nicht träge und zufrieden hängen lassen in den letzten sieben Jahren? Hineinfallen lassen in das schöne Netz aus Wohlstand, Sicherheit, Bürgerlichkeit und Ruhe, das ihr Dirk durch seine berufliche Karriere geknüpft hatte? Hatte sie ihre Kreativität nicht abspeisen lassen durch drei halbe Tage in einer Beratungsstelle, wo ihr hilflose Frauen das lächerliche Gefühl gaben, gebraucht zu werden? Hatte sie so nicht selbst dazu beigetragen, für Dirk langweilig und unattraktiv zu werden?
Kritisch ging sie mit sich selbst ins Gericht. Natürlich trug Dirk genauso viel Verantwortung für den Zustand ihrer Beziehung wie sie. Aber das war sein Problem. Tabea hatte das Gefühl, erst einmal vor ihrer eigenen Haustür kehren zu müssen. Ihr Standardsatz aus vielen Beratungsgesprächen fiel ihr ein: Es wird langsam Zeit für Sie, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen ...
"Ja", sagte sie zu sich selbst, "es wird Zeit, höchste Zeit."
Irgendwann schaute sie auf die Uhr und stellte überrascht fest, dass es schon nach drei war. Sie hatte die Zeit vollkommen vergessen. Ihre Beine waren schwer, als sie wieder bei ihrem Haus ankam. Doch innerlich fühlte sie sich wie gereinigt.
Auf den Stufen vor der Haustür saß Georg, Kathrins Freund.
"Ich warte auf Kata", er stand auf und begrüßte sie lächelnd. "Wir waren für drei Uhr verabredet."
"Pünktlichkeit war noch nie die Stärke meiner Tochter." Tabea schloss die Haustür auf. "Kommen Sie herein, ich mach' uns einen Kaffee."
Er folgte ihr die Treppe hoch. Auf dem Küchentisch lag immer noch das rote Päckchen ,London gefühlsaktiv‘. Tabea legte es in das oberste Fach des Küchenregals. Während sie die Kaffeemaschine anstellte, saß er am Küchentisch und begann zu erzählen. Sie plauderten so zwanglos wie zwei alte Bekannte. Er erzählte von seinen Schülern, sie von ihrer Arbeit in der Frauenberatungsstelle. Auch über Kathrin sprachen sie kurz. Sie registrierte überrascht, dass der Mann nicht ganz glücklich war über den ausgeprägten Freiheitsdrang ihrer Tochter.
Während sie sich am Tisch gegenübersaßen und Kaffee tranken, beobachtete sie ihn verstohlen. Seine blauen Augen lachten unentwegt, und Tabea gestand sich ein, dass sie den neuen Freund ihrer Tochter ausgesprochen attraktiv fand. Innerlich schimpfte sie mit Kathrin. Tabea wusste ja genau, warum sie Georg versetzte und wo sie die Nacht verbringen würde.
Als er ihr Kaffee nachschenkte, betrachtete sie das Geflecht seiner Adern, das seine sehnigen Hände und die flaumbedeckten, kräftigen Unterarme überzog. Eine unerwartete Hitze breitete sich hinter ihrem Brustbein aus und senkte sich hinab bis tief in ihren Bauch. Unwillkürlich straffte sie ihren Körper, als wollte sie sich gegen eine drohende Gefahr wappnen. Sie riss ihre Augen von seinen Armen und Händen los und versuchte das Gespräch wieder aufzunehmen. Doch sie hatte den Faden verloren. Georg schien es genauso zu gehen. Er wich ihrem Blick aus und schaute auf seine Armbanduhr.
"Tja - gleich halb fünf. Kathrin scheint wohl nicht mehr zu kommen." Er stand auf. "Ich glaub', ich geh' dann mal." Unschlüssig stand er vor dem Tisch.
"Tun Sie das, Georg", sagten Tabeas Lippen beiläufig. Während in ihr eine Stimme rief: Bleib noch ein bisschen. Eine Stimme, die sie lange nicht mehr gehört hatte. Sie brachte Georg zur Haustür.
13
Am Samstag, um die Mittagszeit, erreichten sie Stuttgart.
"Es wird knapp, wenn wir um Mitternacht zurück in Jever sein wollen", brummte Rüdiger. Nach Mitternacht durften sie nicht weiterfahren. Vierundzwanzig Stunden lang.
"Schaffen wir schon", beruhigte ihn Fred und bog auf das Gelände der Stuttgarter Speditionsfirma ein, wo sie Maschinenteile für Bremerhaven laden sollten." Die sollen sich halt ein bisschen beeilen mit dem Aufladen."
In der Spedition lag ein Fax für Rüdiger vor. Sein Chef bat um dringenden Rückruf. Er zeigte die Nachricht Fred.
"Mir schwant Übles", sagte der.
Rüdiger ging zum Telefon und sprach fast zehn Minuten mit dem Geschäftsführer der Speditionsfirma, für die sie unterwegs waren. Mit finsterer Miene kam er nach draußen, wo Fred beim Beladen half.
"Scheiße", knurrte Rüdiger, "wir müssen einen Umweg über Nürnberg fahren und von dort nach Mannheim."
"Na Prost Mahlzeit", Fred ließ die Arbeiter allein weiter einladen, "dann können wir uns ja Zeit lassen." Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und begann sich eine Zigarette zu drehen. "Das heißt also, wir sind nicht vor Montagabend Zuhause."
"Sieht so aus", seufzte Rüdiger, "der Chef will versuchen, noch eine Sonntagsfahrerlaubnis für uns zu kriegen. Er hat in Nürnberg ein Pensionszimmer für uns gebucht. Dort sollen wir abwarten."
Zwei Stunden später rollte ihr Brummi wieder über die Autobahn. Am späten Abend trafen sie in Nürnberg ein. Die erhoffte Sonntagsfahrerlaubnis ließ auf sich warten, und die beiden Männer beschlossen, das Beste daraus zu machen. Sie warfen sich ins spärliche Nachtleben der Stadt.
Einer von ihnen musste nüchtern bleiben, falls die Fahrerlaubnis in der Nacht noch eintreffen sollte. Sie losten, und Rüdiger musste sich an Mineralwasser und Cola halten.
Spätabends kamen sie in eine Kneipe der Nürnberger Altstadt und setzten sich zu einer alten Dame an den Tisch, weil kein anderer frei war. Die Frau trug ein exotisches, langes Kleid, trank Rotwein und rauchte schwarze Zigarillos. Die beiden Fernfahrer feixten sich amüsiert zu. Ihre Tischnachbarin passte so gar nicht in das Ambiente der bürgerlichen Kneipe.
"Die Herren kommen von weit her, vermute ich", sprach die alte Dame sie an.