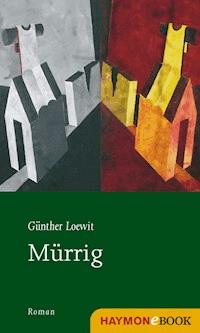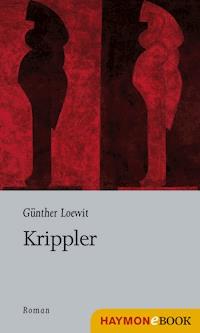Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dr. Günther Loewit ist seit 33 Jahren Landarzt. Schonungslos schildert er, wie die Politik das Gesundheitssystem kaputt macht, wie Gesundheit zur Ware und Patienten zu Kunden verkommen und wie dabei auch noch Milliarden an Steuergeldern verschwendet werden. Loewit beschreibt in diesem Buch, was viele Menschen bereits ahnen, in seiner vollen Tragweite aber nicht für möglich halten würden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Günther Loewit:7 Milliarden für nichts
Alle Rechte vorbehalten© 2019 edition a, Wienwww.edition-a.at
Cover und Satz: Isabella StarowiczLektorat: Maximilian Hauptmann
Dieses Manuskript wurde von der AgenturWildner, Wien, vermittelt.
ISBN 978-3-99001-396-0
E-Book-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Inhalt
Hubschrauber
Das kranke Gesundheitssystem
Rettung
Teure Übermedikation
Parallelstruktur
Doppel-, Dreifach- und Zigfachbefundungen
Wie viel Euro kostet ein Menschenleben?
Kostspielige Befunde
Bürokratie
Angst und Geschäft
Burn-out
Teures Nichtzuhören
Angebot
Zu viele Kranke
Vom Ende zurückgeblickt
Quellenverzeichnis
Hubschrauber
Wie wir täglich tausende Euro an Steuergeldern für völlig sinnlose Rettungseinsätze verschwenden
Juli 2011, sechs Uhr. Ein angenehmer Hochsommermorgen. Blauer Himmel. Die Sonne steigt gerade über den flachen Horizont im Osten. Ein Storch, den Schnabel schwer mit Grasbüscheln beladen, fliegt tief über die Hauptstraße zu seinem Nest. Sonst schläft der Ort noch. Erste Sonnenstrahlen treffen auf den Asphalt. Ein angenehmer Lufthauch erzeugt ein Gefühl von Kühle.
Vogelgezwitscher. Von weit entfernt kann man das Brummen eines Mähdreschers hören. Ein beinahe kitschiges Bild.
Ich höre auch ein anderes Geräusch, ein dumpfes Grollen, das langsam näherkommt. Noch kann ich es nicht richtig einschätzen. Ohnehin bin ich mit den Gedanken ganz woanders.
Ich bin zu Fuß unterwegs zu meiner neuen Ordination. Ein Luxus, den ich mir erst seit ein paar Tagen leisten kann. Denn seit dem 1. Juli bin ich Wahlarzt.
25 Jahre meines Lebens war ich Kassenarzt und damit stets auf Abruf erreichbar. Telefon, Notarztausrüstung und Auto immer in meiner unmittelbaren Nähe. Tag und Nacht. An vier, manchmal auch an sieben Tagen in der Woche. Einen Spaziergang konnte ich mir nur an freien Wochenenden erlauben, im Urlaub, oder wenn ich mir eine Vertretung leistete. 25 Jahre stand ich unter ständiger Anspannung.
Während ich über die neu gewonnene Freiheit nachdenke, wird mir allmählich bewusst, dass aus dem fernen Grollen ein Knattern geworden ist. Plötzlich ordnet meine Wahrnehmung das Geräusch klar zu. Ein Hubschrauber ist im Anflug. Das Kreischen der Turbine zerstört die morgendliche Idylle.
Während meiner Zeit als Kassenarzt gab es keinen Hubschrauberanflug im Ort ohne mein Mitwissen. Der Grund dafür ist einfach. Normalerweise habe ich den fliegenden Notarzt selbst angefordert. Zumindest wäre ich über einen Einsatz informiert worden. Andere Hubschrauber verirren sich kaum in meinen entlegenen Landarztsprengel.
Ich muss mich erst an die neue Situation gewöhnen, nicht mehr für alles rund um die Gesundheit der Bevölkerung verantwortlich zu sein. Somit kann es auch einen Rettungshubschrauber geben, ohne mein Wissen und ohne mein Wollen.
Meine Neugierde ist aber geweckt.
Inzwischen kann ich den gelben Hubschrauber mit der schwarzen Aufschrift klar am Himmel erkennen. Er fliegt tief, die Kanzel vornüber, das Heck hochgestellt. Bedrohlich hängt er schräg in der Luft. Er dreht sich. Wie immer, wenn der Pilot einen geeigneten Landeplatz sucht.
Ich biege von der Hauptstraße in eine Seitengasse ein und sehe vier oder fünf Menschen, die sich um einen liegenden Mann geschart haben. Einer von ihnen erkennt mich und ruft aufgeregt in den ruhigen Morgen. »Herr Doktor, kommen’s schnell zu uns her. Da liegt der Vikerl, alles is’ voller Blut.«
Natürlich bin ich immer noch »der Doktor«. Jeder der fünf ringsum stehenden Männer kennt mich seit 25 Jahren. Genauso gut kennen Sie alle den Viktor Stettner, Mitte vierzig, Alkoholiker seit der späten Jugend. Jeden Abend betrunken. Die Menschen im Ort kennen die Geschichten über seine unzähligen Mopedunfälle. Seine Knochenbrüche. Jeder kennt seinen torkelnden Gang. Sein gesprächiges Lallen, wenn er getrunken hat. Und sein nüchternes Schweigen. Jeder weiß, wie er im Winter einmal fast erfroren wäre, weil er zu später Stunde am Heimweg vom Wirtshaus vierzig Meter vor seiner Haustür bei vier Grad Celsius auf der Straße liegen geblieben und eingeschlafen ist. Damals hat ihm der Zeitungsausträger um drei Uhr früh das Leben gerettet. Kinder zeigen mit den Fingern auf ihn. Und weichen seinetwegen auf die andere Straßenseite aus, wenn er spuckt und schreit. So gut wie jeder hat schon einmal beobachtet, wie ihn sein Vater, selbst im Trinken geübt, in einem Schubkarren spätabends von irgendwo nach Hause führt. Wie eine Fuhre Schotter.
Ich höre, dass der Hubschrauber am nahen Sportplatz gelandet sein muss, weil das Fauchen der Turbine abschwillt. Das Knattern der Rotorblätter hat aufgehört.
Ich beschleunige meinen Schritt und komme der aufgeregten Gruppe näher. Ein untersetzter Pensionist wird grob zur Seite gestoßen. »Lass den Doktor her.« Ich sehe, dass Vikerl wieder einmal stockbetrunken gestolpert sein muss und an Ort und Stelle liegen geblieben ist. Ein typischer Geruch steigt in meine Nase. Seit dreißig Jahren kenne ich diese Mischung von verschwitztem Gewand, Zigarettenrauch, Alkohol, Adrenalin und Blut nur allzu gut.
An seiner Schläfe sehe ich den Puls klopfen. Konstant und regelmäßig. Ich entdecke eine circa drei Zentimeter lange, leicht klaffende Wunde an seiner Stirn. Über dem rechten Auge. Sie blutet nicht mehr. Also liegt Vikerl schon eine Weile hier. Er atmet ruhig. Ich versuche, ihn anzusprechen und frage mit lauter Stimme: »Herr Stettner… Kennen Sie mich? Hören Sie mich?« Zuerst geschieht nichts. Ich wiederhole den zweiten Teil meiner Frage noch lauter: »Hören Sie mich?« Jetzt geht ein Zucken durch den gekrümmten Körper. Herr Stettner bewegt den Kopf, streckt die angewinkelten Beine mit einer ruckartigen Bewegung gerade und versucht, das Gesicht in meine Richtung zu drehen. Die Augen bleiben halb geschlossen. Dann lallt er schwer verständlich: »Geh, Doktor, lass mi in Ruah, es is’ eh nix.«
Ich kenne den Satz. Nicht nur von ihm. Nächtliche »Alkoholleichen« säumen den Lebensweg eines jeden Landarztes.
Ich knie mich zu ihm hinunter.
Nach einer ersten groben Untersuchung muss ich dem Patienten auch recht geben. Außer der kleinen Rissquetschwunde ist nichts passiert. Der Blutverlust hat sich in Grenzen gehalten. Aber Blut schaut immer grässlich aus. Für Laien auch in kleinen Mengen am Asphalt.
Inzwischen dämmert mir, was es mit dem Hubschrauber auf sich haben könnte.
»Hat jemand von Ihnen den Hubschrauber gerufen?«, frage ich neben dem Patienten kniend in die frühmorgendliche Runde. Mit einer Hand fühle ich seinen Puls, mit der anderen ziehe ich seine Unterlider nach unten, um zu sehen, wie das einfallende Morgenlicht seine Pupillen ordnungs- und erwartungsgemäß verengt. Einer der umstehenden Männer gibt mit leicht vorwurfsvollem Ton die Antwort: »Na ja, Herr Doktor, Sie sind ja seit diesem Monat nicht mehr zuständig für uns, und da habe ich mir gedacht, ich rufe den Notarzt.« Ich erkenne sofort die Stimme eines immer überengagierten Feuerwehrmannes. Ohne meinen Kopf zu heben, frage ich ihn: »Und, was haben Sie gesagt?« Dann höre ich von oben die fatalen Worte: »Na, dass wir einen Bewusstlosen auf der Straße liegen haben, und eben, dass alles voller Blut ist, und dass ich glaub’, dass es ein Schädelhirntrauma sein könnte.«
Ohne den Gedanken auszusprechen, denke ich mir: Ja, das sind die richtigen Zauberworte.
Inzwischen höre ich auch das Folgetonhorn eines Rettungstransportwagens. Parallel zur Alarmierung eines Hubschraubers wird von der Leitstelle stets auch die örtliche Rettung zur Hilfe vor Ort mitinformiert. Ich knie immer noch am Boden, fühle mit der rechten Hand immer noch den Puls von Herrn Stettner. Meine Linke berührt seinen Kopf. Ich streichle ihn, weil ich spüre, wie das den Vikerl beruhigt. Während die Umstehenden der Meinung sind, ich würde erste Hilfe leisten, habe ich mich innerlich schon längst absentiert. Verstecke mich auf meinen Knien inmitten der immer größer werdenden Menschentraube. Den Kopf halte ich bewusst gesenkt. Ich will nicht gesehen werden. Wie ein Kind, das sich hinter den vorgehaltenen Händen versteckt und glaubt, nicht da zu sein. Die Gedanken gleiten ab.
Ich bin nicht mehr Arzt.
Denn der Vikerl braucht eigentlich keinen Arzt.
Er bräuchte entweder seinen Vater mit dem Schubkarren, oder sonst jemanden, der ihn nach Hause bringt und in sein Bett legt. Oder eine Mutter, die ihn geliebt hätte. Noch besser, denke ich, neben dem Vikerl kniend, wäre gewesen, er hätte einen Vater gehabt, der ihm ein besseres Vorbild gewesen wäre. Und ja, das schießt mir auch noch durch den Kopf, vielleicht würde ich eine Naht in seine Wunde setzen.
Eine.
Mehr wäre sicherlich nicht notwendig. Ohne Lokalbetäubung. Weil der Vikerl eh schon nichts mehr spürt. Wegen des Alkohols. Und dann denke ich noch an meinen Vorgänger, der mit Sicherheit nur ein Pflaster über die Wunde geklebt hätte. Den Angehörigen hätte er dabei in seiner ruppigehrlichen Art gesagt: »So wie der Vikerl schon ausschaut, wird ihn die eine Narbe auch nicht hässlicher machen.«
Die rot gekleideten Sanitäter laufen aufgeregt auf uns zu, als ginge es um Leben oder Tod.
Mit rotweißen Tornistern und Rucksäcken beladen.
Reflektorstreifen in Form des Kreuzes blitzen im Morgenlicht auf.
Ein Sonnenstrahl fällt auf mein Gesicht.
Dann höre ich: »Der Herr Doktor ist eh schon da.«
Ich schweige.
»Brauchen wir ein EKG?«
Ich schaue auf, weil ich die vertraute Stimme eines Sanitäters höre, den ich seit zwanzig Jahren kenne.
Wir haben uns immer gut verstanden und unzählige Einsätze zu jeder Tages- und Nachtzeit miteinander erlebt.
Ich spüre, dass ich ein Grinsen nicht unterdrücken kann.
Endlich erhebe ich mich und sage: »Nein, wir bräuchten überhaupt nichts. Es ist wieder einmal der Vikerl, und außer einer kleinen Rissquetschwunde auf der Stirn fehlt ihm überhaupt nichts. Er hat einfach zu viel Alkohol im Blut. Dagegen wird der Hubschrauber auch nicht helfen. Oder?«
Jetzt lächelt auch der Rettungsmann.
»Wahrscheinlich nicht«, sagt er und zwinkert mir zu, »aber Herr Doktor, ärgern Sie sich nicht, gehen Sie einfach, wir machen das schon.« Er fügt noch ein »Danke!« hinzu.
Ich fühle mich ohnmächtig.
Ohnmächtig vor Wut. Wut über die Sinnlosigkeit der Situation. Wut darüber, dass der Hausverstand auf allen Ebenen verloren geht. Wut darüber, dass unsere Gesellschaft gedankenlos tausende von Euros für einen Bagatellunfall eines Alkoholikers ausgibt, aber letztlich nichts zu seiner Rettung unternimmt. Wut darüber, dass der Beruf des Hausarztes ganz gezielt ausgehungert wird. Entgegen allen öffentlichen Beteuerungen.
Ich drücke meinem Rettungsfreund die Hand und sage: »Er hat sicher kein Schädelhirntrauma. Sie haben recht, es ist besser, wenn ich mich jetzt zurückziehe.« Aus der Ferne sehe ich auch schon das Team vom Rettungshubschrauber. Immer im Laufschritt. Immer hundert Prozent. Strotzend vor Selbstbewusstsein.
Ich verlasse den Unfallort.
Dem Rettungshubschrauber kehre ich den Rücken zu und mache freiwillig einen kleinen Umweg zu meiner Ordination.
Heute möchte ich mich nicht mit dem Kollegen aus dem Hubschrauber über den Fall und die notwendigen Rettungsmittel unterhalten. Die ewigen Diskussionen über realitätsfremde Alarmierungsketten und sinnlose Hubschraubereinsätze bei Bagatellverletzungen haben noch nie etwas gebracht. »Herr Kollege, Sie haben ja recht, aber wissen Sie, ich mache auch nur meinen Job.«
Ich versuche noch, die Stimmung des Morgens wiederzufinden. Es gelingt mir nicht. Der angenehme Windhauch hat sich gelegt, die Sonne beginnt zu stechen.
Später höre ich, wie der Hubschrauber ein zweites Mal die morgendliche Stille zerreißt und abhebt.
Mit dem Patienten an Bord. Wie ich per SMS erfahre.
Zwei Stunden später wird Vikerl übrigens wieder mit einem normalen Rettungswagen nach Hause gebracht. Aus dem Unfallkrankenhaus. Auf seiner Stirn, über dem rechten Auge, befindet sich eine Naht. Mehr nicht. Die Sanitäter legen ihn in sein Bett. Im Arztbrief steht, dass das Schädelröntgen und die Computertomographie unauffällig gewesen sind und dass ein stationärer Alkoholentzug als sinnvoll erachtet würde.
Zur Klarstellung: Bis zum 1. Juli 2011 ist mir von der Krankenkasse pro Hausbesuch der Betrag von 27 Euro zugestanden. Im Kassenvertrag hieß es dazu lapidar und präzisierend: »Der Aufforderung zur Visite ist Folge zu leisten.«
Also Tag und Nacht, ob Husten oder Unfall. Ob notwendig oder nicht.
Wenn wir, um fair zu bleiben, jetzt auch noch den Zuschlag für eine Nachtvisite (bis sieben Uhr), und die anfallenden Doppelkilometer in unsere Rechnung miteinbeziehen wollten, kämen wir für die Versorgung des gestürzten Patienten Viktor Stettner auf einen Gesamtbetrag von circa sechzig Euro, mit Naht in der Ordination auf hundert Euro.
Die Kosten für den Rettungshubschrauber liegen hingegen pro Minute bei neunzig Euro. Je nach geflogener Distanz also circa zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Auch die Kosten für das zusätzliche Rettungsteam vor Ort und den Heimtransport vom Unfallkrankenhaus werden über die Krankenkasse abgerechnet.
Dabei ist es bedeutungslos, ob die Krankenkasse, oder, wie im Falle eines Unfalls, die AUVA, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, die Kosten für den Hubschraubereinsatz übernimmt, letztlich handelt es sich um Steuergeld.
Denn die öffentliche Hand kann nur Steuergeld ausgeben.
Der ÖAMTC gibt auf seiner Website an, im Jahr circa 18.000 Flugrettungseinsätze zu fliegen.
Streng medizinisch betrachtet sind achtzig bis neunzig Prozent dieser Einsätze nicht notwendig. Das bedeutet, dass dem Patienten durch den Flug mit dem Hubschrauber kein zusätzlicher Nutzen entsteht beziehungsweise durch den Einsatz eines straßengebundenen Transportmittels auch kein weiterer Schaden entstanden wäre.
Ich habe schon von Menschen gehört, die unbedingt einmal mit dem Hubschrauber fliegen wollten. Mit dem Rettungshubschrauber natürlich. Überhaupt, ich habe zunehmend das Gefühl, dass der Notarzt der neue Hausarzt ist. Schon das Wort Notarzt klingt einfach besser. Fernsehserien tun da sicherlich ihr Übriges. Nicht nur meine Patienten wissen, welche Worte man am Telefon benutzen muss, um von einem Notarzt begutachtet zu werden. Dazu gehören: »…leblos, bewusstlos, reagiert nicht, …auf die Brust gegriffen, … nicht ansprechbar, zusammengebrochen.«
Ich weiß, dass es Patienten gibt, für die im Optimalfall der Hubschrauber kommt. Denn, so der Tenor aller Angehörigen, lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig. In der Ordination höre ich am Montag dann Sätze wie: »Jetzt hat unsere Oma auch einmal mit dem Hubschrauber fliegen dürfen.« Das Ganze wird natürlich dramatisch vorgetragen. Denn es ist den Angehörigen klar, dass ich mehr oder weniger entsetzt die Frage stellen werde: »Ja, was ist denn mit der Oma passiert?« Dann bekomme ich zum Beispiel zu hören: »Es war am Samstag, und wir wollten Sie nicht stören, aber wir waren uns nicht ganz sicher, ob sie nicht vielleicht einen Herzinfarkt hat, weil ihr nach dem Essen so schlecht geworden ist, und da haben wir uns gedacht, wir rufen zur Sicherheit halt die Rettung. Wir haben ja nicht gewusst, dass die uns gleich den Hubschrauber schicken werden. Aber vielleicht war es eh gut so, so ist die Oma gleich gründlich untersucht worden.« Und nach einer dramatischen Pause höre ich dann in den allermeisten Fällen: »Aber es war Gott sei Dank eh nichts, sie hat nur den Magen zu voll gehabt.«
Das scheinen auch die Leitgedanken des modernen Alarmierungssystems zu sein. Sicherheit und Gründlichkeit. Vordergründig für die Patienten, in Wahrheit aber um des Geschäftes willen.
Und es ist ein gutes Geschäft.
Natürlich fragen mich Patienten andauernd, wie viel denn ein Hausbesuch als Wahlarzt kosten würde. Meine lapidare Antwort darauf: »Rechnen Sie mit dem Preis, den Sie auch für einen Elektriker oder Installateur zu zahlen bereit sind.«
Vom Standpunkt der öffentlichen Hand aus gesehen bewegen wir uns dabei immer noch im Bereich von Bruchteilen der Kosten, wie sie im geschilderten Fall entstanden sind.
Seit aber eine Visite für den Patienten nicht mehr gratis ist und nicht mehr jederzeit gefordert werden kann, sind die Frequenzen von angeforderten Hausbesuchen dramatisch eingebrochen.
Dafür kann man die gelben Hubschrauber wesentlich öfter über unserem Ort sehen. Auch der Notarztwagen braust mit Blaulicht und überhöhter Geschwindigkeit regelmäßig durch die engen Gassen unseres Ortes. Zu Husten, Fieber und Schüttelfrost.
Denn der Zweck heiligt die Mittel.
Das kranke Gesundheitssystem
Wie die Gesundheit zum großen Geschäft wurde und warum wir trotzdem alle kränker und kränker werden
Diese Episode ist leider kein Einzelfall. Sie ist ein Mosaikstein im Bild eines teuren, aber wenig effizienten Gesundheitssystems. In diesem Buch blicke ich auf 38 Jahre Tätigkeit als Arzt im österreichischen Gesundheitssystem zurück. Den größten Teil davon habe ich als Landarzt erleben wollen, manchmal müssen, vor allem aber dürfen.
Ich bin weder Marktschreier noch Revolutionär, sondern ärztlicher Beobachter. Die Episoden in diesem Text bilden eine Anamnese des österreichischen Gesundheitssystems ab. Manche sind absurd, manche erheiternd und andere sehr ernst. In der Medizin sollte dem Patienten erst nach einer gründlichen Anamnese die Therapie empfohlen werden. Das gilt auch für das Gesundheitssystem selbst und geschieht im letzten Kapitel.
Es erfüllt mich mit Genugtuung, dass meine Beobachtungen und Erkenntnisse im »Länderprofil Gesundheit 2017«, herausgegeben von der OECD und dem European Observatory on Health Systems and Policies, ähnlich gesehen werden1. Die angestellten Überlegungen sollen beweisen, dass die derzeitigen Eckdaten des österreichischen Gesundheitssystems ein Einsparungspotenzial von mindestens sieben Milliarden Euro zulassen.
Ohne dass ein einziger Bürger unter schlechterer medizinischer Versorgung leiden müsste.
Tag und Nacht, Woche für Woche und Jahr für Jahr lassen sich im ganzen Land mit ein wenig Beobachtungsgabe und Geduld mehr oder weniger skurrile, bisweilen aber auch absurde medizinische Fälle ausfindig machen. Alleine die unnötig ausgegeben Summen im Bereich Erste Hilfe, Akutlabor, CT- und MRT-Untersuchungen, nicht notwendige Operationen wie zum Beispiel ein künstlicher Hüftgelenksersatz bei bettlägerigen Patienten und unzählige weitere medizinische Schildbürgerstreiche, die jeder Arzt und jeder Ökonom mit freiem Auge erkennen kann, ergäben insgesamt für jeden Steuerzahler eine mögliche Ersparnis von mindestens 2.000 Euro im Jahr. Ein Betrag, mit dem sich zum Beispiel jährlich ein entspannender Wellnessurlaub finanzieren ließe, oder nach zehn Jahren ein fabrikneuer Mittelklassewagen.
Was das Gesundheitssystem krank macht, sind Systemfehler.
Das beginnt schon beim Namen.
Streng genommen müssten wir von einem Gesundheitswiederherstellungssystem sprechen, oder von einem Krankheitsbehandlungssystem. Aber das klingt nicht so elegant und einprägsam. Die ehemalige Gesundheitsministerin Rendi-Wagner spricht in einem Interview im Sommer 2018 über die geforderten Einsparungsmaßnahmen der AUVA als Versuch »mutwilliger Zerstörung der solidarischen Gesundheitsversorgung« in Österreich. Ein finanziell schwerwiegender und weitreichender sprachlicher Fehler.
Worte wie »Gesundheitsversorgung« und »Gesundheitsreform« sind plakativ. Aber Gesundheit muss weder versorgt noch reformiert werden. Und eine »Gesundenuntersuchung« ist ein Widerspruch in sich, denn ein gesunder Mensch muss nicht untersucht werden.
Erst der weniger attraktive Begriff »Krankheit« ist zu versorgen.
Das einzige Gesundheitssystem, das ich als Arzt kenne, ist ein funktionierender menschlicher Körper. Wenn dieser Körper auch noch zu einem psychisch gesunden Menschen gehört, wäre ich zufrieden. Hätte aber auch keine Arbeit.
Denn die Grundlage meines Berufes sind Patienten. Aus dem Lateinischen übersetzt »Leidende«.
Die eigentliche Grundlage eines sogenannten Gesundheitssystems wäre also die Arzt-Patient-Beziehung.
Ein Leidender, ein Arzt.
Ein Mensch, der Hilfe sucht, und ein Mensch, der Hilfe anbietet. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass der, der die Hilfe anbieten kann, Macht und Ansehen in Händen hält. Es geht also auf jeden Fall auch um Macht.
Der Arzt und sein Patient.
Das wäre die Kernzelle.
Das Samenkorn eines Gesundheitssystems.
Alles andere hat sich im Laufe der Zeit rund um diese besondere Beziehung entwickelt. Pflegedienste, Rettungswesen, Hospitale, Seelsorge und Spitäler, Universitäten, Pharma- und Medizinindustrie, Apotheken, Fachgesellschaften und Qualitätssicherungsinstitute, Patientenanwälte, Heiler und Schamanen, Homöopathen und Energetiker, Krankenkassen, Ärztekammern, Gesundheitsökonomen, Lenkungsausschüsse, Hauptverbände, Krankenanstalten-Holdings und -Verbände, Gesundheitsämter und Ministerien, die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. All diese Institutionen sind wie die Schalen einer Zwiebel rund um die Arzt-Patient-Beziehung entstanden. Sie haben Eigendynamik, Selbsterhaltungstrieb, Fortpflanzungstendenzen, Vernetzungen und Querverbindungen entwickelt. Sie kleben hartnäckig aneinander und sind ineinander verkeilt. Ein gordischer Knoten von Heilsversprechungen.
Vordergründig, um zu helfen.
Das kommt gut an.
In Wirklichkeit geht es jährlich um ein circa dreißig Milliarden Euro schweres Geschäft. Um circa elf Prozent des BIP. 2010 sind zum Beispiel 31,4 Milliarden Euro für den Bereich Gesundheitsdienstleistungen ausgegeben worden.
Es geht um Umsatz, Profit, Macht und Ansehen.
Aber Gesundheit ist nicht käuflich. Niemand kann Gesundheit produzieren, verkaufen oder sonst vermarkten. Ja, manchmal gelingt es uns Ärzten, Gesundheit oder einen Teil davon wiederherzustellen. Die chirurgischen Methoden unserer Tage suchen in der Geschichte der Medizin ihresgleichen. Aber die utopische Begriffserklärung von Gesundheit, wie sie von der WHO propagiert wird, ist so gut wie nie erreichbar. »Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.«2
Das Gesundheitssystem ist ein dreißig Milliarden Euro schweres Geschäft mit der Illusion. Ein Perpetuum mobile erster Art. Es ist in der Lage, Gesundheit wiederherzustellen und zugleich neue Kranke zu produzieren.
Formuliert man den berühmten ersten Hauptsatz der Thermodynamik für die Medizin um, könnte er so lauten: »Es gibt keine gesunden, sondern nur schlecht untersuchte Menschen.«
Bei jeder Vorsorgeuntersuchung werden neue Abweichungen von der Norm festgestellt, sofort behandelt und später kontrolliert. So erhält sich das System selbst am Leben. Das ist die Wirklichkeit. Die beabsichtigte Nebenwirkung, das ist nicht zu leugnen, ist Hilfe für Patienten.
Aber das wäre auch billiger zu haben.
Zur Illustration das medizinische Kapitel »Lebensende«: Die Sterblichkeit der Menschen beträgt auch 2019 trotz der modernen Medizin immer noch hundert Prozent. Eine mathematische Gewissheit, die vom modernen Gesundheitssystem gerne ignoriert wird. Aus Sicht der Gesundheitsindustrie müsste niemand sterben, wenn nur die medizinische Versorgung ausreichend wäre. Das wird Bevölkerung, Ärzten und Politikern so lange suggeriert, bis es alle selbst glauben. Besuchen Sie einmal einen Kardiologen-, Chirurgen- oder Radiologenkongress. Alles wäre möglich. Wenn nur die öffentliche Hand genug Ressourcen zur Verfügung stellen würde.
Verschiedene Studien belegen, dass die letzten drei bis sechs Lebensmonate genauso hohe Ausgaben im Bereich der Gesundheitskosten verursachen wie das gesamte Leben zuvor. Um das 2018 stattfindende Sterben eines 1928 geborenen Menschen zu verhindern, wird vom Gesundheitssystem zehnmal so viel Geld in die Hand genommen wie für einen 1928 geborenen Patienten, der ein normales weiteres Lebensjahr hinter sich bringt und 2018 überlebt. Aber mit Geld lässt sich der Tod nicht verhindern.
Die Medizin behauptet, alles zu unternehmen, um den Tod zu bekämpfen und das Leben zu verlängern. Der Tod entpuppt sich als die Nemesis der Medizin.
Es hätte mehr Würde für den Patienten und wäre billiger für das System, den natürlichen Tod am Ende des Lebens anzunehmen. Es ist keine Schande, am Ende des Lebens zu sterben. Wie es auch keine Schande ist, am Anfang des Lebens geboren zu werden.
Es ist schlichtweg absurd, wenn hochbetagte sterbende Karzinompatienten während ihrer letzten Lebensstunden noch Chemotherapien um etliche tausend Euro intravenös verabreicht bekommen. Da wären wohl ein ehrliches ärztliches Wort mit den Angehörigen und eine sedierende Medikation für den Patienten weit sinnvoller und zweckdienlicher.
Doch mit offenen Worten ist kein Geschäft zu machen.
Und die Illusion, dass die Medizin in wirklich jeder Situation helfen kann, würde berechtigte Kratzer bekommen.
Wenn Politiker bei so gut wie jedem ihrer Auftritte monoton den Satz: »Für die Gesundheit darf uns nichts zu teuer sein!« wiederholen, zeigt das nur, wie sehr sie die Bedeutung des Gesundheitssystems als Machtfaktor erkannt haben. Auch für ihre eigene Stellung. Denn in einer diesseits- und körperorientierten Wohlstandsgesellschaft hat am meisten Macht und Ansehen, wer die körperliche Gesundheit garantieren kann. Wer als Volksvertreter wiedergewählt werden will, verspricht Gesundheit, Wohlstand, ein gut funktionierendes Sozialsystem, ein neues Krankenhaus und noch einmal Gesundheit.
Ein Blick auf die unkontrollierte Expansion des Gesundheitssystems insgesamt muss bei jedem Steuerzahler jedoch die Alarmglocken schrillen lassen.
1960, zwei Jahre nach meiner Geburt, hat es in Österreich circa 11.000 Mediziner gegeben, davon 6.135 Hausärzte. In den Geschichtsbüchern ist aber nichts davon zu lesen, dass zu jener Zeit die medizinische Versorgung im Land schlecht gewesen wäre. Immer wieder fällt im Zusammenhang mit dem propagierten medizinischen Fortschritt der Satz: »Dank der modernen Medizin können heute Patienten überleben, die früher nicht überlebt hätten.« Dieser Sicht zu widersprechen wäre dumm. Die Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen sowie in der Transplantations- und Unfallchirurgie sprechen für sich.
Aus meiner Sicht muss diesem Satz ein zweiter Satz gegenübergestellt werden: »Wegen der modernen Medizin sterben heute Patienten, die früher nicht gestorben wären.« Denken wir dabei nur an die circa 30.000 bis 35.000 Toten in Europa, die zum Beispiel nach einer überstandenen Operation an einer Infektion mit Spitalskeimen sterben. Diese Keime hat die moderne Medizin selbst produziert.
Auf den Punkt gebracht könnte man formulieren: Während früher ein nierenkranker Patient aufgrund einer Nierenspende von einem Unfallopfer überleben konnte, überlebt heute das Unfallopfer selbst.
2019 gibt es mehr als 44.000 ausgebildete Mediziner. Das entspricht einer Vervierfachung der Ärztezahl. 14.000 von ihnen sind inzwischen als Allgemeinmediziner tätig. Dabei ist in dieser Zeitspanne die Gesamtbevölkerung des Landes lediglich von 7 auf 8,5 Millionen Menschen angestiegen. Während sich 1960 159 Ärzte um die Gesundheit von 100.000 Einwohnern bemüht haben, sind es 2019 deutlich mehr als 500 Ärzte. Bei den Allgemeinmedizinern erleben wir in diesem Zeitraum eine Verdoppelung der Versorgungsdichte.
Und trotzdem sind Patienten und Ärzte unzufrieden. Gesundheit und Wohlbefinden erscheinen unerreichbarer als je zuvor. Ambulanzen sind dauerhaft überfüllt, technische Geräte weit über die Kapazitätsgrenzen ausgelastet. Niedergelassene Ärzte und Spitalsärzte klagen über noch nie dagewesenen bürokratischen Aufwand und den Mangel an Zeit für ihre Patienten.
Weder hat sich in dieser Zeitspanne die Lebenserwartung verdoppelt, noch ist die individuelle Gesundheit um den Faktor vier verbessert worden.
Im Gegenteil.
Es gibt mehr Kranke es je zuvor.
600.000 bis 700.000 Diabetiker, fast zwei Millionen Bluthochdruckpatienten, viele von ihnen laut Fachgesellschaft noch gar nicht entdeckt, geschweige denn ausreichend behandelt. Jeder zehnte Österreicher leidet statistisch gesehen an einer Depression, das wären weitere 800.000 Patienten. Jeder vierte Einwohner des Landes, vom Kindergarten bis ins Seniorenheim, soll einmal oder öfter in seinem Leben an einem Burn-out-Syndrom leiden. Das wären noch einmal zwei Millionen Kranke. Circa 400.000 Osteoporose-Patienten, mehrere 100.000 Bewohner leiden an Abnützungserscheinungen der Wirbelsäule und der Gelenke, von Jahr zu Jahr steigen die Zahlen der Demenzerkrankungen, Schwerhörigkeit und Sehkraftverlust, die Statistik führt jeden Teilbereich der normalen Körperalterung akribisch als Einzelkrankheit auf. Jeder dritte Österreicher erkrankt aufgrund der fortgeschrittenen Lebenserwartung im Laufe seines Lebens an einem Karzinom. Jede einzelne Fachgesellschaft dokumentiert ihre eigene Bedeutung mit möglichst hohen Fallzahlen und einem eigenen bürokratischen Netzwerk. Lassen Sie den Begriff: »Dachverband der Österreichischen Osteoporose-Selbsthilfegruppen« und die Konsequenzen seiner Sitzungen und Beschlüsse auf sich wirken!
Addieren wir diese Zahlen.
Dann leben in diesem Land mathematisch gesehen weit mehr Patienten als Einwohner. Möglich wird das nur dadurch, dass viele Menschen an mehreren Krankheiten zugleich leiden.
Auch der Zugewinn an durchschnittlicher Lebenserwartung nimmt sich, im Vergleich zum finanziell betriebenen Aufwand, vergleichsweise bescheiden aus. Dabei ist es keineswegs bewiesen, dass dieser Zugewinn ausschließlich und linear mit besserer medizinischer Versorgung zusammenhängt. In den USA werden zurzeit circa 17 Prozent des BIP für Gesundheit ausgegeben. Bei sinkender Lebenserwartung. Die Statistik erklärt das damit, dass die Anzahl der fettleibigen Individuen, die früher sterben, kontinuierlich steigt.