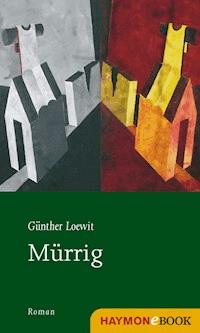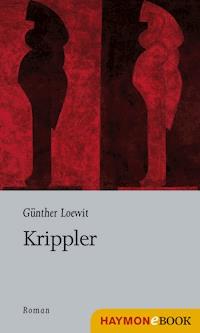Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
WENN MEDIZIN KRANK MACHT: DIE SCHATTENSEITEN DER MODERNEN MEDIZIN. Mehr als 30 Milliarden Euro fließen in Österreich jährlich in den Gesundheitssektor. Die Ausgaben steigen von Jahr zu Jahr um 5 % - und doch waren noch nie so viele Menschen krank wie heute. Scheitert die moderne Medizin an ihren eigenen Ansprüchen? Macht zu viel Medizin gar krank? Und wer sind die Nutznießer dieses Systems? FUNDIERT UND MIT AUTHENTISCHEN BEISPIELEN Der Arzt und Schriftsteller Günther Loewit stellt in seinem neuen Buch unbequeme Fragen. Anhand authentischer Beispiele zeigt er, wie gefährlich die Spirale von Medikamenten, Operationen, Diagnosen und Therapien sein kann, warum Tabletten nicht das Allheilmittel für alle Beschwerden sind - und dass es manchmal gesünder sein kann, nicht zum Arzt zu gehen. "Ein sehr aufschlussreiches Buch für alle, die hinter die Kulissen der modernen Medizin blicken möchten. Sehr interessant geschrieben mit vielen wissenswerten Infos." Weitere Bücher von Dr. med. Günther Loewit zum Thema: - "Sterben." Zwischen Würde und Geschäft - "Der ohnmächtige Arzt". Hinter den Kulissen des Gesundheitssystems AUS DEM INHALT: Irrtümer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Dr. med. Günther Loewit
Wie viel Medizin überlebt der Mensch?
Widmung
Im Gedenken an meine Mutter und ihren Bruder Werner, die beide, mit einer schweren Krebserkrankung konfrontiert, der Dankbarkeit über ein erfülltes Leben den Vorzug gegenüber einem sinnlosen medizinischen Kampf um Wochen und Tage gegeben haben.
Zitat
„Aber natürlich braucht man nur auf die Natur zu schauen, um zu sehen, welchen geringen Wert sie dem Leben beimisst. Dessen Unverletzlichkeit ist eine rein menschliche Idee. Man nehme einen Schmetterling – 12 Millionen Federn auf seinen Flügeln, 16.000 Linsen in seinem Auge – und für einen Vogel kaum ein Maulvoll.“
Winston S. Churchill
Vorwort
Am 7. September 2011 erreicht Österreichs Bundesregierung eine Mahnung des Internationalen Währungsfonds (IWF), mehr zu sparen. Die zurzeit geplanten Budgetkonsolidierungsmaßnahmen, heißt es in der Note, wären kaum dazu geeignet, längerfristig Österreichs rasch zunehmende Überschuldung in den Griff zu bekommen. Vor allem im Bereich Gesundheit und Pensionen würde unverantwortlich viel Geld ausgegeben, präzisiert der Bericht des IWF.
Tatsächlich wurden im Jahr 2010 11 % des BIP (Bruttoinlandsprodukt), nämlich 31,4 Milliarden Euro, für den Bereich der „Gesundheitsdienstleistungen“ ausgegeben. Im Jahr 1990 belief sich der Anteil der Gesundheitsausgaben noch auf 8,4 % des BIP. Berücksichtigt man auch noch den jährlichen Zuwachs der Wirtschaftsleistung, ergeben sich für den Zeitraum 1990 bis 2010 jährliche Steigerungen der gesundheitsrelevanten Ausgaben des Staates um 5,4 % pro Jahr. Dieser Wert liegt deutlich über dem durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstum.
Das bedeutet, dass 11 % der jährlichen Wirtschaftsleistung in ein Unterfangen investiert werden, das zumindest teilweise zum Scheitern verurteilt ist: Die moderne Medizin kann zwar die einzelnen Mitglieder der Bevölkerung weitgehend gesund und möglichst lange am Leben erhalten; den Kampf gegen den Tod wird aber auch das beste Gesundheitswesen immer verlieren. Das „Überleben des Patienten“ ist stets nur eines auf Zeit.
Trotz der gewaltigen Geldsummen, die ins Gesundheitssystem gepumpt werden, sind in Österreich – wie auch in den meisten anderen Industriestaaten – mehr Menschen „krank“ als je zuvor. Rechnet man die Zahlen der einzelnen medizinischen Fachgesellschaften zusammen, stellt sich heraus, dass es scheinbar mehr Patienten als Einwohner gibt. So litten z.B. laut Österreichischer Diabetesgesellschaft 2011 ca. 600.000 Menschen an Diabetes – in einer Veröffentlichung der Statistik Austria aus dem Jahr 2007 waren es noch 390.000 Personen. Ähnliche Entwicklungen gibt es bei den Fallzahlen von Bluthochdruckpatienten. So soll es in Österreich mehr als 1,5 Millionen Erkrankte geben, von denen 750.000 noch gar nicht diagnostiziert und lediglich 200.000 zufriedenstellend behandelt sind. Jeder vierte Einwohner des Landes gibt an, zumindest zeitweise an einem Burnout-Syndrom zu leiden, 10 % der Bevölkerung sind an einer Depression erkrankt. 390.000 Menschen leiden an Osteoporose.
Diese Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt werden. Dass es dennoch vereinzelt „Gesunde“ in diesem Land gibt, ist nur durch die Multimorbidität (= mehrere Krankheiten zugleich) einzelner Patientengruppen, und durch den Widerstand von Gesundheitssystemverweigerern zu erklären.
Auch am überproportional hohen Prozentsatz von teuren Frühpensionierungen hat unser medizinisches Versorgungsmodell einen nicht unwesentlichen Anteil. Lag der Anteil von krankheitsbedingten Frühpensionierungen 1995 noch bei 14.871 Fällen, so wurden 2009 von den Pensionsversicherungen bereits 30.131 krankheitsbedingte Frührenten zuerkannt. Von 1975 bis 2009 stieg der Anteil der Pensionen wegen „dauernder Erwerbsunfähigkeit“ von 284.440 auf 459.710 Fälle. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil, wenn man zugrunde legt, dass im Jahr 2010 in Österreich 2.681.391 Menschen eine staatliche Pension erhielten.
Was läuft also falsch, und welche Lösungsansätze bieten sich an? Sind 31,4 Milliarden Euro pro Jahr für Gesundheit etwa zu wenig?
Wird man das „medizinische Wissen und Können“ von heute, all die gängigen „Behandlungsstandards“ und „medikamentösen Errungenschaften“ mit den Augen von morgen betrachten, so müssen sie unweigerlich unvollständig, teilweise schädlich und stümperhaft erscheinen. Das ist zumindest anzunehmen, wenn man einen Blick vom Heute aufs Gestern richtet. Denn die Medizingeschichte ist durchsetzt von Irrwegen in Diagnose und Therapie, und voll von ärztlicher Anmaßung sowie falschen Patientenerwartungen.
Jahrhundertelang ließen Ärzte mit bestem Wissen und Gewissen zur Ader und setzten Blutegel gegen Krankheiten, über deren Entstehung und Herkunft sie genausoviel bzw. -wenig wussten, wie wir heute über die Entstehung geistiger Krankheiten, bösartiger Tumore oder rheumatischer Erkrankungen. Und dennoch wurden unsere früheren Kollegen (aus heutiger Sicht wären sie zum Teil Kurpfuscher und Scharlatane) von der damaligen Gesellschaft als ehrenwerte Männer (die erste Ärztin promovierte 1849 in den USA) wahrgenommen. Manche von ihnen haben auch heute noch klingende Namen.
Unzweifelhaft ist aber die Tatsache, dass ihre Bemühungen jede Menge Leid gemildert, ihre Worte Hoffnung und Kraft gespendet haben, und alleine schon ihr Anblick am Krankenbett Linderung bedeutet hat. Aber auch wenn unzählige Menschen im Lauf der Zeit an und wegen der Medizin zugrunde gegangen sind, so hat die Menschheit an sich souverän überlebt.
Man muss aber gar nicht weit in die Vergangenheit zurückblicken, um zu erkennen, dass der Wert des menschlichen Lebens und damit auch der der Gesundheit nicht immer derselbe ist. Betrachtet man die unzähligen Schlachtfelder der beiden Weltkriege, der Balkankriege oder der blutigen Auseinandersetzungen im Afrika unserer Tage, wird deutlich, dass Wert und Würde des Menschen enormen historischen und geografischen Schwankungen ausgesetzt waren und bis heute sind.
Solche Überlegungen stehen in krassem Widerspruch zu den Ansprüchen einer postmodernen Gesellschaft an „ihre“ medizinische Versorgung. Denn bestmögliche ärztliche Betreuung zu jeder Zeit und an jedem Ort haben sich als scheinbar selbstverständliches Grundrecht etabliert. Und wer sich urlaubsbedingt einmal außerhalb der geografischen Grenzen dieser „Selbstverständlichkeit“ befindet, wird, sofern er sich rechtzeitig versichern hat lassen, mit dem Ambulanzjet nach Hause geflogen. Zu groß ist das Misstrauen in die medizinischen Fähigkeiten fremder Kulturen. Denn medizinisch gesehen hat die Globalisierung noch nicht einmal begonnen.
Konkret: Für eine HIV-Infektion in Zentralafrika gelten im Vergleich zur gleichen Erkrankung in unserem Gesellschaftsbereich völlig andere ethische und medizinische Standards. Dies zu leugnen wäre Realitätsverweigerung.
Geld ist also offensichtlich ein wesentlicher Bestandteil moderner Medizin und ihrer Möglichkeiten. Damit ist auch die medizinische Ethik relativ und geldabhängig.
Eine Änderung dieser Situation ist weder zu erwarten, noch ist eine solche das Ziel dieses Buches. Es soll auch keinesfalls den Idealismus unzähliger Forscher und Ärzte in Frage stellen, oder in Zweifel ziehen, dass die moderne Medizin wesentlich zur Verlängerung der Lebenserwartung der Menschen in unseren Breitengraden beigetragen hat. Medizinische Hilfe und Lebensbegleitung sind unverzichtbare Bestandteile eines modernen Lebens.
Dieses Buch will lediglich Fragen stellen.
Es will den modernen Menschen und die Medizin seiner Zeit einer kritischen Betrachtung unterziehen. Und es will untersuchen, wie sich grundlegende Verhaltensmuster der Gesellschaft, die sich in allen großen geschichtlichen Themen wiederspiegeln, in der Medizin äußern: Etwa die Gewinnsucht und das Machtstreben des Menschen, das einseitige Ausnützen von Abhängigkeitsverhältnissen, wie die Arzt-Patient-Beziehung eines darstellt, und viele andere Mechanismen, die seit Jahrtausenden die menschliche Realität kennzeichnen.
Dieser Blickwinkel wird nicht zuletzt zeigen, dass die sogenannte zeitgemäße Medizin – so wie auch Religion oder Politik – stets eine Reaktion auf die Lebensumstände von Menschen einer gewissen Epoche darstellt, die von ihrem Kontext nicht zu trennen ist.
Und schließlich soll dieses Buch auch die Frage stellen, ob die Summen, die wir heute für das Thema „Gesundheit“ ausgeben, in einer sinnvollen Relation zum Nutzen für die Gesellschaft stehen – und ob das Ziel, ein gutes, erfülltes Leben zu führen, tatsächlich so eng mit einer möglichst langen Lebensdauer zusammenhängt, wie wir heute zu glauben scheinen.
Günther Loewit
Irrtümer. Eine Einleitung
Die Medizingeschichte ist eine Geschichte von Irrtümern. Aber in einem Punkt hat sich die Medizin nie geirrt: Im Gefühl ihrer Bedeutung, sowohl für den einzelnen Patienten als auch für die Gesellschaft – und den damit verbundenen politischen und geschäftlichen Möglichkeiten. Die heilende Hand war im Anschluss an die Behandlung stets auch die geöffnet hingehaltene, wenn es um die Honorierung der medizinischen Leistung ging. Daran hat sich im Wesentlichen bis in unsere Tage nichts geändert. Auch wenn Medizin bisweilen von Idealisten betrieben wird, die sich z.B. bei „Ärzte ohne Grenzen“ engagieren, so stehen doch im Hintergrund in Form von Gesundheitssystem und Pharmaindustrie gewaltige Macht- und Wirtschaftsapparate, die längst erkannt haben, welche finanziellen Möglichkeiten die Heilkunst eröffnet. Deren Strukturen werden so gut wie ausschließlich von Nichtärzten betrieben. Somit sind Ärzte, soweit sie nicht als reine Privatärzte freiberuflich tätig sind, in ihren Entscheidungen eng an das jeweils etablierte medizinische System gebunden. Denn auch die niedergelassenen Allgemeinmediziner und Fachärzte unterliegen in weiten Bereichen den strikten Vorgaben und Kontrollen von Politik und Krankenkassen.
Die im Gesetz festgeschriebene Freiheit des einzelnen Arztes in Diagnose und Therapie gibt es schon lange nicht mehr, und das Gleiche gilt für Forschung und Lehre. Waren bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts Forschung und Lehre noch fest in Händen der Universitäten, so hat sich mittlerweile still und heimlich die Pharmaindustrie dieser Kompetenzen weitgehend bemächtigt. Die Inhalte ärztlicher Fortbildung werden größtenteils von der Pharmaindustrie bestimmt. Ebenso sind die „Guidelines“ der EBM („Evidence-Based Medicine“) nach den jeweils neuesten pharmakologischen Forschungsergebnissen formuliert. Mit dieser Entwicklung wurde der Politik ein Werkzeug in die Hand gegeben, das Wirken der Ärzte zu dirigieren und zu kontrollieren. Nach dem Motto „Alle Macht dem Staat und den Konzernen“ sollten Ärzte nur noch mittelbar und nachvollziehbar ihr Werk am Menschen verrichten. Für unmittelbare, individuelle medizinische Vorgangsweisen bleiben in der EBM wenig Spielräume. Dem Mythos einer freien und unabhängigen Ärzteschaft steht in der Realität eine streng kontrollierte und reglementierte Berufsgruppe gegenüber. Diese politisch festgeschriebene Realität steht aber bisweilen in deutlichem Widerspruch zu den Erwartungen kranker Menschen.
In einem medizinischen Lehrbuch aus dem Jahr 1986, das damals zu den Standardwerken zählte, kann man folgenden Satz lesen:
„Die durch neuere Erkenntnisse immer komplizierter werdenden unterschiedlichen Regelkreise für wichtige Lebensvorgänge sind am allgemeinen Beispiel einer neuroendokrinen Regelstrecke darstellbar.“ Der Autor, ein anerkannter Wissenschaftler, beschreibt durch seinen kleinen sprachlichen Irrtum ein Dilemma der modernen Medizin. Denn natürlich werden die Regelkreise im menschlichen Körper nicht „immer komplizierter“. Die Anatomie und Physiologie des Menschen ist seit Jahrtausenden unverändert geblieben. Nur unser Einblick in Funktion und Aufbau des menschlichen Körpers wird immer tiefer und genauer. Mit zunehmender Tiefe der Forschung erscheinen die funktionellen Zusammenhänge des menschlichen Organismus immer komplexer, wird das Verständnis für Zusammenhänge schwieriger. Und mit jedem dieser Erkenntnisschritte werden mögliche neue therapeutische Zugänge zu einer Erkrankung vermutet und gesucht.
Dieses Dilemma lässt sich durch einen bildlichen Vergleich darstellen:
Eine Gruppe von Technikern und Wissenschaftlern erforscht einen großen Fluss, der immer wieder Wohngebiet überschwemmt und Ackerland unkontrollierbar überflutet. Sie beschließen, ausgehend vom Mündungsgebiet, die Herkunft der Wassermassen zu erkunden und herauszufinden, wo sie in den natürlichen Ablauf eingreifen können, um das Unheil der Überschwemmungen zu bekämpfen.
Irgendwann stoßen sie bei ihrer Wanderung stromaufwärts auf eine erste Gabelung, bei der zwei Flüsse zusammenfließen. Und sofort sehen sie auch die Möglichkeit, durch die Errichtung einer Staumauer bei einem der Zuläufe das Wasservolumen im Unterlauf besser regeln zu können. Aber die Forscher sind noch nicht zufrieden.
Sie teilen sich in zwei Gruppen und verfolgen ab jetzt getrennt die beiden zuführenden Flüsse weiter stromaufwärts. Dabei entdecken sie naturgemäß immer mehr Verzweigungen und Verästelungen der Wasseradern. Und mit jeder dieser Verästelungen sehen die Forscher neue Möglichkeiten, den Fluss der Wassermassen besser, weil näher am Ursprung, beeinflussen zu können.
Weil sie sich aber an jeder Weggabelung erneut in Untergruppen teilen müssen, haben sie den Kontakt untereinander schon längst auf ein Minimum reduzieren müssen. Zwar treffen sie sich vereinbarungsgemäß von Zeit zu Zeit, um einander ihre Erkenntnisse mitzuteilen und sich auszutauschen, aber den großen Überblick haben sie schon längst verloren. Trotzdem sieht jede Gruppe ihre eigenen Forschungsergebnisse als bahnbrechend an und vermeint die jeweils beste Lösung zur Vermeidung der Überschwemmungen gefunden zu haben. Die einen schlagen vor, einzelne Zuläufe trockenzulegen oder aufzustauen, andere wollen ausgesuchte Wasserläufe umleiten oder durch vorzeitige Zusammenführung und allerlei weitere Maßnahmen die Kontrollierbarkeit des Wassernetzes verbessern.
Nichts anderes geschieht seit Jahrzehnten in der medizinischen Forschung. Immer werden neue, kleinere Regelkreise, feinere Zusammenhänge von biologischen Steuerungen ans Tageslicht gebracht. Mit jeder neuen Erkenntnis entstehen neue Hoffnungen, Erkrankungen endlich an der Wurzel behandeln zu können. Mit jeder bahnbrechenden Entdeckung von bislang unbekannten Zusammenhängen rückt der Traum vom ewigen Leben ein klein wenig näher. Immer ist die Pharmaindustrie zur Stelle und bemüht sich nach Kräften und oft auch redlich, ein entsprechendes Produkt herstellen und am Markt platzieren zu können. Sie wird damit nicht nur ihren eigenen ökonomischen Bedürfnissen gerecht, sondern auch der Erwartungshaltung einer ganzen Gesellschaft, die da lautet: Medizinische Behandlung bedeutet, dass stets die geeignete Tablette verfügbar ist.
Aber das Auffinden der jeweils letzten und allerletzten Wurzelspitzen gestaltet sich äußerst schwierig. Und es gelingt nur sehr schwer, häufig auch gar nicht, Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen bei der Behandlung eines Problems in den Griff zu bekommen. Denn jede Umleitung oder Trockenlegung eines Flussarmes, um beim obigen Beispiel zu bleiben, hat eine Kaskade von ökologischen, in der Medizin eben biologischen, Veränderungen zur Folge. Viele tragische Beispiele aus der Geschichte der Pharmaindustrie zeigen, dass es so gut wie nie gelingt, Wirkung ohne Nebenwirkung zu erzielen. Daran kann auch die beste Werbestrategie für ein neues Produkt nichts ändern.
Und zugleich ist es so gut wie unmöglich, punktgenaue Ursachen für die Entstehung einer Krankheit ausfindig zu machen. Für die meisten Erkrankungen gibt es multifaktorielle Entstehungsmuster, bei denen verschiedenste Faktoren zusammenspielen: Für nicht insulinpflichtigen Diabetes mellitus können etwa das Lebensalter, die genetische Veranlagung, Übergewicht, mangelnde Bewegung, falsche Ernährung, Stress und andere psychosoziale Faktoren als Ursache aufgelistet werden. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, ob, wann und wie medizinisch-pharmakologisch eingegriffen werden soll.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre es wichtig, den Begriff „medizinisch-pharmakologisch“ in seine zwei Komponenten zu teilen. Als Arzt medizinisch tätig zu sein ist nämlich nicht gleichbedeutend mit dem reflexartigen Verordnen von Medikamenten – ein auch unter jungen Medizinern weit verbreiteter Irrtum. Denn gerade in Anbetracht galoppierender Staatsschulden sollte kostengünstigeren und natürlicheren Behandlungsformen der Vorzug gegeben werden. Im angeführten Beispiel der Blutzuckererkrankung kann ein gut auf seine Rolle vorbereiteter Arzt im Gespräch etliche Heilungs- und Behandlungsansätze vermitteln. Auch wenn das nicht im Interesse der Medikamentenhersteller liegt. Unbestreitbar billiger, aber ebenso effektiv wie die Einnahme von Tabletten wäre im Fall des Diabetespatienten die Reduktion der täglichen Kalorienzufuhr, verbunden mit einer Verminderung des Körpergewichts, regelmäßiges sportliches Engagement und andere nicht pharmakologische Maßnahmen. Nur: So weit das Auge reicht, gibt es zurzeit keine ärztliche oder staatliche Autorität, die ein solches Denken umsetzen wollte oder könnte; zu bequem ist der Weg, einen erhöhten Blutzuckerspiegel durch die Einnahme von Medikamenten zu senken und parallel dazu das ungesunde Wohlstandsleben auch weiterhin nicht in Frage stellen zu müssen.
Einen besonderen Blick verdient sich in Anbetracht des Gesagten die Psychiatrie, deren Aufgabengebiet, sowohl in der Wahrnehmung von Ärzten als auch von Patienten, heute auf besonders schwere Fälle geistiger Erkrankungen reduziert ist. Dabei bedeutet „Psychiatrie“ aus dem Griechischen übersetzt eigentlich „Arzt für die Seele“. Davon ist die heutige Medizin weit entfernt. Sie erkennt lediglich pharmakologisch therapierbare Erkrankungen als solche an. Der Rest an „empfundenen Leiden“ wird der Psychologie überlassen. An diesem Manko leidet die moderne Medizin mehr, als ihr bewusst ist. Nach wie vor führt kein Weg an der ganzheitlichen Betrachtung des Menschen vorbei. Und der ist eben mehr als die Summe seiner Organe und Regelkreise. Auch wenn die Seele nicht anantomisch dingfest gemacht werden kann, ihr Mitwirken bei der Entstehung und Heilung von Krankheiten ist offensichtlich. Viele schulmedizinisch nicht erklärbare Phänomene sind eine Folge seelischer Vorgänge. Und selbst wenn einzelne psychosomatische Zusammenhänge wissenschaftlich nicht eindeutig dargestellt werden können, wäre die Schulmedizin gut beraten, zumindest die Möglichkeit solcher Vorgänge im menschlichen Ganzen nicht a priori in Frage zu stellen.
Wenn Medizin krank macht
Alzheimer: Aufstieg einer Erkrankung
Die Alzheimer’sche Demenzerkrankung wird in der Öffentlichkeit häufig als eine „neue“ Bedrohung für die Gesundheit der Menschen wahrgenommen. Durch scheinbar steigende Fallzahlen ist die Erkrankung in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker in den Mittelpunkt sowohl des medizinisch-pharmakologischen als auch des gesellschaftlichen Interesses gerückt. Aber die rapide Zunahme von betroffenen Patienten muss – im Licht des demografischen Wandels – differenziert gesehen und analysiert werden. Denn unter dem Titel „Alzheimer“ werden heute – medizinisch nicht ganz korrekt – verschiedene Arten von Demenzerkrankungen zusammengefasst, darunter auch ein Nachlassen des Kurzzeitgedächtnisses, das bei älteren Menschen gehäuft auftritt und aus medizinischer Sicht völlig normal ist. Aber nicht jeder vergessliche alte Mensch ist krank. Nicht jede Persönlichkeitsveränderung im höheren Alter ist mit Krankheit gleichzusetzen. Und vor allem ist nicht jeder alte Mensch automatisch ein Patient. Altern ist ein essentieller Bestandteil des Lebens und keine medizinisch behandelbare Krankheit. Abnützungsprozesse und psychische Veränderungen sind natürliche Teilaspekte dieses Alterns. Leider geraten solche triviale medizinische Leitsätze zunehmend in Vergessenheit. Als ob die Medizin selbst an Alzheimer leiden würde.
Namhafte Kritiker moderner Medizin behaupten, dass auch die heute weithin verwendete Diagnose Alzheimer-Demenz in vielen Fällen in Wirklichkeit überhaupt keine Krankheit darstellt, sondern im weitesten Sinne einfach eine Folge des „Altwerdens“ des Gehirns ab dem 80. bis 85. Lebensjahr darstellt. Eine normale Abnützung sozusagen.
Im Gegensatz zum heutigen Demenzbegriff war die von Alois Alzheimer beobachtete und protokollierte Patientin zum Zeitpunkt ihrer Erkrankung erst 51 Jahre alt und entspricht damit, zumindest vom Alter her, keineswegs dem Großteil der heute mit dem Etikett „Demenz“ versehenen Menschen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass es keine ursächlich wirkenden Medikamente gegen Alzheimer gibt, muss diesem Standpunkt der Vorzug gegeben werden. Alzheimer wäre demnach nichts anderes, als die Altersschwäche des Gehirns.
Die Krankheit gab es also vermutlich immer schon. Oder: Es hätte sie immer schon gegeben, wenn die Lebenserwartung schon früher heutige Werte erreicht hätte. Aber erst wenn ein Symptomenkomplex eindeutig beschrieben worden ist, erst wenn Ärzte und Öffentlichkeit ausreichend sensibilisiert sind und die zeitgeschichtlichen Bedingungen einen idealen Nährboden bieten, kann eine relativ „junge Krankheit“, wie die Demenz, ihren Siegeszug in dem traurigen Wettbewerb der Krankheiten antreten. Mit dem dramatischen Anstieg der Lebenserwartung in den westlichen Ländern im vergangenen Jahrhundert haben sich diese Bedingungen in Bezug auf Demenzerkrankungen perfekt erfüllt. Die Medien haben ein Übriges zum Bekanntwerden von Demenzerkrankungen getan, indem sie uns ausreichend mit herzzerreißenden Bildern und Berichten über das elende Zugrundegehen von prominenten Alzheimer-Persönlichkeiten versorgt haben. Denken wir nur an den ehemaligen US-Präsidenten und Schauspieler Ronald Reagan oder seinen beliebten Schauspielerkollegen Peter Falk, der 2011 an den Folgen der Alzheimer-Demenz verstarb. In den entsprechenden Medienberichten geht es immer um publikumswirksame Gerichtsentscheidungen, Entmündigungen, intime Familiengeschichten und um Geld. Dazu Bilder von traurig ausdrucks- und inhaltslosen Gesichtern ehemalig bedeutender Menschen. Genau der Stoff, aus dem mediale Kassenschlager gemacht sein müssen.
Wenn dann die Pharmaindustrie auch noch eine geeignete medikamentöse Behandlung anbieten kann, spricht auch für skeptische Geister nichts mehr dagegen, einen beliebig zusammengestellten Symptomenkomplex als eigenständige Krankheit mit speziellen Therapiemöglichkeiten zu akzeptieren.
Betrachtet man den „medialen Hype“ um die verschiedenen Formen der Demenzerkrankung genauer, müsste man sich eigentlich fragen, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, die mangelnde Sprach- und Bewegungsfähigkeit von Säuglingen als eigenes Krankheitsbild zu definieren. Anders formuliert: Wenn es der Heilmittelindustrie eines Tages gelingen wird, die Windelphase von Säuglingen durch geeignete Medikamente zu verkürzen, wird ein einjähriges Kleinkind, das noch eine Windel braucht, vermutlich als „krank“ bezeichnet werden. Und das gilt natürlich auch für die geistig-mentale Entwicklung des Säuglings. Denn punktuell und isoliert betrachtet sind die geistigen Fähigkeiten von Kleinstkindern durchaus auch „alzheimerverdächtig“.
Unsere Gesellschaft ist nunmehr also hervorragend „alzheimersensibilisiert“ – oder, um den Jargon der Pharmawerbebranche zu verwenden: Zurzeit wird „Alzheimer“ regelrecht „gepusht“ (Financial Times Deutschland). Ein großartiges Geschäft ist zu erwarten, denn es geht um weit mehr als die sündhaft teuren Medikamente. Forschungsmöglichkeiten für neu auszubildende Mediziner, Heilbehelfe aller Art, tausende von Arbeitsplätzen für Ergotherapie und Pflege, juridischer Beistand bei der Erstellung von Patientenverfügungen und Sachwalterschaften, die fester Bestandteil einer modernen „Rechtsindustrie“ sind, krankheitsgerechte Unterbringung in Heimen und Pflegeeinrichtungen – eine nicht enden wollende Liste von Begleitumständen begleitet den kometenhaften Aufstieg dieser Erkrankungsform zu einer festen ökonomischen Größe. Aus der Sicht der „Gesundheitsanbieter“ bedeutet Alzheimer schlicht und einfach Milliardenumsätze. Außer den Betroffenen und ihren Angehörigen möchte niemand auf Alzheimer verzichten.
Als „offizielles Geburtsjahr“ der Alzheimer’schen Erkrankung darf das Jahr 1901 angesehen werden. Damals wurde die erst 51 Jahre alte Auguste Deter wegen ihrer auffälligen Wesensveränderungen von ihrem Mann an die „Städtische Anstalt für Irre und Epileptische“ in Frankfurt am Main gebracht. Der aufnehmende Arzt hieß Dr. Alois Alzheimer.
„Wie heißen Sie?“, fragte Dr. Alzheimer.
„Auguste.“
„Familienname?“
„Auguste.“
„Wie heißt ihr Mann?“
Frau Deter soll etwas gezögert – und dann geantwortet haben:
„Ich glaube … Auguste“
„Ihr Mann?“
„Ach so.“
„Wie alt sind Sie?“
„51.“
„Wo wohnen Sie?“
„Ach, Sie waren doch schon bei uns.“
„Sind Sie verheiratet?“
„Ach, ich bin doch so verwirrt.“
„Wo sind Sie hier?“
„Da werden wir noch wohnen.“
„Wo ist Ihr Bett?“
Auguste Deter antwortete: „Wo soll es sein?“
Zwischen den einzelnen Fragen des aufnehmenden Arztes bemerkte sie mehrmals: „Ich habe mich sozusagen selber verloren.“ Alois Alzheimer nannte das Krankheitsbild von Auguste Deter „die Krankheit des Vergessens“.
Als Auguste Deter 1906 „völlig verblödet“, wie es in der Krankengeschichte heißt, in Frankfurt verstarb, ließ sich Alzheimer, der inzwischen das anatomische Labor der Königlichen Psychiatrischen Klinik in München leitete, die Krankenunterlagen sowie ihr konserviertes Gehirn schicken. Ziel seiner Untersuchungen war es, wie zu dieser Zeit üblich, gehirnanatomische Veränderungen als Ursache für die psychiatrische Erkrankung ausfindig zu machen. Und tatsächlich entdeckte Alois Alzheimer unter dem Mikroskop Milliarden von zugrunde gegangenen Nervenzellen in Auguste Deters Gehirn. Zu der damaligen Zeit erschien ihm das als eine ausreichende Erklärung für das Wesen der beschriebenen Krankheit. Therapeutische Möglichkeiten, um die von ihm beschriebene Krankheit zu lindern, gab es zu Alzheimers Zeiten noch nicht.
Bei der „37. Versammlung Südwestdeutscher Irrenärzte“ in Tübingen berichtete Alzheimer über seine Entdeckung unter dem Titel „Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde“. Doch die Reaktionen auf sein Referat waren enttäuschend. Fast keiner der anwesenden Kollegen interessierte sich für Alzheimers Ausführungen. Im Protokoll des Kongresses war zu Alzheimers Präsentation angemerkt: „Offenbar kein Diskussionsbedarf“. In den folgenden fünf Jahren wurden in der medizinischen Literatur elf ähnlich verlaufende Fälle beschrieben. Den offiziellen Namen Alzheimer-Krankheit führte erst der Psychiater Emil Kraepelin in der achten Auflage seines „Lehrbuchs der Psychiatrie“ aus dem Jahr 1910 ein. Damit war die von Alois Alzheimer beschriebene Krankheit innerhalb des medizinischen Wissens als eigenständiges Krankheitsbild etabliert.
Doch auch hundert Jahre nach dem Tod Alois Alzheimers 1915 weiß man immer noch nicht genau, wie die nach ihm benannte Krankheit entsteht und was ihre Ursachen sind. Lediglich die Fallzahlen und das damit verbundene öffentliche Interesse haben sich dramatisch verändert. Es gilt als erwiesen, dass ein hohes Lebensalter den einzigen gesicherten Risikofaktor darstellt, an Alzheimer zu erkranken: Nur 2 % der Erkrankten sind jünger als 65 Jahre, dann steigt die Kurve der betroffenen Menschen rapide an und erreicht ihren Höhepunkt bei den 85-Jährigen, von denen ungefähr 20 % an der Alzheimer’schen Erkrankung leiden. Für Medien, Forschung und Pharmaindustrie, Politiker und Pflegeverantwortliche, aber auch für eine zunehmend ängstliche Menschheit erschreckende Zahlen: in Deutschland ca. 1,3 Millionen Erkrankte, in den USA 5 Millionen, weltweit etwa 15 Millionen Patienten, Tendenz stark steigend. Eine Verdoppelung der Fallzahlen von betroffenen Patienten wird in etwa bis 2050 erwartet.
Zu „verdanken“ ist diese Zunahme an Alzheimerpatienten wohl zum überwiegenden Teil der rasant gestiegenen Lebenserwartung in den westlichen Industriestaaten. Dass dieser Zugewinn an Lebenszeit ein Verdienst moderner Medizin ist, steht außer Frage. Doch mit jedem Jahr Zugewinn an Lebenserwartung steigt das Risiko, an „Alzheimer“ zu erkranken. Derzeit scheint lediglich eine reduzierte Lebenserwartung ausreichenden Schutz vor einer sogenannten Demenzerkrankung zu bieten.
Aber die Pharmaindustrie tut alles, um einerseits Hoffnung und Linderung anzubieten, andererseits maximalen Profit aus dem schrecklichen Krankheitsbild schöpfen zu können. So überschwemmen laufend neue und teure Medikamente gegen Demenz den Markt. Zum Großteil stammen diese Medikamente aus der Gruppe der Cholinesterasehemmer. Sie verhindern bzw. verzögern den Abbau von Acetylcholin, welches als Neurotransmitter maßgeblich am Funktionieren des Gehirns beteiligt ist. Dadurch soll die geistige Leistungsfähigkeit verbessert werden. Bis jetzt aber können die Medikamente lediglich die Symptome von Demenzerkrankungen etwas abschwächen, den Krankheitsverlauf eventuell um einige Monate hinausschieben, man könnte auch sagen: das Leiden verlängern. Auch eignen sich die Medikamente nur zum Einsatz bei Krankheitsbeginn. Es gibt so gut wie keine Studie, die einen eindeutigen und nachhaltigen Nutzen der Medikamente für die betroffenen Patienten im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung darstellen könnte. Die rein wissenschaftliche Abgrenzung zu einem möglichen Placeboeffekt, wie er bei der Einnahme jeder Tablette auftritt, fällt schwer. Dafür leiden viele Patienten massiv unter den Nebenwirkungen der Hochpreistabletten: Untersuchungen kanadischer Wissenschaftler belegen, dass Patienten, die derartige Alzheimer-Medikamente einnehmen, im Durchschnitt doppelt so oft in ein Krankenhaus aufgenommen werden müssen wie Demenzpatienten, die diese Tabletten nicht benutzen. Das Risiko, einen Herzschrittmacher implantiert zu bekommen, steigt um 49 %, das Risiko, einen Hüftbruch mit anschließend notwendiger Operation zu erleiden, um 18 %. Dabei gestaltet sich die Rehabilitation eines Alzheimerpatienten nach einem derartigen Eingriff naturgemäß besonders schwierig.
Ab einem bestimmten Grad der Erkrankung „vergessen“ Alzheimerpatienten, dass sie Nahrung nicht nur kauen, sondern auch schlucken müssen. Sie kauen und kauen, verlieren Flüssigkeit und Nahrung aus den Mundwinkeln, und würden, wenn die moderne Medizin nicht in den Lauf der Dinge eingreifen würde, schlichtweg verhungern und verdursten. Durch das Setzen einer Magensonde kann aber dieser „vorzeitige“ Verlust des Lebens noch einmal hinausgeschoben werden. Durch das unscheinbare Schläuchlein im Bauch können nämlich nicht nur Flüssigkeit und Nahrung, sondern auch mehr oder weniger sinnvolle Medikamente zugeführt werden. Wenn ein solcher Patient dann auch noch mit einem Herzschrittmacher ausgestattet wird, kann der Tod noch einmal ein Stück weit hinausgeschoben werden. Und obwohl tausende von Patienten in fortgeschrittenem Erkrankungsstadium schon völlig apathisch, nur noch in einer Art Wachkoma, dahindämmern, werden ihnen die kostenintensiven – aber nunmehr sicher absolut wirkungslosen – Medikamente weiter über Magensonden oder Hautpflaster zugeführt.
Jeder Versuch des abgekämpften, müden und ausgelaugten Herzens, seine Tätigkeit für immer einzustellen, wird gnadenlos mit einem kleinen Stromstoß geahndet. Und so, durch die Magensonde mit ausreichend Energie versorgt, schlägt und schlägt es weiter, bis auch das letzte bisschen an Muskelkraft verbraucht ist. Erst dann darf ein Patient sterben – und erst dann erleidet die Gesundheitsindustrie wieder einen kleinen Verlust, stirbt eine der beliebig ersetzbaren Geldquellen eines zum Moloch gewordenen Gesundheitssystems.
Es wäre wesentlich ethischer, auf das generelle Setzen von Magensonden bei Alzheimerpatienten zu verzichten und ohnehin sterbenden Menschen einen würdigen Tod zu gönnen. Denn die gewonnenen Lebensmonate haben keinen Inhalt und keinen Sinn mehr. Die Patienten verbringen sie nur noch bewegungslos, meist wundgelegen, mit Windeln und Kathetern versorgt, still leidend und ständig von fremder Hilfe umsorgt. Die einzige Seite, die von dieser dem Tod abgetrotzten Lebenszeit wirklich profitiert, ist die „Lang-leben-Industrie“.
Wenn kritische Ärzte oder nachdenkliche Angehörige die Frage stellen, warum diese Maßnahmen notwendig sind und wozu sie gut sein sollen, so erhalten sie von den selbsternannten Vertretern des Systems in der Regel die Antwort: „Man kann doch einen Menschen nicht einfach so sterben lassen.“ Die Betonung liegt auf dem Wörtchen „so“: ein subtiler Vorwurf. Die Bezichtigung unterlassener Hilfeleistung. Ausgesprochen im Brustton der Überzeugung, die einzig richtige Denkart zu vertreten. Nämlich die Ethik der Gesundheitsindustrie.
Aber wie stirbt ein Mensch?
Wer darf einen Menschen sterben lassen? Oder stirbt er gar von selbst? Verdurstet er? Verhungert er? Oder hört ein komplexes biologisches System einfach auf zu leben?
Aus ärztlicher Sicht muss man klar feststellen, dass die „Nichtverlängerung eines zu Ende gehenden Lebens“ nicht gleichbedeutend ist mit unterlassener Hilfeleistung. Einem sterbenden Menschen Flüssigkeit zuzuführen bedeutet unter Umständen nicht, ihm das Weiterleben zu ermöglichen, sondern kann auch eine Art „medizinisches Ertränken“ darstellen. Dass sterbende Menschen weder essen noch trinken wollen, wird nicht mehr akzeptiert. Wenn Krebspatienten vor lauter Übelkeit nichts mehr zu sich nehmen wollen, hören sie immer wieder den grausamen Satz: „Ein bisschen müssen Sie schon selbst mithelfen, sonst kann Ihnen die Medizin auch nicht mehr helfen.“ Und wenn ein Organ nach dem anderen versagt, bedeutet unreflektierte Kalorienzufuhr eher die Beruhigung des eigenen Gewissens als eine Hilfe für den Sterbenden. Menschen sterben nicht, weil Ärzte als Marionetten der Pharmaindustrie ihnen nicht mehr helfen, sondern weil die einzelnen Organe versagen und ein Leben von sich aus nicht mehr ermöglichen. Menschen sterben, weil ihre Leben zu Ende gehen.
Es gibt Schätzungen, wonach für Forschung und Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten ungefähr gleich viel Geld ausgegeben wird wie für ihre Bewerbung und Vermarktung. Das sollte nachdenklich stimmen, denn gut wirksame Arzneimittel müssen in der Regel nur wenig oder gar nicht beworben werden – und der Schluss liegt nahe, dass intensive und aggressive Bewerbung gerade dann eingesetzt wird, wenn die Wirksamkeit eines Medikaments unbefriedigend ist.
Allerdings darf man auch nicht übersehen, dass der öffentliche Druck auf die Medikamentenhersteller enorm ist. Denn Abhilfe für die neue Krankheit wird einzig und allein von der Pharmaindustrie erwartet. Dabei übersieht man vollständig, welch große Bedeutung gerade für Demenzkranke dem sozialen Umfeld zukommen würde. So zeigen zahlreiche Beobachtungen, dass Hautkontakt sowie regelmäßige körperliche und geistige Beschäftigung mit alzheimerkranken Patienten den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen würden. Ein funktionierendes familiäres Umfeld lässt den Krankheitsverlauf von Betroffenen milder ausfallen als bei Patienten, die in einem Altersheim untergebracht sind. Vereinsamung und der damit einhergehende Verlust von sozialen Bindungen sind ein idealer Nährboden für Demenzentwicklungen.
Ob es nicht einen verborgenen Zusammenhang von absterbenden Nervenzellen und fehlenden sozialen Strukturen gibt? Denn der Neurotransmitter Acetylcholin wird unter anderem auch durch Reize wie Berührung, Worte oder Musik im Gehirn gebildet und an den Nervenknoten ausgeschüttet. Also können zwischenmenschliche Kontakte die entsprechenden physiologischen Abläufe ebenso verbessern wie Medikamente, die lediglich den Abbau des Transmitters verzögern.
Ob die moderne Medizin nicht leichtfertig den Blick auf die größeren Zusammenhänge aufgibt?
Ob sich der verzweifelte Versuch, jede Störung im einwandfreien Funktionieren eines Menschen medikamentös und punktgenau zu beheben, nicht als grundsätzlicher Fehler herausstellen wird?
Eine verwitwete 55-jährige Patientin beklagt seit einiger Zeit, dass sie ihre Lebensfreude verloren habe und immer vergesslicher werde. Sie kompensiert den Verlust ihrer geistigen Fähigkeiten durch das Schreiben von Notizzetteln, die sie überall deponiert. Erst als ihre erwachsenen Kinder die vielen eigenartigen Post-its in der ganzen Wohnung entdecken, nehmen sie ärztliche Hilfe in Anspruch – zunächst gegen den Willen der Patientin, die immer noch ihrem Beruf als Angestellte nachgeht, ohne je am Arbeitsplatz auffällig geworden zu sein.
Die Hausärztin überweist die Patientin nach einigen Tests, die den Verdacht der Kinder bestätigen, zum Neurologen. Zur Sicherheit, wie sie erklärt. Aber auch der Neurologe muss den Verdacht auf eine Demenzerkrankung bestätigen und schickt die unglückliche Frau in ein neurologisches Schwerpunktspital. Die Patientin fragt, wozu das gut sein sollte, sie vergesse eben ein paar Namen und manchmal auch, wo sie den Autoschlüssel abgelegt hat. Doch der Facharzt beteuert, dass man ihr im Krankenhaus sicherlich helfen könnte. Von ihren Kindern gedrängt, stimmt die Frau dem Besuch der neurologischen Ambulanz schließlich zu. Dort werden noch einmal die gleichen Tests sowie eineMRT-Untersuchung des Schädels durchgeführt, die eine für das Alter überdurchschnittliche Gehirnschrumpfung ergibt. Der untersuchende Arzt beteuert aber, dass dieser Befund noch nichts zu bedeuten habe. Als die Patientin fragt, wozu die Untersuchung dann gut gewesen sein soll, erntet sie lediglich ein Lächeln des Arztes. Sie bekommt auch zu hören, dass sie ein interessanter Fall sei, und dass man ihr sicher helfen werde können.
Noch im Warteraum der Ambulanz vertraut sie ihrem Sohn an, dass sie doch gar keine Hilfe in Anspruch nehmen wollte, sie habe ja auch keine Beschwerden. Sie verstehe nicht, warum alle Ärzte immer wieder beteuerten, dass man ihr helfen werde können. Dann nimmt sie die Hand ihres Sohnes, zieht ihn ganz nahe zu sich heran und flüstert ihm ins Ohr, dass das Einzige, was sie vermisse, sein Vater wäre, und dass ihr den niemand zurückgeben werde können.
Nach einer Stunde Wartezeit bekommen Sohn und Mutter den Befundbrief überreicht, mit dem sie sich so bald als möglich bei ihrer Hausärztin einfinden sollte. „Also, wieder zurück zum Anfang“, sagt sie etwas zynisch zu ihrem begleitenden Sohn. Und besucht am nächsten Tag, wieder vom Sohn dazu gedrängt, die Hausärztin, die ihr den Inhalt des Arztbriefes eröffnet: Bis zum nächsten Kontrolltermin auf der Neurologie soll die Patientin eine Ultraschalluntersuchung der Hals- und Kopfschlagadern, ein Belastungs-EKG, eine Herzechountersuchung, eine 24-Stunden-Blutdruckmessung, eine ausführliche Blutanalyse, eine Untersuchung des 24-Stunden-Harns, eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit, eine psychologische sowie eine gynäkologische Untersuchung vornehmen lassen. Dann, nach Vorliegen all dieser Befunde, würde eine Therapie eingeleitet werden.
Nun wird es der Patientin zu viel. Noch vor der Hausärztin macht sie ihrem Sohn lautstark klar, dass sie nicht im Traum daran denke, die kommenden Wochen ausschließlich bei Ärzten zu verbringen, damit sie dann eine Tablette verschrieben bekomme, die man ihr jetzt auch gleich schon geben könnte. Und an die Ärztin gerichtet fragt sie: „Ist es nicht so, Frau Doktor?“ Nach einigem Überlegen bestätigt die Ärztin verlegen: „Ja, Ihr Standpunkt ist sicherlich nicht ganz falsch.“
Etwa zwei Jahre nach dieser Episode lernt die Patientin einen neuen Partner kennen. Die darauffolgenden Jahre verlebt sie weitgehend ohne Post-its und ohne medizinische Probleme.
Diagnose und Therapie werden – nicht nur bei Demenzerkrankungen – oftmals zu einem Teufelskreis, aus dem es weder für den Patienten noch für die Angehörigen ein Entkommen gibt. Ein medikamentöser Ansatz an der Wurzel der Erkrankung lässt währenddessen noch immer auf sich warten, und bis auf Weiteres wird steigende Lebenserwartung auch steigende „Demenzerwartung“ bedeuten, ohne dass man sich die Frage stellt, was diese Entwicklung für den Einzelnen und für die Gesellschaft bedeutet. Lediglich in den USA könnte die Zahl der Alzheimer-Krankheitsfälle zurückgehen – weil dort zugleich die allgemeine Lebenserwartung sinkt. Es wäre zynisch – wenn auch mathematisch korrekt – festzustellen, dass Adipositas (Fettleibigkeit) –eine Hauptursache für die sinkende Lebenserwartung in den USA – zumindest das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, senkt.
Neben der Demenzerkrankung gibt es noch eine Reihe weiterer Krankheitsbilder, deren Hauptursache in der gestiegenen Lebenserwartung zu suchen ist: Herz- und Gefäßerkrankungen oder auch die zahlreichen Abnützungserkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates wie Knie- und Hüftgelenksabnützungen, allgemeiner Knochenschwund und Abbauprozesse im Bereich der Wirbelsäule und der Bandscheiben. Zwar lassen sich bei all diesen Leiden in Hinsicht auf Funktion und Schmerzlinderung einigermaßen befriedigende Ergebnisse erzielen, indem man künstlich hergestellte Körperteile, Schläuche und Pumpen operativ einsetzt.Inwieweit diese Implantationschirurgie im Einzelfall aber ökonomisch sinnvoll ist, wird noch zu diskutieren sein. Denn es liegt auf der Hand, dass ein künstliches Kniegelenk die allgemeine Situation eines demenzerkrankten Patienten nur unwesentlich oder gar nicht verbessern kann.
Sicher ist nur, dass die Erde die unverrottbaren Überreste moderner Medizin wie Herzschrittmacher, implantierte Pumpen, Knie- und Hüftprothesen, künstliche Teile von Wirbelsäulen etc. geduldig für spätere Forscher aufbewahren wird.
Die Zucht multiresistenter Keime
Diskutiert man über den Wert moderner Medizin, so hört man immer wieder den Satz: „Aber die heutige Medizin ermöglicht doch die Heilung von Krankheiten, die früher nicht heilbar waren?“ Dem ist sicherlich nicht grundsätzlich zu widersprechen, allerdings muss man ergänzen: „Zugleich produziert die heutige Medizin neue, zum Teil sogar tödliche Krankheiten, die es früher gar nicht gegeben hat, und bringt damit Patienten hervor, die es früher nicht gegeben hätte.“
Ein gutes Beispiel dafür sind die sogenannten nosokomialen Infektionen – also Infektionserkrankungen, die sich Patienten erst in einem Krankenhaus zuziehen – und die multiresistenten Keime – Bakterien, die auf kein gängiges Antibiotikum mehr ansprechen. Ein bekannter Spezies dieser Bakterien ist der MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus).
Für gesunde Menschen stellt eine Besiedelung der Nasenschleimhäute, des Rachens oder Rektumbereichs durch den Hautkeim Staphylococcus aureus kein Problem dar. Sie bemerken den ungebetenen Gast überhaupt nicht. Er kann die einmal besiedelte Schleimhaut einige Monate lang bewohnen, bevor er durch ein gesundes Immunsystem wieder eliminiert, sozusagen „hinausgeworfen“ wird.
Befällt der Keim aber immungeschwächte oder frisch operierte Patienten, drohen ernsthafte Komplikationen bis hin zum Tod. So kann der Staphylococcus aureus entlang eines Drains oder eines Katheters, oder durch eine offene Operationswunde bis zu den inneren Organen gelangen und sich dort ungehindert ausbreiten. Lange Zeit ließen sich diese Bakterien durch Methicillin oder andere Antibiotika erfolgreich behandeln.
Doch immer häufiger erweist sich das Bakterium als resistent gegen die Behandlung mit den zur Verfügung stehenden antibiotischen Substanzen und verursacht bei betroffenen Patienten eine sogenannte MRSA-Infektion. In Deutschland soll der antibiotikaresistente Keim in jedem der ungefähr 2.000 Krankenhäuser existieren. Schätzungen reichen von 40.000 MRSA-Toten in Deutschland bis zu der etwas weniger dramatischen Zahl von 25.000 bis 50.000 Opfern pro Jahr in ganz Europa. Neben den tödlich verlaufenden Infektionen gibt es aber auch eine Unzahl von bakteriell bedingten Krankheitsfällen, die z.B. die Amputation von Gliedmaßen erforderlich macht. Doch egal wie groß die Zahl der Toten letztendlich ist, jedes dieser Opfer ist letztlich ein Opfer des medizinischen Fortschritts.
Besonders groß ist die Gefahr, sich mit MRSA zu infizieren, in den Krankenhäusern – also gerade an jenen Orten, von denen sich Patienten am meisten Hilfe gegen ihre Leiden erwarten. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat herausgefunden, dass zwischen 4 und 9 % aller Patienten, die ein Krankenhaus aufsuchen, mit einem nosokomialen Keim infiziert werden.
Ähnlich verhält es sich mit dem Bakterium Clostridium difficile, einem Keim, der für gewöhnlich Durchfall verursacht. Für alte Menschen verläuft die Infektion, die vorwiegend in Spitälern auftritt, aber häufig tödlich. Die österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin gibt an, dass von bis zu 1.300 Todesfällen pro Jahr wegen Infektionen mit Clostridium difficile ausgegangen werden muss, obwohl in den Krankenhausentlassungsstatistiken lediglich von etwa 180 Todesopfern die Rede ist. Eine aktuelle Studie des KFJ